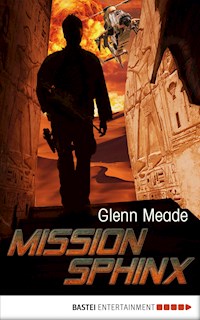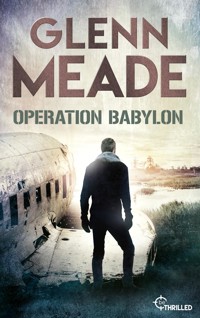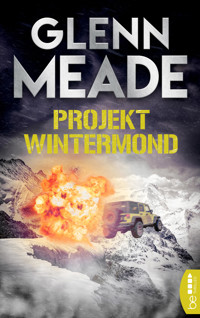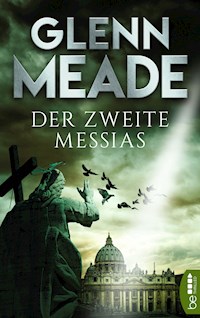4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Polit-Thriller von Bestseller-Autor Glenn Mead - packende Spannung vor dem Hintergrun
- Sprache: Deutsch
1917: Revolution in Russland. Hunger und Chaos regieren die Straßen.
Die Zarenfamilie Romanow ist spurlos verschwunden. Nicolas Curis, ein ehemaliger Offizier, ist auf der Flucht vor den Revolutionären. Er sucht Hilfe bei dem undurchsichtigen Geschäftsmann Jacob Berg und begegnet dort der Irin Lydia Ryan, die ebenfalls das Land verlassen will.
Die beiden gehören zu den wenigen Menschen, die den Aufenthaltsort der Zaren kennen. Denn Jacob Berg ist in Wahrheit ein amerikanischer Spion. Er soll die Romanows aus den Fängen der Revolutionäre befreien und vor dem sicheren Tod retten. Für Berg ist es eine sehr persönliche Mission - er hat eine Affäre mit der Tochter des Zaren. Und er wird über Leichen gehen, um sie zu retten ...
Ein brillanter historischer Thriller von Bestseller-Autor Glenn Meade!
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 773
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
Cover
Weitere Titel des Autors
Über dieses Buch
Über den Autor
Titel
Impressum
Vorwort
Widmung
ANMERKUNGEN DES AUTORS
GEGENWART
1. KAPITEL
VERGANGENHEIT 1918
ERSTER TEIL
2. KAPITEL
3. KAPITEL
4. KAPITEL
5. KAPITEL
6. KAPITEL
7. KAPITEL
8. KAPITEL
9. KAPITEL
10. KAPITEL
11. KAPITEL
12. KAPITEL
13. KAPITEL
14. KAPITEL
ZWEITER TEIL
15. KAPITEL
16. KAPITEL
17. KAPITEL
18. KAPITEL
19. KAPITEL
20. KAPITEL
21. KAPITEL
22. KAPITEL
23. KAPITEL
24. KAPITEL
25. KAPITEL
26. KAPITEL
27. KAPITEL
28. KAPITEL
29. KAPITEL
30. KAPITEL
31. KAPITEL
DRITTER TEIL
32. KAPITEL
33. KAPITEL
34. KAPITEL
35. KAPITEL
36. KAPITEL
37. KAPITEL
38. KAPITEL
39. KAPITEL
40. KAPITEL
41. KAPITEL
42. KAPITEL
43. KAPITEL
44. KAPITEL
45. KAPITEL
46. KAPITEL
47. KAPITEL
48. KAPITEL
49. KAPITEL
50. KAPITEL
51. KAPITEL
VIERTER TEIL
52. KAPITEL
53. KAPITEL
54. KAPITEL
55. KAPITEL
56. KAPITEL
57. KAPITEL
58. KAPITEL
59. KAPITEL
60. KAPITEL
61. KAPITEL
62. KAPITEL
63. KAPITEL
64. KAPITEL
65. KAPITEL
FÜNFTER TEIL
66. KAPITEL
67. KAPITEL
68. KAPITEL
69. KAPITEL
70. KAPITEL
71. KAPITEL
72. KAPITEL
73. KAPITEL
74. KAPITEL
75. KAPITEL
76. KAPITEL
77. KAPITEL
78. KAPITEL
79. KAPITEL
80. KAPITEL
81. KAPITEL
82. KAPITEL
83. KAPITEL
SECHSTER TEIL
84. KAPITEL
85. KAPITEL
86. KAPITEL
87. KAPITEL
88. KAPITEL
89. KAPITEL
90. KAPITEL
91. KAPITEL
92. KAPITEL
93. KAPITEL
94. KAPITEL
95. KAPITEL
96. KAPITEL
97. KAPITEL
SIEBTER TEIL
98. KAPITEL
99. KAPITEL
100. KAPITEL
101. KAPITEL
102. KAPITEL
103. KAPITEL
104. KAPITEL
105. KAPITEL
106. KAPITEL
107. KAPITEL
108. KAPITEL
109. KAPITEL
110. KAPITEL
111. KAPITEL
112. KAPITEL
113. KAPITEL
114. KAPITEL
115. KAPITEL
116. KAPITEL
117. KAPITEL
118. KAPITEL
119. KAPITEL
120. KAPITEL
121. KAPITEL
122. KAPITEL
123. KAPITEL
124. KAPITEL
125. KAPITEL
126. KAPITEL
127. KAPITEL
GEGENWART
128. KAPITEL
DANKSAGUNGEN
Weitere Titel des Autors
Mission Sphinx
Operation Schneewolf
Der Jünger des Teufels
Die letzte Zeugin
Operation Babylon
Projekt Wintermond
Der letzte Messias
Die Achse des Bösen
Unternehmen Brandenburg
Über dieses Buch
1917. Revolution in Russland. Hunger und Chaos regieren die Straßen.
Die Zarenfamilie Romanow ist spurlos verschwunden. Nicolas Curis, ein ehemaliger Offizier, ist auf der Flucht vor den Revolutionären. Er sucht Hilfe bei dem undurchsichtigen Geschäftsmann Jacob Berg und begegnet dort der Irin Lydia Ryan, die ebenfalls das Land verlassen will.
Die beiden gehören zu den wenigen Menschen, die den Aufenthaltsort der Zaren kennen. Denn Jacob Berg ist in Wahrheit ein amerikanischer Spion. Er soll die Romanows aus den Fängen der Revolutionäre befreien und vor dem sicheren Tod retten. Für Berg ist es eine sehr persönliche Mission – er hat eine Affäre mit der Tochter des Zaren. Und er wird über Leichen gehen, um sie zu retten …
Über den Autor
Glenn Meade (*1957 in Dublin) arbeitete als Journalist und als hochspezialisierter Ausbilder am Flugsimulator für Aer Lingus, bevor er zu internationalem Bestsellerruhm gelangte. Seine Bücher wurden in mehr als 20 Sprachen übersetzt. Glenn Meade lebt in Irland und widmet sich ganz der Schriftstellerei.
GLENNMEADE
OPERATIONROMANOW
Thriller
Aus dem Englischen vonKarin Meddekis
beTHRILLED
Digitale Neuausgabe
»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2012 by Glenn Meade
All rights reserved.
Titel der englischen Originalausgabe: »The Romanov Conspiracy«
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2012/2021 by Bastei Lübbe AG, Köln
Covergestaltung: Massimo Peter-Bille unter Verwendung von Motiven von © Grisha Bruev/shutterstock; © Dmitry Laudin/shutterstock; © railway fx/shutterstock; © Fercan/shutterstock
eBook-Erstellung: Jilzov Digital Publishing, Düsseldorf
ISBN 978-3-7517-0626-1
be-ebooks.de
lesejury.de
Für Kim und Luke
ANMERKUNGEN DES AUTORS
Alle Geschichten finden ihre Liebhaber.
Ich habe mich in diese hier verliebt, als ich das im Schatten der majestätischen Mourne Mountains gelegene Dorf Collon an der irischen Nordostküste besuchte.
Auf dem Friedhof der presbyterianischen Kirche aus dem Jahre 1813 mit den wunderschönen, bunten Kirchenfenstern fand ich die in Vergessenheit geratenen Gräber einiger Russen, die während der Oktoberrevolution in ihrer Heimat nach Irland geflohen waren.
Hier hörte ich zum ersten Mal von dem unglaublichen Plan, den russischen Zaren und seine Familie 1918 zu retten, doch all das ist bis zum heutigen Tage in geheimnisvolle Dunkelheit gehüllt. Selten zuvor habe ich für einen Roman so intensiv recherchiert, denn diese Geschichte erwies sich als ungeheures Rätsel mit vielen Fragezeichen.
Was in den turbulenten Zeiten der russischen Revolution in Sankt Petersburg begann, endete mit einer Reihe von Gräbern auf einem irischen Friedhof auf dem Lande. Dazwischen liegen längst verwischte Hinweise auf eine sorgfältig geplante Verschwörung, die das hartnäckigste Rätsel des Zwanzigsten Jahrhunderts lösen könnte.
Viele Figuren dieses Romans haben wirklich gelebt, und auch den geheimnisvollen Orden, der von einigen die Bruderschaft des Heiligen Johannes von Tobolsk genannt wird, hat es gegeben.
Das meiste dessen, was Sie lesen werden, ist wahr.
Nur bei einem kleinen Rest handelt es sich um Fiktion, den Teil im Mosaik des Geschichtenerzählens, dessen sich der Schriftsteller bedienen muss, um seiner Erzählung Leben einzuhauchen.
Doch ich überlasse es Ihnen zu entscheiden, welcher Teil Wahrheit und welcher Fiktion ist.
Meine liebe Marija,
die Geschichte wird vielleicht niemals vollständig aufdecken, was wirklich mit allen Zarenkindern geschah. Die Antwort ist so geheim, dass ich vorerst nicht darüber sprechen kann.
Lenin in einem Brief an seine Schwester im Juli 1918, nachdem sie ihm geschrieben hatte, sie habe Gerüchte über die Hinrichtung der Romanows gehört.
Anna Anderson ist Teil eines viel größeren Geheimnisses, als sich irgendjemand von uns vorstellen kann, denn sie hat zahlreiche unbeantwortete Fragen hinterlassen. Eine besonders erschreckende Frage ist die: Wie konnte es einer vermeintlich einfachen, geistig verwirrten Bäuerin gelingen, über sechs Jahrzehnte lang die hellsten und angesehensten Anwälte, Ermittler und Journalisten hinters Licht zu führen? In diesem Zusammenhang erinnere ich mich an eine Redensart, die ich einst gehört habe: »Jede Geschichte hat drei Seiten. Es gibt Ihre Seite, und es gibt meine Seite. Und dann gibt es noch die Wahrheit.«
GEGENWART
1. KAPITEL
Ich glaube, die größten Geheimnisse sind vergraben, und nur die Toten sprechen die Wahrheit.
Und in gewisser Weise kam ich aus diesem Grunde an jenem Sommermorgen, als wir die Leichen fanden, in die Wälder. Es regnete in der Stadt der Toten Seelen, und ein kräftiger Schauer überschwemmte die Straßen.
»Heute Morgen ist nicht viel Verkehr. Dreißig Minuten, länger nicht«, sagte mein russischer Fahrer, als unser Landrover an imposanten Granitgebäuden vorbeifuhr, den Relikten einer längst vergangenen prächtigen Epoche.
Ich lehnte mich zurück und sah das alte kaiserliche Jekaterinburg an mir vorüberziehen. Die Stadt, die 1723 zu Ehren von Kaiserin Katharina der Ersten ihren Namen erhalten hat, liegt im Schatten des Urals. Die Landschaft erinnert an die zerklüftete Schönheit Alaskas – dichte Wälder mit Wölfen und Bären, tiefe Schluchten und schneebedeckte Gipfel. Ergiebige Erzminen, welche die größten Schätze der Welt – Platin und Smaragde, Gold und Diamanten – bergen, durchziehen die felsigen Bergketten, die hinter der sibirischen Metropole aufragen.
Als wir Jekaterinburg hinter uns ließen und an den mit Birkenwäldern bewachsenen Hängen vorbeifuhren, öffnete ich die Lederaktentasche auf meinem Schoß und nahm eine Akte heraus. Auf dem blauen Aktendeckel stand:
VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE ERGEBNISSE DER ARCHÄOLOGISCHEN GRABUNGEN IN JEKATERINBURG
Dr. Laura Pawlow, Forensische Pathologin, verantwortliche Archäologin der Grabungen
Ich blätterte den dicken Papierstapel durch und sah mir noch einmal die Ergebnisse meiner Arbeit der letzten drei Monate an. Dies war meine erste Reise nach Jekaterinburg, und unser Team kam von überall her: forensische Archäologen, Wissenschaftler und Studenten aus Amerika, England, Deutschland, Italien und natürlich aus unserem Gastland Russland. Für unser gemeinsames Abenteuer erhielten wir nur eine kurze Einweisung: Wir sollten in den Wäldern nach Beweisen für Massenhinrichtungen während des Roten Terrors zur Zeit der russischen Revolution graben.
Viele Tausende kamen um, nicht zuletzt auch die Romanows, die russische Zarenfamilie – der Zar, die Zarin, ihre vier hübschen Töchter und ihr jüngstes Kind, der dreizehnjährige Alexej – von Kugeln und Bajonetten durchbohrt, ihre Schädel von Gewehrkolben zertrümmert und ihre Leichen mit Schwefelsäure übergossen.
Das Ipatjew-Haus, in welchem die Familie gefangen gehalten worden war, wurde von den Stadtbewohnern das Haus der Toten Seelen genannt. Aber die Roten richteten während ihrer Herrschaft so viele Menschen hin, deren Leichen sie in Minenschächte warfen und in anonymen Gräbern in den weiten Wäldern außerhalb von Jekaterinburg vergruben, dass die Bewohner ihrer Stadt einen neuen Namen gaben: Stadt der Toten Seelen.
Mit der Hitze und den vielen Mücken hatte ich nicht gerechnet. Im Winter gleicht Sibirien einem Gefrierschrank, doch in den kurzen, heißen Sommern herrschen oft hohe Temperaturen. In den Wäldern wimmelt es dann von Fliegen und Mücken. Die Hitze ist so stark, dass süßlich duftendes Harz von den Bäumen tropft und dessen wohlriechender Geruch die Luft erfüllt.
Als mein Fahrer auf einen schmalen, schlammigen Pfad einbog, auf dem schwere Lastwagen Spurrillen hinterlassen hatten, hörte es auf zu regnen. Unser Landrover steuerte auf eine Ansammlung von Baracken und stabilen, begehbaren Zelten zu, die für die Dauer unserer Grabungen in der Mitte einer Lichtung in einem Birkenwald aufgebaut worden waren. Auf einem von Hand beschriebenen Holzschild stand auf Englisch und Russisch:
GRABUNGSSTÄTTE – PRIVATGRUNDSTÜCKUNBEFUGTES BETRETEN VERBOTEN!
Es gab noch etwas, womit ich nicht gerechnet hatte, als wir an diesem Sommermorgen neben einem der Zelte anhielten. Ich war in diesen nach Harz duftenden Wald gekommen, um die Geister der Vergangenheit auszugraben. Doch absolut nichts hätte mich auf das ungeheure Geheimnis vorbereiten können, über das ich stolperte, als die gefrorene sibirische Erde ihre Toten preisgab.
Denn mit den Toten kam die Wahrheit ans Licht.
Und mit der Wahrheit kamen die ersten Gerüchte der unglaublichsten Geschichte auf, die ich jemals gehört hatte.
Ich stieg aus dem Wagen, schob die Plane zur Seite und betrat mein Zelt. Als ich an meinem Arbeitstisch Platz nahm, kam Roy Moran herein, der die Ausgrabungen vor Ort beaufsichtigte. »Hallo, Baby.«
Wir nannten ihn Memphis Roy, und er nannte mich immer Baby. In Memphis nannte jeder jeden Baby. Die Tatsache, dass einer Frau die Leitung der Grabungen oblag, änderte nichts daran. Wenn ich ein Mann gewesen wäre, hätte Roy mich auch Baby genannt.
Roy ist ein großer und knochiger, nüchterner Typ und einer der Besten auf seinem Gebiet. Ich öffnete meine Aktentasche, um Unterlagen herauszunehmen, und sagte: »Wolltest du nicht heute Morgen im Schacht 7 graben?«
»Klar, Baby.« Roy, der ein wenig außer Atem war, stemmte die Hände in die Hüften. In seinem Gesicht spiegelten sich Erregung und Verwirrung. Er nahm das schmutzige Basecap der Detroit Tigers ab, das er immer trug, wischte sich den Schweiß von der Stirn und grinste. »Sieht so aus, als könnte die Sieben unsere Glückszahl sein.«
»Spuck’s aus!«
»Wir haben so tief gegraben, wie wir konnten, und sind auf eine torfige Schicht Dauerfrostboden gestoßen. Aber wir haben etwas gefunden, Laura. Ich meine, wir haben wirklich etwas gefunden.«
Ich warf den Stift auf den Tisch. Roy gehörte nicht zu den Leuten, die sich leicht beeindrucken ließen. Doch in diesem Augenblick schien er unter Spannung zu stehen und vor Begeisterung überzusprudeln wie ein aufgeregter zwölfjähriger Junge. »Nun sag schon!«, forderte ich ihn auf.
»Das musst du dir selbst ansehen, Baby.«
Ich folgte Roy durch den Wald. Er bahnte sich mit seinen muskulösen Beinen langsam einen Weg durch regennassen Farn und an alten umgestürzten Bäumen vorbei. »Der Schacht ist über zwanzig Meter tief«, erklärte er mir unterwegs.
Überall auf der Lichtung lagen Bergbaugeräte, Stützpfeiler und Material zum Ausbau der Schächte. Dazwischen standen zahlreiche Lastwagen und SUVs. »Warum habe ich das Gefühl, dass du mir gleich etwas Interessantes erzählst? Du hast mir immer noch nicht gesagt, was du gefunden hast.«
Roy ging grinsend weiter. Seine Erregung wirkte ansteckend auf mich. Auf seiner Stirn schimmerten Schweißperlen, und seine Augen strahlten. »Es ist eine Frau, Baby. Wir glauben, dass da unten eine weitere Leiche liegen könnte, aber sie ist zu tief vergraben, um zu sehen, was es ist. Und wer weiß? Vielleicht sind es sogar noch mehr!«
Als wir zwischen silbrig schimmernden Birken hindurchgingen und vor der Öffnung eines Minenschachtes stehen blieben, wurde ich nervös. Ich roch den intensiven erdigen Geruch des braunen Torfs. Das Loch im Boden war einen knappen Quadratmeter groß, und dicke Holzbalken sicherten die Seitenwände. Diese Grube gehörte zu einer Reihe von Schächten, die wir bei unseren Ausgrabungen erforschten. Wir suchten nach Hinweisen auf weitere Fundstücke aus der Romanow-Zeit, als der größte Teil dieses Gebietes eine Hinrichtungsstätte gewesen war.
In der Nacht des 16./17. Juli 1918 verschwand in Jekaterinburg die Romanow-Familie – die damals reichste Adelsfamilie der Welt. Augenzeugenberichten zufolge soll die ganze Familie umgebracht worden sein.
Doch aus irgendwelchen unbekannten Gründen beschlossen die Bolschewisten, ihren Tod nicht zu bestätigen, und über lange Zeit hielten sich hartnäckige Gerüchte, dass einige – wenn nicht gar alle Familienmitglieder – der Hinrichtung hatten entkommen können. Es gab auch Hinweise auf geheime Pläne, die Familie aus Jekaterinburg, von dem geheimen Ort, wo sie gefangen gehalten worden war, zu retten. Jahrelang erschienen immer wieder Berichte, dass eine oder mehrere Töchter des Zaren und ihr Bruder Alexej dem Tod entkommen seien.
Die Romanows hatten Edelsteine, Diamanten, Smaragde und Rubine in ihre Unterkleidung eingenäht, weil sie hofften, dass ihnen diese Wertgegenstände bei der Flucht behilflich wären. Später hieß es, die Edelsteine hätten die Qualen während ihrer Hinrichtung verlängert und den Tod hinausgezögert.
Solchen Geschichten hatte ich in meiner Kindheit gebannt gelauscht. Ob sie der Wahrheit entsprachen, spielte keine Rolle. Jedenfalls faszinierte mich, wie so viele andere auch, dieses Geheimnis, und ich wollte glauben, dass Anastasia und Alexej entkommen waren.
Zahllose Gerüchte rankten sich um ihre Ermordung, und Jahrzehnte später wurden bei verschiedenen Grabungen außerhalb von Jekaterinburg die sterblichen Überreste von sechs Erwachsenen gefunden. Unter ihnen sollten sich angeblich der Zar, seine Gattin und zwei seiner Töchter befinden. DNA-Vergleiche mit der blutsverwandten britischen Königsfamilie bestätigten die möglichen Identitäten mit hoher Wahrscheinlichkeit.
Über die Entdeckung wurde heftig diskutiert. Viele Experten glaubten, es handele sich um die Skelette der Romanows. Ebenso viele glaubten es nicht und führten als Beweis unter anderem die Tatsache an, dass zahllose Verwandte der Zarenfamilie in dieser Gegend hingerichtet worden waren und es ebenso gut deren Skelette sein konnten, die man gefunden hatte.
Bei einer späteren Grabung in einem Wald westlich von Jekaterinburg wurden zwei weitere vollständige menschliche Skelette gefunden. DNA-Tests deuteten darauf hin, dass es die Knochen der beiden vermissten Kinder des Zaren, Anastasia und Alexej, waren. Es konnte jedoch niemals eindeutig bewiesen werden, dass eines der Skelette das von Anastasia war. Es bestand eine gewisse Wahrscheinlichkeit, doch zweifelsfreie Beweise gab es nicht. Deshalb wurden diese Tests von einigen Wissenschaftlern und hartnäckigen Zweiflern innerhalb der russisch-orthodoxen Kirche als uneindeutig zurückgewiesen. Was blieb, war die quälende Ungewissheit, dass das Geheimnis fortbestand und das Rätsel noch immer nicht gelöst war.
Über der Öffnung des Schachtes hatten unsere Techniker eine von einem Stromgenerator angetriebene, elektrische Winde mit einem alten Sitzgurt installiert. Von unten stieg der Geruch des Torfes herauf. »Was denkst du: Knochen oder ein vollständiges Skelett?«, fragte ich Roy.
»Ich glaube, es ist die Leiche einer Frau. Der Dauerfrostboden hat sie mumifiziert, und sie ist durch den Torf und die Kälte perfekt erhalten.«
Mir lief vor Erregung ein Schauer über den Rücken. Ich stützte mich mit einer Hand gegen eine Birke, deren weiße Rinde den Stamm vor der Sonneneinstrahlung schützte. »Wie alt?«
»Meiner Erfahrung nach sprechen wir über die Zeit der letzten Romanows. Darauf weist auch ihre Kleidung hin.«
Roy fuhr als Erster hinunter. Er winkte mir zu, ehe er die elektrische Winde aktivierte und in dem dunklen Schacht verschwand. Ein paar Minuten später kehrte der leere Sitzgurt zurück. Ich schnallte mich fest und folgte ihm.
Während unserer Grabungen in Jekaterinburg im letzten Monat hatten wir allerhand gefunden: verrostete Mosin-Nagant-Gewehre, von Grünspan überzogene Kupfermünzen, Patronenhülsen und eine Brille. Wir waren sogar auf mehrere Verstecke der Zarenfamilie voller Silber- und Goldbarren sowie persönlicher Gegenstände und Schmuck gestoßen. So viele wohlhabende Familien mit Verbindungen zum Zarenhaus waren in der Hoffnung, dem Gemetzel zu entkommen, während der Revolution hierhergeflohen, aber die Roten hatten jeden Einzelnen von ihnen aufgespürt.
Nicht alle Opfer waren wohlhabend. Auch meine eigene Vergangenheit lag in diesen Wäldern begraben. Lange bevor ich nach Jekaterinburg kam, hatte ich viel über diese Stadt an den gewundenen, breiten Ufern der Isset gehört, in der meine Großmutter Marijana als Kind gelebt hatte. Sie war elf Jahre alt, als die Rotgardisten während der Oktoberrevolution in ihre Heimatstadt einfielen. Ihre Familie waren einfache Muschiks – leidgeprüfte russische Bauern und Bergarbeiter, die bis zum Umfallen arbeiteten, um Erz aus dem Dauerfrostboden zu fördern, aus der steinharten, torfigen sibirischen Erde, die selbst im Sommer gefroren war.
Drei von Marijanas Brüdern, darunter auch ihr geliebter Pjotr, der gerade mal fünfzehn war, wurden in den Wäldern hinter der Stadt erschossen. Was hatten sie verbrochen? Sie hatten protestiert, als die Roten ihren kleinen Minenbetrieb beschlagnahmten, ein dilettantisches Unternehmen, das ihre zwölfköpfige Familie kaum ernährte. Lenin hielt nichts von Privatbesitz.
Persönliche Besitztümer jeglicher Art gehörten nun den Sowjets. Alle, die protestierten, wurden ins Gefängnis geworfen. Wenn sie weiterhin protestierten, wurden sie erschossen. Das alles gehörte zum Roten Terror, der Russland heimsuchte, als Lenin die Macht ergriff.
Während eines ungewöhnlich kalten Winters reiste die Familie meiner Großmutter auf der Flucht vor der Diktatur durch Sibirien und bestieg in Sankt Petersburg ein verrostetes Dampfschiff, das nach Amerika fuhr. Die einzigen Erinnerungen, die sie in ihren Stofftaschen bei sich trugen, waren einige verblichene Familienfotos in bräunlichen Farbtönen und Postkarten des kaiserlichen Jekaterinburg – Andenken auf brüchigem Papier, das im Laufe der Jahre vergilbte und immer nach verbranntem Holz roch. Ich erinnere mich noch an diesen Geruch, der mir in die Nase stieg, wenn ich als Kind in dem Familienalbum mit den verblassten Bildern aus einer anderen Welt blätterte.
Damals fand ich zwischen den Seiten des Albums auch ein altes Schwarz-Weiß-Foto und daneben eine Handvoll zerbröselter getrockneter Blumen in einem alten Bogen Pergamentpapier, dessen Ränder mit der Zeit fleckig geworden waren.
»Was ist das, Nana?« Die Fotografie zeigte einen beeindruckenden, mit flatternden Fahnen des russischen Zarenreiches geschmückten Bahnhof. Auf den Stufen des Bahnhofs standen unverkennbar die Romanows: der Zar und seine Gattin, die einer Menge zuwinkten, und neben ihnen ihr Sohn und die Töchter. Ich erkannte Anastasia, die ein weißes Kleid und hübsche Schuhe trug. Sie hatte eine Schleife im Haar und hielt einen Blumenstrauß in der Hand.
»Das wurde beim Besuch der Zarenfamilie 1913 in Jekaterinburg aufgenommen. Das war vor dem Krieg, bevor in Russland die Hölle ausbrach.« Großmutters blaue Augen wurden feucht, als die Erinnerungen an ihr schönes altes Leben in ihr aufstiegen.
»Und die Blumen?«
»Niemand in der Zarenfamilie war so rebellisch und geistreich wie Anastasia. Als sie an jenem Tag auf den Stufen des Bahnhofs stand, warf sie den Kindern in der Menge den Blumenstrauß zu. Du kannst dir sicherlich vorstellen, was für ein Gedränge entstand. Ich wurde fast totgetrampelt, doch es gelang mir, ein paar Blumen zu ergattern. Ich habe sie immer in Ehren gehalten.«
Ich sah auf die Fotos in dem Album und strich mit den Fingerspitzen behutsam über die brüchigen getrockneten Blumen. »Du hast Anastasia gesehen? Sie hat tatsächlich diese Blumen geworfen?«
»Es war ein freches Ding, dieses Mädchen, voller Leben, ein richtiger Wildfang. Wir Kinder haben sie geliebt. Die Familie nannte sie liebevoll Kubyschka. Das heißt ›Pummelchen‹.«
Und jetzt war ich hier, Mitglied eines internationalen archäologischen Grabungsteams, und verbrachte meinen Sommer in Jeans und schmuddeligen Pullovern in einem begehbaren Zelt im Umland von Jekaterinburg. Seltsamerweise hatte ich das Gefühl, als hätte mich die Vergangenheit meiner Familie eingeholt.
Die Neugier brachte mich fast um. Ich drückte auf den Schalter, worauf der Motor zu surren begann und die Winde mich in den Schacht hinunterfuhr.
Zuerst umgab mich Dunkelheit, doch nach etwa sieben Metern wurden die Seiten des Schachtes von Glühbirnen erhellt. Mit meinen abgetragenen Reeboks trat ich immer wieder gegen die Wände, um nicht dagegenzustoßen.
Unter mir sah ich helles Licht, und plötzlich ergriff Roy den Gurt. »Okay, Baby, du bist unten.«
Ich ließ das Seil los und trat auf glitschige verschlammte Holzplanken. Als ich mich abschnallte, begann ich zu frösteln. Es war furchtbar kalt. Ich rieb mir die Arme. Durch die quadratische Öffnung des Schachtes schien grelles blaues Licht auf mich hinab.
Ein Stück von mir entfernt erhellten starke Halogenlampen den Boden der Kammer, die sich mindestens vier Meter in alle Richtungen erstreckte und damit breiter war als der Schacht selbst. Ein Teil der Kammer war in tiefe Dunkelheit gehüllt, wodurch eine ausgesprochen schaurige Atmosphäre entstand. Roy hatte die Wände mit einem Gerüst aus Balken und Streben gesichert, um einen Einsturz zu verhindern, doch das tröstete mich nicht. Ich hasste geschlossene Räume, vor allem Tunnel, was in meinem Job nicht gerade hilfreich war.
Ein kräftig gebauter Mann mit einem dicken grauen Schnurrbart und einer Metallbrille schlug mit einem Fäustel und einem breiten Meißel an einer Wand der Kammer den gefrorenen Torfboden weg. Tom Atkins aus Boston. Er unterbrach seine Arbeit und grinste mich an. »Hallo, Laura, alles klar?«
Vor seinen Füßen stand ein geöffneter Werkzeugkasten, und sein Atem bildete weiße Wölkchen in der kalten Luft. Tom trug eine dick gefütterte Columbia-Skijacke, warme Wollhandschuhe und Ohrenschützer. Neben ihm stand ein Klapptisch, auf dem Werkzeuge und Bürsten sowie zwei große elektrische Taschenlampen lagen. Er nahm die Ohrenschützer ab.
»Du hast dich aber gut eingedeckt, Tom«, sagte ich und wies mit dem Kinn auf einen Haufen ungeöffneter Budweiser- und Heinekendosen, die in einer Ecke aufgestapelt waren.
»Erspar dir deinen Kommentar. Hier unten ist es kälter als in meinem Kühlschrank!«
»Und was habt ihr beide gefunden außer einem perfekten Ort, um euer Bier zu kühlen?«
»Sieh dir erst mal das hier an.« Tom zeigte auf ein Schüttelsieb aus Draht.
Ich nahm es in die Hand. In einer Ecke des Siebes lagen mehrere stark angelaufene Messingknöpfe einer Militäruniform. Ich sah ein paar kupferne Kopeken und silberne Rubel, auf denen ich nur mit Mühe die Jahreszahlen erkennen konnte: 1914 und 1916, und eine Münze aus dem Jahr 1912. Ein vergilbter Kamm aus Elfenbein und ein Teil eines Kofferverschlusses lagen ebenfalls in dem Sieb. Der Anblick des Kinderhaarbandes daneben jagte mir einen kalten Schauer über den Rücken.
In der Zeit des Roten Terrors – der Säuberungsaktion nach der Oktoberrevolution, um die Macht durchzusetzen und Angst und Schrecken zu verbreiten – brachten die Bolschewisten ganze Familien um. Ich schüttelte den Kopf. »Traurig, aber interessant.«
»Den Jackpot findest du da drüben.« Tom zeigte mit dem Daumen in die Ecke der Kammer, in der er arbeitete. »Du solltest erst einmal tief durchatmen, Laura.«
»Warum?«
»Es ist ein bisschen unheimlich. Fast makaber.«
Ich nahm eine Taschenlampe von Toms Tisch und ging tiefer in die Kammer hinein. Als ich den kräftigen Lichtstrahl auf den gefrorenen Boden richtete, stieg pures Entsetzen in mir auf. Aus dem Dauerfrostboden ragte eine Hand heraus. Das Fleisch war unversehrt und ausgeblichen, die Finger von einer dünnen Schicht Schlamm überzogen und zur Faust geballt. Sie schien etwas festzuhalten. »Mein Gott …!«
»Bis jetzt hast du noch nichts gesehen. Schau mal hier.« Roy zeigte auf die gefrorene Wand.
Und dann sah ich es. Es war nicht nur eine Hand, sondern ein ganzer Leichnam. Das Gesicht einer Frau starrte aus der Torferde heraus. Es war ein grotesker Anblick. Auch ihre Kleidung war freigelegt. Sie trug eine helle Bluse und ein dunkles Oberteil aus Wolle, die aussahen, als stammten sie aus einem anderen Jahrhundert. »Wahnsinn!«
»Gruselig, nicht wahr?«, sagte Tom. »Der Dauerfrostboden hat sie tiefgefroren.«
»Das überrascht mich nicht, Baby«, fügte Roy hinzu. »In einem solchen Boden hat man sogar schon unversehrte Wollhaarmammuts gefunden. Wirf mal einen Blick nach links.«
Ich folgte der Aufforderung und sah die Überreste einer dunklen Jacke aus grobem Stoff aus der braunen Erde herausragen. Etwa dreißig Zentimeter des Kleidungsstückes waren freigelegt. Darunter zeichneten sich die vagen Umrisse eines kleinen menschlichen Rumpfes ab.
»Da liegt noch eine Leiche«, sagte Roy. »Wir wissen nicht, ob es die eines Kindes oder eines Erwachsenen ist, und es wird eine Weile dauern, bis wir sie ausgegraben haben. Zuerst konzentrieren wir uns auf die Frau.«
Fröstelnd richtete ich meine Aufmerksamkeit wieder auf die Frau und sah sie mir genauer an. Der gut erhaltene Kopf war deutlich sichtbar. Die Augen waren geschlossen. Ich sah ihre Nase, die Lippen, Ohren und Wangen. Ein paar Locken ihres dunklen Haars fielen auf ihr Gesicht und die Stirn. Sie hatte hübsche Wangenknochen. Ich richtete den Schein der Taschenlampe auf ihr bleiches Gesicht. Der Anblick wühlte mich auf, denn dies war einer der bedeutendsten Funde, die jemals in Jekaterinburg gemacht worden waren. »Unglaublich. Ich frage mich, wer sie war.«
»Keine Ahnung. Aber da ist noch etwas«, sagte Roy.
»Was denn?«
»Schau mal, was sie in der Hand hält.«
Ich richtete die Taschenlampe auf die geballte Faust und fragte mich, wie viele Jahrzehnte sie die Hand schon ballte. Offenbar umklammerte sie eine Metallkette. »Was ist das?«
»Sieht wie ein Schmuckstück aus«, meinte Tom.
»Wahrscheinlich hast du recht. Möchte jemand von euch versuchen, die Hand zu öffnen?«
Roy grinste mich an. »Wir dachten, das überlassen wir dir.«
»Vielen Dank!«
»Du bist der Boss, Baby.« Joe reichte mir ein Paar Einweghandschuhe.
»Okay, ich versuche es. Halt bitte die Taschenlampe«, bat ich ihn.
Roy richtete das Licht auf die geballte Faust. Ich streifte die Handschuhe über, atmete tief durch und schloss kurz die Augen. Dann umklammerte ich den Zeigefinger und das Handgelenk, zog vorsichtig an dem Finger und versuchte, die Hand zu öffnen.
Das Fleisch fühlte sich wie harter, kalter Marmor an.
Ich hatte Angst, die Haut könnte zerreißen oder die ganze Hand wie feines Porzellan zerbrechen. Zu meiner Überraschung öffneten sich die Finger lautlos, zwar nur ein kleines Stück, aber es reichte aus, um zu sehen, was sie festhielt. »Komm näher heran mit dem Licht«, bat ich Roy.
Er richtete die Taschenlampe auf die geöffnete Hand. In den ausgeblichenen weißen Furchen fand ich eine Kette und ein Medaillon.
Es sah nicht so teuer und ausgefallen aus wie andere in Jekaterinburg gefundene Schmuckstücke, welche Verwandte des Adelshauses oder reiche Händler, die hier ermordet worden waren, versteckt hatten. Ich zog das Medaillon mit der dünnen Kette heraus und wischte es vorsichtig mit den Fingern ab. Auf der Vorderseite des Schmuckstückes, das teilweise mit Torf bedeckt war, entdeckte ich ein erhabenes Bild.
Roy reichte mir sein Taschenmesser. »Hier, versuch’s mal damit.«
Ich nahm das Messer und kratzte die Erde ab. Es bestand kein Zweifel, dass das leicht nach vorne gewölbte goldene Familienwappen der Romanows die Vorderseite zierte. Ich erkannte den doppelköpfigen kaiserlichen Adler. Auf der Rückseite fand ich eine Gravur, doch die Korrosion hatte sie unkenntlich gemacht. Mein Herzschlag setzte aus.
»Meinst du, wir hatten Glück?«, fragte Tom begeistert.
»Das frage ich mich selbst. Ich wünschte, ich wüsste es.«
»Könnte es sein, dass wir die sterblichen Überreste einer Romanow gefunden haben, Baby?«, wollte Roy wissen.
Ich antwortete nicht und starrte wie gebannt auf das Medaillon.
Tom rieb sich die eisigen Hände, als wollte er sie durch die Reibung in Brand setzen. »Wer weiß? Jedenfalls müssen wir die Russen informieren, und wir müssen die Leiche aus dem Dauerfrostboden herausholen. Hoffentlich erfahren wir bei der genaueren Untersuchung, ob ihr Körper irgendwelche Wunden aufweist und wie sie möglicherweise gestorben ist.«
Den Russen oblag die Aufsicht über die Grabungsstätte. Jeden Tag kam ein Inspektor aus Jekaterinburg und überprüfte unsere Fortschritte. Doch daran dachte ich nicht, als ich auf das Medaillon blickte und angestrengt nachdachte. »Nein, ihr macht vorläufig gar nichts und informiert niemanden. Noch nicht.«
Tom runzelte die Stirn.
»Warum nicht?«, fragte Roy.
Ich war wie gelähmt und wahnsinnig aufgeregt, als ich noch einmal auf die beiden Leichen starrte. Intuitiv hob ich den Kopf zu der Öffnung des Schachtes. Das blaue Licht, das in diesem Augenblick auf mich herabschien, war wie eine Erleuchtung. Ich umklammerte das Medaillon. Mein Herz begann zu rasen.
»Was ist los?«, fragte Roy, als er bemerkte, wie fassungslos ich war.
Ich ging zurück zu dem Sitzgurt und schnallte mich fest. »Macht Fotos von der Leiche, und zwar aus allen Winkeln. Wir brauchen auch eine Haarprobe für eine DNA-Analyse. Ich will wissen, ob diese Frau eine Romanow oder eine Blutsverwandte der Zarenfamilie sein könnte.« Ich drückte auf den Schalter, worauf die Winde mich nach oben zog.
»Eh, wo gehst du hin, Baby?«, fragte Roy irritiert.
»Ich muss einen Flug buchen. Und frag mich nicht, wohin. Das würdest du sowieso nicht glauben.«
Einige Ereignisse in unserem Leben treffen uns mit einer so ungeheuren Wucht, dass wir sie kaum begreifen können. Die Geburt unseres ersten Kindes. Oder die Hand, die erschlafft, wenn wir am Totenbett eines geliebten Menschen sitzen. Das Mysterium, das diese Leichen im Dauerfrostboden umgab, lag auf derselben seismischen Skala. In den nächsten achtzehn Stunden konnte ich weder richtig denken noch schlafen. Aber ich erinnere mich noch gut daran, wie ich nach dem Flug von Jekaterinburg nach Moskau am nächsten Nachmittag am Londoner Heathrow Airport landete.
Als Erstes suchte ich die Telefonnummer heraus, die ich mir ins Notizbuch geschrieben hatte, und rief sie noch einmal vom Handy aus an. Es klingelte und klingelte. Ich versuchte es noch weitere sechs Mal mit demselben Ergebnis. Eine Computerstimme forderte mich auf, eine Nachricht zu hinterlassen. Es war die sechste seit dem Morgen.
Ich war erschöpft, doch ich hoffte, dass die Lösung des Geheimnisses um die Leichen in Jekaterinburg nur ein paar Hundert Meilen entfernt lag.
Der Flug nach Dublin über die Irische See dauerte eine knappe Stunde. Als das Flugzeug von Aer Lingus zur Landung ansetzte, erblickte ich die grüne irische Küste, über die dicke, dunkle Regenwolken hinwegzogen.
Nachdem ich einen Wagen gemietet und in einer Straßenkarte nach dem kürzesten Weg gesucht hatte, war wieder eine Stunde vergangen. Es regnete unaufhörlich, als ich Richtung Norden fuhr. Ich konnte es kaum erwarten, mein Ziel zu erreichen.
Pechschwarze Wolkenfelder verdeckten die Sonne, doch als ich in der Nähe einer Stadt namens Drogheda über eine große, moderne Brücke fuhr, brachen einzelne Strahlen durch die Wolken. Bald sah ich die irische Küste und die zerklüfteten Mourne Mountains vor mir. Es war ein eindrucksvolles Spiel leuchtend grüner Farbschattierungen, die so intensiv waren, dass meine Augen brannten.
Jetzt musste ich nur noch das Dorf finden, das ich suchte, und den Mann, der mir – so hoffte ich – bei der Lösung des Rätsels helfen konnte.
Auf dem Straßenschild stand: COLLON. Ich parkte den gemieteten Ford auf dem mit Blumenkörben geschmückten Dorfplatz. Er war menschenleer, sauber und gepflegt. Hübsche Häuser im viktorianischen Stil und eine alte Hufschmiede mit einem Eingang in Form eines Hufeisens säumten den Platz.
Ich überquerte die Straße, betrat ein Lebensmittelgeschäft und fragte nach dem Weg. Am südlichen Ende des Dorfes fand ich die presbyterianische Kirche aus rotem Granitstein und den Friedhof. Unterhalb des Glockenturms war das Baujahr in den Stein gemeißelt: 1813.
Der Friedhof sah noch älter aus. Die Kirche war wunderschön, und die bemalten Fenster waren echte Meisterwerke. Ich ging an den Gräbern entlang, von denen einige von Gestrüpp und Brombeersträuchern überwuchert wurden. Mein Blick fiel auf ein verrostetes Metallkreuz mit einer Inschrift aus dem Jahre 1875.
Elizabeth, drei Jahre, und Caroline, sechs Jahre,liebliche, bezaubernde Wesen, niemals vergessen;nun ruhen sie in den Armen unseres Herrn.
Ich spürte, wie eine längst vergessene Trauer in mir aufstieg.
Als ich näher heranging, klingelte mein Handy. Die schrillen melodischen Klänge störten jäh die Stille. Ich meldete mich und hoffte, dass es die Nummer war, die ich versucht hatte zu erreichen. »Laura?« Es war Roy, und die Verbindung war trotz der großen Entfernung erstaunlich gut. »Wo bist du?«
»In Irland.«
»Irland?«
»Das ist eine lange Geschichte. Hoffentlich hältst du mich jetzt nicht für verrückt, weil ich Hals über Kopf abgereist bin, aber es könnte sein, dass ich einer Sache auf der Spur bin. Es hat mit den Leichen und dem Medaillon zu tun. Wenn ich mehr weiß, melde ich mich.«
»Interessant, Baby. Und wenn nicht?«
»Es könnte auch eine ungeheure Zeit- und Geldverschwendung sein. Was ist mit der DNA?«
Roy hatte nicht alle Antworten von mir bekommen, die er sich erhofft hatte, und ich hörte sein frustriertes Seufzen. »Sie arbeiten daran. Den vorläufigen forensischen Untersuchungen zufolge war es wahrscheinlich eine Europäerin zwischen siebzehn und fünfundzwanzig. Wir sind noch nicht bis zu der zweiten Leiche vorgedrungen, weil wir bis jetzt zu sehr mit der ersten beschäftigt waren.«
»Noch etwas?«
»Der Leichnam ist noch nicht genügend aufgetaut, um zu erkennen, ob der Körper Wunden aufweist. Du erinnerst dich an die Münzen, die wir gefunden haben? Die jüngste ist von 1916. Wir glauben, dass wir es ungefähr mit dieser Zeit zu tun haben, plus minus ein paar Jahre. Der Zahnstatus der Frau lässt vermuten, dass sie aus recht guten Verhältnissen stammte. Wir sind also den Romanows auf der Spur. Konntest du inzwischen etwas von der Gravur entziffern?«
Behutsam nahm ich das Medaillon aus der Handtasche und drehte es in meiner Hand um. Den größten Teil der neun Flugstunden hatte ich damit verbracht, es mir genau anzusehen. Mir war es gelungen, etwas mehr von dem Schmutz zu entfernen. Doch die Gravur war durch die Korrosion ziemlich zerfressen und ließ sich beim besten Willen nicht entziffern. »Ich kann wirklich nichts erkennen.«
»Den Russen wird das gar nicht gefallen«, sagte Roy in besorgtem Ton. »Sie haben schon gefragt, wo du steckst. Ich hab denen erzählt, du musstest wegen einer dringenden Familienangelegenheit schnell abreisen. Mensch, Laura, wenn du ein Stück ihrer Geschichte entwendest, könnte es leicht als Diebstahl ausgelegt werden. Sogar am Telefon hab ich ein komisches Gefühl, darüber zu sprechen. Was passiert, wenn sie dich bei deiner Rückkehr ins Gefängnis stecken?«
Vorsichtig ließ ich das Schmuckstück wieder in die Handtasche gleiten. »Keine Sorge. Ich bring das Medaillon zurück. Ich hab es mir nur ausgeliehen, weil ich hoffe, etwas über seine Herkunft herauszufinden.«
»Wie?«
»Ich ruf dich später noch mal an.«
»Eh, Baby, spann mich nicht so auf die Folter!«
»Tut mir leid, ich muss auflegen. Mach dir keine Sorgen wegen der Russen. Ich kümmere mich darum. Ruf mich sofort an, wenn du etwas hast.«
Als ich das Handy zuklappte, sah ich zwischen den Gräbern einen alten Mann, der auf mich zukam. Neben mehreren Grabstätten mit Kreuzen im russischen Stil mit doppelten Querbalken und kyrillischen Inschriften blieb er stehen. Diese Kreuze wirkten zwischen all den katholischen und keltischen Insignien irgendwie sonderbar.
Ich konnte den Namen auf dem polierten Granitstein des Grabes, neben dem der Mann innegehalten hatte, erkennen: JURI ANDREW.
Der Mann stützte sich mit der rechten Hand auf einen Gehstock aus Schlehdornholz und musterte mich. Seine Haut hatte eine seltsame Farbe, als litte er unter Gelbsucht, und sie wirkte dünn wie Papier. Trotz eines leicht gebeugten Rückens hatte er eine aufrechte, stolze Haltung. Er sprach Englisch, doch ich glaubte, einen russischen Akzent herauszuhören. »Sie sind also endlich gekommen. Dr. Pawlow, nicht wahr?«
Ich starrte ihn an. »Woher wissen Sie das?«
»Ich habe Ihre Nachrichten erhalten. Ich trage niemals ein Handy bei mir. Verzeihen Sie, aber ich lag in den letzten Tagen im Krankenhaus.«
»Ich hoffe, nichts Ernstes.«
Er lächelte verhalten. »Die üblichen Probleme des Alters, fürchte ich. Verzeihen Sie, dass ich Sie nicht zurückgerufen habe, aber Sie sagten ja in Ihrer Nachricht, dass wir uns an der Kirche treffen. Meine Haushälterin hat mich hergebracht, und ich habe Sie von der Straße aus gesehen. Ich kenne Ihr Gesicht von den Fotos in den Fachzeitschriften. Sie sind eine hervorragende Wissenschaftlerin, Dr. Pawlow.«
»Vielen Dank.«
Als der Mann mir seine Hand reichte, sah ich, dass der Handrücken mit Leberflecken übersät war. »Michail Jakow. Offenbar haben wir beide dieselbe Passion.«
»Wie bitte?«
»Die Romanow-Ära. Ich interessiere mich schon seit langer Zeit für Ihre Arbeit.«
»Und ich interessiere mich plötzlich sehr für Ihre.«
»Ich nehme an, Ihre Nachricht bedeutet, dass Sie die Frau gefunden haben?«
»Ja, Mr Jakow. Wir haben sie gefunden. Genau so, wie Sie es vorhergesagt haben. Es könnten noch weitere Leichen dort liegen, vielleicht auch die eines Kindes, doch zum jetzigen Zeitpunkt kann ich Ihnen nicht mehr sagen.«
Jakow atmete tief ein, als würde diese Information ihm schwer zu schaffen machen. »Ich hatte so sehr gehofft, dass Sie sie finden. Sie haben ein Gebiet untersucht, in dem sie meines Wissens nach vergraben worden sein könnte.«
Als ich dort stand und dem alten Mann zuhörte, wurde mir mit einem Mal die Absurdität der Situation bewusst. Ich hatte Michail Jakow nie zuvor getroffen, im Laufe eines Jahres aber regelmäßig Briefe von ihm erhalten. Eine Zeit lang hatte ich mich von ihm fast verfolgt gefühlt. Im Abstand einiger Monate hatte ich immer wieder Schreiben von ihm erhalten, in denen er sich nach den Fortschritten der Grabungen in Jekaterinburg erkundigte. Und jetzt stand ich hier und hoffte, dass er mein Rätsel lösen würde.
»Mr Jakow, seitdem der Öffentlichkeit bekannt war, dass ich beabsichtigte, Grabungen in Jekaterinburg durchzuführen, haben Sie mir mindestens ein Dutzend Mal geschrieben. In fast jedem Brief wiesen Sie darauf hin, dass ich in dem Gebiet, in dem die Grabungen stattfanden, die sterblichen Überreste einer Frau finden könnte. Sie baten mich, Sie zu kontaktieren, falls ich tatsächlich auf ihre Leiche stoßen sollte. Es schien Ihnen ungeheuer wichtig zu sein, auf diese bestimmte Frau hinzuweisen.«
Er nickte. »Ja, das stimmt.«
Ich sah ihm in die Augen. »Sie haben in Ihren Briefen erwähnt, dass ich möglicherweise ein Medaillon finden könnte. Über die Identität der Frau haben Sie aber nie gesprochen. Und auf meine Fragen, warum Sie so großes Interesse an den Grabungen haben und davon überzeugt zu sein scheinen, dass ich die Leiche finde, bekam ich nie Antwort. Ehrlich gesagt habe ich Sie für einen Spinner gehalten. Das ist auch der Grund, warum ich mich seit Monaten nicht mehr bei Ihnen gemeldet habe. Bis gestern. Als wir die Leiche der Frau gestern gefunden haben, habe ich mich gefragt, ob Sie Hellseher sind. Würden Sie mir verraten, was das alles zu bedeuten hat?«
Jakow stieß einen Seufzer aus, der beinahe schmerzverzerrt klang, und seine Augen wurden feucht. »Es ist eine sehr persönliche Geschichte, Dr. Pawlow. Mein Vater hat sie mir erzählt.«
»Es betrifft auch meine Person. Sie haben mich in die Sache hineingezogen.«
Jakow schwieg und legte eine Hand auf den polierten Grabstein. Seine Finger strichen behutsam über den Granit, dann bekreuzigte er sich, als wollte er dem Toten darunter Ehre erweisen.
»Es ist ein seltsamer Ort für das Grab eines Russen zwischen all den keltischen Kreuzen«, sagte ich.
»Kennen Sie dieses Land?«
»Ich habe mehrfach keltische Grabungsstätten besucht.«
Jakows Blick wanderte über den Friedhof, als würde er jeden Stein und jede Grabstelle, jedes Gestrüpp und jeden Grashalm kennen. »In dieser Gegend sind viele Russen begraben. Und das ist nicht so verwunderlich, wie Sie vielleicht meinen, Dr. Pawlow.«
»Und warum nicht?«
»Zwischen Russland und Irland gab es einst einen regen Flachs- und Pferdehandel. Nach der Revolution kamen viele russische Familien hierher, einige auch in diese Gegend. Das war ungefähr zu derselben Zeit, als die Iren mit der britischen Krone um ihre Unabhängigkeit kämpften. Sie kamen sozusagen vom Regen in die Traufe.«
»Das wusste ich nicht. Gehörte dieser Mann auch dazu? Kannten Sie ihn?«
Jakow strich wieder über den glatten Granitstein. »Ja. Ich lernte ihn kurz vor seinem Tod kennen. Juri Andrew war ein ausgesprochen bemerkenswerter Mann, Dr. Pawlow. Ein Mann, der die Geschichte verändert hat. Und noch bemerkenswerter ist, dass ihn kaum jemand kennt. Sein Name ging in den Wirren der Zeit verloren.«
»Ich verstehe das nicht. Was hat all das mit der Leiche der Frau zu tun?«
Jakow sah mich an, und seine wässrigen Augen strahlten plötzlich vor Begeisterung. »Es hat eine ganze Menge damit zu tun. Vielleicht passt es ganz gut, dass wir uns gerade hier auf dem Friedhof getroffen haben, Dr. Pawlow.«
»Warum?«
»Weil wir an diesem Ort von Geheimnissen und Lügen umgeben sind, die allesamt eine Erklärung verlangen.«
Briar Cottage stand in der Nähe des Meeres und war sicherlich weit über hundert Jahre alt. Auf einem schwarz lackierten, ovalen Metallschild an der Mauer neben der Eingangstür stand in verschnörkelter weißer Schrift der Name.
Das Cottage hatte offenbar einmal zu einem großen Landsitz gehört. Auf dem Weg dorthin gingen wir zwischen zwei alten Granitpfeilern hindurch, auf denen verwitterte, aus Kalkstein gemeißelte Löwen saßen.
Hinter einigen Feldern erblickte ich die Ruinen eines riesigen Herrenhauses und die verfallenen Steinmauern eines Obstgartens. Wir fuhren über einen Schotterweg, der sich durch eine Wiese schlängelte, ehe wir schließlich vor dem weiß getünchten Cottage ankamen.
Dank der von Rosen umrankten, blau gestrichenen Tür sah es recht malerisch aus. Eine Hügelkette, von welcher der intensive Kokosduft von prächtigem gelbem Ginster herüberwehte, schützte das Häuschen vor dem Meereswind. Von hier aus hatte man einen herrlichen Blick auf die Landschaft.
Es begann wieder zu regnen, als ich den gemieteten Ford auf dem Kiesweg vor dem Haus neben einer alten dunkelblauen Toyota-Limousine parkte. Ein paar Halme des ursprünglichen Strohdaches des Cottages ragten unter den schwarzen, nachträglich angebrachten Schieferplatten hervor, sodass es wie eine schlecht sitzende Perücke aussah.
Ich folgte Jakow zur Tür. Er war überraschend rüstig, doch ich sah auch, dass das Alter seinen Tribut forderte. Die Hüften machten ihm zu schaffen.
Die Eingangstür bestand aus einem unteren und einem oberen Teil, wie man es manchmal noch in einigen ländlichen Gebieten Europas findet. Jakow bereitete es ein wenig Mühe, die Tür aufzuschließen, doch als er es geschafft hatte, führte er mich hinein. Das Cottage war erstaunlich groß. Es hatte eine Balkendecke und bot einen atemberaubenden Blick auf die fernen Mourne Mountains, deren Hänge sich sanft zum Meer hin senkten.
In dem Haus herrschte ziemliche Unordnung. Alles war von Büchern, Zeitungen und Zeitschriften übersät. Ein paar lagen auch auf dem großen Couchtisch aus hellem Kalkstein, der vor dem Kamin stand und an manchen Stellen schwarze Rauchflecken aufwies.
Holzregale, die mit Büchern und zahllosen verschnürten Stapeln vergilbter Zeitungen gefüllt waren, säumten die Wände. Mehrere Spazierstöcke aus Bruyèreholz standen in einem Schirmständer in einer Ecke. Die beiden alten Lehnstühle neben dem Kamin hatten so verschlissene Lehnen, dass man durch den Stoff hindurchsehen konnte. Ein Weidenkorb neben dem Kamin war randvoll mit Holzscheiten und Torfstücken gefüllt.
Es war ein wenig kalt in dem Raum, obwohl das Feuer noch brannte. Jakow schob den Kaminschirm zur Seite und stocherte mit einem Schürhaken in der Glut herum. Dann warf er ein paar Holzscheite und Torfstücke hinein, stellte den Schirm wieder vor den Kamin und rieb sich die Hände.
»Je älter man wird, desto mehr freut man sich über ein bisschen Wärme. Auch im Sommer kann es hier recht kühl sein.«
»Wie lange wohnen Sie schon hier?«
Jakow füllte frisches Wasser in den Wasserkocher und schaltete ihn ein. »Über drei Jahrzehnte. Zuerst zur Miete, und als der Eigentümer verstarb, habe ich das Cottage gekauft. Eine nette Dame hält das Haus in Ordnung und kocht für mich.« Er lächelte verschmitzt. »Wir haben eine Abmachung. Sie beseitigt die Unordnung, und sobald sie gegangen ist, bringe ich alles wieder durcheinander. Tee?«
»Gern.« Ich warf einen Blick auf die Schwarz-Weiß-Fotos an den Wänden. Nach der Kleidung der Männer und Frauen auf den Bildern zu urteilen, nahm ich an, dass sie etwa zurzeit des Ersten Weltkrieges oder kurz danach entstanden waren.
Auf einem der Fotos war ein Paar abgebildet. Ich trat näher heran, um es mir genauer anzusehen: ein gut aussehender Mann mit slawischen Gesichtszügen und Leinenmütze auf dem Kopf neben einer hübschen jungen Frau mit langem dunklem Haar. Sie sahen glücklich aus. Die Frau hatte sich bei dem Mann untergehakt, und sie standen in lässiger Haltung lächelnd und entspannt vor einem weiß getünchten Haus.
Unten auf dem Foto stand mit blauer Tinte geschrieben: Juri und Lydia, aufgenommen von Joe Boyle in Collon am 2. Juli 1918. Mein Blick wanderte zu dem weiß getünchten Haus hinter dem Paar. Das Foto konnte überall aufgenommen worden sein. Doch dann sah ich die halbe Tür und daneben die Kletterrosen, und ich erkannte das Haus, in dem ich stand: Briar Cottage.
Jakow schüttete drei Löffel getrocknete Teeblätter in eine Keramikkanne und goss das kochende Wasser darüber, woraufhin ein kräftiges Aroma den Raum erfüllte. »Übrigens, das Cottage war einst Teil eines großen Landsitzes, das einem russischen Geschäftsmann und seiner Frau, einer bekannten Theaterschauspielerin aus Sankt Petersburg, gehörte. Sie hieß Hanna Wolkowa und war vor dem Ersten Weltkrieg sehr berühmt. Haben Sie mal von ihr gehört?«
»Ich fürchte, nein.«
»Darf ich Sie fragen, woher Ihr Interesse an Russland stammt, Dr. Pawlow? Es scheint ziemlich stark und persönlich motiviert zu sein.«
»Meine Großmutter stammte aus Jekaterinburg, und in meiner Kindheit habe ich viele Geschichten über ihre Heimat gehört. Jedes Mal, wenn sie sich Doktor Schiwago anschaute, weinte sie hinterher eine Woche lang. Beantwortet das Ihre Frage?«
Jakow lächelte verhalten. »Ich habe gehört, dass dieser Film einen starken Eindruck hinterlassen kann. Es scheint fast, als hätten die Russen eine harte Schale – dabei sind es ausgesprochen gefühlvolle Menschen.«
»Sie hat immer gesagt, Lenins Revolution sei ein Kampf für die Seele Russlands gewesen. Eine Schlacht zwischen Gut und Böse, zwischen Gott und dem Teufel, und eine Zeit lang habe es so ausgesehen, als ob der Teufel gewinnen würde.«
Jakow strich sich nachdenklich über die Wange. »Vielleicht hatte sie recht. Es war jedenfalls ein entsetzlich brutaler Kampf.«
Die zahlreichen Andenken an Russland in dem Raum weckten in mir die Erinnerung an die Heimat meiner Großmutter. Auf einem Bücherregal entdeckte ich eine lackierte Matroschka. Ein polierter, vernickelter Samowar stand in einer Ecke, und vergoldete religiöse Ikonen hingen an den Wänden.
Sogar die Bücher in den Regalen erzählten Geschichten: Das Ende des imperialen Russlands von Waldron, Der Hof des letzten Zaren von King, Lenins Leben von Fischer. Zwischen all diesen Werken entdeckte ich unzählige Bücher über die Romanows und genauso viele über Anna Anderson, die mysteriöse Frau, von der einige behaupteten, sie sei Anastasia, die jüngste Tochter des Zaren, gewesen.
»Was hat Sie nach Irland geführt, Mr Jakow?«
»Es gibt viele Gründe, und sie sind alle persönlicher Natur. Vor vielen, vielen Jahren kam ich als Gastdozent ans Trinity College und kehrte nie wieder nach Russland zurück. Aber das ist eine andere Geschichte.« Er zeigte auf die Regale. »Ich bin glücklich mit meinen Büchern und meinen Unterlagen. Es ist ein ruhiges, aber erfülltes Leben.«
»Darf ich?«, fragte ich mit Blick auf die Bibliothek.
»Gerne.«
Eines der Bücher trug den Titel: Die verlorene Welt von Nikolaus und Alexandra. Ich nahm es heraus und blätterte darin. Es enthielt Bilder des Russlands, das meine Großeltern gekannt hatten, und Schwarz-Weiß-Fotografien der Zarenfamilie, ihrer vier hübschen Töchter und ihres gut aussehenden jungen Sohnes. Anschließend griff ich nach einem der zahlreichen Bücher über Anna Anderson. »Sie scheinen sich für Anna Anderson zu interessieren, Mr Jakow.«
»Sie kennen ihre Geschichte sicherlich?«
»Natürlich. Sie war eine psychisch labile Frau. Als sie 1920 aus einem Kanal in Berlin gezogen und in eine psychiatrische Klinik eingewiesen wurde, hatte sie keine Papiere bei sich, durch die sie sich identifizieren konnte. Sie weigerte sich zu sagen, wer sie war. Doch sie schien so detaillierte Kenntnisse über die russische Zarenfamilie zu besitzen, dass ihre Unterstützer immer behaupteten, sie sei tatsächlich die Zarentochter Anastasia, die das Massaker an den Romanows überlebt hat.«
Ich blätterte in dem Buch. »Ihre Geschichte hat Stoff für Filme, ein Broadway-Musical und zahllose Bücher geliefert, nicht wahr?«
Jakow nickte und steckte die Daumen in die Taschen seiner Weste. »Ja, das ist richtig. Sie war eine geheimnisvolle, faszinierende Frau, deren Existenz mehr Fragen aufwarf als beantwortete. Manche behaupten, dass sich das bis heute nicht geändert hat.«
»Sie war gewiss eine rätselhafte Persönlichkeit. Das muss man schon sagen.« Ich stellte das Buch zurück ins Regal und entdeckte einen alten Gedichtband von Yeats mit einem braunen, abgestoßenen Lederumschlag. Ich nahm das Buch, das, wie mir die erste Seite verriet, 1917 veröffentlicht worden war, in die Hand. Ich schlug die mit einem langen braunen Seidenbändchen markierte, abgegriffene Seite auf und las ein paar Zeilen:
Wenn du alt und grau und müde bistund am Kamin sitzt und ruhst, nimm dieses Buch,lies ein paar Zeilen und träume von dem sanften Blick,den deine Augen hatten, und von ihren tiefen Schatten.
Wie viele liebten dich wahrhaftig oder begehrten dich nur,wenn du vor Anmut und Schönheit erstrahltest,doch einer liebte deine unstete Seeleund den Kummer auf deinem wechselvollen Gesicht.
»Mögen Sie Yeats?«, fragte Jakow.
Ich sah vom Buch auf. »Dieses Gedicht gefällt mir, aber ich weiß nicht, was es bedeutet.«
»Es hat die Bedeutung, die Sie ihm geben. Yeats schreibt immer über Liebe und Verlust, Erinnerungen und Sehnsucht. Die Russen und die Iren verbinden ihr Hang zur Melancholie und die Liebe zur Poesie.«
Ich klappte das Buch zu und stellte es zurück ins Regal. »Haben Sie Familie, Mr Jakow?«
»Nein, es gibt nur mich. Meine Frau und ich hatten nicht das Glück, Kinder zu bekommen.«
»Sie haben noch immer Ihren russischen Akzent.«
»Ich habe die meiste Zeit meines Lebens in Russland gelebt. Nehmen Sie doch bitte Platz, Dr. Pawlow.« Er zeigte auf einen der verschlissenen Lehnstühle am Kamin und goss duftenden, dampfenden Tee in zwei Gläser.
»Kann ich Ihnen behilflich sein?«
»Ich komme seit vielen Jahren allein zurecht, seitdem meine Frau verstarb. Ich werde es schaffen, bis meine Krankheiten mich besiegen. Zucker? Milch? Oder Sahne, wie Ihr Amerikaner sagt?«
»Keine Sahne, ein Löffel Zucker. Wann werden Sie mir verraten, was hinter diesem Geheimnis steckt, Mr Jakow?«, fragte ich ihn.
Er gab in beide Gläser einen Löffel Zucker, fügte noch ein paar Löffel in sein Glas hinzu und reichte mir dann meinen Tee. Als ich mich in einen der Lehnstühle setzte, nahm Jakow ächzend auf dem gegenüber Platz. »Zuerst muss ich Ihnen mehr über mich erzählen, Dr. Pawlow. Mein Vater war Kommissar Leonid Jakow, der in den Geschichtsbüchern als hoher Funktionär der Geheimpolizei der Bolschewiki, der Tscheka, erwähnt wird. Vielleicht haben Sie mal von ihm gehört?«
Ich wollte gerade einen Schluck heißen Tee trinken, stattdessen hob ich erstaunt den Kopf. »Ja, habe ich. Wenn ich mich nicht täusche, stand er im Ruf, äußerst brutal gewesen zu sein.«
»Eine gewisse Zeit gehörte mein Vater zu den meistgefürchteten Menschen in Russland. Und das zu Recht. Er hat viele schreckliche Dinge getan.« Jakow trank einen Schluck Tee. »Sie erinnern sich an das Grab von Juri Andrew, das Sie vorhin gesehen haben, nicht wahr?«
»Was ist damit?«
»Er und mein Vater hatten eine sehr enge persönliche Bindung.«
»Was denn für eine Bindung?«
»Eine, die viel stärker war, als sie beide es sich hätten vorstellen können, und von der sie lange Zeit nichts wussten. Ein gut gehütetes Familiengeheimnis.«
»Ein Familiengeheimnis? Ich verstehe nicht.«
»Andrews Vater und Leonid Jakows Mutter … Sie hatten ein Verhältnis miteinander. Sie gehörten unterschiedlichen gesellschaftlichen Klassen an, verstehen Sie, aber sie fühlten sich dennoch sehr wohl miteinander. Aus dieser Beziehung ging ein Kind hervor, ein Junge namens Stanislaw. Er war der Bruder von meinem Vater und von Juri Andrew, doch sie erfuhren erst viel später davon.«
»Verzeihung, aber ich verstehe nicht. Das müssen Sie mir erklären.«
»Alles zu seiner Zeit, Dr. Pawlow. Sie sagen, Sie haben die Leiche gefunden?«
»Ja, und auch das Medaillon, das Sie in einem Ihrer Briefe erwähnt haben. Die Frau hielt es in der Hand.«
Jakow schüttelte den Kopf, und seine blassen Lippen zitterten leicht. »Ihre Entdeckung erleichtert und erstaunt mich zugleich, Dr. Pawlow.«
Ich stellte meine Tasse auf den Tisch. »Ich kann es kaum erwarten zu hören, woher Sie diese Frau kannten. Ich habe das Medaillon mitgebracht.«
Er riss die Augen auf. »Haben die Behörden es erlaubt?«
»Ehrlich gesagt habe ich es ihnen nicht gesagt.«
»Dr. Pawlow, Sie wissen doch sicherlich, dass der Diebstahl eines Fundstückes in Russland …«
»… ein schweres Vergehen ist, ja. Aber vertrauen Sie mir. Ich habe vor, es zurückzubringen. Ich dachte, Sie würden es sich gerne einmal ansehen. Ich habe auch Nahaufnahmen der Leiche mitgebracht, die wir am Fundort gemacht haben.«
»Darf ich Sie sehen?«, fragte Jakow gespannt.
Ich reichte ihm eine gepolsterte Versandtasche mit den Fotos.
Jakows Hände zitterten, als er die Farbfotos herausnahm und sorgfältig auf dem Tisch ausbreitete. Er setzte eine dicke Lesebrille auf und nahm ein Foto nach dem anderen vorsichtig in die Hand, als handelte es sich um wertvolle Gegenstände.
Er betrachtete die Fotos von dem Leichnam der Frau, der aus verschiedenen Winkeln aufgenommen worden war. Als er schließlich den Blick hob, waren seine Augen feucht. »Darf ich das Medaillon sehen?«, fragte er mich.
Ich reichte es ihm. »Wie Sie bereits andeuteten, ist die Vorderseite mit dem kaiserlichen Adler der Romanows verziert. Auf der Rückseite ist eine Gravur. Sie ist jedoch korrodiert, und ich konnte sie bisher nicht entziffern. Da Sie aber von dem Medaillon wussten, hoffe ich, dass Sie mir helfen können. Wissen Sie, was dort steht?«
Jakow nahm das Medaillon fast ehrfürchtig entgegen, als wäre es eine heilige Reliquie. Aufmerksam betrachtete er das korrodierte Metall, drehte das Medaillon in seiner Hand hin und her. Die dünne Kette baumelte in der Luft, und jetzt füllten sich Jakows Augen mit Tränen.
»Ist alles in Ordnung?«, fragte ich ihn.
»Ja, Dr. Pawlow«, erwiderte er in heiserem Ton.
»Unsere Entdeckung in Jekaterinburg bedeutet Ihnen offenbar sehr viel, nicht wahr?«
»Das kann man wohl sagen.«
»Wie haben Sie von dem Medaillon erfahren?«
»Genauso wie ich von der Leiche der Frau erfahren habe. Mein Vater hat es mir erzählt.«
Ein Gedanke durchfuhr mich wie ein Blitz, und mein Pulsschlag beschleunigte sich. »Hatte Ihr Vater irgendetwas mit der Ermordung der Romanows zu tun?«
Ich erinnerte mich, Leonid Jakows Namen in den Geschichtsbüchern gelesen zu haben, aber niemals in diesem Zusammenhang.
Zu meiner Überraschung nickte sein Sohn. »Ja, hatte er. Er wurde heimlich von Lenin beauftragt, die Hinrichtung zu überwachen. Ich muss gestehen, dass ich noch nie mit einem Menschen darüber gesprochen habe.«
»Wissen Sie, wie die Gravur lautet?«
»Ich glaube schon, Dr. Pawlow.«
»Dann sagen Sie es mir um Himmels willen!«
Jakow wandte den Blick ab und starrte in die Ferne, als versuchte er, vor seinem geistigen Auge etwas zu erkennen. Es musste etwas sehr Persönliches sein, denn er sagte nichts. Und dann begann er aus irgendeinem mir unbekannten Grund zu weinen. Seine Schultern bebten, als bittere Tränen über seine Wangen liefen. Er zog ein Taschentuch hervor und tupfte sich die Augen. »Verzeihen Sie bitte.«
»Mr Jakow, es gibt nichts zu verzeihen. Was wühlt Sie so auf?«
»Die Erinnerungen eines alten Mannes.«
»Ich verstehe nicht. Wer war die Frau? Und was hat sie mit dem Grab zu tun, an dem wir uns getroffen haben? Es gibt eine Verbindung, nicht wahr?«
Plötzlich sah Jakow gebrechlich und besorgt aus, schrecklich einsam, wie ein alter Mann auf der Schwelle des Todes, der Angst hat, sie zu überschreiten. Eine Sekunde später veränderte sich seine Miene, und die traurigen Gesichtszüge erinnerten an einen kleinen Jungen, der sich ohne seine Eltern furchtbar verloren fühlte. »Sie sind doch eine Expertin der Romanows, Dr. Pawlow, oder?«, fragte er mich leise.
»Eine Expertin vielleicht nicht unbedingt, aber mich verbindet ein starkes berufliches Interesse mit der Zarenfamilie.«
»Dann, fürchte ich, werden Sie niemals glauben, was ich Ihnen erzählen werde.«
»Warum nicht?«
Jakows Stimme klang nun wieder etwas fester. »Weil hinter der allgemein anerkannten Darstellung dessen, was in der Nacht, als die Romanows starben, passierte, eine gewaltige Verschwörung steckt.«
»Das ist eine recht kühne Behauptung, Mr Jakow.«
»Ich kann es beweisen.«
Ich musterte ihn verwirrt. »Warum haben Sie nie zuvor über Ihre Behauptung gesprochen, wenn sie wahr ist?«
In Jakows Augen funkelte ein Feuer. »Ich habe es so oft versucht, aber niemand wollte mir glauben. Auch Sie hätten mir ohne Beweise nicht geglaubt. Nachdem Sie nun die Leiche und das Medaillon gefunden haben, haben Sie den Beweis. Ich bin ein alter Mann. Mir bleibt nicht mehr viel Zeit, und darum möchte ich, dass Sie die wahre Geschichte hören, Dr. Pawlow.«
»Welche wahre Geschichte?«
»Über das, was den Romanows in der Nacht, als sie verschwanden, zugestoßen ist. Das ist nicht die Geschichte, die in den Geschichtsbüchern steht. Es war ein entsetzliches Blutvergießen, eine unglaubliche Brutalität und ein grausames Sterben. So viel steht jedenfalls fest.« Er verstummte kurz. »Zu viele persönliche Interessen haben in all den Jahren verhindert, dass die Wahrheit ans Licht kam. Aber wenn ich Ihnen alles erzählt habe, werden Sie das Geheimnis um Anna Anderson verstehen, die Frau, die Anastasia genannt wurde.«
Ich starrte Jakow verblüfft an, als er fortfuhr. »Wenn ihre Geschichte irgendwo begann, dann war es in Sankt Petersburg im Jahre 1918 mit einem amerikanischen Spion namens Philip Sorg.«
»Ich habe nie etwas von Sorg gehört.«
»Nur wenige kannten ihn. Sorg ist ein Rätsel, ein junger Mann, der sich in die Tochter des Zaren verliebte, die Großfürstin Anastasia. Das Paar, das Sie vor diesem Cottage auf dem Foto gesehen haben, Juri Andrew und eine Frau namens Lydia Ryan, spielten dabei ebenfalls eine Rolle. Sie verbrachten gemeinsam einige Zeit hier in diesem Haus, ehe sie nach Russland reisten, um sie zu retten.«
»Um wen zu retten?«
»Den Zaren und seiner Familie.«
Ich blickte Jakow schockiert an. »Ich habe so einiges über verschiedene Rettungsverschwörungen gelesen, aber sie schlugen doch alle fehl, oder?«
»Glauben Sie mir, bei dieser war es anders.« Jakows Augen strahlten. »Von dieser Geschichte steht nichts in den Geschichtsbüchern, und das aus gutem Grund. Und nun werden Sie etwas erfahren, was auch ich erfahren habe, Dr. Pawlow.«
»Und das wäre?«
»Dass die Wahrheit, soweit sie die Romanows betrifft, hinter einem Netz aus Rätseln, Mythen und Lügen verborgen liegt.«
VERGANGENHEIT
1918
ERSTER TEIL
2. KAPITEL
Sibirien
Es war der kälteste Winter seit fünfundzwanzig Jahren. In Paris fielen in einer einzigen Nacht dreißig Zentimeter Schnee. Vierzehn Clochards starben, und ihre Leichname froren auf den Bürgersteigen fest. Die Tragödie zwang den Bürgermeister der französischen Hauptstadt, die Metrostationen zu öffnen, damit die Obdachlosen darin Schutz vor der Kälte fanden.
Die Pariser scherzten mit grimmigen Mienen, dass der Winter mehr Todesopfer forderte als die Granaten der Deutschen. Der blutige Krieg, der in ganz Europa wütete, hatte bereits siebzehn Millionen Menschen das Leben gekostet, und die eisigen Temperaturen machten alles noch unerträglicher.
In einer Zeitung wurde berichtet, dass an der Westfront, wo inmitten von Schneeverwehungen grausame Schlachten tobten, eine Einheit der deutschen Artillerie drei Wochen lang ohne Verpflegung von der Außenwelt abgeschnitten gewesen war. Die Soldaten hatten ihre Pferde geschlachtet, um zu überleben. Und nachdem sie das Pferdefleisch verzehrt hatten, kochten sie ihre Ledersättel und aßen sie.
In Sibirien, wo die Temperaturen unter dreißig Grad minus sanken, kämpfte Juri Andrew in einem anderen Kampf, als seine Verfolger sich ihm näherten, um ihn zu töten.
Schreie und Gewehrschüsse hallten durch den Wald, und die Kugeln flogen links und rechts von ihm durch die Bäume. Sie schlugen in die Birken ein und wirbelten den Schnee auf, doch Andrew lief weiter. Er brach vor Erschöpfung fast zusammen, als seine müden Beine in dem tiefen, eisigen Schnee versanken.
Verbissen kämpfte er sich durch den Wald und rannte um sein Leben. Das Bellen und Kläffen der Hunde wurde lauter, nachdem sie seine Spur aufgenommen hatten.
Andrews Brust brannte, als er die eisige Luft tief einatmete. Bei jedem qualvollen Schritt betete er, dass es ihm gelang, die Eisenbahnschienen zu erreichen. Die Stiefel und die Gefängnisuniform waren sein einziger Schutz vor der furchtbaren Kälte, und der grobe Stoff scheuerte wie Schmirgelpapier auf seiner Haut.
Ein Gewehrschuss hallte durch die Luft, dann ein zweiter, und beide Kugeln zischten nur Zentimeter an seinem Kopf vorbei. Andrew rang nach Atem und warf einen flüchtigen Blick zurück. Mindestens zwei Dutzend bewaffnete Wachen rannten hinter ihm kreuz und quer durch den Wald.