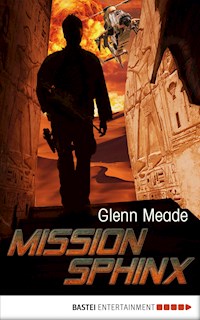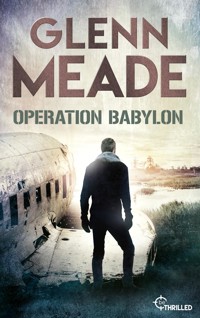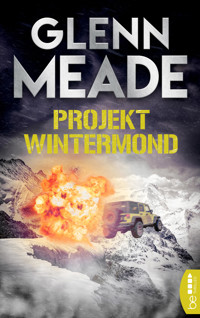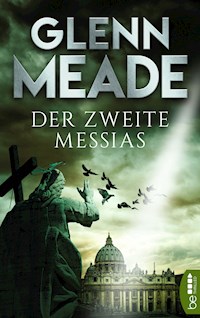4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Polit-Thriller von Bestseller-Autor Glenn Mead - packende Spannung vor dem Hintergrun
- Sprache: Deutsch
1953. Die Siegermächte befinden sich mitten im Kalten Krieg. Die US-Regierung befürchtet, die Sowjetunion könnte nukleare Waffen entwickeln und einsetzen. Um das zu verhindern, setzen die Amerikaner ihre "Operation Schneewolf" in Kraft. Das Ziel: Die Ermordung Josef Stalins. Der Top-Agent Alex Slanski soll die Operation leiten - an seiner Seite die Russin Anna Chorjowa. Doch als der KGB Wind von der Sache bekommt, droht nicht nur der ganze Plan zu scheitern, sondern auch der Ausbruch des Dritten Weltkrieges unausweichlich zu sein ...
Glenn Meade liefert einen hervorragend recherchierten Spionage-Thriller. Ein packendes Katz-und-Maus-Spiel zur Zeit des Kalten Krieges.
"Ein großer Stoff, unwiderstehlich spannend gestaltet." Los Angeles Times
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 970
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
Cover
Weitere Titel des Autors
Über dieses Buch
Über den Autor
Titel
Impressum
Widmung
Danksagungen
Zitat
Die Gegenwart
1. Kapitel
Die Vergangenheit
Erster Teil: 1952
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
Zweiter Teil: 12. bis 27. Januar 1953
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
Dritter Teil: 1. bis 22. Februar 1953
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
Vierter Teil: 23. bis 24. Februar 1953
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
Fünfter Teil: 25. bis 27. Februar 1953
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
Sechster Teil: 27. Februar 1953 (9.15 bis 18.30 UHR)
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
Siebter Teil: 27. Februar bis 2. MÄRZ 1953
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
Die Gegenwart
61. Kapitel
Anmerkungen des Verfassers
Weitere Titel des Autors
Mission Sphinx
Der Jünger des Teufels
Der zweite Messias
Die Achse des Bösen
Die letzte Zeugin
Operation Babylon
Operation Romanow
Projekt Wintermond
Unternehmen Brandenburg
Über dieses Buch
1953. Die Siegermächte befinden sich mitten im Kalten Krieg. Die US-Regierung befürchtet, die Sowjetunion könnte nukleare Waffen entwickeln und einsetzen. Um das zu verhindern, setzen die Amerikaner ihre „Operation Schneewolf“ in Kraft. Das Ziel: Die Ermordung Josef Stalins. Der Top-Agent Alex Slanski soll die Operation leiten – an seiner Seite die Russin Anna Chorjowa. Doch als der KGB Wind von der Sache bekommt, droht nicht nur der ganze Plan zu scheitern, sondern auch der Ausbruch des Dritten Weltkrieges unausweichlich zu sein …
eBooks von beTHRILLED – mörderisch gute Unterhaltung.
Über den Autor
Glenn Meade (*1957 in Dublin) arbeitete als Journalist und als hochspezialisierter Ausbilder am Flugsimulator für Aer Lingus, bevor er zu internationalem Bestsellerruhm gelangte. Seine Bücher, darunter der Thriller „Mission Sphinx“, wurden in mehr als 20 Sprachen übersetzt. Glenn Meade lebt in Irland und widmet sich ganz der Schriftstellerei.
Glenn Meade
Operation Schneewolf
Thriller
Aus dem Englischen von Wolfgang Thon
beTHRILLED
Digitale Neuausgabe
»be« – Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Für die Originalausgabe:
Copyright © 1996 by Glenn Meade
All rights reserved.
Titel der englischen Originalausgabe: „Snow Wolf“
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover
Für diese Ausgabe:
Copyright © 1998/2021 by Bastei Lübbe AG, Köln
Covergestaltung: Guter Punkt, München unter Verwendung von Motiven © mikolajn/Gettyimages; © A.S.B./Shutterstock; © Logtnest/shutterstock
eBook-Produktion: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN 978-3-7517-0216-4
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Für Geraldine und Alex,und zum Gedenken anJulie Anne
DANKSAGUNGEN
Einige der in diesem Roman geschilderten Ereignisse sind historisch belegt. Obwohl bestimmte Persönlichkeiten aus dem historischen Kontext dieser Epoche erwähnt werden, ist die Handlung rein fiktiv; Anspielungen auf lebende Personen sind nicht beabsichtigt. Mit dem Ausdruck KGB wird der Sowjetische Staatssicherheitsdienst bezeichnet, der vor und nach dem Zeitraum, in dem dieses Buch größtenteils spielt, verschiedene Namensänderungen erfahren hat, bis er schließlich 1954 endgültig den Namen KGB annahm. Obgleich einige Ereignisse, von denen auf diesen Seiten die Rede ist, ebenfalls historisch verbürgt sind, wurden sie mit angemessener literarischer Freiheit angereichert, was Zeit, Ort und Inhalt angeht.
Bei meinen Recherchen haben mir viele Menschen geholfen und mir ihre eigenen Einblicke in diese Ereignisse gewährt. Daher möchte ich folgenden Personen und Institutionen meinen Dank sagen:
In den Vereinigten Staaten: der Gesellschaft Ehemaliger Geheimdienstoffiziere (AFIO).
In Finnland: dem Personal der US-Botschaft in Helsinki; der SUPO (der finnische Spionageabwehrdienst) für ihre unschätzbare Hilfe und Herzlichkeit, und dafür, dass sie mir Zugang zu bestimmtem Archivmaterial gewährt hat.
In Estland: Arseni Sacharow, Überlebender des Gulag, für seine Erinnerungen und Hintergrundinformationen, und Ave Hirvelaan für ihre Freundlichkeit und Unterstützung.
In Rußland: bestimmten, ehemaligen Angehörigen des KGB, die aus verständlichen Gründen nicht namentlich genannt werden möchten und die wissen, weshalb ich ihnen zu Dank verpflichtet bin. Für ihre fachkundige Hilfe über diese Epoche und für bestimme historische Episoden in diesem Roman danke ich Alexander Wischinski und Waleri Nekrasow.
Außerdem möchte ich Steven Milburn meinen Dank ausdrücken sowie den stets hilfreichen Angestellten der finnischen Botschaft in Dublin, vor allem Hannele Ihonen und Leena Alto.
Es gibt noch viele andere, vor allem ehemalige Geheimdienstangehörige, die mir ihre Zeit und ihr Sachwissen zur Verfügung gestellt haben; wie ich feststellen mußte, bevorzugen diese Frauen und Männer in ihrem Ruhestand die Anonymität – ihnen allen gilt mein aufrichtigster Dank.
Für die Transkription und Überprüfung sämtlicher russischer Namen, Ausdrücke und Ortsbezeichnungen dankt der Verlag Corinna Hartmann.
Das schwierigste Unterfangen ist nicht, die Zukunft vorherzusagen, sondern die Vergangenheit.
Russisches Sprichwort
Da draußen lauert ein Wolf. Er will mein Blut.Wir müssen alle Wölfe ausrotten.
Diese Bemerkung wird Josef Stalin zugeschrieben. Angeblich hat er diese Bemerkung am 17. Februar 1953, also gut zwei Wochen vor seinem Tod, dem indischen Botschafter in Moskau gegenüber gemacht. Dieser Mann war der letzte Ausländer, der Josef Stalin lebend gesehen hat.
DIE GEGENWART
1. KAPITEL
Moskau
Ich war gekommen, um die Vergangenheit zu begraben und die Geister wiederauferstehen zu lassen. Deshalb schien es mir passend, die Geschichte von Wahrheit und Lügen der Vergangenheit auf einem Friedhof zu beginnen.
Es regnete an diesem Morgen auf dem Nowodewitschi-Friedhof, als ich meinen Vater zum zweiten Mal zu Grabe trug.
Daß jemand zweimal beerdigt wird, kommt nicht oft vor. Ich stand allein unter einer Kastanie, von deren Ästen der Regen tröpfelte, und sah, wie ein schwarzer Mercedes durch die Friedhofstore fuhr und in der Nähe des Grabes hielt. Zwei Männer stiegen aus. Einer war mittleren Alters und grauhaarig, der andere war ein orthodoxer Priester mit Vollbart.
Es ist eine alte russische Tradition, den Sarg zu öffnen, bevor er in die Erde gesenkt wird. Damit gibt man Freunden und Verwandten Gelegenheit, ihre Toten noch einmal zum Abschied zu küssen und ihnen ein Lebewohl mit auf den letzten Weg zu geben. Aber hier, an diesem nassen Junitag, verzichtete man wohlweislich auf diese Zeremonie. Immerhin war der Mann, der hier beigesetzt wurde, schon vor mehr als vierzig Jahren gestorben. Dies hier war nur eine schlichte Bestattung, mit der man seinen Tod jedoch endlich auch offiziell anerkannte.
Ich erinnere mich daran, dass jemand einen Kranz aus roten Blumen neben das Grab gelegt hatte. Dann sah ich die gezackten Blitze, die am grauen Horizont flackerten, und hörte das Grollen des Donners.
Es war eines dieser Frühsommergewitter, das den Himmel über Moskau wie ein Feuerwerk erhellt und in dem sich die Wolken vollkommen leerzuregnen scheinen. Es war eine passende Szenerie für eine Beerdigung und – im Fall meines Vaters – auch ein dramatisches Ende eines dramatischen Lebens.
Das Kloster von Nowodewitschi liegt südlich von Moskau. Die alte orthodoxe Kirche aus dem sechzehnten Jahrhundert war von Mauern aus ausgebleichtem Stein umgeben und wurde von fünf goldenen Kuppeln gekrönt. Hinter den Gittertoren, durch die man auf den Friedhof gelangte, erstreckte sich ein Labyrinth aus schmalen Wegen zwischen Unkraut, marmornen Grabsteinen und alten Grüften.
Bis vor ein paar Jahren war der Friedhof der Öffentlichkeit nicht zugänglich gewesen. Chruschtschows Grab lag nicht weit entfernt. Es war ein massives Monument aus weißem und schwarzem Marmor. Stalins Frau und ihre Familie ruhten weiter rechts. Tschechow. Schostakowitsch. Unter weiteren großen Grabstätten aus Marmor ruhten die Helden der Sowjetunion, Schriftsteller und Schauspieler, Männer und Frauen, die der sowjetischen Geschichte ihren Stempel aufgedrückt hatten. Mein Vater machte sich merkwürdig zwischen ihnen. Er war Amerikaner.
Während ich im strömenden Regen unter tropfenden Ästen in einer Ecke des Friedhofes stand, beobachtete ich, wie der grauhaarige Mann leise mit dem Priester sprach. Der nickte und zog sich unter einen Baum zurück, der ein paar Schritte entfernt stand.
Der grauhaarige Mann war Ende Vierzig, groß und gut gebaut. Unter dem regenfeuchten Umhang trug er einen modischen blauen Anzug und lächelte mich herzlich an, als er auf mich zukam.
»Ein ziemlicher feuchter Tag für einen solchen Anlaß, finden Sie nicht?« Er reichte mir die Hand. »Brad Taylor, Botschaft der Vereinigten Staaten. Sie sind Massey, nicht wahr?«
Er hatte einen festen Händedruck.
»Ich hatte schon befürchtet, Sie würden es nicht schaffen«, erwiderte ich.
»Entschuldigen Sie die Verspätung. Ich wurde in der Botschaft aufgehalten.« Er nahm eine Schachtel Zigaretten aus der Tasche und bot mir eine an. »Rauchen Sie? Ich hoffe, es wirkt nicht despektierlich.«
»Überhaupt nicht. Danke, ich nehme gern eine.«
»Es ist eine schreckliche Angewohnheit, aber an solch tristen Tagen spendet es ein bißchen Trost.«
Nachdem er unsere Zigaretten angezündet hatte, warf er dem Priester einen Seitenblick zu. Der hatte aus seiner weißen Robe unter dem schwarzen Umhang eine Bibel hervorgezogen und las darin.
»Bob hat mir erzählt, dass Sie als Journalist bei der Washington Post arbeiten«, sagte Taylor. »Sind Sie schon mal in Moskau gewesen, Mr. Massey?«
»Einmal, vor etwa fünf Jahren. Aber nur kurz. Im Rahmen meiner Arbeit. Was hat Bob Ihnen noch erzählt?«
Taylor lächelte und zeigte dabei seine perfekten, gleichmäßigen weißen Zähne. »Genug, um zu wissen, dass es nicht überflüssig wäre, Sie zu treffen. Er hat gesagt, Sie wären ein alter Freund von ihm aus Ihrer gemeinsamen Schulzeit im Internat. Sie hätten in seiner Einheit in Vietnam gedient. Außerdem hat er mich gebeten, dafür zu sorgen, dass Ihr Aufenthalt in Moskau glatt verläuft. Darauf hat Bob besonderen Wert gelegt.«
Taylor schien noch etwas sagen zu wollen, zögerte jedoch und blickte erneut zu dem Priester hinüber, der gerade zu Ende gelesen und ein kleines Weihrauchgefäß entzündet hatte und nun zu uns kam.
»Wir können wohl anfangen«, bemerkte Taylor. »Übrigens spricht der Priester Englisch. Ich dachte, es wäre Ihnen recht. Ich glaube, wir haben an alles gedacht, worum Bob gebeten hat.«
Jemand hatte einen neuen Marmorstein gegen einen Baum gelehnt. Ich konnte die schlichte Inschrift in kyrillischen Buchstaben entziffern.
Jakob Massey3. Januar 1912 – 1. März 1953
Daneben lag ein alter Grabstein ohne Inschrift, den man vom Grab entfernt hatte. Er war von grünem Moos überwuchert und mit den Jahren verwittert. Ein anderer Stein, der genauso alt aussah, lag noch auf dem Boden und markierte ein zweites Grab unmittelbar neben dem meines Vaters. Aus den Augenwinkeln sah ich zwei Totengräber mit Umhängen etwas weiter entfernt unter einigen Bäumen stehen. Sie warteten darauf, den Grabstein meines Vaters aufstellen zu können.
Während ich da stand, wurde mir klar, wie die Dinge sich so plötzlich zusammengefügt hatten. Es war einer dieser seltenen Fälle, in denen der Zufall sich wirklich alle Mühe gibt, einen davon zu überzeugen, dass es so etwas wie Schicksal gibt. Vor einer Woche – und fünftausend Meilen entfernt – hatte ich in Washington den Anruf aus Langley erhalten, in dem man mir mitteilte, die Beerdigungsfeierlichkeiten wären arrangiert worden, und Anna Chorjowa wollte mich in Moskau treffen. Ich brauchte drei Tage, alle Details abzuklären, und konnte bis dahin meiner Aufregung kaum Herr werden.
Der orthodoxe Priester trat vor und schüttelte mir die Hand. »Soll ich jetzt beginnen?« Sein Englisch war perfekt.
»Ja, vielen Dank.«
Er trat vor das Grab. Mit seinem schwarzen Hut, dem schwarzen Regenmantel und der weißen Robe wirkte er sehr feierlich. Er schwang einen kleinen Weihrauchbehälter, der einen angenehmen Duft verströmte, und intonierte die Totengebete auf russisch. Taylor und ich standen daneben und lauschten dem klagenden Sprechgesang, der in der feuchten, süßlich duftenden Luft weit trug. Schließlich begann der Priester, laut aus dem Buch der Offenbarung vorzulesen.
Er wird euch die Tränen trocknen, und dann wird es keinen Tod mehr geben, kein Leid, kein Weinen und keinen Schmerz. All das wird für immer vergessen sein …
Die Zeremonie verflog im Nu. Der Priester verabschiedete sich und ging zum Wagen zurück. Die Totengräber traten näher und machten sich an die Arbeit. Sie stellten den neuen Grabstein auf das Grab meines Vaters.
»Das war es dann wohl!« sagte Taylor. »Bis auf Ihre Freundin Anna Chorjowa. Sie ist heute morgen aus Tel Aviv eingetroffen. Ihretwegen bin ich zu spät gekommen.«
Taylor steckte sich eine weitere Zigarette an und spendierte auch mir noch eine. »Ich nehme an, Bob hat Ihnen die Grundregeln erklärt?« fragte er dann.
»Sicher. Keine Fotos, keine Aufnahmen. Alles streng vertraulich.«
Taylor lächelte. »Das dürfte wohl ausreichen. Sie hält sich in einem Haus in den Worobjowije Gory, den sogenannten Spatzenhügeln, außerhalb von Moskau auf. Es gehört der israelischen Botschaft, und normalerweise wohnen dort die Angestellten. Man hat es für Ihr Treffen geräumt.« Er reichte mir einen Zettel. »Das ist die Anschrift. Man erwartet Sie heute nachmittag um fünfzehn Uhr.« Er zögerte. »Darf ich Ihnen eine Frage stellen?«
»Nur zu.«
Er deutete mit dem Kopf auf das Grab meines Vaters. »Bob hat mir erzählt, dass Ihr Vater vor vierzig Jahren gestorben ist. Wieso haben Sie dann heute diesen Gottesdienst abhalten lassen?«
»Das hat Bob Ihnen nicht gesagt?«
Taylor lächelte. »Ich bin hier nur der Botenjunge. Bob hat mir genug mitgeteilt, damit ich nicht völlig ahnungslos bin und alles organisieren konnte. Aber Genaueres wollte er mir nicht sagen. Und wenn man für das diplomatische Corps der Vereinigten Staaten arbeitet, lernt man schnell, nicht zu viele Fragen zu Themen zu stellen, die einen nichts angehen. Man nennt es, glaube ich: ›das nötige Wissen‹.«
»Ich kann Ihnen nur sagen, dass mein Vater für die amerikanische Regierung gearbeitet hat und 1953 in Moskau gestorben ist.«
»Hat er für unsere Botschaft gearbeitet?«
»Nein.«
»Ich dachte, dass Moskau während des kalten Krieges für alle Amerikaner außer für die Botschaftsangehörigen verbotenes Terrain war«, erwiderte Taylor verblüfft. »Wie ist Ihr Vater gestorben?«
»Um das herauszufinden, bin ich hier.«
Taylor war verwirrt, schien etwas erwidern zu wollen. Doch in diesem Augenblick donnerte es über uns, und er blickte zum Himmel.
»Ich würde ja gern noch ein bißchen mit Ihnen plaudern, aber die Pflicht ruft.« Er zertrat die Zigarette mit dem Absatz. »Ich muß den Priester zurückbringen. Kann ich Sie irgendwo absetzen?«
Ich warf meine Zigarette achtlos fort. »Das ist nicht nötig. Ich nehme mir ein Taxi. Eine Zeitlang möchte ich noch hierbleiben. Danke für Ihre Hilfe.«
»Wie Sie wollen.« Taylor spannte den Regenschirm auf. »Viel Glück, Massey. Ich wünsche Ihnen, dass Sie finden, was Sie suchen, ganz gleich, worum es sich handelt.«
Ich kann mich noch erinnern:
Es ist ein kalter, windiger Abend Anfang März 1953. Ich bin zehn Jahre alt und liege im Bett meines Schlafraums im Internat von Richmond, Virginia. Draußen auf der Treppe höre ich Schritte. Die Tür geht auf. Ich blicke dorthin und erkenne den Rektor. Hinter ihm steht ein anderer Mann, aber es ist kein Lehrer oder Angestellter. Er trägt einen Mantel und Lederhandschuhe und starrt mich an; dann lächelt er gezwungen.
»William«, sagt der Rektor, »dieser Gentleman möchte dich besuchen.« Vielsagend schaut er die beiden anderen Jungen an, mit denen ich das Zimmer teile. »Würdet ihr William bitte eine Weile allein lassen?«
Die Jungen verlassen das Zimmer, ebenso der Rektor. Der Mann schließt hinter ihnen die Tür. Er ist breitschultrig und hat ein hartes Gesicht; die Augen liegen tief in den Höhlen. Mit seinem kurzen Haar und den blank geputzten braunen Schuhen sieht er wie ein Soldat aus.
Lange Zeit sagt er gar nichts, als suche er vergeblich nach den richtigen Worten. »William«, beginnt er schließlich, »ich heiße Karl Branigan und war ein Kollege deines Vaters.«
Irgend etwas in seiner Stimme läßt mich aufhorchen, vielleicht die Art, wie er sagt, er ›war ein Kollege‹. Ich schaue ihn an und frage: »Was ist denn, Mr. Branigan?«
»William, ich fürchte, ich habe schlechte Nachrichten für dich. Es geht um deinen Vater … Er ist tot … Es tut mir leid … Aufrichtig leid.«
Der Fremde steht einfach nur da und sagt nichts mehr. Dann weine ich, aber der Mann kommt nicht zu mir, umarmt mich nicht und tröstet mich auch nicht auf andere Weise. Zum ersten Mal im Leben fühle ich mich vollkommen verlassen. Kurz darauf höre ich die Treppe unter seinen Schritten knarren, als er hinuntergeht. Draußen heult der Wind. Der Zweig eines Baums schlägt gegen die Mauer, knarrt und zerbricht schließlich. Ich rufe nach meinem Vater. Aber er antwortet nicht.
Dann schreie ich auf, ein gequälter Schrei aus meinem tiefsten Inneren, der mir noch heute in den Ohren gellt. Ein schrecklicher Schrei voller Angst. Ich kann die Tränen nicht mehr zurückhalten.
Ich erinnere mich, dass ich dann losgerannt bin. Ohne bestimmtes Ziel. Durch die alten Eichentüren aus der Schule hinaus, über die feuchten, kalten Felder Virginias. Der Kummer lag wie ein Stein in meinem Herzen, bis ich an den kalten Fluß kam, der durch die Felder strömte. Ich lag auf dem feuchten Gras, schlug die Hände vors Gesicht und wünschte mir meinen Vater zurück.
Erst später erfuhr ich Einzelheiten über den Tod meines Vaters. Man hat mir nie erzählt, wo genau er gestorben ist, nur, dass es irgendwo in Europa war und dass er Selbstmord begangen hatte. Der Leichnam hatte im Wasser gelegen – kein schöner Anblick für einen Jungen; deshalb durfte ich ihn nicht sehen. Es hatte zwar eine Beerdigung gegeben, aber keine weiteren Erklärungen oder Antworten auf meine Fragen. Niemand machte sich die Mühe, einem Kind etwas darüber zu erzählen. Doch Jahre später stiegen all die unbeantworteten Fragen wieder in mir auf. Warum? Wo? Es sollte sehr lange dauern, bis ich die Wahrheit erfuhr.
Vor zehn Tagen, als meine Mutter gestorben war, war ich in ihre Wohnung gegangen und hatte mich dem Ritual gewidmet, ihre Habseligkeiten durchzusehen. Ich hatte nicht geweint, weil ich sie kaum gekannt hatte. Wir hatten uns im Lauf der vielen Jahre so gut wie nie gesehen. Nur gelegentlich war eine Karte gekommen, in größeren Abständen auch mal ein Brief. Wir hatten uns nie nahegestanden – nicht so wie mein Vater und ich. Meine Eltern hatten sich kurz nach meiner Geburt scheiden lassen, und meine Mutter war ihren eigenen Weg gegangen. Sie hatte es meinem Vater überlassen, mich großzuziehen.
Sie war Tänzerin in einer Broadway-Show gewesen, und ich hatte immer vermutet, dass sie und mein Vater nie zusammengepaßt hatten.
Sie mietete sich eine kleine Wohnung in der Upper East Side in New York. Ich erinnere mich vor allem an die Unordnung, die dort herrschte. An das schmale, ungemachte Bett, an den einsamen Stuhl, an leere Ginflaschen und die Fläschchen mit der Haarblondierung. In einer Blechdose unter dem Bett verwahrte sie mit Gummibändern zusammengehaltene Briefe von alten Freunden und meinem Vater.
Hier fand ich auch dieses Schreiben von seiner Hand. Es war alt und verblichen, hatte Eselsohren an den Ecken und wirkte zerbrechlich wie ein Papyrus.
Er datierte vom 24. Januar 1953.
Liebe Rose,nur ein paar kurze Zeilen an Dich, damit Du weißt, dass es William gutgeht und er in der Schule gut vorankommt. Ich werde eine Zeitlang unterwegs sein. Falls mir etwas zustößt, sollst Du wissen, dass (wie immer) genug Geld auf meinem Konto ist, um Euch beide durchzubringen. Zusammen mit meiner Berufsversicherung. Wir leben in gefährlichen Zeiten. Ich habe gehört, dass sie wegen der russischen Kriegsdrohungen sogar damit anfangen, Luftschutzbunker am Broadway zu bauen.
Mir geht es gut, und ich hoffe, Dir ebenfalls. Noch eins, falls mir etwas passiert: Ich wäre Dir dankbar, wenn Du im Haus nach dem Rechten sehen würdest. Solltest Du irgendwelche Unterlagen im Arbeitszimmer oder am üblichen Platz im Keller finden, dann tue mir doch bitte den Gefallen und gib sie an das Büro in Washington weiter. Würdest Du das für mich tun?
Jake.
Ich las die anderen Briefe aus reiner Neugier. Viel stand nicht drin. Einige kurze Notizen stammten von anderen Männern. Jemand, der Mutter in der Tanzgruppe gesehen hatte und dem ihre Beine gefielen, hatte ihr den Zettel hinter die Bühne geschickt, um sie zum Essen einzuladen. Es waren auch einige Briefe von meinem Vater dabei, aber in keinem fand ich auch nur eine Andeutung, dass sie sich geliebt hätten.
Aber ich mußte immer an diesen einen Satz denken, in dem von den Unterlagen die Rede gewesen war. Das Haus meines Vaters gehörte jetzt mir. Es war ein altes Holzhaus, das er gekauft hatte, als er mit meiner Mutter nach Washington gezogen war. Nach seinem Tod verfiel es, bis ich alt genug war, es wieder aufzupolieren. Ich habe Jahre dafür gebraucht. Früher hatte ein alter Diebold-Safe im Arbeitszimmer meines Vaters gestanden; der Safe war im Boden eingelassen, und er verwahrte Dokumente und Unterlagen darin auf. Aber ich erinnere mich, dass er immer sagte, er traue keinem Safe, weil jemand, der entschlossen oder gerissen genug war, so ein Ding leicht knacken könnte. Der Safe war schon lange fort und das Zimmer renoviert. Aber ich kannte keinen anderen Ort, an dem mein Vater etwas hätte verstecken können.
An dem Tag, als ich die Angelegenheiten meiner Mutter geregelt hatte, stieg ich in den Keller hinunter. Ich ging selten dorthin. Im Keller verwahrte ich nur uraltes Zeug auf, Dinge, die meinen Eltern gehört hatten, Kisten voller Sachen, die sich im Lauf der Jahre angesammelt hatten und die ich immer schon hatte entsorgen wollen. Ich dachte an den Safe im Arbeitszimmer, wuchtete die Kartons und Holzkisten herum und überprüfte den Betonboden.
Nichts.
Dann schaute ich mir die Wände genauer an.
Es dauerte ziemlich lange, bis ich zwei lockere Ziegelsteine in der Wand hoch über der Kellertür fand.
Ich weiß noch, dass mein Herz vor Aufregung ein bißchen schneller schlug, als ich mich fragte, ob ich fündig werden würde. Vielleicht hatte meine Mutter längst getan, worum mein Vater sie damals gebeten hatte, oder aber seine Wünsche wie so oft ignoriert. Ich entfernte die Ziegelsteine aus dem Mauerwerk. Dahinter verbarg sich eine tiefe Nische. Ich sah den großen, gelben Schreibblock zwischen den Deckeln eines Pappordners. Er war verschlissen und verblaßt.
Manchmal reicht ein Ereignis aus, das ganze Leben zu verändern. Zum Beispiel eine Hochzeit oder eine Scheidung. Oder jemand am anderen Ende des Telefons teilt einem mit, dass ein nahestehendes Familienmitglied gestorben ist.
Mit dem, was ich hinter den Ziegelsteinen in diesem Keller fand, hatte ich allerdings ganz und gar nicht gerechnet.
Ich nahm den gelben Notizblock mit nach oben und las ihn durch. Zwei Seiten waren in der Handschrift meines Vaters mit blauer Tinte beschrieben.
Es standen vier Namen da, einige Daten, ein paar Details und flüchtig hingeworfene Notizen, als hätte er versucht, etwas auszuarbeiten. Aber nichts ergab viel Sinn. Und dann war da ein Kodename: Operation Schneewolf.
Mein Vater hatte für die CIA gearbeitet. Er war sein Leben lang Militär gewesen und hatte während des Krieges für das OSS gearbeitet, den Militärgeheimdienst. Damals war mein Vater hinter den deutschen Linien eingesetzt worden. Soviel wußte ich. Aber das war auch alles. Bis ich diesen gelben Notizblock fand.
Ich saß lange regungslos da und versuchte, aus der ganzen Angelegenheit schlau zu werden. Mein Herz raste, und meine Gedanken überschlugen sich, bis mir ein Datum auf dem Block auffiel. Da endlich klickte es bei mir.
Ich fuhr zum Arlington-Friedhof. Lange stand ich vor dem Grab meines Vaters und betrachtete die Inschrift.
Jakob Massey3. Januar 1912 – 20. Februar 1952
Ich starrte auf die Buchstaben und Zahlen, bis mir die Augen brannten. Dann verließ ich den Friedhof, machte Kopien von den beschriebenen Seiten und schickte die Originale in einem versiegelten Umschlag an meinen Anwalt.
Eine Stunde später rief ich Bob Vitali an. Er arbeitete für die CIA in Langley.
»Bill, das ist ja eine Ewigkeit her«, begrüßte Vitali mich liebenswürdig. »Halt, nichts verraten. Es geht um das Ehemaligentreffen des Internats, richtig? Warum machen die das bloß immer, wo man doch alles tut, um diese Zeit möglichst zu vergessen? Den Haufen Geld, den mich dieses Internat in Richmond an Honoraren für meinen Seelenklempner gekostet hat …«
Ich erzählte ihm, was ich gefunden hatte und wie ich darauf gestoßen war, ließ jedoch nichts über den Inhalt verlauten.
»Na und? Du hast irgendwelche vergessenen Unterlagen von deinem alten Herrn aufgestöbert. Klar, er hat für die CIA gearbeitet, aber das ist vierzig Jahre her. Tu dir selbst einen Gefallen und verbrenn die Papiere.«
»Ich glaube, jemand sollte herkommen und einen Blick darauf werfen.«
»Soll das ein Witz sein? Rufst du etwa deswegen an?«
»Bob, ich glaube wirklich, dass jemand kommen und es sich ansehen sollte.«
Vitali seufzte. Ich konnte mir vorstellen, wie er an seinem Schreibtisch saß und ungeduldig auf die Uhr schaute.
»Na gut, um was geht es? Gib mir schon mal ein paar Einzelheiten, mit denen ich was anfangen kann. Dann hör ’ ich mich um und finde heraus, ob du auf etwas Wichtiges gestoßen bist. Aber wahrscheinlich ist es längst freigegeben. Du machst bestimmt Lärm um nichts.«
»Bob, bitte komm her und sieh es dir an!« wiederholte ich eindringlich.
»Bill«, erwiderte Vitali ungeduldig, »ich hab’ nicht die Zeit, zu dir rauszufahren. Meine Güte, verrate mir doch etwas. Irgendwas, womit ich was anfangen kann.«
»Operation Schneewolf.«
»Was soll das sein?«
»Das steht ganz oben auf der ersten Seite des Notizblocks.«
»Nie davon gehört. Sonst noch was?«
»Komm her und sieh es dir an.«
Vitali seufzte. »Bill, ich sag’ dir, was ich unternehme: Ich werde einen der alten Hasen hier fragen, einen aus dem Archiv. Mal sehen, was die ausspucken, und ob es bei ihnen klingelt, wenn sie Schneewolf hören.«
Ich hörte die Ungeduld in seiner Stimme. »Tut mir leid, da kommt ein Anruf für mich. Ich rufe zurück. Alles Gute, alter Junge.«
Die Verbindung wurde unterbrochen.
Ich stand auf, ging in die Küche und machte mir einen Kaffee. Vermutlich habe ich lange, mit heftig pochendem Herzen dort gesessen und darüber nachgedacht, was mein Fund bedeuten könnte. Ich hatte Vitali nicht alles erzählen wollen, weil ich neugierig darauf war, was man in Langley wußte. Ich war wie elektrisiert, hatte aber keine Ahnung, was ich als nächstes unternehmen sollte.
Etwa eine Stunde später hörte ich das Quietschen von Autoreifen vor dem Haus. Ich blickte aus dem Fenster und sah zwei schwarze Limousinen in der Auffahrt. Ein halbes Dutzend Männer sprangen aus den Fahrzeugen, unter ihnen Bob Vitali.
Er war blaß um die Nase, und als ich die Tür öffnete, fragte er drängend: »Darf ich reinkommen? Wir müssen uns unterhalten.«
Nur Vitali und noch ein Mann betraten das Haus. Die übrigen warteten auf der Veranda. Vitalis Begleiter war groß, etwa sechzig Jahre alt und hatte gepflegtes, silbergraues Haar. Er wirkte arrogant, sagte kein Wort und lächelte auch nicht. »Bill«, sagte Vitali schließlich, »du kannst dir sicher denken, dass es um die Unterlagen geht, die du gefunden hast …«
Sein Begleiter schnitt ihm das Wort ab. »Mr. Massey, mein Name ist Donahue. Ich bin Abteilungsleiter beim CIA. Bob hat mir berichtet, was Sie ihm mitgeteilt haben. Darf ich bitte diese Papiere sehen, die Sie am Telefon erwähnten?«
Ich reichte ihm die Unterlagen.
Er wurde blaß. »Das sind ja Kopien!«
Donahues Tonfall forderte eine Erklärung. Ich schaute ihn an. »Die Originale befinden sich an einem sicheren Ort.«
Ein Muskel zuckte in Donahues Gesicht, das plötzlich sehr hart aussah. Er warf Vitali einen vielsagenden Blick zu, bevor er langsam und gründlich die Fotokopien durchlas. Schließlich setzte er sich. Seine Miene wirkte besorgt.
»Mr. Massey, diese Unterlagen sind Eigentum der CIA.«
»Nein. Sie gehörten meinem Vater. Der hat zwar für die CIA gearbeitet, war aber nicht deren Eigentum.«
Donahues Stimme klang entschlossen. »Mr. Massey, über diesen Punkt können wir gern den ganzen Abend streiten, aber diese Unterlagen, die jetzt in Ihrem Besitz sind, unterliegen immer noch der höchsten Geheimhaltungsstufe. Insofern sind sie Eigentum der Regierung.«
»Es ist schon über vierzig Jahre her.«
»Das spielt keine Rolle … Die Klassifizierung ist nach wie vor gültig. Gerade diese Unterlagen werden niemals zur Veröffentlichung freigegeben. Die Operation, von der in diesen Papieren die Rede ist, unterlag strengster Geheimhaltung und war hochbrisant. Mehr als Sie sich vorstellen können. Bitte, geben Sie mir die Originalunterlagen …«
»Ich schlage Ihnen einen Handel vor.«
»Kein Handel, Massey. Die Papiere«, forderte Donahue.
Ich war fest entschlossen, mich nicht einschüchtern zu lassen. »Sie sollten mir lieber zuhören, Donahue. Mein Vater ist vor mehr als vierzig Jahren gestorben. Ich habe nie erfahren, wo, wann und wie er tatsächlich ums Leben gekommen ist. Ich will Antworten. Zum Beispiel will ich genau wissen, worum es sich bei dieser Operation Schneewolf gehandelt hat. Er war daran beteiligt.«
»Kommt nicht in Frage. Tut mir leid.«
»Ich bin Journalist. Ich werde dafür sorgen, dass diese Unterlagen veröffentlicht werden. Ich werde einen Artikel schreiben und herausfinden, ob jemand, der für die CIA gearbeitet hat, sich daran erinnert. Sie werden überrascht sein, was alles ans Tageslicht kommt.«
Donahue wurde wieder blaß. »Ich versichere Ihnen, keine einzige Zeitung in diesem Land wird auch nur eine Zeile veröffentlichen, die Sie über diese Sache schreiben. Die CIA würde es nicht zulassen. Ihre Recherchen würden Sie ohnehin nicht weit bringen.«
Donahue blies sich ganz schön auf.
Ich erwiderte ungerührt seinen durchdringenden Blick. »Das nennt man also Demokratie. Vielleicht kann ich meine Artikel wirklich nicht in den Staaten veröffentlichen«, fuhr ich fort. »Aber es gibt noch genügend Zeitungen im Ausland, die nicht unter Ihrer Fuchtel stehen.«
Donahue runzelte die Stirn. Ich konnte sehen, dass er angestrengt nachdachte.
»Was wollen Sie, Massey?«
»Antworten. Ich will die Wahrheit wissen. Und ich will Leute treffen, die zusammen mit meinem Vater auf dieser Mission waren. Jeden, der noch lebt.«
»Das ist unmöglich. Sie sind alle tot.«
»Alle bestimmt nicht. Irgend jemand wird noch leben. Eine dieser vier Personen, deren Namen im Notizblock stehen. Alex Slanski. Anna Chorjowa. Henri Lebel. Irina Dezowa. Wer immer das sein mag. Ich will keinen Bericht aus zweiter Hand. Sie könnten mir alles mögliche auf die Nase binden. Ich will Beweise. Beweise aus Fleisch und Blut. Ich will mit jemandem sprechen, der meinen Vater kannte, der über die Operation informiert war und weiß, wie er wirklich gestorben ist. Und ich will erfahren«, fuhr ich entschlossen fort, »was aus seinem Leichnam geworden ist.«
Diesmal wurde Donahue so weiß wie die Wand. »Ihr Vater wurde in Washington begraben.«
»Das ist eine Lüge, und das wissen Sie ganz genau. Werfen Sie doch einen Blick auf die Kopien, Donahue. Auf der letzten Seite steht ein Datum in der Handschrift meines Vaters. Es ist der 20. Februar 1953. Ihre Leute haben mir weisgemacht, er wäre zu dieser Zeit irgendwo in Europa gestorben. Und das ist auch der Todestag auf seinem Grabstein – 20. Februar. Ich mag ja dumm sein, aber tote Männer schreiben keine Notizen, außer vielleicht Lazarus. Und selbst ein Lazarus kann nicht an zwei Orten gleichzeitig sein. Die CIA hat behauptet, mein Vater wäre im Ausland gestorben, aber er war an diesem Tag hier, in diesem Haus. Wissen Sie was? Ich glaube nicht einmal, dass Sie meinen Vater begraben haben. Sie hatten gar keinen Leichnam. Deshalb durfte ich ihn auch nie sehen, und deshalb haben Sie mir den Mist erzählt, dass er zu lange im Wasser gelegen habe. Ich war ein Kind und habe keine Fragen gestellt, als man mir damals nicht erlaubte, den Leichnam zu sehen. Aber jetzt stelle ich Fragen. Mein Vater hat keinen Selbstmord begangen. Er hat sich nicht ertränkt. Er ist bei dieser Operation Schneewolf gestorben, habe ich recht?«
Donahue lächelte gequält. »Mr. Massey, ich glaube, Sie schießen mit Ihren wüsten Spekulationen ziemlich weit über das Ziel hinaus.«
»Dann sollten wir vielleicht mit dem Spekulieren aufhören. Ich gehe zu meinem Anwalt und beauftrage ihn, die Exhumierung des Leichnams zu beantragen. Wenn der Sarg geöffnet wird, werde ich bestimmt nicht meinen Vater darin finden. Und dann stecken Sie wirklich bis zum Hals in Schwierigkeiten, Donahue. Ich werde Sie und Ihre Vorgesetzten vor den Richter zerren und eine öffentliche Erklärung von Ihnen erzwingen.«
Donahue antwortete nicht, sondern lief rot an. Entweder war er zutiefst verlegen, oder er war nicht gewohnt, dass man in diesem Ton mit ihm redete. Er warf einen kurzen, hilfesuchenden Blick zu Vitali hinüber, doch Bob saß nur da, als würde er unter Schock stehen. Entweder war er sprachlos oder hatte Angst vor Donahue – oder beides.
Schließlich stand Donahue auf. Er sah mich an, als hätte er mich am liebsten verprügelt. »Ich möchte, dass Sie eins wissen, Massey. Wenn Sie tun, was Sie sagen, werden Sie eine Menge Ärger bekommen.«
»Von wem?«
Donahue antwortete nicht, starrte mich einfach nur an.
Ich erwiderte den Blick und versuchte es dann auf die etwas sanftere Tour. »Welchen Schaden kann es denn anrichten, wenn Sie mir verraten, was wirklich mit meinem Vater geschehen ist? Ich bin bereit, die Unterlagen zurückzugeben. Und wenn die ganze Sache tatsächlich so ungeheuer geheim war, unterschreibe ich, was Sie wollen, und garantiere damit mein Schweigen. Aber drohen Sie mir nicht, Donahue. Es hat mich vierzig Jahre Ärger und Schmerz gekostet, nicht die Wahrheit über meinen Vater zu kennen, sondern nur gesagt zu bekommen, er habe irgendwo Selbstmord begangen.« Ich blickte Donahue entschlossen an. »Glauben Sie mir eins: Wenn ich die Wahrheit nicht erfahre, werde ich tun, was ich gesagt habe.«
Donahue seufzte, schaute mich ärgerlich an und preßte die Lippen zusammen. »Kann ich Ihr Telefon benutzen?«
»Es steht im Flur. Sie sind daran vorbeigegangen, als Sie hereingekommen sind.«
»Ich muß Ihnen sagen, dass die ganze Angelegenheit jetzt nicht mehr meiner Entscheidungsgewalt untersteht«, erklärte Donahue. »Ich werde einen Anruf tätigen, Mr. Massey. Einen sehr wichtigen Anruf. Die Person, mit der ich spreche, wird jemand anderen anrufen. Diese beiden Leute werden sich einigen müssen, bevor Ihre Forderungen erfüllt werden können.«
Ich blickte ihm fest ins Gesicht. »Wen rufen Sie an?«
»Den Präsidenten der Vereinigten Staaten.«
Die nächste Frage stellte sich wie von selbst. »Und wen ruft er an?«
Donahue warf einen kurzen Seitenblick auf Vitali und schaute dann wieder mich an.
»Den russischen Präsidenten.«
Es hatte aufgehört zu regnen. Die wärmenden Sonnenstrahlen schienen zwischen den aufgerissenen Wolken hindurch und ließen die goldenen zwiebelförmigen Kuppeln des Klosters von Nowodewitschi erstrahlen.
Ich blickte auf die beiden schlichten Gräber, auf das meines Vaters und die Grabstätte daneben, mit dem verwitterten Grabstein.
Es stand kein Name und keine Inschrift darauf. Es war ein Stein wie der meines Vaters.
Auf sämtlichen russischen Friedhöfen stehen kleine Bänke vor den Gräbern. Dort setzen sich die Verwandten mit einer Flasche Wodka hin und reden mit ihren Verstorbenen. Aber vor diesen Gräbern standen keine Bänke. Sie waren vergessen, von Unkraut und Gras überwuchert.
Das zweite Grab beschäftigte mich, aber ich wußte, dass es keinen Sinn hatte, lange darüber zu grübeln. Obwohl ich natürlich ständig daran denken mußte und mir instinktiv klar war, dass dieses zweite, schlichte, anonyme Grab irgend etwas mit dem Tod meines Vaters zu tun haben mußte.
Ich wußte so wenig, und es gab so viel, was ich noch erfahren mußte. Hoffentlich würde Anna Chorjowa es mir erzählen.
Ich schlenderte zurück zu den Friedhofstoren, winkte ein Taxi heran und fuhr durch die heißen, belebten Straßen nach Moskau zurück in mein Hotel. Dort wartete ich, legte mich aufs Bett und schloß die Augen. Aber ich schlief nicht ein.
Nachdem es zu regnen aufgehört hatte, senkte sich die Hitze drückend auf die Stadt.
Ich hatte länger als vierzig Jahre darauf gewartet, das Geheimnis meines Vaters zu erfahren.
Da zählten ein paar Stunden gar nichts.
Die Worobjowije Gory, die sogenannten Spatzenhügel, lagen im strahlenden Sonnenschein. Im Garten des großen Holzhauses blühten Blumen, und man konnte von dort aus die Moskwa sehen.
Es war eine alte Villa aus der Zarenzeit, ein großes, geräumiges Gebäude mit einem weißen Holzzaun, Fensterläden aus Holz und Blumenkästen davor. Das Haus lag ein Stück von der Straße entfernt.
Der Taxifahrer setzte mich vor dem Tor ab. An dem Wachhäuschen warteten zwei Männer in Zivilkleidung. Es waren israelische Sicherheitsbeamte. Der eine kontrollierte meinen Ausweis, der andere den Strauß weißer Orchideen, den ich mitgebracht hatte. Bevor der zweite Wachmann mir das Tor öffnete, rief er in der Villa an. Ich ging zum Haus.
Zu meiner Überraschung öffnete mir eine junge Frau die Tür, als ich klingelte. Sie trug Jeans und Pullover und war Anfang Zwanzig, groß, schlank und sonnengebräunt.
Sie lächelte herzlich und begrüßte mich auf englisch. »Bitte, kommen Sie herein, Mr. Massey.«
Ich folgte ihr durch einen kühlen Marmorflur, in dem unsere Schritte laut hallten.
Sie führte mich auf die Rückseite der Villa. Der Garten beeindruckte mich durch seine Farbenpracht, doch im hellen Sonnenlicht wirkte das Haus ein wenig schäbig und heruntergekommen. An den Mauern wucherte Unkraut, und die Wände hätten einen neuen Anstrich gut gebrauchen können.
Während ich dem jungen Mädchen über den Hinterhof folgte, sah ich eine ältere Dame, die an einem Tisch saß. Sie war elegant, und ihr schön proportioniertes, wie gemeißelt wirkendes Gesicht ließ kaum einen Schluß auf ihr Alter zu.
Obgleich ihr Haar ergraut war, war die Frau bemerkenswert attraktiv. Die hohen Wangenknochen verliehen ihren Zügen einen slawischen Einschlag. Sie trug ein schlichtes, schwarzes Kleid, das sich um ihre schlanke Gestalt schmiegte, eine dunkle Brille und einen weißen Schal.
Sie blickte mich lange an, bevor sie aufstand und mir die Hand reichte.
»Es freut mich, Sie kennenzulernen, Mr. Massey.«
Ich schüttelte ihr die Hand und reichte ihr die Orchideen.
»Man hat mir gesagt, dass alle Russen Blumen lieben.«
Sie lächelte und roch an den Orchideen. »Wie nett von Ihnen. Möchten sie etwas trinken? Kaffee? Oder einen Brandy?«
»Einen Brandy, bitte.«
»Russischen Brandy? Oder ist der für euch Amerikaner zu stark?«
»Ganz und gar nicht. Vielen Dank.«
Das Mädchen hatte neben der Frau gewartet. Jetzt nahm sie eine Flasche von einem Tablett und schenkte mir ein Glas ein.
Die Frau legte die Orchideen auf den Kaffeetisch. »Danke, Rachel«, sagte sie. »Du kannst uns jetzt allein lassen.« Als das Mädchen gegangen war, erklärte die Frau: »Das ist meine Enkelin. Sie hat mich nach Moskau begleitet.« Als müßte sie die Anwesenheit ihrer Enkeltochter rechtfertigen. Dann lächelte sie wieder. »Ich bin Anna Chorjowa, aber das wissen Sie zweifellos.«
Sie bot mir aus einer Packung, die auf dem Tisch lag, eine Zigarette an, und ich nahm an. Sie steckte sich selbst eine zwischen die Lippen, gab uns beiden Feuer und betrachtete dann den Ausblick. Sie spürte mit Sicherheit, dass ich sie anstarrte, aber vermutlich war sie an die Blicke von Männern gewöhnt.
Sie lächelte, als sie mich wieder anschaute. »Wie ich gehört habe, waren Sie sehr hartnäckig, Mr. Massey.«
»Vermutlich bringt das der Beruf mit sich. Ich bin Journalist.«
Sie lachte. Es war ein offenes Lachen. »Dann sagen Sie mir mal, was Sie von mir wissen.«
Ich trank einen Schluck Brandy. »Bis vor einer Woche wußte ich fast gar nichts. Erst dann erfuhr ich, dass Sie noch leben und in Israel wohnen.«
»Ist das alles?«
»Oh, es gibt noch eine Menge mehr, das versichere ich Ihnen.«
Das schien sie zu amüsieren. »Erzählen Sie weiter.«
»Sie sind vor über vierzig Jahren aus einem sowjetischen Gefangenenlager entkommen, nachdem man Sie zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt hatte. Sie sind die einzige Überlebende einer streng geheimen CIA-Operation mit Kodenamen Schneewolf.«
»Wie ich sehe, haben Ihre Freunde in Langley Sie eingeweiht.« Sie lächelte. »Reden Sie weiter.«
Ich lehnte mich zurück und schaute sie an. »In Langley hat man mir so gut wie nichts erzählt. Ich glaube, das wollte man Ihnen überlassen. Man hat mir nur gesagt, dass mein Vater nicht in Washington begraben ist, sondern in einem anonymen Grab in Moskau. Er ist im Dienst für sein Vaterland gefallen, und Sie waren dabei, als es passierte.«
Sie forderte mich mit einem Nicken auf fortzufahren.
»Ich habe Unterlagen gefunden. Alte Papiere aus dem Besitz meines Vaters.«
»Das hat man mir erzählt.«
»Auf den Seiten standen vier Namen, die mehrmals aufgetaucht sind. Ihrer war darunter und noch drei andere: Alex Slanski. Henri Lebel. Irina Dezowa. Mein Vater hatte noch einen Satz darunter geschrieben, der letzte Satz auf den Seiten. Er lautete: ›Wenn sie gefaßt werden, stehe Gott uns allen bei.‹ Ich habe gehofft, dass Sie mir weiterhelfen können.«
Lange Zeit sagte sie nichts, betrachtete mich durch ihre dunklen Brillengläser. Dann nahm sie die Brille ab, und ich sah ihre Augen. Sie waren groß, dunkelbraun und sehr schön.
»Sagt Ihnen dieser Satz irgend etwas?«
Sie zögerte. »Ja, er bedeutet etwas für mich«, erwiderte sie dann rätselhaft. Sie schwieg erneut einige Augenblicke und wandte den Kopf ab. Als sie mich dann wieder anschaute, fragte sie: »Was wissen Sie noch?«
Ich lehnte mich im Stuhl zurück. »Möchten Sie den Aktenordner sehen, den ich gefunden habe?«
Anna Chorjowa nickte. Ich zog ein einzelnes, fotokopiertes Blatt aus meiner Tasche und reichte es ihr.
Sie las es kurz und legte es dann langsam auf den Tisch.
Ich warf einen flüchtigen Blick auf das Papier. Mittlerweile hatte ich die Worte so oft gelesen, dass ich sie auswendig wußte.
OPERATION SCHNEEWOLF:
SICHERHEITSDIENST, CIA, ABTEILUNG
SOWJETUNION
HÖCHSTE PRIORITÄT. ALLE AKTENEXEMPLARE UND
NOTIZEN BETREFFEND DIESER OPERATION MÜSSEN
NACH GEBRAUCH VERNICHTET WERDEN.
WIEDERHOLE: VERNICHTET WERDEN.
HÖCHSTE SICHERHEITSSTUFE.
WIEDERHOLE: HÖCHSTE SICHERHEITSSTUFE.
Ihr Gesicht zeigte keine Reaktion, als sie mich wieder anschaute.
»Als Sie das und die anderen Seiten gelesen haben und erfuhren, dass Ihr Vater keinen Selbstmord begangen hat … und auch nicht an dem Tag gestorben ist, den man Ihnen genannt hat … ist Ihnen klargeworden, dass vielleicht noch mehr hinter seinem Tod steckte. Da haben Sie angefangen, nach Antworten zu suchen?«
»Man hat mir einen Handel angeboten. Falls ich die Originalseiten übergebe, bekomme ich ein paar Antworten, sagte man mir. Und dann wäre ich dabei, wenn man meinem Vater eine angemessene Beisetzung gewährt. Aber man hat mir auch mitgeteilt, dass die Angelegenheit noch immer der höchsten Geheimhaltungsstufe unterliegt und dass ich eine Erklärung unterschreiben müßte, in der ich mich verpflichte, diese Geheimhaltung zu respektieren.«
Sie drückte die Zigarette im Aschenbecher aus. »Ja, ich kenne Ihre Freunde in Langley, Mr. Massey«, sagte sie, als würde sie sich insgeheim darüber amüsieren.
»Also wissen Sie auch, dass man mir sagte, die Entscheidung läge bei Ihnen, ob Sie mir erzählen, was ich wissen will.«
»Und was wollen Sie wissen?«
»Die Wahrheit über den Tod meines Vaters. Die reine Wahrheit über Schneewolf und weshalb mein Vater mitten im kalten Krieg in einem Grab in Moskau endete.«
Sie antwortete nicht, sondern stand auf und ging zur Veranda.
Ich beugte mich im Stuhl vor. »So wie ich es sehe, hatte mein Vater einen höchst geheimen Auftrag, über den die Leute selbst heute nur sehr zögernd und sehr ungern sprechen. Damit meine ich nicht bloß ein einfaches Geheimnis. Ich rede über etwas vollkommen Außergewöhnliches.«
»Warum außergewöhnlich?«
»Weil die Leute, mit denen ich in Langley darüber gesprochen habe, selbst heute, vierzig Jahre später, noch die Wahrheit verheimlichen wollen. Als mein Vater an dieser Operation teilnahm, standen die Russen und Amerikaner kurz davor, sich gegenseitig auszulöschen. Und Sie sind die einzige noch lebende Person, die mir helfen kann. Die einzige, die vielleicht weiß, was meinem Vater zugestoßen ist.« Ich schaute sie an. »Habe ich recht?«
Sie schwieg.
»Darf ich Ihnen etwas erzählen?« fuhr ich fort. «Ich habe meinen Vater vor fast vier Jahrzehnten verloren. Vierzig Jahre, in denen ich keinen Vater hatte, mit dem ich reden konnte und von dem ich geliebt wurde. Es hat sehr lange gedauert, bis er allmählich zu einer sehnsüchtigen Erinnerung verblaßte. Ich mußte mit der Lüge leben, dass mein Vater angeblich Selbstmord begangen hat. Und Sie – Sie wissen, wie und warum er wirklich gestorben ist. Und deshalb glaube ich, dass Sie mir eine Erklärung schulden.«
Sie antwortete nicht, betrachtete mich nur nachdenklich.
»Ich habe auch eine Frage an Sie. Warum wollten Sie mich ausgerechnet in Moskau treffen, nirgendwo sonst? Man hat mir erzählt, dass Sie aus diesem Land geflohen sind. Warum sind Sie zurückgekommen?«
Anna Chorjowa dachte einen Augenblick nach. »Vermutlich ist die schlichte Wahrheit, dass ich auch sehr gern auf die Beerdigung Ihres Vaters gegangen wäre, Mr. Massey, aber ich hielt es für Ihre Privatangelegenheit. Vielleicht war es das zweitbeste, hierherzukommen.« Sie zögerte. »Außerdem habe ich sein Grab niemals gesehen, und das wollte ich immer schon.«
»Das zweite Grab, das neben dem meines Vaters, hat den gleichen anonymen Grabstein. Wer liegt in diesem Grab?«
Ein Ausdruck der Trauer huschte über ihr Gesicht. »Jemand, der sehr tapfer war«, sagte sie. »Ein außerordentlich bemerkenswerter Mensch.«
»Wer?«
Sie ließ ihren Blick über das Panorama der Stadt gleiten, schaute auf die roten Mauern des Kreml, als wollte sie einen Entschluß fassen, und drehte sich schließlich zu mir herum. Plötzlich schien ihr Blick weicher zu werden, und sie schaute kurz auf die Blumen, die auf dem Tisch standen.
»Wissen Sie, dass Sie Ihrem Vater sehr ähnlich sehen? Er war ein guter, ein sehr guter Mann. Und alles, was Sie gesagt haben, stimmt.« Sie machte eine kleine Pause. »Sie haben recht. Der Schmerz, den Sie ertragen mußten, und das Schweigen verdienen eine Erklärung. Deshalb bin ich hier. Verraten Sie mir, was Sie über Josef Stalin wissen, Mr. Massey?«
Diese Frage kam völlig unerwartet und überrumpelte mich. Ich betrachtete Anna einen Moment lang und zuckte dann mit den Schultern. »Nicht mehr als die meisten anderen. Für einige Menschen war er wohl eine Art Gott. Für andere der Teufel persönlich. Das hing wohl davon ab, auf welcher Seite des Zauns man gestanden hat. Auf jeden Fall war er einer der großen Despoten unseres Jahrhunderts. Angeblich hat er genau so viele Menschen auf dem Gewissen wie Hitler. Er ist ungefähr acht Jahre nach Kriegsende an einer Gehirnblutung gestorben.«
Anna Chorjowa schüttelte entschieden den Kopf. »Dreiundzwanzig Millionen Tote. Nicht eingerechnet diejenigen, die wegen seiner Unfähigkeit im Zweiten Weltkrieg gestorben sind. Er hat dreiundzwanzig Millionen Landsleute ermordet. Männer, Frauen, Kinder. Er hat sie abgeschlachtet, sie erschießen lassen oder in Lager gesteckt, die schlimmer waren, als die Nazis sie jemals hätten ersinnen können, ausgeheckt von dem grausamsten Mann, den die Welt jemals gesehen hat.«
Ich wich ein wenig zurück. Die Heftigkeit in ihrer Stimme überraschte mich. »Ich verstehe nicht. Was hat das mit unserem Thema zu tun?«
»Es ist unser Thema. Stalin ist gestorben, sicher, aber nicht so, wie es in den Geschichtsbüchern steht.«
Ich war wie vom Donner gerührt. Anna Chorjowas Gesicht wirkte todernst. Schließlich sagte sie: »Ich denke, die Geschichte, die ich Ihnen erzähle, reicht lange zurück, bis in die Schweiz. Dort hat sie angefangen.«
Sie lächelte plötzlich. »Und wissen Sie was? Sie sind der erste Mensch seit vierzig Jahren, dem ich sie erzählen werde.«
DIE VERGANGENHEIT
ERSTER TEIL1952
2. KAPITEL
LuzernSchweiz11. Dezember
Ganz Europa vernahm in diesem Jahr nur Katastrophenmeldungen.
In Deutschland wurde die Vergangenheit wieder aus der Versenkung geholt, als in Nürnberg das Kriegsverbrechertribunal den Prozeß um das Massaker in Katijn begann. Viertausend Leichen waren in der Nähe dieser kleinen polnischen Stadt ausgegraben worden, alle gefesselt und mit Kleinkaliberpistolen erschossen. Es handelte sich um die grausigen Überreste der ehemaligen Führungsriege der polnischen Armee.
Im selben Jahr sah Frankreich sich einer Großoffensive der Viet Minh gegenüber, in Korea tobte ebenfalls ein blutiger Krieg, und – zurück in Europa – wurde zwischen Westberlin und der Sowjetischen Besatzungszone, deren Gebiet die Stadt vollkommen umschloß, der eiserne Vorhang heruntergelassen. Es war das endgültige Zeichen des Kreml, dass es keinen Frieden geben würde.
Was noch? In Großbritannien waren immer noch die Kriegsrationierungen gültig, Eva Perón starb, der Republikaner Dwight D. Eisenhower schlug seinen Rivalen der Demokratischen Partei, Adlai Stevenson, bei den Präsidentschaftswahlen in Amerika, und in Hollywood erlebte die Welt einen Lichtblick in diesem ansonsten eher trüben Jahr: das Filmdebüt eines entzückenden blonden Starlets namens Marilyn Monroe.
Manfred Kass interessierte das alles nicht besonders, als er an diesem kalten Dezembermorgen durch die Wälder vor der alten Schweizer Stadt Luzern stapfte. Auch wenn er es nicht ahnte, sollte dies ein Tag von weitreichender Bedeutung werden.
Kass kam von der Nachtschicht in einer kleinen, aber florierenden Bäckerei, die noch in Familienbesitz war. Er hatte an diesem Samstagmorgen um sieben seine Schicht beendet, ging aber nicht nach Hause, sondern auf Kaninchenjagd. Das war ihm am Wochenende zur Gewohnheit geworden, weil seine Frau es haßte, wenn er nachts arbeitete. Hilda Kass war ein Morgenmuffel, und am Wochenende schlief sie gern aus. Also versuchte ihr Ehemann, jeden Samstagmorgen den Haussegen zu retten, und ging in den Gütschiwald westlich von Luzern, um Kaninchen zu schießen.
Es wurde schon hell, als Kass seinen alten schwarzen Opel auf der Straße vor dem Wald parkte. Er wickelte die einläufige Schrotflinte aus der Decke auf dem Rücksitz. Es war eine Mansten Kaliber 12, eine zwar veraltete, aber verläßliche Waffe. Kass stieg aus und schloß den Wagen ab. Er schob eine Patrone in den Lauf, klappte die Waffe aber nicht zu. Er steckte einen Karton Patronen in die Tasche seiner Jagdjacke und stapfte in den Wald.
Kass war zweiunddreißig, groß und unbeholfen. Er hatte einen schweren Gang und humpelte ein wenig. Plump war er immer schon gewesen, das Humpeln jedoch war eine unschöne Erinnerung an die Schlacht um Kiew elf Jahre zuvor. Obwohl von Geburt Deutscher, hatte Kass es nicht sonderlich gefallen, in Hitlers Wehrmacht einberufen zu werden. Er wollte vor dem Krieg nach Luzern emigrieren, wo der Onkel seiner Frau eine Bäckerei führte. Aber er hatte Deutschland zu spät verlassen, so wie er vieles in seinem Leben zu spät getan hatte.
»Vertrau mir, Hilda«, hatte Kass seiner Frau versichert, als man von einem bevorstehenden Krieg munkelte. Sie hatte vorgeschlagen, sich rasch in die Schweiz zu ihrer Familie abzusetzen. »Es gibt bestimmt keinen Krieg, Liebchen«, hatte er behauptet.
Zwei Tage später hatten Hitlers Armeen Polen angegriffen und damit den Zweiten Weltkrieg entfacht.
Es sollte nicht Kass’ einziger Irrtum bleiben. Vor allem war es ein Fehler gewesen, sich freiwillig an die Ostfront zu melden. Kass hatte diesen Schritt unternommen, weil die deutsche Armee wie ein Sturm durch die ukrainische Steppe fuhr, und weil die Russkis seiner Meinung nach schmutzige und dumme Bauern waren. Der Krieg gegen die Russen mußte ein Spaziergang sein.
In einem Punkt sollte er recht behalten. Die Russen, die Kass getroffen hatte, waren im allgemeinen arme Bauern. Aber sie waren auch aufopferungsvolle Kämpfer. Und der schlimmste Feind war der russische Winter. Er war so kalt, dass einem beim Wasserlassen der Urin gefror. Die baltischen und sibirischen Winde, die über die Steppe fegten, waren so eiskalt, dass die eigene Scheiße binnen Minuten steinhart gefroren war.
Als Kass das erste Mal seinen eigenen gefrorenen Haufen sah, hatte er gelacht. Doch das Lachen sollte ihm schnell vergehen. Denn als er mit seinem Bajonett in der eigenen Scheiße stocherte, wurde er von der Kugel eines Heckenschützen getroffen. Es war ein sauberer Schuß aus zweihundert Metern Entfernung, und er traf ihn in die rechte Seite seines nackten Hinterns. Der Russki, dem dieser Sonntagsschuß gelungen war, hatte sich bestimmt vor Lachen bepißt. Kass hatte nicht mehr gelacht, sondern nach drei Wochen Feldlazarett feststellen müssen, dass er beim Gehen nun ein Bein nachzog.
Manfred Kass war es gewohnt, dass er Fehler machte.
Doch der Fehler, den er an diesem Dezembermorgen im Wald vor Luzern begehen sollte, erwies sich als der größte seines Lebens.
Kass kannte die Wälder ziemlich gut. Er wußte, welche Wege wohin führten, und er wußte auch, wo man am besten Kaninchen schießen konnte. Aus dem Kaninchenfleisch bereitete er einen sehr schmackhaften Eintopf zu, der gut zu dem frischen mehligen Brot paßte, das er sechsmal in der Woche backen half. Der Gedanke ans Essen machte ihn hungrig, und er stapfte zielstrebig durch den Wald. Als er sich der Lichtung näherte, klappte er die Waffe zu.
Es herrschte noch schwacher, dunstiger Bodennebel, aber das Tageslicht wurde immer heller; es würde reichen, sauber zu zielen.
Manfred Kass kannte den gewaltsamen Tod. Er hatte ihn in den verschneiten Steppen Rußlands oft genug zu Gesicht bekommen. Aber was er hier sehen sollte, übertraf diese Erfahrungen bei weitem. Es kam ihm wie das Böse selbst vor.
Während Kass sich vorsichtig auf die Lichtung zu bewegte, hörte er Stimmen. Er blieb stehen und rieb sich das unrasierte Kinn. Er hatte zu dieser frühen Stunde noch nie jemanden im Wald getroffen, und die Stimmen weckten seine Neugier. Vielleicht war er ja über ein Liebespaar gestolpert, das nach einer durchtanzten Freitagnacht in Luzern in die Wälder gegangen war, um es hier miteinander zu treiben. So was kam gelegentlich vor. Aber heute hatte Kass keinen Wagen an der Straße gesehen, auch keine Fahrradspuren auf den Waldwegen. Als er aus dem Wald auf die Lichtung trat, starrte er fassungslos auf die Szene vor ihm und blieb wie angewurzelt stehen.
Ein Mann in Hut und dunklem Wintermantel stand mitten auf der Waldlichtung. Er hielt einen Revolver in der Hand. Was Kass daran schockiert war die Tatsache, dass der Mann mit der Waffe auf einen Mann und ein junges Mädchen zielte, die im feuchten Gras knieten. Ihre Gesichter waren leichenblaß, und man hatte ihnen Hände und Füße mit Stricken gefesselt.
Kass wich stolpernd zurück; sein Magen brannte, und ihm brach der kalte Schweiß aus. Der kniende Mann schluchzte herzerweichend. Er war in mittlerem Alter und hatte ein schrecklich mageres, krankhaft graues Gesicht. Kass bemerkte die dunklen Schwellungen unter seinen Augen und die Wunden an seinen Händen. Er mußte übel geschlagen worden sein.
Das Mädchen weinte ebenfalls, doch es hatte einen weißen Knebel im Mund, der hinter dem Kopf unter dem langen, dunklen Haar verknotet war. Kass schätzte sie auf höchstens zehn Jahre. Als er ihren verängstigten Gesichtsausdruck und das furchtsame Zittern ihres Körpers sah, hätte er sich am liebsten übergeben.
Unvermittelt schoß grelle Wut in ihm hoch. Ihm war nicht mehr kalt. Die beiden Gefesselten strahlten etwas Mitleiderregendes aus, wie reumütige Sünder. Sie knieten da, als warteten sie auf ihren Tod.
Kass betrachtete den stehenden Mann, der eine Waffe mit langem Schalldämpfer hielt; doch von der Stelle aus, an der Kass stand, konnte er nur das Profil des Mannes erkennen. Er sah eine rote Narbe, die vom linken Auge des Mannes bis zum Kinn reichte. Sie war so deutlich zu erkennen, als hätte jemand sie aufgemalt.
Der Bursche redete mit dem Mann, der im Gras kniete und zwischen seinen Schluchzern offensichtlich um Gnade flehte. Kass konnte die Worte nicht hören, doch er sah, dass der Mann mit der Narbe gar nicht hinhörte. Plötzlich begriff er, dass er Zeuge einer Hinrichtung war.
Es geschah so schnell, dass Kass nicht einmal reagieren konnte.
Das Narbengesicht hob den Revolver, bis er auf gleicher Höhe mit der Stirn des Knienden war. Die Waffe gab ein heiseres Husten von sich. Eine Kugel schlug in den Schädel des Mannes ein, sein Körper zuckte heftig, und er kippte nach vorn aufs Gras.
Das Mädchen schrie hinter ihrem Knebel. Ihre Augen waren vor nackter Angst weit aufgerissen.
Kass schluckte. Auch er hätte am liebsten geschrien. Er spürte eisigen Schweiß über sein Gesicht rinnen. Sein Herz schien vor Entsetzen stehenzubleiben. Er wollte sich abwenden, weglaufen, nicht Zeuge dessen werden, was gleich passieren mußte … und dann wurde ihm zum ersten Mal bewußt, dass er ja eine Schrotflinte in der Hand hielt. Wenn er nichts unternahm, würde das Kind sterben.
Er sah, wie das Mädchen sich heftig wehrte, als der Mann ihr den Lauf der Waffe an den Kopf drückte und den Zeigefinger um den Abzug krümmte.
Kass hob unbeholfen seine Schrotflinte. »Halt!« rief er heiser.
Der narbengesichtige Mann drehte ihm sein brutales, hartes Gesicht zu und starrte Kass kalt an. Seine schmalen Lippen wirkten wie Schlitze. Sein Blick schien alles auf einmal in sich aufzunehmen, huschte kurz nach rechts und links, um die Umgegend zu überprüfen. Dann richtete der Mann die Augen wieder auf Kass und taxierte seinen Gegner. Kein Zeichen von Furcht lag in seinem Blick, als wäre auch er es gewohnt, dem Tod ins Auge zu sehen.
»Halt!« rief Kass mit bebender Stimme. »Werfen Sie die Waffe weg!«
Er hörte die blanke Furcht in seiner Stimme und schaffte es kaum noch, den Abzug zu drücken, als sein Gegner die Waffe herumschwang und ihr erneut dieses heisere Husten entlockte. Die Kugel schlug in Kass’ rechtes Jochbein ein, zertrümmerte Fleisch, Knochen und Zähne und schleuderte ihn gegen einen Baum. Die Schrotflinte flog ihm aus der Hand.
Während Kass vor Schmerz und Todesangst aufschrie, sah er, wie der Mann dem Mädchen in den Kopf schoß. Ihr Körper zuckte und brach zusammen.
Kass stolperte in die Deckung der Bäume zurück, aber der Mann rannte bereits auf ihn zu. Kass hatte nur einen Gedanken, als er hastig durchs Unterholz stürmte, ohne den Schmerz in seinem Kiefer zu spüren: Er wollte am Leben bleiben und hoffte, dass er es bis zu seinem Wagen schaffte.
Noch fünfzig Meter, dann konnte er den Opel zwischen den Bäumen sehen. Aber er hörte, wie der Mann ihm durch den Wald folgte.
Fünfzig lange Meter, die ihm wie tausend vorkamen. Kass rannte wie ein Besessener, preßte die Hand auf sein blutiges Gesicht. Sein Körper brannte, vorangepeitscht vom instinktiven Überlebenswillen, während in seinem Hirn immer wieder, wie in einem schrecklichen Alptraum, die fürchterlichen Bilder der Hinrichtung des Mannes und des jungen Mädchens aufflackerten und ihn noch mehr anspornten.
Bitte, lieber Gott!
Noch dreißig Meter.
Bitte.
Zwanzig.
Zehn.
Lieber Gott.
Bitte.
Eine Kugel surrte an ihm vorbei und schlug splitternd in einem Baum neben ihm ein.
Lieber, lieber Gott …
Als Kass die Tür des Wagens erreichte und sie aufriß, tauchte der Mann am Waldrand auf.
Kass hörte den Schuß nicht, der ihn traf, spürte aber, wie die Kugel wie ein glühender Dolch in seinem Rücken einschlug. Ihre Wucht riß ihn nach vorn auf die Motorhaube des Wagens. Er schrie auf, glitt von dem Wagen herunter und drehte sein blutiges Gesicht herum. Er sah, wie der Mann auf ihn zielte.
Kass schrie noch einmal, schlug die Hände vors Gesicht.
Der erste Schuß drang durch seine rechte Hand und trat hinter seinem linken Auge aus. Die Kugel zerriß die Netzhaut und ließ ihn auf der Stelle erblinden. Als Kass vor Todesangst kreischte und weiter von der Motorhaube herunterrutschte, trat der Mann einen Schritt vor, lud ruhig die Waffe nach und hob sie an. Der Fangschuß explodierte in Kass’ Schädel und sprengte ein Loch in den Hinterkopf.
Kass war tot, bevor er auf den Boden schlug.
Zwei Tage später wurden die Leichen im Wald gefunden.
Von einem Freizeitjäger, wie Kass einer gewesen war. Allerdings ein Mann mit mehr Fortune, der nicht zur falschen Zeit am falschen Ort aufgetaucht war. Er übergab sich, als er den Leichnam des Kindes sah.
Ihr hübsches Gesicht war weiß gefroren. Das Fleisch um die Kopfwunde und am Hals war von Nagetieren zum Teil weggefressen.
Selbst für die abgebrühten Polizeibeamten des Luzerner Kriminalamtes war es einer der brutalsten Morde, den sie je gesehen hatten. Die Leiche eines ermordeten Kindes hat immer etwas besonders Mitleiderregendes an sich und zeugt von einer besonderen Brutalität. Die Obduktion und die pathologische Untersuchung ergaben, dass das Mädchen zwischen zehn und zwölf Jahren alt war. Man hatte sie nicht vergewaltigt, obwohl sie an Beinen, Armen, Brust und im Genitalbereich schwere Verletzungen hatte. Daraus schloß man, dass sie vor ihrer Hinrichtung grausam geschlagen und gefoltert worden war. Der Leichnam des Mannes wies ähnliche Spuren auf. Beide Leichen wurden im Kühlraum des Leichenschauhauses der Luzerner Polizei gelagert.
Der einzige Leichnam, der identifiziert werden konnte, war der von Manfred Kass. In seiner Brieftasche befanden sich ein Führerschein und ein Waffenschein für eine Schrotflinte. Außerdem trug er eine Armbanduhr mit einer Widmung: ›Für Manni, in Liebe, Hilda‹.
Die Polizei fand heraus, dass der Bäcker nach seiner Freitagnachtschicht zur Jagd gegangen und dabei zufällig Zeuge der Hinrichtung geworden war – und diesen Zufall mit dem Leben bezahlt hatte.
Die Polizei wußte nicht, weshalb der Mann und das Kind ermordet worden waren; man kannte nicht einmal die Namen. Doch mit typischer Schweizer Gründlichkeit machten die Beamten sich daran, Antworten auf beide Fragen zu finden.
Flughäfen und Grenzposten wurden alarmiert – ein ziemlich fruchtloses Unterfangen, weil die Schweizer Polizei nicht wußte, nach wem sie suchen sollte; es gab keine Beschreibung des Mörders. Aufgrund der Fußabdrücke im Wald ging man jedoch davon aus, dass ein Mann den Mord allein begangen hatte. Dafür sprach auch, dass Kass und die beiden anderen Toten von denselben Kugeln aus einem Revolver Kaliber .38 getroffen worden waren. Waffen dieses Typs waren seit dem Krieg überall in Europa frei erhältlich.
Auf die Identität des Mörders gab es keinerlei Hinweise.