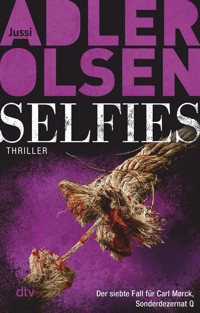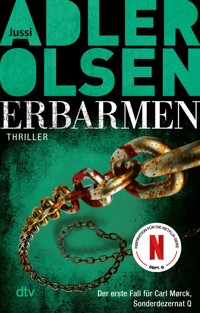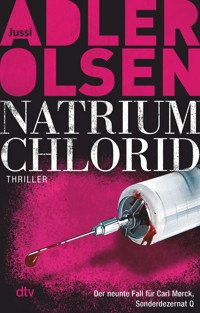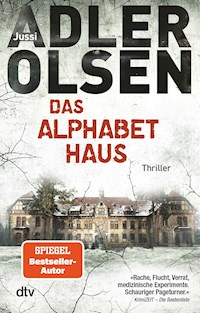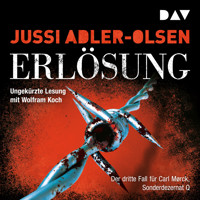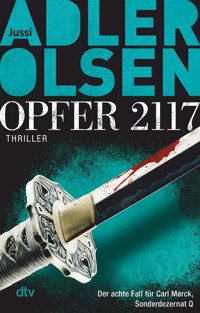
10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Carl-Mørck-Reihe
- Sprache: Deutsch
Ertrunkene Bootsflüchtlinge im Mittelmeer. Ein psychisch gestörter Gamer. Ein geplanter Terroranschlag in Berlin. Der achte Fall für Carl Mørck und sein Team vom Sonderdezernat Q für Cold Cases der dänischen Polizei. »Die Tote am Strand von Ayia Napa trug noch immer einen Hauch von Rot auf den Lippen. Wie schön sie gewesen war. Auch wenn tiefe Falten in ihrem Gesicht erahnen ließen, warum sie sich auf den gefährlichen Weg über das Mittelmeer gemacht hatte. Assad erstarrte ...« An Zyperns Küste wird eine tote Frau aus dem Nahen Osten angespült: Auf der Tafel der Schande in Barcelona, wo die Zahl der im Meer ertrunkenen Flüchtlinge angezeigt wird, ist sie ›Opfer 2117‹. Doch sie ist nicht ertrunken – sondern ermordet worden! Auf verschlungenen Wegen gelangt ihr Foto auch ins Kopenhagener Sonderdezernat Q: Als Assad das Bild der toten Frau zu Gesicht bekommt, bricht er zusammen. Denn er kannte sie nur zu gut. Ein hochemotionaler Fall für Kriminalkommissar Carl Mørck und sein Team, der nicht nur Assad an seine Grenzen bringt. Die große skandinavische Bestseller-Reihe – spannender geht es nicht »›Opfer 2117‹ ist nicht nur skandinavische Krimiunterhaltung auf höchstem Niveau, sondern auch ein Politthriller mit Wucht.« Weser Kurier Neben der Carl-Mørck-Reihe sind bei dtv außerdem folgende Titel von Jussi Adler-Olsen erschienen: - ›Das Alphabethaus‹ - ›Das Washington-Dekret‹ - ›Takeover‹ - ›Miese kleine Morde‹
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 734
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Über das Buch
Seit über zehn Jahren wirkt Assad wie eine geheimnisvolle Naturgewalt im Sonderdezernat Q in Kopenhagen. Doch nun gerät er ins Auge des Sturms und an seine eigenen Grenzen.
Zypern. Am Strand von Ayia Napa wird der Journalist Joan Aiguader Zeuge, wie Helfer eine Tote aus dem Wasser ziehen. Die Frau aus dem Nahen Osten ist das »Opfer 2117« auf der »Tafel der Schande« am Strand von Barcelona, die die Zahl der im Mittelmeer ertrunkenen Bootsflüchtlinge anzeigt. Ihr Bild geht um die Welt. Die Tote am Strand ist eine Frau, die Assad einst sehr nahestand. Und er weiß, dass er nun von seiner Vergangenheit eingeholt wird: Ghaalib, ein irakischer Krimineller, hat bereits einmal sein Leben zerstört – jetzt will er Assad für immer vernichten. Mit Assad im Zentrum der Ereignisse beginnt für Carl Mørck und sein Team ein nervenzerfetzender, atemloser Countdown, um eine Katastrophe im Herzen Europas zu verhindern.
Carl Mørck, Sonderdezernat Q, Kopenhagen, ermittelt
Erbarmen/Die Frau im Bunker (1. Fall)
Schändung/Die Fasanentöter (2. Fall)
Erlösung/Flaschenpost von P (3. Fall)
Verachtung/Akte 64 (4. Fall)
Erwartung/Der Marco-Effekt (5. Fall)
Verheißung/Der Grenzenlose (6. Fall)
Selfies (7. Fall)
Opfer 2117 (8. Fall)
Natrium Chlorid (9. Fall)
Jussi Adler-Olsen
Opfer 2117
Thriller
Aus dem Dänischen von Hannes Thiess
Für Sandra
Die Finger der Ertrunkenen
Das Leben
der Hände
der Ertrunkenen
ist
länger als unsere Geschichte.
Weit entfernt
und ganz nahe
sehen wir die Ertrunkenen,
sehen ihre Sehnsucht
nach Leben und Frieden.
Jeden Tag
sehen wir das Äußerste
der Fingerspitzen
im Meer verschwinden.
Aber unsere Augen
haben nicht gelernt,
ihre Finger
aufsteigen zu sehen,
sich aus dem Meer
zum Himmel
zu strecken.
Sie sind nicht mehr nass,
die Finger der Ertrunkenen.
Sie sind auf immer ausgetrocknet.
Falah Alsufi – Dichter und »Kontingentflüchtling« aus dem Irak
Prolog
Eine Woche, bevor Assads Familie Sab Abar verließ, nahm ihn sein Vater am Samstag mit zum Markt: ein überwältigendes, farbensattes Gemälde von Ständen mit Kichererbsen, Granatäpfeln und Bulgur, voll grellbunter Gewürze und gackerndem Federvieh, das auf das Beil wartete. Der Vater legte Assad die Hände auf die schmalen Schultern und sah ihn mit seinen dunklen, klugen Augen an.
»Mein Sohn, hör mir gut zu«, sagte er. »Bald wirst du von dem, was du heute siehst, nur noch träumen. Und es wird viele Nächte geben, bevor deine Hoffnung, all diesen Gerüchen und Geräuschen noch einmal zu begegnen, verblassen wird. Sieh dich gründlich um, solange es möglich ist, und bewahre alles, was du siehst, in deinem Herzen. Denn dann wirst du die Erinnerung daran nie ganz verlieren. Das ist mein Rat an dich. Hörst du, mein Sohn?«
Assad drückte die Hand seines Vaters und tat, als habe er ihn verstanden.
Aber so ganz verstanden hatte Assad ihn nie.
1
Joan
Joan Aiguader war nicht religiös. Im Gegenteil, wenn in der Karwoche die Prozessionen der Katholiken in schwarzen Kutten die Ramblas überschwemmten, verließ er fluchtartig die Stadt. Er sammelte respektlose Figuren von Päpsten oder den Heiligen Drei Königen, die hockend ihre Notdurft verrichteten. Aber trotz dieser blasphemischen Neigung hatte er sich in den letzten Tagen immer mal wieder bekreuzigt, denn falls Gott doch existierte, war es verdammt wichtig, dass er, Joan, sich gut mit ihm stellte – so wie sich die Dinge jetzt leider entwickelt hatten.
Als die Morgenpost mit dem lange ersehnten Briefumschlag dann endlich kam, bekreuzigte sich Joan vorsichtshalber ein weiteres Mal. Der Inhalt würde definitiv über sein weiteres Schicksal entscheiden. Das war ihm nur zu bewusst.
Drei Stunden später saß er niedergeschmettert in einem Café im Stadtteil Barceloneta. Tja, das war’s dann wohl. Trotz der Wärme zitterte er am ganzen Leib. Zweiunddreißig Jahre lang hatte er in der lächerlichen Hoffnung gelebt, früher oder später einmal wäre ihm das Glück hold. Aber nach dem heutigen Rückschlag hatte er endgültig keine Kraft mehr, noch länger zu warten. Acht Jahre zuvor hatte sich sein Vater ein Elektrokabel um den Hals geschlungen und sich an einem Wasserrohr in dem Wohnhaus aufgehängt, in dem er als Hauswart tätig war. Der kleinen Familie hatte es den Boden unter den Füßen weggezogen, denn auch wenn der Vater nie ein heiterer Mensch gewesen war: Dieser Schritt war für sie alle einfach unbegreiflich. Von einer Sekunde zur nächsten hatten Joan und seine fünf Jahre jüngere Schwester mit ihrer Mutter allein dagestanden. Diese war über den Schock nie hinweggekommen. Joan hatte so gut er konnte für sie alle gesorgt, auch wenn er damals erst vierundzwanzig gewesen war. Damit sie einigermaßen zurechtkamen, nahm er neben seiner Journalistenausbildung jede Menge unterbezahlter Hilfsjobs an. Im Jahr darauf kam dann der nächste Schicksalsschlag: Da schluckte seine Mutter Schlaftabletten. Und nur wenige Tage später seine Schwester …
Erst jetzt, nach all diesen Jahren, wurde ihm bewusst, warum er nicht mehr konnte. Für fast alle Mitglieder der Familie Aiguader hatte das Leben im Laufe der Zeit seinen Sinn verloren. Das Dunkel hatte sie alle ergriffen, es würde auch vor ihm nicht haltmachen. Über dieser Familie schien ein Fluch zu liegen – und er machte da keine Ausnahme. Daran konnten auch die wenigen glücklichen Momente und die kleinen beruflichen Triumphe nichts ändern. Es war erst einen Monat her, da hatte ihn seine Freundin verlassen. Und als wollte das Schicksal sich vergewissern, dass es ganze Arbeit geleistet hatte, verlor er auch noch seinen Job.
Warum sich also noch quälen, wenn ja doch alles sinnlos war?
Joan steckte die Hand in die Hosentasche, dabei warf er einen Blick zum Kellner hinter der Theke.
Könnte ich doch mit ein klein wenig Respekt vor mir selbst mein Leben beenden oder wenigstens dem Kellner den Kaffee bezahlen. Verbittert starrte er auf den letzten Schluck in der Tasse. Aber die Hosentasche war leer, und in einer Endlosschleife ließ er all die Projekte, mit denen er in seinem Leben Schiffbruch erlitten hatte, vor seinem inneren Auge Revue passieren. All die zerbrochenen Beziehungen, die verfehlten Ziele, die immer weiter heruntergeschraubten Ansprüche. Das Gefühl des Scheiterns wurde übermächtig, jegliches Leugnen oder Ignorieren war zwecklos.
Er war am Ende.
Als ihn zwei Jahre zuvor eine schwere Depression heimgesucht hatte, war er bei einer Wahrsagerin aus Tarragona gewesen. Sie hatte ihm prophezeit, dass ihn eines Tages in nicht allzu ferner Zukunft – da stünde er schon mit einem Bein im Grab – ein helles Licht retten würde. Sie hatte das so überzeugend vorgebracht, dass sich Joan bis heute an diese Weissagung geklammert hatte. Aber wo zum Teufel blieb das helle Licht? Er konnte sich ja noch nicht einmal mit Anstand von seinem Stuhl im Café erheben, weil ihm die lächerlichen zwei Euro für seinen Cortado fehlten. Selbst der zerlumpte Bettler, der mit ausgestreckter Hand auf dem Bürgersteig vor El Corte Inglés hockte, ja selbst die Obdachlosen, die mit ihren Hunden in den Eingangsbereichen der Banken auf den Fliesen schliefen, bekamen genug für einen Espresso zusammen.
Der intensive Blick der Wahrsagerin hatte ihn in die Irre geleitet und ihm Hoffnung auf eine Zukunft gemacht, die es nicht gab. Sie hatte sich gründlich getäuscht, und jetzt war der Zeitpunkt gekommen, der Realität ins Auge zu sehen.
Seufzend warf er einen Blick auf die Briefumschläge. Wie Zeugen seiner Naivität und seiner Fehleinschätzungen lagen sie auf dem Cafétisch. Dagegen erschien ihm die Flut an Mahnungen, die zu Hause aufgelaufen war, fast harmlos. Denn auch wenn er seit Monaten die Miete schuldig geblieben war, konnte man ihn nicht aus der Wohnung werfen, so wie die Mietgesetze Kataloniens gestaltet waren. Und warum sollte er sich über Gasrechnungen den Kopf zerbrechen, wenn er sich seit Weihnachten keine warme Mahlzeit mehr zubereitet hatte? Nein, es waren diese vier Umschläge hier, die ihm den Rest gaben.
Seiner Ex-Freundin gegenüber hatte Joan immer wieder beteuert, dass er beruflich bald Fuß fassen würde. Aber die erwarteten Einnahmen waren ausgeblieben und am Ende war sie es leid gewesen, ihn mitzufinanzieren, und hatte ihm den Laufpass gegeben. In den darauffolgenden Wochen hatte er seine hartnäckigsten Gläubiger mit der Aussicht auf vier Kurzgeschichtenhonorare vertröstet. Immerhin schrieb er an einer Sammlung genialer Texte.
Aber hier auf dem Tisch lagen die Absagen, und die waren weder vage noch ausweichend oder beschönigend, sondern genauso unbarmherzig und präzise, wie der Degen, mit dem der Matador den Stier ins Herz trifft.
Joan hob die Tasse vors Gesicht, um das schwindende Aroma des Espressos zu genießen. Sein Blick schweifte über die Palmen am Strand und das bunte Treiben der Badegäste. Es war noch gar nicht lange her, da war Barcelona von der Todesfahrt eines Verrückten auf der Rambla, den Ausschreitungen vor den Wahllokalen und dem gewaltsamen Einschreiten der Zentralregierung wie gelähmt gewesen. Das schien angesichts der vielen Menschen, die sich vor ihm in der flirrenden Hitze amüsierten, wie beiseitegeschoben. In ihren Gesichtern stand die reine Lebenslust, sie johlten und schrien übermütig, die Luft vibrierte vor Sinnlichkeit und geballter Erwartung. Die Stadt schien für den Moment wie neugeboren, fast spöttisch, während er dasaß und vergebens nach dem »hellen Licht« der Wahrsagerin Ausschau hielt.
Der Wassersaum mit den spielenden Kindern war verführerisch nah. In weniger als einer Minute könnte er an den Sonnenanbetern vorbei ins Wasser rennen, in die Wellen abtauchen, dann ein letztes Mal Luft holen. Bei dem Trubel am Strand würde keiner von dem Verrückten Notiz nehmen, der sich voll bekleidet in die Fluten stürzte. In weniger als zwei Minuten könnte alles vorbei sein.
Trotz heftigen Herzklopfens lachte er ein bittersüßes Lachen: Sollte ein Schlappschwanz wie Joan Aiguader etwa in der Lage sein, sich das Leben zu nehmen? Dieser farblose, blutleere Journalist, der nicht einmal in Diskussionen den Mumm hatte, klar Stellung zu beziehen?
Joan wog die Umschläge in der Hand. Ein paar hundert Gramm weiterer Erniedrigung, zusätzlich zu all dem anderen Scheiß, der sich im Lauf der Jahre angehäuft hatte. Und deshalb Rotz und Wasser heulen? Er hatte doch seinen Entschluss längst gefasst. In einer Sekunde würde er dem Kellner sagen, er könne nicht zahlen, und danach würde er, begleitet von dessen Flüchen, zum Strand rennen, um endlich Schluss zu machen.
Doch noch bevor er diesen Entschluss an seine Beine weitergeben konnte, damit sie aufstanden, erhoben sich zwei Gäste in Badekleidung so abrupt, dass ihre Stühle nach hinten kippten.
Joan drehte den Kopf. Einer der beiden gaffte ausdruckslos auf den großen Fernsehschirm oben an der Wand, während der andere seinen Blick über den Strand schweifen ließ.
»Stell mal lauter!«, rief der in der Nähe des Bildschirms.
»Hey! Die stehen ja direkt unten auf der Promenade«, rief der andere und deutete auf die sich weiter vorn versammelnde Menschenmenge. Als Joan seinem Blick folgte, bemerkte er ein Fernsehteam, das sich auf der Promenade direkt vor der drei Meter hohen Anzeigetafel aufgebaut hatte, die die Stadtverwaltung vor zwei Jahren hatte errichten lassen. Der untere Teil der Tafel war aus unscheinbarem Metall, darüber leuchteten auf einem digitalen Display vier Ziffern: die sich stets aktualisierende Zahl der Flüchtlinge, die seit Jahresbeginn im Mittelmeer ertrunken waren, wie Joan unlängst dem Erklärtext der Tafel entnommen hatte. Es war ein Mahnmal der Schande.
Badegäste in Shorts und Bikinis scharten sich um das Kamerateam, und ein paar Einheimische eilten vom Carrer Baluard herbei. Wahrscheinlich hatten auch sie den Fernseher angeschaltet gehabt.
Joan richtete seine Aufmerksamkeit auf den Kellner. Der trocknete mechanisch die Gläser ab, völlig absorbiert von den Fernsehbildern. Eine Textzeile verkündete »Breaking News«. Da erhob sich auch Joan von seinem Stuhl und folgte den anderen zur Promenade.
Ja. Er war trotz allem immer noch am Leben – und er war immer noch Journalist.
Die Hölle konnte doch wohl noch eine Weile warten.
2
Joan
Unbeirrt von all den Joggern, Inlineskatern und dem ganzen Trubel stand die Reporterin vor der hohen Anzeigetafel und war sich ihrer Wirkung vollkommen bewusst. Mit einer schnellen Kopfbewegung warf sie ihr Haar zurück, befeuchtete die Lippen und hielt sich dann das Mikrofon vor den Mund. Männer allen Alters gafften sie mit offenem Mund an – sie und vor allem ihre Brüste.
»Wie viele Menschen wirklich ertrunken sind auf der Flucht nach Europa, das für viele von ihnen das Paradies und die Freiheit symbolisiert«, sagte sie, »das wissen wir nicht. Aber in den letzten Jahren ist die Zahl auf viele Tausende angestiegen, und allein in diesem Jahr sind schon über zweitausend Menschen umgekommen.«
Sie drehte sich ein bisschen und deutete auf die leuchtende Zahl auf der Tafel.
»Diese Ziffer hier oben zeigt an, wie viele Flüchtlinge bereits im Laufe dieses Jahres im Mittelmeer ertrunken sind. Und dies ist nur die Zahl der erfassten Opfer. Im letzten Jahr hatte es um diese Zeit sogar noch mehr Tote gegeben, im kommenden Jahr rechnen wir mit einer ähnlichen Zahl. Es ist beschämend, dass die Welt – Sie und ich, jeder Einzelne von uns – trotz dieser entsetzlichen Zahl weiterhin wegschaut. Und das wird sich auch nicht ändern, solange diese Toten anonym bleiben. Was ist schon eine Zahl?«
Sie richtete ihre dramatisch schwarz geschminkten Augen direkt in die Kamera. »Tun wir Europäer nicht so, als ginge uns das alles nichts an? Wir wissen um die Zahl der Opfer, aber wir ignorieren sie. Wir blenden die Menschen hinter den Zahlen aus. Und deshalb werden wir von TV11 unsere kommende Reportage einem Ertrunkenen widmen, dessen Leiche vor weniger als einer Stunde im östlichen Mittelmeerraum, in Zypern, an den Strand geschwemmt wurde. Wir wollen das Leben des Menschen zeigen, der auf der Flucht ins vermeintliche Paradies sein Leben gelassen hat. Das Leben eines Menschen aus Fleisch und Blut.«
Sie blickte auf ihre funkelnde diamantbesetzte Armbanduhr. »Vor nicht einmal einer Stunde fand man die Leiche dieses Mannes am Strand von Ayia Napa. Er war von den Wellen an den Strand gespült worden und zwischen ebenso fröhlichen Badegästen gelandet wie ihnen.« Mit einer ausladenden Armbewegung deutete sie auf die Sonnenanbeter am Platja Sant Miquel.
»Liebe Zuschauer, dieser junge Mann, von dem ich spreche, war der Erste, dessen Leichnam heute Morgen an den beliebten Badestrand Ayia Napa auf Zypern angeschwemmt wurde. Mit ihm stieg die Zahl auf der Tafel hinter mir auf genau zweitausendachtzig.« Sie legte eine Kunstpause ein und sah hoch zu der leuchtenden Ziffer. »Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Zahl weiter steigt. Das erste Opfer an diesem Morgen war jedenfalls dieser dunkelhäutige junge Mann mit zweifarbigem Adidas-Shirt und abgelaufenen Schuhen. Warum musste er im Mittelmeer sein Leben verlieren? Wenn wir hier in Barcelona über die friedlichen azurblauen Wellen blicken, können wir uns dann vorstellen, wie dasselbe Meer Tausende von Kilometern entfernt die verzweifelten Hoffnungen von Flüchtlingen auf ein besseres Leben vernichtet?«
Sie unterbrach sich, und ihr Producer spielte Aufnahmen von Zypern ein. Die Strandbesucher konnten das Ganze auf einem Monitor neben dem Kameramann verfolgen, und bei dem Anblick verstummte das Gemurmel augenblicklich. Es waren heftige Bilder von der Leiche eines jungen Mannes, bäuchlings in den Wellen, der von ein paar Helfern an Land gezogen und umgedreht wurde. Dann wurde zurückgeschaltet. Jetzt war wieder die Reporterin in Barcelona auf dem Monitor zu sehen, die zwei Meter entfernt stand, bereit, den Bericht abzuschließen.
»In wenigen Stunden wissen wir hoffentlich mehr über den jungen Mann. Wer er war, woher er kam, was ihn zu der gefährlichen Flucht über das Mittelmeer veranlasst hat. Gleich nach der Werbung sind wir zurück. Die Zahl auf der Tafel hinter mir wird weiter ansteigen.« Sie endete damit, dass sie auf die Leuchtziffern deutete und mit ernster Miene in die Kamera blickte, bis der Kameramann sich bedankte und abwinkte.
Joan ließ den Blick über die Menge schweifen. Das konnte eine große Sache werden! Aber war das möglich – dass außer dem Fernsehteam und ihm selbst kein weiterer Pressevertreter anwesend war? Sollte er tatsächlich einmal im Leben rechtzeitig zur Stelle gewesen sein? Bei einer Story, von der er ahnte, dass sie groß werden konnte?
Sein Bauchgefühl war stärker denn je.
Wer könnte eine solche Möglichkeit ungenutzt lassen!
Joan blickte hoch zu der »2080« auf dem Display.
Und genau wie die jungen Typen, die auf die Brüste der Reporterin starrten, während diese sich eine Zigarette ansteckte und ein paar Worte mit dem Kameramann wechselte, stand auch Joan noch eine ganze Weile wie hypnotisiert da.
Vor zehn Minuten war er fest entschlossen gewesen, sich in die Statistik derer einzureihen, die im Mittelmeer ertrunken waren, jetzt starrte er wie gebannt auf die Leuchtziffern. Ihre provokante Botschaft war mit einem Mal so real und präsent, dass ihm schwindlig wurde. Hatte er tatsächlich gerade noch – wie ein kleines Kind – den Fokus allein auf sich gerichtet gehabt? Hatte selbstmitleidig und resigniert aufgeben wollen, während dort draußen auf dem Meer Menschen um ihr Leben kämpften? Ja, kämpften! Die Wucht des Wortes haute ihn fast um. Und schlagartig begriff er, was er gerade erlebt hatte, in was er hineingezogen worden war. Vor Erleichterung kamen ihm die Tränen. Er war dem Tod so nahe gewesen. Aber das hier, das war womöglich das Licht, das ihn rettete – genau wie die Wahrsagerin prophezeit hatte! Das Licht, das ihm neuen Lebensmut brachte, diese Zahl über ihm, die vom Unglück der anderen zeugte und ihm die fantastische Möglichkeit einer bisher nicht geschriebenen Geschichte eröffnete. All das wurde ihm binnen einer Sekunde klar.
Sollte er tatsächlich – im Sinne der Weissagung – seinen Fuß in allerletzter Sekunde aus dem Grab gezogen haben?
In den nächsten hektischen Stunden setzte Joan den Plan um, den er auf die Schnelle entwickelt hatte. Dieser Plan würde seine Karriere retten und ihm eine Existenzgrundlage für sein zukünftiges Leben verschaffen.
Als Erstes checkte er die Flüge nach Zypern. Mit der Maschine um 16.45 Uhr nach Athen würde er einen Anschlussflug nach Larnaca erreichen, sodass er gegen Mitternacht am Strand von Ayia Napa stehen konnte.
Aber die Preise! Allein der Hinflug kostete fast fünfhundert Euro. Woher sollte er die nehmen, er, der nicht mal seinen Cortado hatte zahlen können? Was blieb ihm also anderes übrig, als den Schlüssel zu nutzen, den seine Ex in den letzten Wochen immer wieder von ihm zurückgefordert hatte? Er schloss die Hintertür ihres Gemüseladens auf und ging schnurstracks zum Ladentisch, unter dem sie hinter ein paar Gemüsekisten eine kleine Geldkassette versteckte.
In zwanzig Minuten würde sie von ihrer Siesta zurückkommen und den Leihschein lesen, den er auf der Theke hinterlegt hatte. Und in zwanzig Minuten würde er mit knapp sechzehnhundert Euro in der Tasche auf dem Weg zum Flughafen sein.
*
Durchdringende Schreie gellten vom Strand von Ayia Napa herauf. Die vielen Scheinwerfer tauchten den Sand in gleißendes Licht, alles war bis ins kleinste Detail ausgeleuchtet, sogar die Schaumkronen auf den Wellen blitzten weiß. Im Sand, nur wenige Meter von einer Gruppe uniformierter Rettungsarbeiter entfernt, lagen in einer Reihe dicht an dicht die Leichname, die man aus dem dunklen Meer gezogen hatte. Ihre Gesichter waren unter grauen Wolldecken verborgen. So schrecklich der Anblick war: Aus der Perspektive des Journalisten war er auch faszinierend.
Streng bewacht von der Polizei stand etwa fünfzehn Meter weiter landeinwärts eine Gruppe von zwanzig bis dreißig traumatisierten Überlebenden, verzweifelt, erschöpft und vor Kälte zitternd, trotz der Wolldecken, die sie umgehängt hatten – die gleichen grauen Decken, die auch die Gesichter der Toten bedeckten. Außer diesen Decken war das leise Weinen der Überlebenden über das Schicksal derer, die es nicht geschafft hatten, aber auch über ihre eigene ungewisse Zukunft das Einzige, was sie jetzt noch miteinander verband.
»Die, die dort oben stehen, das sind die, die Glück hatten«, kommentierte einer Joans prüfenden Blick. »Sie trugen Rettungswesten, sie wurden von den Rettungsbooten ein ganzes Stück weit draußen auf dem Meer geborgen. Es ist erst eine halbe Stunde her, seit unsere Leute sie fanden. Sie hielten sich dicht aneinandergedrängt, wie ein Fischschwarm – vermutlich, um nicht auseinandergetrieben zu werden.«
Joan nickte und trat vorsichtig einen Schritt näher an die Reihe der Toten heran. Zwei Polizisten wollten ihn verjagen, aber als er ihnen seinen Presseausweis hinhielt, ließen sie ihn gewähren. Stattdessen richteten sie die Kraft ihrer Autorität auf die gaffenden Touristen und Partygänger in Strandkleidung, die das schreckliche Ereignis eifrig mit ihren Smartphones dokumentierten.
Wie herzlos!, dachte Joan und packte seine Kamera aus.
Er verstand kein Griechisch, schon gar nicht das zypriotische, aber die Körpersprache der Rettungsarbeiter war unmissverständlich. Gerade gestikulierten sie in Richtung der Wellen. Daraufhin dirigierte ein Kollege das Scheinwerferlicht zu einem länglichen Klumpen, der landeinwärts trieb.
Als die Leiche schließlich nur noch etwa zwanzig Meter vom Ufer entfernt war, watete ein Mann von der Rettungswacht hinaus und zog daran wie an einem Kleiderbündel. Kaum lag der leblose Körper am Ufer, brachen zwei Frauen aus der Gruppe der Überlebenden aus. Schwankend drängten sie sich vor und schlugen immer wieder die Hände vors Gesicht. Fassungslosigkeit stand in ihren Gesichtern, und unter allen Herumstehenden gab es kaum jemanden, der beim Anblick des Toten und dieser beiden verzweifelten Menschen nicht bis ins Mark erschüttert war.
Ein neben ihnen stehender Mann mit schwarzem ungepflegtem Vollbart versuchte rüde, sie zum Schweigen zu bringen. Vergeblich, denn als ein kahlköpfiger, jüngerer Mann in einer Art blauer Uniformjacke nach vorne rannte und die Leiche aus nächster Nähe fotografierte, schrien die beiden Frauen auf. Sie schienen kurz davor zusammenzubrechen. Der Mann wirkte sehr offiziell, vermutlich sollte er die Bergung jeder einzelnen Leiche dokumentieren. Deshalb fotografierte Joan ihn ebenfalls, dann nickte er ihm vorsichtshalber zu, als wenn er eine besondere Genehmigung für seine Anwesenheit hätte.
Danach drehte er sich wieder um und machte so diskret wie möglich ein paar Aufnahmen von den weinenden Frauen. Denn auch wenn er wusste, dass es bei dieser Reportage auf ganz andere Dinge ankam: Aus journalistischer Sicht hatte der Anblick tiefer Trauer im Gesicht eines Menschen immer etwas Faszinierendes. Und er wollte seine Reportage genauso aufbauen wie die Fernsehmacher in Barcelona: aufdecken, ausmalen, erschüttern und Anteilnahme wecken.
Denn dieser Ertrunkene war, wie unerträglich das auch erscheinen mochte, seine ganz persönliche Trophäe: Er, Joan, wollte einen toten Menschen wiederauferstehen lassen, und zwar nicht nur für einen kleinen Kreis katalanischer Zeitungsleser. Nein, das hier sollte um den Globus gehen, so wie vor einigen Jahren die Geschichte des dreijährigen syrisch-kurdischen Jungen, der ertrunken und auf den Titelseiten der Weltpresse gelandet war. Ungeachtet dessen, wie entsetzlich das Ganze war, wollte Joan jetzt auch auf so ein Einzelschicksal setzen. Das berührte die Menschen, das machte die großen Zusammenhänge ganz anders erfahrbar. Das würde ihm endlich journalistisches Renommee einbringen und ihn finanziell sanieren. So war der Plan.
Für einen Moment stand er still. Die Schreie im Hintergrund waren sehr real, die hatte man in dieser Form nicht gehört, als der Fernsehsender TV 11 in Barcelona die letzten Bilder von Ayia Napa gezeigt hatte. So etwas gab natürlich Kolorit und machte eine Story authentisch, aus diesen Details konnte er endlich die Geschichte schaffen, die er für seinen Durchbruch brauchte. Doch plötzlich meldete sich ein Gefühl, das er eigentlich nur aus anderen Zusammenhängen kannte und am liebsten ganz weit wegschieben wollte. Auf der anderen Seite: Warum sollte er wegen seines Tuns ein schlechtes Gewissen haben? Machte er hier nicht etwas sehr Besonderes?
Auf einmal schien die Kamera schwerer geworden zu sein. »Etwas sehr Besonderes«, glaubte er das wirklich? Kupferte er nicht in Wahrheit das Konzept von TV11 ab? Denn ob er nun vor Ort recherchierte oder nicht: Das machten schließlich Hunderte anderer Journalisten auch. Nein, er war nichts weiter als ein Trittbrettfahrer, warum sich das nicht eingestehen?
Joan schüttelte den Gedanken ab. Und wenn schon! Hauptsache, er machte die Reportage so, dass sie die Menschen berührte, nur darum ging’s doch!
Und sobald er die Bergung des Mannes dokumentiert hatte, würde er sich den weinenden Frauen zuwenden. Er musste herausfinden, ob es eine besondere Verbindung zwischen ihnen und dem Ertrunkenen gegeben hatte, durch die sich ihre große Verzweiflung erklären ließe. Vielleicht konnte er auf diese Weise sogar Details zur Identität des Toten in Erfahrung bringen oder über die Hintergründe seiner Flucht. Woher kannten die Frauen am Strand ihn? Warum hatten die anderen überlebt, war er krank oder besonders schwach gewesen? Was war er für ein Mensch gewesen, hatte er Frau und Kinder? Das Gedankenkarussell in Joans Kopf setzte sich in Bewegung.
Er trat einen Schritt näher zum Leichnam. Er wollte ihn genau so fotografieren, wie er dort mit abgewandtem Gesicht am Wassersaum lag. Die Kleidung des Mannes war nicht genau zu erkennen, Stoffbahnen, wie um den Leib herumgewickelt, vielleicht eine Art Volkstracht. Die Rettungsleute versperrten die Sicht, als sie den Körper vollständig aus dem Meer zogen.
Joan stand jetzt ganz nahe bei der Leiche, und als der Rumpf ein wenig gedreht wurde und der Kopf zur Seite fiel, stockte ihm der Atem: Er sah direkt in das Gesicht einer alten Frau.
Er kniff die Augen zusammen und versuchte, seinen Herzschlag unter Kontrolle zu bringen. Noch nie war er so unmittelbar mit dem Tod konfrontiert gewesen. Er hatte Opfer von Verkehrsunfällen gesehen, blutigen Asphalt und das Blaulicht der Rettungswagen, die vergeblich gekommen waren, und in der kurzen Zeit seiner Tätigkeit als Gerichtsreporter war er hin und wieder auch im städtischen Leichenschauhaus gewesen. Doch anders als all die Verkehrs- oder Unfalltoten berührte ihn der Tod dieser schutzlosen Frau ganz tief in seinem Inneren. Sie war auf eine lange und beschwerliche Reise gegangen, voller Hoffnung auf ein besseres Leben – das ganz kurz vor dem Ziel ein so tragisches Ende genommen hatte. Was für eine starke, ganz eigene Geschichte konnte daraus entstehen …
Er sog tief die feuchte Seeluft ein und hielt kurz den Atem an, um sich nicht von seinen widerstreitenden Gefühlen mitreißen zu lassen. Nachdenklich blickte er über das nachtschwarze Meer. Das Unglück dieser Frau war gleichzeitig ein echter Scoop: Diesmal war es kein Mann und auch kein Kind. Nein, eine alte Frau war zum Opfer geworden, das war neu. Und das würde die Story ungleich verkäuflicher machen – denn das Groteske dieses Unglücks sprang einen geradezu an. Ein so langes Leben und dann ein so furchtbares Ende.
Nach kurzem Zögern söhnte sich Joan mit dem Gedanken aus, dann richtete er die Kamera auf die Tote und aktivierte die automatische Intervallfunktion, drückte nach ein paar Sekunden auf den Videoknopf und bewegte sich rund um die Leiche, sodass alle Details dokumentiert wurden, ehe ihn die Rettungsarbeiter aufhalten konnten.
Trotz des Aufenthalts im Salzwasser und der Strapazen der Überfahrt konnte man durchaus sehen, dass die Frau aus besserem Haus stammte. Auch das erhöhte sicher die Aufmerksamkeit des Publikums und somit die Verkäuflichkeit. Wie oft hatte man nicht leidgeprüfte Menschen in verschlissener Kleidung gesehen, denen die Strapazen einer langen Überfahrt ins Gesicht geschrieben standen? Diese Frau hingegen war geschmackvoll gekleidet, der Lippenstift war noch als blasses Rot zu erkennen, und selbst ihrem Lidschatten hatte das Meer wenig anhaben können. Sie war schön gewesen, wohl um die siebzig Jahre alt. Sie hatte ihre Schuhe verloren, die Jacke war zerrissen. Die tiefen Falten in ihrem Gesicht zeugten womöglich von all den Prüfungen, die sie letztlich zu diesem verzweifelten Schritt getrieben hatten. Dennoch strahlte sie eine große Würde aus.
»Wissen wir, woher diese Menschen kommen?«, fragte Joan auf Englisch einen Mann in Zivil, der neben der Leiche kniete.
»Aus Syrien, würde ich meinen, so wie überhaupt der Flüchtlingsstrom in den letzten Tagen.«
Joan wandte sich den Überlebenden zu. Recht dunkle Haut, aber nur wenig dunkler als die der Griechen, insofern klang Syrien wahrscheinlich.
Er sah zu der Reihe der Leichen auf dem Strand und zählte sie. Siebenunddreißig. Männer, Frauen und vereinzelt ein Kind. Joan dachte an die Anzeigetafel in Barcelona auf der anderen Seite des Mittelmeers, wo jetzt eine »2117« in den Nachthimmel leuchten musste. Wenn nicht sogar eine noch höhere Zahl. Was für eine sinnlose Vergeudung von Leben.
Dann nahm er seinen Block und notierte Datum und Zeitpunkt, um zumindest das Gefühl zu bekommen, mit dem begonnen zu haben, was ihn vom Abgrund wegziehen und seinem Leben ein neues Fundament verschaffen sollte. Es sollte ein Artikel werden über diese eine Tote unter so vielen anderen. Keine Geschichte über ein schutzloses Kind oder einen Mann im besten Alter, sondern über eine alte Frau, die gerade erst ertrunken war. Über sie, die es wie die vorherigen zweitausendeinhundertsechzehn Opfer in diesem Jahr nicht geschafft hatte, das Mittelmeer lebend zu überqueren.
Er brachte seine Überschrift zu Papier: »Opfer 2117«. Dann richtete er den Blick auf die Gruppe der Überlebenden und suchte die zwei Frauen, die so verzweifelt geschrien hatten. Weiter oben am Strand waren noch immer viele gequälte Gesichter und zitternde Körper zu sehen, dicht aneinandergedrängt. Aber die beiden Weinenden und auch der Vollbärtige waren verschwunden. An der Stelle stand jetzt der Mann mit der blauen Uniformjacke, der eben noch neben Joan fotografiert hatte.
Joan steckte sein Notizbuch in die Tasche. Er wollte noch ein paar Nahaufnahmen vom Gesicht der Frau machen. Doch da traf ihn ihr offener, klarer Blick mitten ins Herz – und er zuckte zurück.
Warum nur musste das passieren?, fragten ihre Augen.
Joan hatte nichts übrig für esoterische Gedanken, aber in diesem Moment zitterte er am ganzen Körper. Es war, als wollte die Frau mit ihm in Kontakt treten. Ihm zu verstehen geben, dass er nichts, überhaupt nichts begriff und dass das ganz und gar nicht in Ordnung war.
Joan konnte den Blick nicht abwenden, denn diese schönen, lebendigen Augen schienen immer neue Fragen an ihn zu richten.
Joan, weißt du, wer ich bin?
Du kennst nicht einmal meinen Namen!
Weißt du, woher ich komme?
Joan schüttelte den Kopf und kniete sich vor sie hin.
»Nein, aber ich werde es herausfinden«, sagte er und schloss sanft ihre Augen. »Das verspreche ich dir.«
3
Joan
»Nein, Joan, wie oft soll ich dir das noch sagen? Deine Reisekosten als Freelancer werden nicht erstattet, wenn das nicht im Vorhinein vertraglich festgelegt ist.«
»Aber ich habe doch alle Belege. Ich habe eine komplette Reiseabrechnung erstellt, hier.«
Er schob die Mappe mit den Flugtickets und den Quittungen für die sonstigen Ausgaben über die Theke, und dabei schenkte er ihr sein schönstes Lächeln.
Er kannte die Befugnisse der Büroangestellten Marta Torras sehr gut. Sie hatte nicht das Recht, ihn zurückzuweisen, jetzt schon gar nicht.
»Marta, hast du nicht gesehen, dass mein Artikel gestern der Aufmacher war? Das war keine kleine Kolumne in der Beilage, das war die Top-Story. Das Beste, was ich je geschrieben habe. Völlig klar, dass die Buchhaltung die sechzehnhundert Euro genehmigen wird. Komm schon, Marta. Ich werde doch meine Dienstreise nicht privat bezahlen! Zumal ich mir das Geld von meiner Ex geliehen habe.«
Joan blieb gar nichts anderes übrig, als hartnäckig zu bleiben. Seine Ex-Freundin hatte ihm eine runtergehauen und damit gedroht, ihn anzuzeigen. Sie hatte ihn einen Dieb genannt und geweint, weil sie wusste, dass sie ihr Geld nie wiedersehen würde. Dann hatte sie die Hand ausgestreckt und ihm befohlen, ihr den Ladenschlüssel auszuhändigen. Damit war das nicht länger eine Ex-Beziehung. Jetzt war es eine Ex-Ex-Beziehung.
»Ach ja? Die Buchhaltung wird die Reisekosten genehmigen? Wenn du dich da mal nicht täuschst. Denn ich bin die Buchhaltung, Joan«, schnaubte Marta. »Und deine Ex muss naiv sein, wenn sie glaubt, dass du dich nach Belieben aus der Zeitungskasse bedienen kannst.«
Während sie kehrtmachte und zurück zu ihrem Schreibtisch stiefelte, sammelte er sich. Der Knopf an ihrem Rock, der verhindern sollte, dass sich der Reißverschluss öffnete, fehlte, und der Reißverschluss stand schon halb offen. Marta war wirklich der Prototyp einer Buchhalterin: in Gedanken immer nur bei der nächsten Siesta und der nächsten Mahlzeit. Satt und faul, einfach nur peinlich. Während er selbst sich die Beine ausriss, um endlich mal auf einen grünen Zweig zu kommen.
»Aber Marta, die Zeitung hat meinen Artikel doch gedruckt! Die müssen mir doch zumindest die Reisekosten erstatten!«
»Klär das mit deiner Redakteurin. Ich handele hier nur auf Anweisung.« Sie befand es noch nicht mal für nötig, sich beim Sprechen zu ihm umzudrehen.
Oben in der Redaktion hatte er dann vielleicht doch etwas Beifall erwartet. Eine gewisse Anerkennung für seinen Scoop, denn ›Hores del dia‹ hatte mit seiner Reportage vorgestern endlich den großen Wurf gelandet, den sämtliche anderen Zeitungen aufgegriffen hatten. Seine Fotos waren durch die internationale Presse gegangen. Eine schöne ältere Frau, tot am Strand von Ayia Napa, im grellen Scheinwerferlicht, das noch auf diverse andere Leichen fiel. Und dann diese schmerzverzerrten Gesichter der beiden Trauernden. Die umwerfende Resonanz auf seinen Artikel musste doch auch ›Hores del dia‹ zugutegekommen sein.
Aber bis auf einen jüngeren Auslandskorrespondenten, der deutlich den Kopf schüttelte, als Joan zwischen den Reihen der Festangestellten zum Büro seiner Redakteurin ging, nahm niemand Notiz von ihm. Kein Nicken, kein kleines Lächeln. Verdammt noch mal, in Filmen standen die Kollegen auf und klatschten, wenn einem Journalisten ein solcher Scoop gelungen war. Was stimmte denn da nicht?
»Joan, ich hab nur fünf Minuten, also fass dich kurz.« Montse Vigo, seine Redakteurin, schloss die Tür. Offenkundig vergaß sie, ihm durch ein Zeichen zu verstehen zu geben, sich zu setzen. Er setzte sich trotzdem.
»Marta aus der Buchhaltung hat eben angerufen und mir gesagt, dass du deine Reisekosten erstattet haben willst.« Sie sah ihn über den Rand ihrer Brille hinweg an. »Aber das kannst du vergessen, Joan. Für den Artikel von Ayia Napa bekommst du die elfhundert Euro, die ich dir dummerweise zugesagt habe, als du ihn abgeliefert hast. Und da kannst du noch froh sein.«
Joan sah sie verständnislos an. Er hatte damit gerechnet, dass die Geschichte von der Ertrunkenen ihm einen fetten Bonus bescheren würde und vielleicht sogar die Aussicht auf eine Festanstellung! Warum zum Teufel stand Montse Vigo jetzt vor ihm und sah ihn an, als hätte er sie angespuckt?
»Joan, du hast uns lächerlich gemacht.«
Joan schüttelte den Kopf. Was um Himmels willen meinte sie denn damit?
»Sag mal, du bekommst aber auch gar nichts mit, was? Na, dann erzähle ich dir wohl erst mal, wie es mit der Geschichte von Opfer 2117 weiterging. Gestern wirkte das Ganze tatsächlich noch wie eine gute Story. Aber heute Morgen konnte man die wahre Geschichte in mindestens fünfzig internationalen Zeitungen lesen. Alle Zeitungen Barcelonas, Joan, hörst du: Alle Zeitungen hatten die gleiche Geschichte. Außer uns. Joan: Du hast null Komma nichts recherchiert! Du warst vor Ort, hast die Kamera auf die Tote gehalten und dir den Rest zusammengereimt. Ist das deine Vorstellung von Qualitätsjournalismus? Nein, Joan, so geht das nicht!«
Sie knallte einige der spanischen Tageszeitungen vor ihn auf den Tisch. Beim Überfliegen der Überschriften blieb ihm die Luft weg.
»Opfer Nummer 2117 wurde ermordet!«
Dann deutete Montse Vigo auf einen Absatz etwas weiter unten. »Entgegen der Darstellung von ›Hores del dia‹ ist das Opfer 2117, die Tote am Strand von Ayia Napa, nicht ertrunken – anders als die übrigen Flüchtlinge, die man dort aus dem Meer geborgen hat. Opfer 2117 war zuvor brutal erstochen worden.«
»Und weißt du, Joan, auf wen dieser ganze Scheiß zurückfällt? Genau: auf mich.« Mit Schwung schob sie den demütigenden Stapel in eine Ecke ihres Schreibtischs. »Ja, es ist meine Verantwortung. Ich hätte es wissen müssen, nach all diesen blutarmen Reportagen, die du uns in letzter Zeit immer andrehen wolltest.«
»Ich verstehe das nicht«, stammelte er, und das tat er auch tatsächlich nicht. »Ich hab doch gesehen, wie sie aus dem Wasser gezogen wurde. Ich bin dabei gewesen! Du hast doch meine Fotos gesehen.«
»Joan: Dieser Frau wurde ein so langes Dingens« – sie markierte die Länge mit den Händen – »zwischen den dritten und vierten Halswirbel gerammt! Offenbar war sie auf der Stelle tot. Und du hast nichts davon mitbekommen?« Nach kurzer Unterbrechung fuhr sie fort. »Gott sei Dank sind wir nicht die Einzigen, die sich zum Narren gemacht haben. Auch das Team von TV11 hat mit seinem Aufmacher auf das falsche Pferd gesetzt: den jungen Mann, der als Erster angeschwemmt wurde an dem Tag, als du in Ayia Napa warst. Wie sich zeigte, war er der Anführer einer Terrorzelle, nur eben ganz frisch rasiert.«
Joan war fassungslos: Man hatte diese Frau ermordet? War es das, was ihm ihre Augen erzählt hatten? Hätte er … hätte er das erkennen müssen?
Joan hob an zu einer Erklärung, wollte seine Redakteurin einweihen in diese seltsame Situation am Strand, er wusste ja, dass einem Journalisten so etwas nicht passieren durfte, aber …
Da klopfte es an der Tür, und Marta aus der Buchhaltung trat ein. Sie überreichte Montse Vigo zwei Umschläge, und ohne Joan auch nur eines Blickes zu würdigen, zog sie sich wieder zurück.
Montse gab Joan einen der Umschläge. »Hier sind die elfhundert, auch wenn du sie weiß Gott nicht verdient hast.«
Wortlos nahm Joan den Umschlag. Das Recht, ihn fertigzumachen, gehörte zu Montse Vigos Job – was sollte er da sagen? Er deutete eine Verbeugung an, drehte sich um und wollte sich zurückziehen. Wie lange würde der Inhalt dieses Umschlags wohl reichen? Schon begann er wieder zu schwitzen.
»Moment, wo willst du hin?«, hielt ihn Montse zurück. »Glaub ja nicht, dass du so leicht davonkommst.«
Kurze Zeit später auf der Straße starrte er auf das Gebäude, das er gerade verlassen hatte. Auf der Diagonal war mal wieder eine Demonstration unterwegs in die Stadt, Pfiffe, Parolen und aufgebrachtes Hupen schallten von dort herüber. Aber in seinem Kopf dröhnten noch die Worte der Redakteurin.
»Hier sind fünftausend Euro. Du hast genau zwei Wochen, um diese Geschichte zu Ende zu bringen. Und du machst es alleine, verstanden? Du bist zwar nicht meine erste Wahl, aber keiner deiner Kollegen will sich an dieser Sache die Finger verbrennen. Zu viele Spuren sind schon zu kalt, sagen sie. Aber du wirst sie wieder aufwärmen, das bist du der Zeitung schuldig. Finde andere Überlebende, die dir erzählen können, wer die Frau war und was genau mit ihr passiert ist. Du hast doch einige der Überlebenden interviewt, von daher weißt du, dass sie mit zwei Frauen zusammen war, einer jungen und einer älteren, und dass ein Mann mit Vollbart während der Überfahrt mit ihnen geredet hatte. Bis das Schlauchboot sank. Finde heraus, wer sie sind. Vielleicht helfen dir die Fotos dabei ja. Und dann erwarte ich täglich Meldung, ich will wissen, wie du vorankommst und wo du bist. In der Zwischenzeit spinnen wir hier in der Redaktion dazu eine Story, um die Geschichte am Köcheln zu halten. Die fünftausend Euro sind eine Pauschale, ist das klar? Mir ist völlig egal, wen du bestichst und wo du wohnst. Aber fest steht: Ohne die Geschichte brauchst du hier nicht wieder aufzuschlagen. Und mehr Geld gibt’s auch nicht, wir sind hier nicht bei ›El País‹.«
Er hatte genickt und den Umschlag in der Hand gehalten. Es würde ihm wohl gar nichts anderes übrig bleiben, als die Scharte so gut es eben ging auszuwetzen.
Die fünftausend Euro waren gewissermaßen das Ticket zur Wiedergutmachung.
4
Alexander
Im Lauf der letzten Monate waren seine Finger unglaublich geschmeidig geworden. Man konnte fast meinen, er und der Controller wären eins. In seinen besten Stunden wurde das »Kill Sublime«-Universum zu seiner einzig wahren Realität. Die Distanz zwischen ihm, den Soldaten auf dem Monitor, und denen, die sie töteten, wuchs gleichzeitig ins Unendliche und schrumpfte zu Nichts. Alexander hatte sich mit Leib und Seele diesem Spiel verschrieben.
Nach dem Abi hatten seine Mitschüler alles, was noch an die Schule erinnerte, in den Schrank geworfen. Anschließend waren sie in die entferntesten Ecken der Welt aufgebrochen, nach Vietnam, Neuseeland oder Australien, um den Prüfungsstress zu vergessen. Alexander hingegen zog etwas ganz anderes in den Bann: Endlich konnte er sich ganz und gar seiner Verachtung der Welt widmen. Wie zum Teufel konnten sich die Dumpfbacken aus seinem Jahrgang überall auf dem Erdball tummeln, ohne zu merken, was los war? Wie konnten sie komplett ignorieren, dass die Menschen wie die verdammten Ratten waren, an nichts anderem interessiert, als sich gegenseitig zu dominieren, zu fressen und zu vermehren? Wie konnten sie das alles nicht sehen? Er hasste sie dafür. Letztlich hasste er alle Menschen. Rückten sie ihm zu dicht auf den Pelz, legte er gnadenlos und höhnisch ihre finstersten Eigenschaften bloß. Das hatte ihn zum Gegenstand von Schikanen gemacht, nur nicht hin zu Nähe und Freundschaft.
Aber egal, Alexander hatte sich für diesen Weg entschieden. Er hatte beschlossen, ganz in der virtuellen Welt zu leben. Denn sobald er sein Zimmer verließe, würde er riskieren, auf andere Menschen zu stoßen. Eines Tages jedoch würde er herauskommen – am letzten Tag seines Lebens.
So hatte er es bestimmt. So sollte es sein.
Einen Großteil des Tages drang von der anderen Seite seiner Zimmertür sporadisch Lärm zu ihm. Von vier Uhr am Nachmittag bis gegen Mitternacht und von Viertel nach sechs am nächsten Morgen bis Viertel vor acht hörte er seine Eltern in der Wohnung. Wenn sie endlich die Tür hinter sich zugeknallt und sich auf den Weg zur Arbeit gemacht hatten und auf der anderen Seite alles still war, schloss er die Tür auf und schlich aus dem Zimmer. Er leerte seinen Nachttopf, schmierte sich Brote für den Rest des Tages, füllte sich zwei Thermoskannen mit Kaffee und schlich wieder zurück, schloss die Tür ab und schlief bis ein Uhr mittags. Danach saß er zwölf Stunden vor seinem Computer und spielte »Kill Sublime«, schlief zwei Stunden, um die Augen etwas zu schonen, und machte dann für ein, zwei Stunden weiter.
So gestalteten sich seine Tage und Nächte. Schießen, schießen und wieder schießen. Sein Kill Account stieg stetig und seine Winrate, für die er sämtliche Gegner ausrotten musste, wurde jeden Tag besser. Wenn jemand zu den Top-Playern dieses Spiels gehörte, dann er.
Für die Wochenenden rüstete sich Alexander besonders gründlich. Am Freitagmorgen versorgte er sich mit reichlich Haferflocken, Milch, Butter und Brot. Den Nachttopf leerte er erst am Montag wieder, aber mittlerweile hatte er sich an den Gestank gewöhnt. Immer noch besser als seinen Eltern zu begegnen, die er an den verdammten Wochenenden dauernd hören konnte. Dass sie sich immer öfter stritten, scherte ihn nicht, beinahe freute es ihn. Aber wenn es auf einmal still wurde, war er auf der Hut. Dann musste er damit rechnen, dass sie wieder vor seinem Zimmer standen und ihm drohten, sie würden früher oder später seine Tür aufbrechen, ihn einweisen lassen oder das Internet abstellen. Die letzte Drohung schreckte ihn nicht, dafür waren sie selbst viel zu abhängig davon.
Manchmal behaupteten sie auch, sie würden nichts mehr vom Erbe seiner Großmutter abheben und deshalb auch nicht mehr für ihn mit einkaufen. Dann wieder drohten sie, jemanden kommen zu lassen, einen Psychologen, einen Sozialarbeiter, einen Familienhelfer. Irgendwann hatten sie sogar seinen alten Klassenlehrer ins Spiel gebracht.
Aber Alexander wusste, dass das nur Gerede war. So wie seine Eltern tickten, lag ihnen nichts ferner, als dass andere wüssten, was in ihrem gelben Kopenhagener Vorortshäuschen abging. Wenn sie vor seiner Tür standen und nach allen Regeln der Kunst bettelten und flehten, verzweifelt darauf bedacht, die kleinbürgerliche Illusion von einem normalen Familienleben aufrechtzuerhalten, dann spuckte er auf den Fußboden oder lachte so lange wie ein Wahnsinniger, bis sie die Klappe hielten.
Wie sie sich damit fühlten, war ihm scheißegal. Sie waren doch selbst schuld. Wollte seine Mutter ihn mit ihrem erbärmlichen Gejammer vor der Tür etwa mürbe machen? Ihn brechen? Glaubte sie, dass er all ihre widerwärtigen Seiten und überhaupt ihren ganzen Scheiß einfach so ausblenden konnte? Dass er vergessen konnte, wie wenig sie und diese lachhafte Parodie eines Vaters sich um den Rest der Welt scherten?
Er hasste sie. Und wenn der Tag kam, an dem er sein Zimmer endgültig verließ, dann würden sie vor Entsetzen erstarren und bereuen, je gewollt zu haben, dass er die Tür öffnete.
Mindestens zum zwanzigsten Mal an diesem Tag sah er vom Monitor mit der erstarrten Landschaft aus Farben und Gewalt auf zu dem Zeitungsartikel an der Wand. Vor ein paar Tagen hatte er ihn dort aufgehängt, weil er ihm endlich einen Weg aufzeigte, wie er auf die Gleichgültigkeit und den Zynismus seiner Eltern und ihresgleichen reagieren konnte. Denn letztlich waren solche wie sie die Schuldigen. Sie waren der Grund, warum es immer wieder Opfer wie diese Frau auf dem Foto geben würde.
Als sie bei der Arbeit waren, hatte die Zeitung ungelesen im Eingangsflur gelegen – seine Eltern scherten sich nicht um die Katastrophen der Welt, über die sie berichtete. Die Überschrift hatte ihn gepackt. Die große Ähnlichkeit der Frau mit seiner Großmutter hatte einen wunden Punkt berührt. Schmerzliche Erinnerungen an eine Nähe und Wärme, die er nur bei ihr gefunden hatte, waren mit Macht zurückgekommen.
Als er den Artikel über das Schicksal dieser Frau las, packte ihn eine Wut, die er eigentlich schon seit Monaten anwachsen spürte und auf die er jetzt endlich reagieren musste.
Alexander betrachtete die alte Frau lange. Auch wenn der Tod in ihren Augen glänzte, und obwohl sie aus einer für ihn unendlich weit entfernten Welt kam: Für genau diese Frau würde Alexander sich opfern. Seine Botschaft würde vernichtend sein und glasklar. Jegliche Gewalt gegen Menschen musste hart bestraft werden.
Zunächst einmal wollte er die Polizei in sein Vorhaben einweihen. Das würde ihm starke Headlines sichern, wenn es dann schließlich losging.
Er presste die Lippen zusammen und nickte. Aktuell hatte er tausendneunhundertsiebzig Wins, dafür hatte er mehr als zwanzigtausend Gegner getötet. Das Ziel von zweitausendeinhundertsiebzehn Wins war also machbar, und wenn er vierundzwanzig Stunden am Stück am Computer sitzen musste. Es war ein Akt der Solidarität mit diesem anonymen Opfer an der Wand. Mit Opfer Nummer einundzwanzig siebzehn.
Sobald er diesen unfassbaren Score erreicht hatte, würde er aus dem Zimmer treten und Rache nehmen für die alte Frau – und für all die Widerwärtigkeiten, denen er selbst in seinem Leben ausgesetzt gewesen war. Die Rache würde unmissverständlich sein.
Er sah hinüber zur anderen Wand, wo das Samuraischwert hing, das er von seinem Großvater geerbt und nachgeschliffen hatte, als er damals »Onimusha« auf der Playstation 2 gespielt hatte.
Schon bald käme die Gelegenheit, es zu benutzen.
5
Carl
Es war so paradox. Schon wieder war einer dieser Regentage angebrochen, an denen das fahle Licht, das durch die Jalousien drang, Monas nackte Haut und die weißen Wände förmlich zum Glühen brachte. Auch an diesem Morgen streichelte Carls Blick die sich sanft abzeichnenden Vertiefungen zwischen den Sehnen an ihrem Hals. In dieser Nacht hatte sie tief geschlafen. Wenn er bei ihr war, gelang ihr das inzwischen. In den ersten Monaten nach dem Tod ihrer jüngsten Tochter Samantha hatte sie unendlich viel geweint. Tag für Tag hatte sie ihn gebeten, bei ihr zu bleiben, und wenn er in ihrem Bett lag, hatte sie hektisch und nervös nach ihm getastet. Sie weinte oft ganze Nächte lang, manchmal sogar, wenn sie sich liebten. Und Carl blieb bei ihr.
Natürlich war diese Zeit für sie beide anstrengend gewesen. Aber ohne ihn und ohne die Verantwortung, die Mona für Samanthas vierzehnjährigen Sohn Ludwig fühlte, wäre das Weiterleben für sie wohl zu schwer gewesen. An Monas ältester Tochter Mathilde lag es sicher nicht, dass sich mittlerweile ein erträglicherer Zustand zu stabilisieren begann. Mona sprach eigentlich nie mit ihr.
Carl streckte sich nach seiner Armbanduhr. Es war an der Zeit, zu Hause bei Morten anzurufen, um sicherzugehen, dass er Hardy fertig machte.
»Gehst du?« Die Stimme neben ihm klang schläfrig.
Er legte ihr die Hand auf das kurze, mittlerweile völlig graue Haar. »Ich muss in einer Dreiviertelstunde im Präsidium sein. Schlaf weiter, ich kümmere mich darum, dass Ludwig rechtzeitig loskommt.«
Als er aufgestanden war, verweilte sein Blick auf dem Umriss ihres Körpers unter der Decke. Jeden Morgen dachte er dasselbe.
Wie schwer es die Frauen in seinem Leben doch hatten.
Eine dunkle Wolkendecke hing über dem Präsidium, und das seit fast einer Woche. Schon wieder ein vergeudeter Herbst, der sich wie eine Last auf seine Schultern legte, immer schwerer wurde, bis der finstere Winter ihn dann endgültig niederdrückte. Er hasste diese Jahreszeit, ganz einfach. Schneeregen, Schnee, Menschen, die wie verrückt durch die Gegend jagten, um Geschenke zu kaufen, auf die man gut und gerne verzichten konnte. Bereits im Oktober ging es mit den Weihnachtsliedern los, das Lichtermeer war gigantisch und der Plastikflitterkram, der die Menschheit an Jesu Geburt erinnern sollte, trieb immer absurdere Blüten. Und als wenn das alles noch nicht reichte, türmten sich auf seinem Schreibtisch hinter diesen grauen Mauern die Akten. Eine jede stand für einen Mörder, der, unbeeindruckt von Tannengrün und Weihnachtssternen, derzeit in Dänemark herumlief – frei und unerkannt. Und es war seine Aufgabe, diese Schweine zu finden.
»Piece of cake« – vielleicht sollte man so denken. Aber seit dem Fall vor gut zwei Jahren mit der Sozialarbeiterin, die reihenweise ihre Klienten umgebracht hatte, wurde es in der Welt – so war jedenfalls sein Eindruck – immer nur noch schlimmer. Schießereien auf offener Straße, Lockout-Drohungen gegenüber Angestellten im öffentlichen Dienst, Burkaverbot … es kam so viel zusammen, dass das alles eigentlich gar nicht mehr zu verwalten war. Kein Wunder, dass sich etliche Kollegen im Präsidium inzwischen lieber in der Kommunalpolitik engagierten, als Steuersündern, straffällig gewordenen Einwanderern oder kriminellen Bankern hinterherzurennen. Und hatte sich eine Region in der Provinz endlich einmal mühsam aufgerappelt und funktionierte so halbwegs, konnte man sicher sein, dass sie schon bald wieder bürokratisch ausgebremst würde. Die ganze Maschinerie fraß Unmengen an Zeit und Energie. Nicht zuletzt seine. Carl hatte die Schnauze wirklich gestrichen voll.
Aber wenn er jetzt auch noch kündigte, wer sollte dann all die Verbrechen aufklären, an denen die da oben im zweiten Stock gescheitert waren? Denn einfach aufzuhören, der Gedanke lag natürlich nahe. Und stattdessen Tagesmutter zu werden. Oder anderer Leute Hunde auszuführen. Jedenfalls eigenständig zu entscheiden, welche Laune man haben, mit wem man zusammen sein oder um wen man sich kümmern wollte. Nur: Wenn alle so dachten, wer würde dann die Verbrecher dort draußen aufhalten?
Carl war sich aber gar nicht mehr so sicher, ob er überhaupt Lust hatte, diese Frage zu beantworten. Er seufzte laut, als er an den Männern in der Wachstube vorbeiging. Bei diesem Seufzen wussten alle: Besser die Klappe halten und gehörigen Abstand wahren! Heute schienen sie allerdings weder das Seufzen noch ihn überhaupt wahrzunehmen.
Irgendetwas stimmte nicht, das spürte er auf dem Weg in den Keller ganz deutlich. Alle, die ihm begegneten, starrten in die Luft, und bis auf einen kaum wahrnehmbaren Schein aus Gordons Büro am Ende des Kellerflurs war da unten alles zappenduster. Im Sonderdezernat Q brannte nicht eine Lampe.
Carl schnaubte. Und jetzt? Wo zum Teufel schaltete man das verdammte Licht wieder an? Dafür hatte man doch jemanden?
Er suchte am Fuß der Treppe nach einem Schalter, nur war da keiner. Allerdings befand sich dort ein schwerer Klotz, gegen den er erst mit der Schuhspitze und dann mit dem Knie stieß. Fluchend trat Carl einen Schritt zur Seite und einen nach vorn, stolperte über ein kastenförmiges Ding, knallte mit dem Kopf gegen die Wand und mit der Schulter gegen ein Fallrohr – und schlug der Länge nach hin.
Auf dem Boden stieß er Flüche aus, von deren Existenz er nicht einmal geahnt hatte.
»Gordon!«, brüllte er. Keine Antwort.
Er stand auf und tastete sich an der Wand entlang zu seinem Büro. Dort gelang es ihm schließlich, eine Schreibtischlampe und den Computer anzuschalten. Stöhnend setzte er sich und rieb sich das Knie.
War er wirklich als Einziger des Dezernats am Platz? Das wäre seit langer Zeit das erste Mal.
Er griff nach seiner Thermoskanne und schüttelte sie. Manchmal war noch ein Schluck Kaffee vom Vortag übrig.
Verdammte Pfütze, dachte er, aber eine halbe Tasse war es wohl doch noch.
Aus der Schublade holte er den kleinen Becher, den ihm sein Stiefsohn geschenkt hatte. Bei Licht konnte man den wirklich nicht benutzen, so hässlich war er. Er schenkte sich Kaffee ein – kalten zwar, aber egal.
Da erst sah er den Zettel auf seinem Schreibtisch. Was zum Teufel sollte das?
Lieber Carl,
das Archivmaterial, um das du in Verbindung mit eurem gegenwärtigen Fall gebeten hast, habe ich auf dem Flur abgestellt. Es noch weiterzutragen war leider zu schwer für ein zartes Wesen wie mich.
Liebe Grüße
Lis
Carl riss die Augen auf. Was für ein beschissener Platz, um das Zeug abzustellen! Aber wie konnte er böse sein, wenn die appetitlichste Frau des ganzen Präsidiums den Ort ausgewählt hatte?
Dann legte er sein Handy auf den Tisch und betrachtete es.
Die Taschenlampenfunktion fiel ihm ein. Verdammt, da hätte er auch früher drauf kommen können! Genervt knallte er die Faust auf den Tisch, woraufhin der Kaffeebecher einen Satz machte und umkippte. Nicht nur Lis’ Zettel, sondern der ganze Stapel Papiere, den er gleich durchsehen musste, färbten sich braun.
Zehn Minuten lang gaffte er die versauten Akten an und dachte an Zigaretten. Mona hatte ihn gebeten, mit dem Rauchen aufzuhören, und das war’s dann gewesen. Doch das Verlangen nach kühlem Rauch in den Lungen ließ sich nicht einfach so abstellen. Die Entzugserscheinungen waren ätzend und machten ihn ungenießbar, davon konnten Assad und Gordon ein Lied singen. Aber bei irgendwem musste er sich doch im Lauf des Tages abreagieren, um Mona nach Feierabend mit einem Anflug von natürlicher Positivität entgegentreten zu können?
Scheiße, das war sein Mantra, wenn das Verlangen übermächtig wurde. Als ob das helfen würde.
Das Telefon klingelte so unerwartet, dass er zusammenzuckte.
»Carl, kommen Sie mal nach oben!« Das war keine Frage. Die Polizeipräsidentin hatte, sogar für eine federleichte Frau in den Wechseljahren, eine nörgelige Stimme, die, beabsichtigt oder nicht, jeden vergrätzen konnte.
Aber warum rief sie höchstpersönlich an? War seine Abteilung abgewickelt worden? War es deshalb hier so dunkel? Wollte man ihn feuern? Wurde ihm die Entscheidung gerade abgenommen? Das wäre ihm dann aber doch nicht so recht.
Oben im zweiten Stock spürte Carl sofort die tiefdunkelgraue Stimmung. Selbst Lis wirkte auffällig düster, und auf dem Gang zum Büro der Polizeipräsidentin standen dicht gedrängt schweigende Ermittler.
»Was zum Teufel ist denn hier los?«, fragte er Lis.
Sie schüttelte den Kopf. »Weiß ich nicht genau, aber nichts Gutes. Irgendwas mit Lars Bjørn.«
Carls Augenbrauen zuckten nach oben. Hatte man den alten Schweinehund endlich bei einer Sauerei ertappt?
Eine Minute später stand er zusammen mit den Kollegen im Sitzungssaal. Jeder von ihnen erstaunlich ausdruckslos. Hatten irgendwelche Politiker die Budgets gekürzt? Ging das wieder mal auf Lars Bjørns Kappe? Wundern täte es ihn nicht. Jedenfalls konnte er ihn in der Menge nirgendwo sehen.
Die Polizeipräsidentin schob wie gewöhnlich die Schultern vor. Sollte das beim Kampf mit der zu engen Uniformjacke in der Brustpartie für Erleichterung sorgen?
»Ich bedauere, Ihnen etwas mitteilen zu müssen, worüber einige von Ihnen bereits informiert sind. Vor einer Dreiviertelstunde haben wir einen Anruf der Klinik in Gentofte erhalten, der bestätigt, dass Lars Bjørn verstorben ist.« Sie senkte für einen Moment den Kopf, und Carl versuchte zu begreifen, was sie gerade eben gesagt hatte.
Lars Bjørn tot? Klar war er ein Scheißkerl und ein arroganter Stinkstiefel, und auf Carls Sympathieskala rangierte er eher unterhalb der Grasnarbe, aber ihm den Tod wünschen? Das war dann doch …
»Heute Morgen hat Lars wie immer im Bernstorffspark seine Joggingrunden gedreht, und als er nach Hause kam, ging es ihm offenkundig auch noch gut. Aber keine fünf Minuten später bekam er plötzlich Atemnot, gefolgt von einer Herzattacke, die also …« Nach einem Moment hatte sie sich wieder gefasst. »Seine Frau Susanne, die viele von Ihnen kennen, hat es mit Herzmassage versucht, und auch der binnen Kürze eingetroffene Notarzt sowie das Personal der kardiologischen Abteilung haben alles unternommen, was in ihren Kräften stand. Aber sie alle konnten sein Leben nicht retten.«
Carl sah sich um. Ein paar der Kollegen wirkten aufrichtig berührt. Aber so wie er die Mienen der anderen interpretierte, spekulierten viele bereits, wer wohl die Nachfolge antreten würde.
Mit einem wie Sigurd Harms wird es die Hölle, dachte Carl mit Grausen. Wenn es hingegen Terje Ploug würde oder noch besser Bente Hansen, konnte es problemlos funktionieren.
Da half nur Daumen drücken.
Carl suchte in der Menge vergeblich nach Assads Gesicht. Vermutlich war er bereits bei Rose oder unterwegs zum Präsidium. Gordon hingegen fiel ihm natürlich sofort auf, bei der Länge. Die Bohnenstange war kreidebleich und seine Augen rot wie Monas, wenn es ihr besonders schlecht ging.
Als sich ihre Blicke trafen, signalisierte Carl Gordon, herüberzukommen.
»Wir müssen es heute etwas ruhiger angehen lassen«, fuhr die Polizeipräsidentin fort. »Mir ist bewusst, dass einige von Ihnen die Nachricht sehr erschüttert, denn Lars war ja ein durch und durch geschätzter Vorgesetzter und ein für das gesamte Dezernat wichtiger Kollege.«
Hier musste Carl ein paarmal schlucken, um einen unpassenden Hustenanfall zu vermeiden.
»Wir sollten der Trauer Zeit lassen. Dennoch müssen wir uns in den folgenden Tagen darauf konzentrieren, unsere Arbeit mit der üblichen Professionalität fortzusetzen. Ich werde Lars’ Nachfolger selbstverständlich schnellstmöglich benennen und einsetzen. Bei der Gelegenheit werden wir auch unsere Arbeitsabläufe hier im Präsidium auf den Prüfstand stellen und gegebenenfalls optimieren.«
Der neben ihr stehende Pressechef Janus Staal nickte. Natürlich tat er das. War das nicht vielleicht die größte Schwäche jeder Führungsspitze, dass sie nur schwer der Versuchung widerstehen konnte, alles auf den Kopf zu stellen, sobald sich die geringste Gelegenheit bot? Klar, wie sonst sollten die Vorgesetzten – und ganz besonders die Führungskräfte im öffentlichen Dienst – ihre Existenzberechtigung unter Beweis stellen?
Er hörte Gordon hinter sich seufzen und drehte sich zu ihm um. Also, gut sah der wirklich nicht aus. Carl wusste ja, dass Lars seinerzeit Gordon einen Platz im Präsidium verschafft hatte, insofern war die Reaktion wohl verständlich. Aber hatte Bjørn es Gordon nicht immer wieder schwer genug gemacht, zu bleiben?
»Wo ist Assad?«, fragte Gordon. »Ist er bei Rose?«
Carl runzelte die Stirn. Gordon hatte recht, in Verbindung mit Lars Bjørn an Assad zu denken. Erstaunlicherweise hatte es immer so etwas wie einen Geist von Zusammengehörigkeit zwischen Lars Bjørn und Assad gegeben. Gemeinsame Erlebnisse in der Vergangenheit, deren Umfang und Wesen Carl nicht kannte, hatten offenbar ein starkes Band zwischen den beiden geschaffen, und bei Licht betrachtet hatte eigentlich Lars Bjørn Assad im Sonderdezernat Q untergebracht. Zumindest dafür konnte Carl ihm dankbar sein.
Und jetzt war er tot.
»Soll ich Assad anrufen?«, fragte Gordon, erwartete aber wie selbstverständlich, dass Carl das übernehmen würde.
»Tja, ob wir nicht besser damit warten, ihn darüber zu informieren, bis er herkommt? Falls er gerade bei Rose ist, könnte es sie zu sehr aufregen. Bei ihr weiß man nie.«
Gordon zuckte die Achseln. »Du könntest ihm eine SMS schicken, dass er dich anrufen soll, wenn Rose nicht in der Nähe ist.«
Gute Idee. Carl hob den Daumen.
»Heute Morgen hatte ich wieder einen Anruf von diesem merkwürdigen Typen«, sagte Gordon schniefend, während sie die Treppe hinuntergingen.
»Okay.« Das war etwa das zehnte Mal in zwei Tagen. »Hast du ihn gefragt, warum er ausgerechnet dich anruft? Hat er etwas dazu gesagt?«
»Nein.«
»Und du hast ihn immer noch nicht lokalisieren können?«
»Nein. Ich hab’s versucht, aber er benutzt eine Prepaid Card.«
»Hm. Wenn es dir lästig ist, dann leg beim nächsten Mal einfach auf.«
»Das habe ich versucht, es hilft nicht. Er ruft fünf Sekunden später wieder an, und das macht er so lange, bis ich mir seine Botschaft angehört habe.«
»Sag mir noch mal, worum es geht.«
»Also. Dieser Irre ›will töten, wenn er die Zahl einundzwanzig siebzehn erreicht hat‹. So formuliert er das jedenfalls.«
»Bis dahin sind es noch ganz schön viele Jahre.« Carl lachte. Diese Replik hätte in ihren besten Zeiten auch von Rose kommen können.
»Ich habe ihn gefragt, was die Zahl zu bedeuten hat, und die Antwort war ziemlich kryptisch. Das wäre natürlich dann, hat er gesagt, wenn er in seinem Spiel das Level einundzwanzig siebzehn erreicht hätte. Und dann hat er vor Lachen gebrüllt. Ein echt unheimliches Lachen, das kannst du mir glauben.«
»Sollen wir ihn nicht erst mal unter ›dezent gestörter Idiot‹ verbuchen? Was schätzt du, wie alt er ist?«
»Nicht so alt. Er spricht fast wie ein Teenager. Aber ich glaube, etwas älter ist er schon.«
Es wurde ein langer Vormittag. Assad rief weder zurück noch antwortete er auf Carls SMS.
Irgendwer hatte ihn wohl schon unterrichtet.
Am liebsten hätte Carl einfach zusammengepackt und wäre nach Hause gegangen. Seit der Versammlung oben in der Abteilung hatte er noch keine Akte in die Hand genommen. Das Gefühl, dass jetzt womöglich alles zusammenbrach, lastete mindestens ebenso schwer auf ihm wie das Verlangen nach einer Zigarette.
Wenn Assad nicht innerhalb der nächsten halben Stunde hier aufkreuzt, bin ich weg, dachte er und surfte durch die Stellenanzeigen im Internet. Schon merkwürdig, aber tatsächlich suchte gerade niemand einen dreiundfünfzigjährigen Mann mit einem BMI, der sich der achtundzwanzig näherte.
Blieb ihm also doch nur die Kommunalpolitik? Aber was um Himmels willen hatte er in der Gemeindevertretung von Allerød zu suchen? Und für welche Partei überhaupt?
Da hörte er Assads vertraute Schritte auf dem Gang.
»Du hast es also schon erfahren?«, interpretierte Carl die beiden tiefen Falten über der Nasenwurzel, als Assads Gesicht in der Tür auftauchte.
»Ja, habe ich. Und war anschließend zwei Stunden draußen bei Susanne. Das war gar nicht witzig, das kannst du mir glauben.«