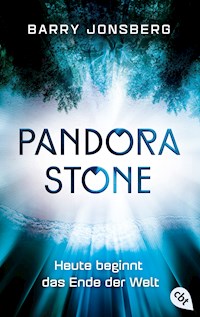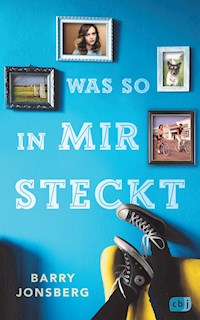9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbt
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Die Pandora Stone-Reihe
- Sprache: Deutsch
Stell dir vor, alle erinnern sich an das Ende der Welt. Doch du bist dir sicher, es ist nie geschehen.
Nach den jüngsten Ereignissen kämpft Pandora darum, Erinnerung und Realität zu trennen. Wie kann es sein, dass sich mehrere Schüler an die gleichen Details erinnern, ohne am selben Ort gewesen zu sein, und sich Träume realer anfühlen als Erinnerungen? Könnte es womöglich sein, dass außerhalb der Mauern der Akademie noch eine intakte Welt existiert?
Gemeinsam mit der abenteuerhungrigen Jen will Pan der Sache auf den Grund gehen und schmiedet einen Plan, aus der Akademie zu fliehen. Doch die überwacht jeden ihrer Schritte ...
Die großartige Fortsetzung der Pandora-Stone-Trilogie von Barry Jonsberg.
Alle Bände der Pandora-Stone-Trilogie
Band 1 - Heute beginnt das Ende der Welt
Band 2 - Gestern ist noch nicht vorbei
Band 3 - Morgen kommt vielleicht nie mehr
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 366
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
BARRY JONSBERG
Gestern ist noch nicht vorbei
Aus dem Englischen von Bettina Obrecht
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Erstmals als cbt Taschenbuch Januar 2021
© 2016 by Barry Jonsberg
© 2021 für die deutschsprachige Ausgabe
cbj Kinder- und Jugendbuch Verlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel
»Pandora Jones – Deception« bei Allen & Unwin, AUS
Aus dem Englischen von Bettina Obrecht
Umschlaggestaltung: Geviert, Grafik & Typografie
Umschlagmotive © Getty Images (Xuanyu Han), Shutterstock.com (Maridav, Literator)
FK · Herstellung: AS
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-17831-4V002www.cbj-verlag.de
Prolog
Es ließ sich schwer sagen, wo der Albtraum endete und wo die Wirklichkeit anfing. Die Grenzen waren so wenig greifbar wie Nebel.
Pandora Stone wusste das genauso gut wie jeder andere Schüler der Akademie. In seinen Träumen konnte man die Augen nicht vor dem Horror verschließen. Man konnte nur durchhalten, die Monster betrachten, die der eigene Geist geschaffen hatte, das Schreien unterdrücken und sich klarmachen, dass die Schreckensbilder in einer Endlosschleife abliefen, sich ewig wiederholen würden.
Zum hundertsten Mal sieht Pan zu, wie die Stadt Melbourne untergeht. Eine Vertretungslehrerin, die nach Luft ringt, aufgibt, ihr letztes Ausatmen ein Blutnebel, der sich auf Pans Gesicht niederschlägt. Die Leichen in den Straßen, ein Polizist, der sich den Lauf einer Pistole in den Mund schiebt, der Geruch nach verbranntem Fleisch, als sein Schädel explodiert.
Pan rennt.
Ein Park, eine Frau auf einer Bank. Pans Mutter, der Boden vor ihren Füßen mit leuchtend roten Punkten übersät, sie hustet und hustet. Ihr Bruder Danny auf der Schaukel. Sie beschreibt einen Bogen durch die Luft, der immer langsamer wird, verebbt mit Dannys Leben. Das Gefühl, in die Luft gehoben zu werden, das Dröhnen von Rotoren über ihrem Kopf. Und andere Erinnerungen, seltsame Erinnerungen aus der Zeit, in der die Stadt noch gelebt hatte. Männer in dunklen Anzügen, die sie verfolgten, ein Streifenwagen, der ihr zu Hilfe kam, eine Injektionsnadel im Bein und eine Stimme, die in ihrem Kopf hallt, als sich die Dunkelheit über sie legt: »Das wollte ich schon immer einmal sagen.«
Eine Zeit, in der gar nichts mehr existiert, eine Leere, eine Dunkelheit, die so tief ist wie der Tod. Kälte durchdringt das taube Gefühl in ihrem Kopf. Sie steht in einem Garten, schaudert in ihrem dünnen Hemd, blickt auf eine öde Landschaft, eine winzige Gestalt gegen die hohen Berge. Eine Mauer und dahinter das Meer. Unter ihr die Akademie.
Die Akademie.
Echt oder nur Einbildung? Pan, gefangen in ihrem Albtraum, kann es nicht sagen. Ein alter Mann steht vor einer Schulklasse, er liest laut vor. Andere Unterrichtsstunden. Praktischer Unterricht. Jemand sagt: »Wir müssen die alten Techniken neu erlernen, wenn wir überleben wollen. Die Welt gibt es nicht mehr. Das Virus hat sie mitgenommen als Milliarden starben. Es sind nur noch zehntausend von uns übrig, verteilt auf Archen überall auf der Welt. Archen, die ihr als Akademien kennt. Wir müssen lernen, und wenn die Welt wieder sauber ist, werden wir losziehen und sie neu bevölkern. Und wir dürfen nicht dieselben Fehler machen. Wir müssen lernen.«
Splitter einer zerbrochenen Zeit.
Laufen, Runden auf einer Rennbahn. Ein Junge mit dunklen, lockigen Haaren. Sein Name ist Nate und er hat Pan geliebt. Hat er sie verraten? Sie sieht ihm in die Augen und spürt gleichzeitig Furcht und Vertrauen. Da sind noch andere Leute. Sie stehen ihr nah, aber nicht so nah wie Nate. Ein Mädchen mit einem Köcher über der Schulter, den Bogen in der Hand.
»Deine Intuition könnte die Welt retten, Pandora.«
»Die Welt ist tot.«
»Deine Intuition könnte die Welt retten …«
Pan starrt auf die Steilwand wenige Zentimeter vor ihrem Gesicht und fürchtet sich. Der kleinste Ausrutscher, eine kurze Unsicherheit wird sie in die Tiefe stürzen lassen, dorthin, wo es nichts gibt, noch nicht einmal Albträume. Auf der Felswand glitzern Eiskristalle, Kälte kriecht in ihre Knochen. Was hat sie hierher geführt? Ein Mädchen. Eine Freundin, aber doch kein richtige Freundin.
Pan schließt die Augen, aber in ihrem Traum kann sie noch immer sehen. Allerdings schwebt sie jetzt hoch über der Landschaft als Herrin der Berge, sie dreht sich die Welt so, wie es ihr gefällt. Ich stecke im Körper eines Falken. Ich sehe durch seine Augen. Ich bin der Falke.
»Du musst deine Gabe annehmen, Pandora. Alles hängt davon ab.«
Pan sieht ein Mädchen. Auf halber Höhe am Berghang, dort, wo es kein Überleben gibt. Das Mädchen heißt Cara. Und jetzt ist Pan zurückgekehrt in ihren schwerfälligen Körper, klammert sich an einem Felshang fest und hofft inständig, dass sie sich ihre Gabe nur eingebildet hat und Cara in Sicherheit ist. Aber sie klettert höher hinauf und entdeckt ihre Freundin. Sie sitzt mit dem Rücken an den Hang gelehnt, mit dem Gesicht zur Akademie und dem endlosen Himmel. Tot. Pan kniet sich vor sie hin und das tote Mädchen schlägt die Augen auf.
»Die Uhren sind falsch«, sagt Cara. »Alles ist falsch, Pandora. Denk über deine Träume nach. Über die, die einen Sinn ergeben. Dann verstehst du vielleicht.«
Und dann steht Pan oben auf der Mauer, neben Nate. Links von ihr liegt die Akademie, rechts das Dorf und dahinter das Meer. Sie klettert an einem Seil hinab und dann sticht ein Lichtstrahl in ihre Augen. Da sind Männer mit Schusswaffen, eine Spritze. Dunkelheit. Das kennt sie schon aus den Träumen, die keinen Sinn ergeben. Oder vielleicht doch. Ein Polizist mit Goldzahn, der sich auf dem Beifahrersitz eines Wagens zu ihr umdreht und sagt: »Das wollte ich schon immer mal sagen.«
Ein weiterer Lichtschein weckt sie auf. Sie wird abgeholt zu einer Reise durch die Nacht. Ihr Team durchquert ein Tor in der Mauer und besteigt ein Boot, lässt die Akademie hinter sich. Der Wind schmeckt nach Salz und Freiheit. Aber da ist dieser leichte Nachgeschmack, das stechende Aroma des Todes. Sie übergeben Caras Leiche dem Meer. Als sie versinkt, sind ihre Augen geöffnet und sie sprechen.
»Mein Tod darf nicht vergebens sein, Pandora. Finde heraus, was falsch ist.«
Pan ist im Wasser, schwimmt in Richtung Strand, in Richtung Gefahr. Sie weiß es. Die Gruppe. Ihre Freunde. Ihre Liebe. Sie alle kämpfen sich durch einen Wald, nass, müde, über sich eine Wolke aus Stechmücken, die wie Rauch dahinzieht. Dann eine Lichtung und Leichen, die zu zucken und zu summen scheinen, aber es sind nur die vielen fetten schwarzen Fliegen. Eine Gewehrkugel schlägt splitternd ineinen Baumstamm. Sie rennen durch den Wald, alle in ihrer Gruppe am Rand der völligen Erschöpfung. Ein Mann auf einer Lichtung, ein Pfeil steckt in seinem Hals. Wei-Lin hält den Bogen in der Hand, ihre Augen sind vor Entsetzen geweitet. Ihre Miene schuldbewusst.
Pan schwimmt wieder im Meer, lässt sich treiben, wartet. Auf ein Boot und auf Nate – sie weiß nicht, wer oder was zuerst da sein wird. Dann diese Gestalt am Strand, sie rennt, rennt vor einer Gruppe von Verfolgern davon. Aber das ist Nate. Er kann jedem davonlaufen. Sicher kann er auch vor einer Kugel davonlaufen? Pandora Stone täuscht sich. Die Kugel trifft ihn und er ist fort. Aber es ist eine Lüge.
Pan sitzt im Boot und weiß, dass sie niemandem trauen kann. Überall Lügen, sie atmet sie ein. Sie benetzen ihr Gesicht wie Schweiß. Und durch die glitzernden Scherben des reflektierten Lichts hindurch taucht die Akademie in ihrem Blickfeld auf. Die größte aller Lügen. Ein Albtraum, der einfach nicht weichen will.
Sie spürt den Schrei in ihrer Kehle …
Pan schreckte hoch. Ihr Gesicht war schweißnass und das Herz trommelte in ihrer Brust. Sie sah an sich herab und stellte fest, dass ihre Fäuste das Bettlaken zusammengeknäult hatten. Ihre Knöchel traten weiß unter der angespannten Haut hervor. Sie brauchte einige Konzentration, bis sich ihre Hände wieder entspannten. Sie wischte sich mit einer Ecke des Bettlakens über die Stirn.
Das Spital. Hierher hatten sie ihre Gruppe nach der Rückkehr von der Insel gebracht. Sie erinnerte sich an den Rückweg durch das Dorf und durch die Mauer und an den langen Anstieg hoch zum Spital der Akademie und auch daran, dass Dr. Morgan und Dr. Macredie sie untersucht hatten. Sie hatten ihr eine Tablette gegeben, die ihr beim Einschlafen helfen sollte. Das war das Letzte, woran sie sich erinnerte.
Die Station schien verlassen; allerdings waren ein oder zwei Betten so zerwühlt, als wären sie bis vor Kurzem belegt gewesen. Die Glastüren waren weit aufgerissen und dahinter lag die schwindelerregende Kulisse der Berge. Pan schwang die Beine aus dem Bett und zuckte zusammen, als der Schmerz ihre Waden und ihre Hüfte durchfuhr. Jemand hatte sie umgezogen. Oder vielleicht hatte sie es auch selbst getan. Sie wusste es nicht mehr. Vieles war unklar. Die Fahrt zu der Insel wirkte wie ein böser Traum, wie ein alter Kinofilm, an dessen Handlung sie sich nur noch schwach erinnern konnte. Aber sie erinnerte sich noch daran, wie Nate am Strand entlanggerannt war und wie er durch das Meer auf sie zu schwamm, als sein Körper erstarrte und dann ins Wasser sank. Dieses Bild war kristallklar.
Sie dachte an die Erleuchtung, die ihr gekommen war, als die Gruppe sich auf der Rückfahrt zur Akademie befunden hatte. Ihr Körper war erschöpft, aber ihr Verstand arbeitete mit größter Präzision.
Ein Wasserkrug stand auf ihrem Nachttisch, ein Glas war über den Flaschenhals gestülpt. Sie griff danach.
Was sollte sie jetzt tun? Ein Verdacht war ja gut und schön. Aber was sie brauchte, war ein Beweis.
1.
Pan nahm ihr Wasserglas mit nach draußen in den Garten auf dem Dach der Welt – ein Felsplateau hoch über der Akademie, der sie umschließenden Mauer, dem Dorf und dem Meer. Im Garten standen Stühle und Tische sowie hier und da eine Topfpflanze. Bunte Kleckse gegen das Grau, etwas Schönes vor dem hässlichen Hintergrund, wie ein Symbol der Akademie selbst – sie war überwiegend trostlos, aber dann gab es doch ganz überraschend hin und wieder einen Moment der Freude. Sie setzte sich an einen Tisch und blickte hinunter auf die Akademie. Als jemand sich zu ihr setzte, sah sie gar nicht auf. Sie wusste schon, wer es war.
»Nur sechs von uns verlassen die Insel«, sagte Jen. »Du hattest recht damit.«
Hatte ich nicht, dachte Pan. Jedenfalls nicht so, wie du dir das vorstellst. Nur sechs von uns haben die Insel verlassen, aber Nate ist nicht tot. Es war zu schwierig zu erklären, also schwieg sie. Trotzdem hätte sie beinahe gelächelt. Es war doch ironisch – genau der Fall, in dem sie vermutlich falsch gelegen hatte, war derjenige, der Jen endlich davon überzeugte, dass Pans Intuitionsgabe nicht irgendein absurdes Hirngespinst war. Eine Minute lang saßen sie schweigend am Tisch.
»Ich soll dich holen«, sagte Jen.
»Mich holen?«
»Es gibt ein Treffen.« Jen seufzte. »Des ganzen Teams – zumindest, was davon übrig ist. Dr. Macredie hat eine Beratungsstunde für uns angesetzt. Wir sollen über unsere Gefühle reden, heulen und schluchzen und dann geheilt hinausgehen. O Mann, Pandora. Das klingt wie ein Albtraum.«
Auch für Pan klang es wie ein Albtraum, und Albträume hatte sie in letzter Zeit schon genug. Was sie aber dringend brauchte, war Zeit zum Nachdenken.
»Wann denn?«, fragte sie.
»In fünfzehn Minuten. Alle treffen sich an der Schwesternstation.« Jen schmunzelte. »Selbst Sanjit kommt, so wie es aussieht. Sie haben seinen Knöchel untersucht. Nur verstaucht.« Ihre Stimme wurde zum Flüstern und Pan hätte ihre nächsten Worte beinahe nicht verstanden. »Eine teure Verstauchung.«
Pan wusste nicht, was sie sagen sollte, also schwieg sie und betrachtete die schwarzen Punkte am Himmel. Vögel, die auf dem Wind und der warmen Luft dahinsegelten.
»Wie geht es dir?«, fragte Jen schließlich.
»Ich bin froh, dass wir von der Insel weg sind«, sagte Pan. »Seltsam, im Ernst. Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal froh sein würde, wieder in der Akademie zu sein.«
»Ich meine, wie geht es dir wegen … Nate? Möchtest du darüber reden? Ich meine … wir wussten ja alle, dass da etwas zwischen euch beiden lief. Ich dachte nur … Also, sag mir einfach, dass es mich einen feuchten Dreck angeht, wenn das jetzt voll daneben ist, ja?«
Pan lehnte sich in ihrem Stuhl zurück und betrachtete die Berge, die sich zu ihrer Linken erhoben. Der Schnee war größtenteils geschmolzen, nur ganz oben um die Gipfel lag noch eine dicke Schicht, wie Zuckerguss auf einem Kuchen. Vermutlich blieb dort ein Teil des Schnees das ganze Jahr über liegen, ein niemals endender Winter. Aber einzelne Stellen an den Bergflanken leuchteten bereits grün. Neues Leben erwachte, versuchte, sich zu behaupten. Überleben war das Einzige, was zählte. Oder vielleicht war es noch einfacher. Ein Kreislauf aus Leben und Tod, der seit Anbeginn der Zeit existiert hatte. Eine friedliche Koexistenz. Das hatte sie schon einmal gedacht, fiel ihr ein – damals, als sie zum ersten Mal den Garten betreten hatte. Es wirkte tiefgründig, war aber genau genommen vollkommen nutzlos.
»Genau dafür ist dieses Treffen doch gedacht, oder?«, fragte Pan. »Um darüber zu reden, wie wir uns fühlen.«
»Schon«, gab Jen zu. »Aber ich spiele da nicht mit. Oh ja, ich möchte auf jeden Fall mit Dr. Macredie reden. Aber den ganzen sentimentalen, gefühlsduseligen Mist kann sie sich sonst wohin stecken. Ich möchte wissen, was da draußen passiert ist. Ich möchte die Wahrheit hören.«
Pan vermutete, dass es sehr schwer sein würde, die Wahrheit zu packen, aber es war sinnlos, das auszusprechen.
»Warum fragst du mich denn dann nach Nate?«, fragte sie. »Ist das nicht genau die Art von gefühlsduseligem Mist, den du nicht leiden kannst?«
»Ich bitte dich ja nicht, mir was vorzuheulen.« Wieder seufzte Jen. »Aber wenn ich auf der Insel etwas gelernt habe, dann das: Wir sind ein Team.« Sie schnaubte. »Ein seltsames, durchgeknalltes Team, das schon, aber Dr. Macredie ist definitiv keine von uns. Keiner der Mitarbeiter hier gehört zu uns. Sie können sich alle zum Teufel scheren.«
Pan rückte ihren Stuhl und sah Jen ins Gesicht. Jen war niemand, der gern über seine Gefühle redete. Jen empfand Gefühle als Schwäche, gegen die man sich wappnen musste. Sie lebte nach einem einzigen, großen Grundsatz: um ihr persönliches Überleben zu sichern. Pan erinnerte sich an den ersten Konflikt, den sie beide ausgetragen hatten, damals in Gwynnes Waffentraining. Sie erinnerte sich auch noch daran, welche Diskussion Miss Kingston, die stahlharte Fitnesstrainerin, in ihrer ersten Unterrichtsstunde an der Akademie angestoßen hatte. Die Gruppe hatte darüber geredet, ob es richtig sei, ein schwaches Individuum zu opfern, falls das dem Überleben der Gruppe diente. Jen hatte darauf bestanden, dass nur die Stärksten ein Überleben verdienten. Doch während des Aufenthalts auf der Insel hatte Jen sich nicht dagegen ausgesprochen, dass Sanjit geschützt werden musste. Als Nate erschossen worden war (war er überhaupt erschossen worden?), hatte sie versucht, sich über den Bootsrand ins Meer zu stürzen und ihn zu holen. Hatte Jen etwa ein weiches Herz, das sie mit allen erdenklichen Mitteln überspielen wollte? Und konnte man ihr trauen?
»Du hast diesen Mann, den Wächter, dort in der Höhle, getötet«, sagte Pan. »Wie geht es dir damit?«
»Du weichst meiner Frage aus.«
»Ja. Aber du hast mit den Gefühlen angefangen.«
Schweigen. Pan wartete ab.
»Willst du die Wahrheit hören?«, fragte Jen.
»Nein. Lüg mich an. Natürlich die Wahrheit.«
Jen lachte. Pan wurde klar, dass sie Jen zum ersten Mal überhaupt lachen hörte. Es veränderte ihr Gesicht, verlieh ihm eine Wärme, die normalerweise fehlte.
»Es war schwieriger, als ich dachte«, sagte Jen. Ihre Stimme war ungewohnt nachdenklich. »Und gleichzeitig war es viel einfacher. O Mann, das passt überhaupt nicht zu mir. So ein sinnloses Gerede.«
»Was ist passiert?«
»Ich habe mich über den Rand der Klippe rutschen lassen und bin in die Höhle geschlichen. Mir war klar, dass ich schnell sein musste, weil er mich bestimmt hören würde. Er hat mich aber nicht gehört. Er hat neben dem fast erloschenen Feuer geschlafen. Er ist erst aufgewacht, als ich nur noch ein, zwei Meter von ihm entfernt war. Er hat versucht, aufzuspringen, hat nach irgendwas gegriffen. Wahrscheinlich nach einer Waffe. Also habe ich ihm mein Messer in den Bauch gerammt.« Jen starrte in die Ferne, in eine dunkle Höhle, Angesicht zu Angesicht mit einem sterbenden Menschen. »Er hat geächzt. Blut ist über meine Hand gelaufen. Es war so heiß und es war so viel. Aber ich wusste, dass er nicht sterben würde. Jedenfalls nicht gleich. Also habe ich noch mal auf ihn eingestochen. Ins Herz. Jedenfalls dahin, wo ich sein Herz vermutet habe. Dann ist er irgendwie zusammengeklappt. Einmal habe ich dann noch zugestochen.«
»Wie hast du dich gefühlt?«
Diesmal dauerte das Schweigen länger.
»Du wolltest die Wahrheit hören«, sagte Jen. Ihre Stimme war jetzt ganz leise. »Als Wei-Lin diesen Kerl getötet hatte. Mit dem Pfeil im Hals. Da habe ich mich … Scheiße gefühlt. Ich war neidisch auf sie. Sie ist nur so ein Weichei und trotzdem hatte sie jemanden getötet. Es war so, als würde man von jemandem besiegt werden, von dem man genau weiß, dass er einem unterlegen ist.« Sie sah Pan in die Augen. »Wie damals, als du mich im Stockkampf besiegt hast. Hasst du mich jetzt?«
»Nein.«
»Seltsam. Ich glaube, ich hasse mich selbst.« Jen wandte sich wieder ihren inneren Bildern zu. »Aber so habe ich mich gefühlt. Und ich war ganz scharf darauf, diesen Rückstand auszugleichen. Es hat sich herausgestellt, dass es ganz leicht ist, jemanden umzubringen. Aber danach gibt es kein Zurück. Und keine Möglichkeit, es jemals ungeschehen zu machen. Das ist die Schwierigkeit daran. Es ist so verdammt endgültig.«
»Jen? An was erinnerst du dich noch aus deinem Leben vor der Akademie? Vor deiner Rettung?«
Jen rieb sich die Augen.
»Was sollen diese ganzen Fragen, Pandora? Versuchst du, eine Beziehung zu mir aufzubauen? Hey, Mädchen, da gibt es etwas, was du über mich wissen musst. Ich bin kein Kumpel für Pyjama-Partys, habe keine Lust, dir Zöpfe zu flechten, und Gegacker über Jungs kann ich nicht leiden.«
Pan lächelte. »Das habe ich mir schon so gedacht. Aber du hast damit angefangen.«
»Mittlerweile wünschte ich, ich hätte das nicht getan.«
Pan hob eine Augenbraue.
»Du beantwortest meine Fragen nicht«, fuhr Jen fort. »Aber selbst haust du mir jede Menge Fragen um die Ohren. Worum geht’s?«
»Die Wahrheit?«
»Nein. Lüg mich an.«
»Ich muss wissen, ob ich dir vertrauen kann.«
»Warum?«
»Das sage ich dir, wenn ich dir vertrauen kann.«
Jen seufzte. »Ich verstehe nichts von Vertrauen. Misstrauen ist wesentlich gesünder.« Sie erhob sich. »Komm, Pandora, wir gehen eine Runde.«
Viele Möglichkeiten zum Spazierengehen gab es nicht. Der Garten auf dem Dach der Welt bildete ein Rechteck, das zu drei Seiten von tiefen Abgründen begrenzt war. Sie schlenderten zu der Seite, die am weitesten vom Spitalgebäude entfernt war. Die Mädchen stellten sich an den Abgrund und betrachteten die Gebäude weit unter ihnen.
»Ich erinnere mich ziemlich genau an dasselbe wie alle anderen«, sagte Jen. »Tod. Abscheulichkeiten. Kampf. Andererseits ist das eh die Kurzfassung meines gesamten Lebens.«
»Jeder erinnert sich an dasselbe wie jeder andere«, erwiderte Pan. »Kommt dir das nicht komisch vor?«
Jen starrte sie ratlos an. »Im Lösen von Rätseln bin ich nicht gut, Pandora. Nein, ich finde das nicht komisch. Ich empfinde das als normal.«
»Was ist mit deiner Familie?«
»Ach Gott. Meine Familie? Was soll das?« Sie setzte sich auf die Felskante, ihre Beine baumelten über dem Abgrund. Pan setzte sich ungefähr einen Meter hinter sie. Ihr waren Höhen nicht geheuer und sie war nicht gewillt, ihr Schicksal herauszufordern.
»Es gab nur meine Mutter«, fuhr Jen fort. »Sie verschwand eines Tages, als ich vierzehn war. Stieg bei irgendeinem Typen hinten auf die Harley und danach habe ich sie nie wiedergesehen. Was soll’s? Das ist unwichtig.«
»Unwichtig?«
»Ja. Genau wie das Virus, die ganzen Toten, das ganze Leid. Weißt du, was ich denke, Pandora? Ich glaube, das war das Beste, was passieren konnte. Die meisten Leute, die ich kannte, haben sich gequält. Das Leben war hart. Manchmal war es total schwierig, von einem Tag auf den anderen durchzukommen. Und ich hatte es noch leicht im Vergleich zu den meisten anderen. Denk doch mal an die ganzen Kinder in der Dritten Welt, die verhungern, an vermeidbaren Krankheiten sterben. Die Welt war beschissen. Sie lag sowieso im Sterben. Das Virus hat uns allen einen Gefallen getan. Es hat das ganze Leid beendet und jetzt können wir neu anfangen.«
»Glaubst du das denn wirklich?«
»Ja. Vielleicht bin ich einfach anders als du. Ich fand die Welt nie wunderbar. Ich fand sie beschissen. Die allermeisten Leute waren Schweine. Nur haben einige es eben besser getarnt als andere. Nein. Das Virus hat der Welt einen Gefallen getan und das einzig Dumme ist, dass es seine Aufgabe nicht zu Ende gebracht und uns nicht alle ausgelöscht hat.«
Dazu sagte Pan nichts. Es gab nicht viel zu sagen. Aber sie fragte sich, was für ein Leben Jen wohl geführt hatte, wenn sie so schlecht über die Welt dachte. Nach einer Weile stand Jen auf und wischte sich den Hosenboden sauber.
»Bist du fertig, Pandora? Wenn wir jetzt nicht losgehen, kommen wir zu spät zu diesem Treffen.«
Pan war nicht fertig. Noch lange nicht. Aber sie konnte warten.
Die Gruppe saß um den Tisch herum, den Pan von so vielen persönlichen Förderstunden mit Dr. Morgan kannte. Dr. Macredie hatte am Kopfende des Tischs Platz genommen, Wei-Lin zu ihrer Linken und Sanjit zu ihrer Rechten. Sam und Karl saßen mit ineinander verschränkten Händen neben Sanjit. Pan und Jen setzten sich neben Wei-Lin.
Pan musterte die anderen Mitglieder ihres Teams. Sanjit ließ den Kopf hängen, seine Finger zeichneten Muster in das Kondenswasser, das sich unter seinem Wasserglas gebildet hatte. Ich muss ihn im Auge behalten, dachte Pan. Er ist in sich zurückgezogen, verletzlich. Ich kann und werde nicht zulassen, dass er es ihm wie Cara ergeht. Auch Sam und Karl wirkten bedrückt, aber daran, wie fest sie sich aneinanderklammerten – Pan sah, dass ihre Fingerknöchel weiß hervortraten – war deutlich zu sehen, dass sie sich in ihrer Verzweiflung gegenseitig beistanden. Ich freue mich für sie, dachte Pan. Das Glück ist so vergänglich und sie müssen es mit aller Kraft festhalten. Wei-Lin saß reglos da, den Blick auf Dr. Macredies Gesicht gerichtet, aber ein Pulsieren in ihrem Hals verriet den Aufruhr in ihrem Inneren. Jens Miene war genauso verschlossen. Sie hat recht, dachte Pan. Wir sind ein seltsamer Haufen, jeder von uns kämpft gegen seine eigenen Dämonen. Aber wir haben nur einander.
Dr. Macredie hüstelte und klopfte sanft mit einem Finger auf die Tischplatte.
»Vielen Dank, dass Ihr alle gekommen seid«, sagte sie. Fast schon automatisch beugte sich Pan über die Tischplatte vor. Die Frau sprach so leise, dass die Luft ihre Worte beinahe schon auszulöschen schien, während sie sie noch aussprach. »Dr. Morgan lässt sich entschuldigen, er hält eine Ansprache an die anderen Schüler. Nach dem, was mit Nate passiert ist, halten wir es für wichtig, dass alle informiert sind. Alle sollen Gelegenheit erhalten, angemessen … zu trauern.«
Keiner sagte etwas. Dr. Macredie wischte sich eine rote Haarsträhne aus dem Gesicht.
»Ich habe Erfahrung mit therapeutischen Gesprächen«, fuhr sie fort. »Und ich weiß, wie wichtig es ist, nach einem Verlust zu reden, unseren Emotionen freien Lauf zu lassen, unsere Gefühle miteinander zu teilen. Ich glaube, es wäre richtig, wenn jeder von uns jetzt etwas über Nate sagen würde – wir etwas aus seinem Leben erzählen, an das wir uns erinnern, und was uns sein Tod bedeutet. Möchte jemand anfangen?«
Fünf Sekunden lang herrschte Schweigen.
»Okay. Ich.« Jen verschränkte die Arme. »Ich möchte wissen, warum ausgerechnet unser Team so vom Unglück verfolgt wird. Ich meine, erst Cara und jetzt Nate. Soweit ich weiß, sind bis jetzt nur zwei Schüler gestorben, und beide waren Mitglieder unseres Teams. Das zufällig auch noch das kleinste aller Teams ist. Also, ich weiß ja nicht, wie die anderen darüber denken, aber mir kommt es so vor, als wäre das verdammt unwahrscheinlich, ein zu großer Zufall. Sind wir verflucht oder ist hier irgendwas anderes im Gange?«
Wei-Lin warf Jen einen Seitenblick zu und die Ader in ihrem Hals pulsierte schneller. Aber sie sagte nichts, sondern wandte sich wieder Dr. Macredie zu, die ihre Finger ineinanderflocht und die Hände in den Schoß legte.
»Jen, ich weiß nicht, was ich dazu sagen …«
»Könnten Sie etwas lauter sprechen?« Jen tippte sich auf das rechte Ohr. »Hier kommt nichts an.«
Dr. Macredie wand sich auf ihrem Stuhl, aber als sie weiterredete, war ihre Stimme lauter. Wenn auch nicht viel.
»Jen, an so etwas wie Flüche glaube ich nicht. Und was das andere angeht, was hier im Gange sein könnte – ich habe keine Ahnung, was du damit meinst.«
»Okay. Gut. Vielleicht haben wir einfach Pech. Dann stelle ich jetzt aber noch eine andere Frage: Warum hat die Akademie uns da rausgeschickt, an so einen gefährlichen Ort, nur mit einem Messer und Pfeil und Bogen bewaffnet, gegen Soldaten mit automatischen Waffen? Was sollte der ganze Mist, den Gwynne da veranstaltet hat – dass wir zurückgelassen würden, wenn wir nicht zu einer bestimmten Uhrzeit wieder da sind? Ich meine – kommen Sie schon, Dr. Macredie – im Ernst? Irgendwas an dieser ganzen Aufgabe stinkt doch zum Himmel. Sie wissen das. Wir wissen das. Ich möchte die Wahrheit erfahren.«
Dr. Macredie räusperte sich.
»Du redet hier über operative Belange«, sagte sie. »Und ich bin nicht die richtige Ansprechpartnerin, um zu erklären …«
Jen lachte, aber es klang bitter.
»Wie bitte? Operative Belange? Mann, Sie reden wie eine Politikerin. Wie wäre es denn mal mit der schlichten Wahrheit? Ich finde nämlich, das ist das Mindeste, was wir erwarten können.«
»Meinst du nicht, es wäre wichtiger, über Nate zu reden?«
»Ich rede doch über Nate«, sagte Jen. »Er ist da draußen gestorben und ich möchte wissen, warum. Sie kommen uns hier mit Ihrem ganzen Mist von wegen ›wir sollten über unsere Gefühle reden‹, aber von meinen Gefühlen wollen Sie nichts hören. Ich formuliere es jetzt so einfach, wie ich kann. Mein Gefühl sagt mir, Nates Tod war bestenfalls unnötig, schlimmstenfalls ist die Akademie ganz direkt dafür verantwortlich. Wir wollen eine Erklärung hören.«
»Ich bin schuld.«
Die Stimme war ganz leise, kaum mehr als ein Flüstern. Sanjit hatte den Kopf nicht gehoben und auch nicht aufgehört, wie unter Zwang Muster in den Wasserfilm zu zeichnen.
»Es war mein Fehler«, fuhr er fort. »Wenn ich mir nicht den Fuß verstaucht hätte, hätten wir wahrscheinlich alle abhauen können. Nate hat dieses Ablenkungsmanöver nur durchgezogen, um mich zu beschützen, weil ich nicht mithalten konnte. Ich war derjenige, ich war das schwache …«
»Hey, halt die Luft an, Sanjit.« Jen hob die Hand. »Hör sofort auf damit. Das ist Quatsch und das weißt du selbst. Selbst wenn wir alle fit gewesen wären, hätten wir die Typen niemals abhängen können. Wir sind wie eine Büffelherde durch den Wald getrampelt. Genauso gut hätten wir Leuchtsignale abfeuern können. Unsere einzige Chance war es, uns zu verstecken, während Nate sie weggelockt hat. Du hattest mit seinem Tod nichts zu tun und du hast keinen Grund, dich schuldig zu fühlen.«
»Vielleicht solltest du einfach zulassen, dass Sanjit ausspricht, was er fühlt«, mahnte Dr. Macredie. »Vielleicht ist es ihm ein Bedürfnis.«
»Und vielleicht käme Ihnen das ganz gelegen, weil Sie dadurch vermeiden können, mir meine Fragen zu beantworten.« Jen stemmte beide Hände auf den Tisch. »Also, Doc. Kommen wir doch einfach zum Punkt, ja? Warum hat die Akademie uns auf diese Mission geschickt?«
Dr. Macredie blickte in die Runde, als suche sie Unterstützung, aber keiner sagte etwas. Sie seufzte.
»Das weiß ich nicht«, sagte sie. »Soweit mir bekannt ist, gab es Berichte über einen Überlebenden und ihr wurdet hingeschickt, um sie oder ihn ausfindig zu machen. Aber keiner hatte ernsthaft Hoffnung – es war ein sehr schwammiger Bericht – und deswegen wurde daraus eine Aufgabe, ein Überlebenstraining. Wenn wir gewusst hätten, dass sich dort Bewaffnete aufhalten, hätten wir euch niemals losgeschickt. Natürlich nicht. Es haben nur so wenige überlebt. Warum sollten wir euch absichtlich einem Risiko aussetzen?«
»Nun, ich glaube, Sie vergessen, dass das genau meine Frage war«, erwiderte Jen. »Und ich habe immer noch keine Antwort darauf.«
Es gab noch mehr Fragen, die Pan gerne stellen wollte. Wäre die statistische Wahrscheinlichkeit, an einer Stelle so viele sogenannte Überlebende zu finden, nicht äußerst gering? Warum erinnerten sich so viele Schüler der Akademie an die gleichen Dinge in den gleichen Einzelheiten? Aber es war zu riskant, solche Fragen zu stellen. Behalte deinen Verdacht für dich, dachte sie. Und vertraue niemandem. Schon gar nicht Dr. Macredie.
»Darauf weiß ich auch keine Antwort«, sagte Dr. Macredie. »Wenn ich sie wüsste, würde ich sie euch mitteilen. Aber du wirst es mir nachsehen müssen, Jen. Ich verstehe deine Bedenken, wirklich, aber wir sind aus therapeutischen Gründen hier zusammengekommen und ich kann nicht zulassen, dass du dieses Gespräch an dich reißt. Sanjit beispielsweise hat ganz offensichtlich Schuldgefühle wegen des Vorfalls, und ich bin der Ansicht, ihm steht es zu, uns das mitzuteilen und sich unsere Unterstützung zu sichern. Sanjit?«
Selbst in diesem Moment hob Sanjit nicht den Kopf. Seine Finger zeichneten Achten in die Pfütze, immer und immer wieder.
»Ich … vor dem Virus«, sagte er mit fast unhörbarer Stimme, »gab es mit mir immer nur Ärger. Ich weiß nicht. Es ist, als … als würde ich das Unglück anziehen. Ich bringe allen um mich herum nur Schwierigkeiten.«
»Was für Schwierigkeiten?«, fragte Dr. Macredie. Sie beugte sich in ihrem Stuhl nach vorn.
Sanjit zuckte mit den Achseln. »Probleme eben. Ich glaube, das spielt jetzt keine Rolle mehr. Außer für Nate …«
Sam hüstelte und erhob sich. Karl tat es ihr nach – es war schwer zu beurteilen, ob er sie damit unterstützen oder nur ihre Hand nicht loslassen wollte.
»Dr. Macredie«, sagte Sam. »Vielleicht versuchen Sie ja, uns zu helfen. Ich weiß es nicht. Um ehrlich zu sein, ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich denken soll. Aber ich möchte hier nicht gemütlich herumsitzen und über Gefühle plaudern. Das hilft mir nicht. Und es wird die Toten definitiv nicht wieder zum Leben erwecken. Jen hat recht. Wir haben ein Recht auf Antworten. Also, wenn Sie keine haben, dann gehe ich jetzt.«
Karl warf ihr einen Seitenblick zu und nickte dann.
»Dem schließe ich mich an«, sagte er.
Dr. Macredie seufzte. »Sam, Karl«, sagte sie. »Es ist ungesund, seine Gefühle zu unterdrücken. Mir ist schon klar, dass ihr alle von dieser Expedition erheblich traumatisiert seid. Ein weiterer Mensch, einer der … Feinde … wurde getötet.« Sie sah zu Wei-Lin, die jedoch nicht reagierte. »Von dir«, fuhr sie dann fort. »Ich kann mir nicht einmal ansatzweise vorstellen, wie schwierig das für euch alle sein muss. Aber wenn diese Wunden heilen sollen, dann müsst ihr über eure Gedanken und eure Gefühle sprechen. Wir sind hier alle Freunde. Und Freunde unterstützen einander.«
Stuhlbeine scharrten über den Boden. Wei-Lin erhob sich. »Wir haben Freunde, Dr. Macredie«, sagte sie. »Unser Team. Was davon übrig ist.«
Sie sah in die Runde und Pan und Jen standen auf. Jen grinste. Sanjit sah hoch, dann stemmte er sich mit den Händen auf der Tischplatte ab und kam unsicher auf die Füße. Sam streckte eine Hand aus, um ihn zu stützen, aber er beachtete sie nicht.
»Sie waren bei der Expedition nicht dabei, Dr. Macredie«, sagte Wei-Lin. »Keiner von der Akademie war dabei. Wir haben uns dort gegenseitig unterstützt, ohne Hilfe von außen. Wir werden einander weiter unterstützen.«
Dr. Macredie fuhr sich mit dem Handrücken über die Stirn. Plötzlich wirkte sie erschöpft.
»Ihr macht einen Fehler«, sagte sie. »Aber ich kann euch nicht zwingen. Ihr wisst, wo ihr mich findet, wenn ihr reden wollt. Ich stehe euch zur Verfügung, auch außerhalb unserer Sprechzeiten im Spital. Kommt zu den Personalunterkünften, wenn es einen Notfall gibt. Andere Schüler haben das schon genutzt.«
»Danke«, sagte Wei-Lin. »Wir wissen das zu schätzen.«
Sam und Karl halfen Sanjit, die steile Treppe, die vom Spital zur Akademie hinabführte, zu bewältigen. Es hatte Probleme damit, seinen verletzten Knöchel voll zu belasten, also bot Karl ihm seine Schulter zum Abstützen. Sam ging einen oder zwei Schritte voraus, als die beiden mühsam treppab humpelten. Wei-Lin folgte ihnen.
Sie kamen sehr langsam vorwärts, und als die Gruppe anhielt und sich ausruhte, drängelten Jen und Pan vorbei. Nach wenigen Minuten hatten sie einen großen Vorsprung. Jen kicherte.
»Ich muss zugeben, es hat mir gefallen, Dr. Macredie so stehen zu lassen«, sagte sie. »Hast du gesehen, was sie für ein Gesicht gezogen hat, als wir ihr Spiel nicht mitgespielt haben?«
»Wir müssen auf Sanjit aufpassen«, sagte Pan. »Klar, wir sind alle angeschlagen, aber ich würde sagen, bei ihm ist es am brenzligsten.«
»Du hast wahrscheinlich recht. Ich werde mal mit Karl reden. Er soll ihn im Schlafsaal im Auge behalten. Sanjit redet ja nicht viel, deswegen ist er leicht zu übersehen.«
»Genau. Und wir können uns nicht leisten, ihn zu übersehen, so wie wir Cara übersehen haben.«
Sie erreichten die steinige Ebene der Akademie. Eine blasse Sonne hing tief am Horizont und es war keine Menschenseele zu sehen. Dr. Morgan hatte seine Ansprache an die Schüler wohl schon beendet. Pan wandte sich zu Jen um.
»Kannst du irgendwoher ein Stemmeisen oder besser noch einen Bolzenschneider besorgen?«, fragte sie.
»Warum?«
»Kannst du?«
Jen runzelte die Stirn und musterte Pan. »Ich habe da so meine Methoden«, sagte sie. »Einen Bolzenschneider allerdings eher nicht. So einen habe ich noch nie in einem der Lagerräume gesehen. Aber ein Stemmeisen könnte ich vermutlich beschaffen.«
»Heute Abend? Und ein Seil?«
»Wahrscheinlich. Worum geht’s denn?«
»Ich möchte, dass wir etwas versuchen. Nur wir beide. Kein anderer darf davon wissen.« Pan verspürte ein schlechtes Gewissen. Das Team hatte sich gerade so einig gezeigt und schon ließ Pan die anderen wieder außen vor. Nur heute Abend, dachte sie. Morgen erzähle ich ihnen alles, was wir herausgefunden haben. Falls wir überhaupt etwas herausfinden. »Schon gar keiner von den Mitarbeitern.«
»Wird es denn gefährlich?«
»Sehr wahrscheinlich. Wenn wir erwischt werden.«
Jen lächelte und ihre Miene hellte sich auf. Sie wirkte viel liebenswerter, wenn sie lächelte. Es war bemerkenswert, wie schnell Eiseskälte sich in Wärme verwandeln ließ. Dasselbe, wurde Pan klar, galt auch umgekehrt. Plötzlich sah sie im Geiste Nate vor sich. Sie fröstelte.
»Großartig«, sagte Jen. »Ich liebe Gefahr.«
2.
Der Schlafsaal war so, wie Pan ihn in Erinnerung hatte. Sauber, ungemütlich und vollkommen bar jeder Wärme. Er roch nach Einsamkeit. Es war niemand da, als Pan eintrat. Jen war losgegangen, um die Ausrüstung zu besorgen. Die beiden hatten verabredet, sich um Mitternacht vor dem Schlafsaal zu treffen. Pan war froh, ein bisschen Zeit für sich zu haben.
Sie schlug die Bettdecke zurück. Jemand hatte in ihrer Abwesenheit ihr Bett gemacht, was an sich schon eine Überraschung war. In der Akademie kümmerte man sich um seine eigenen Aufgaben, denn niemand hatte Zeit oder Lust, auch noch anderen zu helfen. Pan lächelte. Sie spürte Wei-Lin hinter dieser kleinen Geste der Solidarität. Die Matratze war hart und die Federn drückten gegen ihren Rücken, als sie sich hinlegte. Obwohl sie im Spital so lange geschlafen hatte, war sie todmüde, dennoch kam ihr das unbequeme Lager gerade recht. Sie wollte nicht wieder schlafen. Noch nicht.
Auf dem Rückweg von der Insel war ihr eine Erkenntnis gekommen, eine Gewissheit, die Pan nun noch einmal heraufzubeschwören versuchte. Die Akademie belog ihre Schüler – schlimmer noch, sie manipulierte ihre Erinnerungen, pflanzte ihnen neue Erinnerungen ein. Das fühlte sich immer noch wahr an. Aber war sie sich immer noch hundertprozentig sicher, dass Nates Tod nur eine Inszenierung gewesen war, nur eines von vielen Trugbildern in dieser vernebelten und verspiegelten Scheinwelt? Nein, von ihrem ursprünglichen Gefühl waren nur noch Spuren vorhanden, als hätten die dazwischen liegenden Stunden es verblassen lassen. Vielleicht hatte sie in manchen Dingen recht, in anderen aber nicht. Gab es irgendein Indiz dafür, dass Nate nicht tot war? Nein. Genau genommen hatte sie mit eigenen Augen gesehen, wie er gestorben war. Sie besaß nur ihre Intuition. War es vielleicht ein verzweifelter Akt der Selbsttäuschung? Weigerte sie sich einfach anzuerkennen, dass Nate tot war und niemals zurückkehren würde? So tot wie alle anderen Menschen, die ihr nahegestanden hatten? Ihre Mutter. Ihr Bruder. Ihre Freunde. Gedanken verwoben sich, verwirbelten und wurden immer verschwommener. Sie wusste nur eines mit Sicherheit: Da draußen gab es Antworten auf ihre Fragen, und die musste sie finden.
An dieser Entschlossenheit klammerte sie sich fest, selbst, als sie einschlief. Diesmal träumte sie nicht.
Als sie erwachte, war es beinahe Mitternacht und alle anderen schliefen. Sie hatte sich einen inneren Wecker gestellt und freute sich darüber, dass es funktioniert hatte. Pan glitt aus dem Bett und schlüpfte in ihre Tarnjacke – Standardausrüstung der Akademie und ein willkommener Schutz gegen die frostige Nacht. Der Winter ging zu Ende und die Temperaturen waren jetzt milder als bei ihrer Ankunft, aber draußen würde es mitten in der Nacht dennoch kalt sein. Pan tastete sich durch den Schlafsaal zu Jens Bett. Sie musste sie nicht aufwecken. Pans Augen hatten sich an die Dunkelheit gewöhnt und sie sah, dass Jen mit offenen Augen auf der Seite lag. Pan wies mit dem Kinn in Richtung Tür und Jen nickte. Sie war bereits angezogen und die beiden Mädchen tappten schweigend zwischen den Bettenreihen hindurch. Die Kälte draußen war eisiger, als Pan befürchtet hatte. Ein scharfer Wind schnitt durch ihre Kleidung und drang in ihre Knochen. Fröstelnd zog sie die Jacke enger um sich.
»Hast du das Stemmeisen und das Seil besorgt?«, flüsterte sie.
Jen nickte und verschwand hinter der Wand der Schlafbaracke. Einen Moment lang hörte Pan sie in der Dunkelheit rumoren, dann tauchte sie mit beiden Werkzeugen wieder auf.
»Ich dachte, es wäre sicherer, die zu verstecken«, erklärte sie.
»Gut«, sagte Pan. »Außerdem brauche ich deine Armbanduhr.«
»Meine Armbanduhr? Warum denn?«
»Ich habe meine Gründe.«
Einen Moment lang sah Jen Pan einfach nur an, dann zuckte sie mit den Achseln, löste den Riemen und reichte Pan die Uhr.
»Danke.« Pan nahm ihre eigene Uhr ab. »Warte hier, ich lege sie in den Schlafsaal.«
»Du bist echt schräg, Pandora. Das ist dir klar, oder?«
Pan zuckte mit den Schultern. »Ist mir auch schon in den Sinn gekommen.«
Es dauerte einen Moment, bis sie die Uhren auf die Kopfkissen gelegt hatte, dann stand Pan wieder neben Jen in der kalten Nacht.
»Okay«, sagte sie. »Die Party kann losgehen.«
»Wohin wollen wir?«, erkundigte sich Jen.
»Das siehst du dann schon.«
»Ein bisschen Vertrauen?«
»Misstrauen ist gesünder.«
Den größten Teil der Strecke legten sie im Dauerlauf zurück. Pan fiel es leichter als erwartet. Die Strapazen ihrer Mission auf der Insel hatten sie ausgelaugt, aber nach einer Weile fand sie ihren Rhythmus. Jen war keine Schwäche anzumerken, obwohl sie die Brechstange und das Seil trug. Lange bevor sie den Fluss erreicht hatten, war sein dumpfes Tosen zu hören. Das Schmelzwasser hatte ihn anschwellen und reißender werden lassen als an dem Tag, an dem Pan mit Nate am Ufer gesessen hatte. Sie hoffte, das Rauschen würde ihre Schritte übertönen. Sie rannte am Ufer entlang, Jen war einige Schritte hinter ihr. Sie kamen an den Unterkünften der Mitarbeiter vorbei. Ein paar Lichter brannten, aber die meisten Häuser lagen im Dunkeln. Niemand stand auf seiner Veranda und sie konnten unbemerkt passieren. Danach war es wieder vollkommen dunkel, aber ihre Augen hatten sich daran inzwischen vollkommen angepasst und sie kamen relativ gut voran. Nach nur fünfzehn Minuten ragte eine düstere Masse vor ihnen auf: die Mauer.
»Hab schon geahnt, dass wir hierherkommen würden«, sagte Jen.
»Warum?«
»Ich würde ja sagen, Intuition, aber darauf besitzt du ja das Monopol. Dann eben einfache Logik. Was für ein Ziel sollten wir sonst haben? Wir wollen über die Mauer, oder?«
»Nein«, sagte Pan. »Drunter durch.«
Der Himmel war schwarz, kein Mond schien. Im tiefen Schatten der Mauer hätte man ohnehin selbst im Mondschein kaum etwas gesehen. Pan hielt an und kroch dann näher an die Mauer heran. Sie sah das aufgewühlte Wasser, das schäumend und strudelnd durch das Schleusentor strömte, aber das Tor selbst konnte sie nicht erkennen.
»Und was jetzt?«, wollte Jen wissen.
»Es gibt ein Schleusentor«, erwiderte Pan. »Ich war einmal mit Nate hier und er hat es mir gezeigt. Das Wasser fließt direkt hinunter ins Dorf und später dann, das nehme ich jedenfalls an, bis ins Meer. Ein Teil des Schleusentors ist verrostet. Es gibt vielleicht eine Lücke.«
»Ach ja? Und wie sieht es auf der anderen Seite der Mauer aus? Da ist doch bestimmt auch wieder so ein Tor.«
»Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich vermute, diese Mauer und das Gitter sind nur dazu da, uns hier drin gefangen zu halten. Es ist durchaus möglich, dass es auf der anderen Seite keins gibt. Und selbst wenn … es liegt nahe, dass es ähnlich verrostet ist wie das hier. Es ist unsere beste Chance, auf die andere Seite zu kommen.«
»Ich würde eher sagen, es ist unsere beste Chance zu ertrinken«, sagte Jen »Es wäre sinnvoller, einfach über die Mauer zu klettern.«
»Schon probiert«, sagte Pan. »Ich vermute, dass sie die Mauer jetzt besser überwachen.«
»Du warst auf der anderen Seite?«, fragte Jen. »Pandora Stone, du bist wirklich eine Überraschung. Ich hätte nie damit gerechnet, dass so was in dir steckt.«
Pan dachte einen Moment lang nach. »Als Nate und ich über die Mauer geklettert sind, haben sie uns innerhalb von Sekunden geschnappt. Wir sind kaum unten angekommen, da waren schon überall Bewaffnete und haben uns umzingelt. Und als wir wieder zu uns gekommen sind, waren wir wieder zurück in der Akademie, in einer Art Gefängniszelle. Sie hatten mir irgendwas injiziert. Mich ausgeknockt.«
»Mann«, sagte Jen. »Davon habt ihr uns überhaupt nichts erzählt.«
»Na ja.« Pan seufzte. »Ich habe gedacht, uns hat jemand verraten. Vielleicht ist uns jemand gefolgt und hat Alarm geschlagen. Deswegen erschien es uns besser, niemandem etwas zu erzählen. Aber inzwischen habe ich eine andere Theorie.«
»Ja?«
»Wie würdest du es dir erklären, dass die Akademie von unserem Ausbruch wusste – dass schon Leute auf der anderen Seite der Mauer auf uns gewartet haben?«
Jen überlegte ein, zwei Sekunden. »Vielleicht haben sie euch beim Hochklettern beobachtet und eine Art Alarm ausgelöst. Ich meine, diese Wachtürme müssen ja aus irgendeinem Grund da sein.«
»Aber es ergibt immer noch keinen Sinn. Sie wussten ganz genau, wo wir waren. In dem Moment, als ich meinen Fuß auf den Boden gesetzt habe, hat mir jemand mit der Taschenlampe ins Gesicht geleuchtet und mir eine Waffe an den Kopf gehalten. Es war wie eine Militäroperation. Und noch etwas anderes, Jen. Warum dieser ganze Aufstand, nur weil ein paar Teenies über eine Mauer geklettert sind? Sie haben uns wie Terroristen behandelt.«
»Die erzählen uns doch, wir sollen uns nicht mit anderen Viren infizieren.«
»Jaja. Was die uns alles erzählen.«
»Und wie lautet deine Theorie?«
»Ich glaube, wir werden ständig überwacht. Ich vermute, die Uhren, die sie uns gegeben haben, sind in Wirklichkeit Überwachungsgeräte. Daher wussten sie ganz genau, wo wir uns befanden. Irgendwer, irgendwo ist diesem Signal gefolgt. Zwei Leuchtpunkte auf einem Bildschirm – und als wir dann auf der anderen Seite der Mauer ankamen, war sofort der Teufel los.« Pan erinnerte sich an Caras Tagebucheintrag: Meine Uhr ist falsch. Sie beschloss, Jen nicht davon zu erzählen. Jedenfalls noch nicht. »Und wenn das stimmt – was befindet sich auf der anderen Seite der Mauer? Was müssen sie so dringend vor uns verbergen?«
Jen schmunzelte. »Eins muss ich dir lassen, Pandora. Du bist noch misstrauischer als ich, und das will etwas heißen. Na ja, es gibt wohl nur eine Möglichkeit, mehr herauszufinden.«
»Genau«, sagte Pan. »Binde mir das Seil um den Bauch und befestige das andere Ende irgendwo, aber sicher. Ich steige ins Wasser und versuche, die verrostete Stelle zu finden.«
»Die Strömung ist ganz schön stark«, wandte Jen ein. »Und du bist keine gute Schwimmerin. Lass lieber mich vor.«