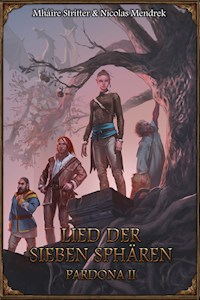
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ulisses Spiele
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Das Schwarze Auge
- Sprache: Deutsch
Die Hochelfen befinden sich im Krieg. Mehrere ihrer Städte sind bereits an den Drachengott Pyrdacor gefallen. Nach dem Ende ihrer alten Gefährten stellt sich die Kriegern Israni selbstmörderisch gegen die Horden des Feindes. Sie erfährt von einer Prophezeiung, die von einer Rettung von jenseits der Sterne spricht. Von einem Elfen, der dazu bestimmt ist, zurückzukehren, wenn Pyrdacor fällt. Israni begibt sich auf eine Queste, um die sieben Sphären zu durchqueren und schließlich die Niederhöllen zu erreichen – während Aventurien vom Krieg der Drachen zerrissen wird. Die Pardona-Trilogie erzählt über einen Zeitraum von 5.000 Jahren die Geschichte einer der bekanntesten bösen Figuren Aventuriens und enthüllt, dass alle ihre Taten einem höheren Ziel dienten. Die Reihe führt durch die aventurische Geschichte, während sich eine epische Geschichte entfaltet, und eignet sich deswegen auch sehr gut für Neulinge in der Welt des Schwarzen Auges. Zweiter Teil einer epischen Trilogie um eine der bekanntesten Figuren aus der Welt des Schwarzen Auges.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 472
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum
Ulisses SpieleBand US25734Titelbild: Dagmara MatuszakRedaktion: Nikolai HochLektorat: Frauke ForsterKorrektorat: Claudia WallerUmschlaggestaltung und Illustrationen:Steffen Brand, Nadine Schäkel, Patrick SoederLayout und Satz: Jörn Aust, Michael Mingers
Administration Christian Elsässer, Cora Elsässer, Carsten Moos, Sven Paff, Stefanie Peuser, Marlies Plötz, Markus Plötz Marketing Philipp Jerulank, Björn Meyer, Katharina Wagner, Wolfgang G. Wettach Ulisses Digital Alina Conard, Nico Dreßen, Thomas Engelbert, Nele Klumpe, Julia Metzger, Phillip Nuss, Maximilian Thiele, Jan Wagner, Carina Wittrin, Kai Woitczyk Verlag Zoe Adamietz, Jörn Aust, Mirko Bader, Steffen Brand, Bill Bridges, Timothy Brown, Simon Burandt, Carlos Dias, Christiane Ebrecht, Frauke Forster, Christof Grobelski, Kai Großkordt, Darrell Hayhurst, Nikolai Hoch, Nadine Hoffmann, Johannes Kaub, Christian Lonsing, Matthias Lück, Susanne Majewski, Thomas Michalski, Elisabeth Raasch, Nadine Schäkel, Maik Schmidt, Ulrich-Alexander Schmidt, Nils Schürmann, Eric Simon, Alex Spohr, Ross Watson Vertrieb Jan Hulverscheidt, Anke Kühn, Thomas Schwertfeger, Stefan Tannert
Copyright © 2021 by Ulisses Spiele GmbH, Waldems. DAS SCHWARZE AUGE, AVENTURIEN, DERE, MYRANOR, RIESLAND, THARUN, UTHURIA und THE DARK EYE sind eingetragene Marken der Ulisses Spiele GmbH, Waldems. Alle Rechte vorbehalten.
Titel und Inhalte dieses Werkes sind urheberrechtlich geschützt. Der Nachdruck, auch auszugsweise, die Bearbeitung, Verarbeitung, Verbreitung und Vervielfältigung des Werkes in jedweder Form, insbesondere die Vervielfältigung auf photomechanischem, elektronischem oder ähnlichem Weg, sind nur mit schriftlicher Genehmigung der Ulisses Spiele GmbH, Waldems, gestattet.
Mháire Stritter & Nicolas Mendrek
Lied der Sieben Sphären
Pardona I
Ein Roman in der Welt von Das Schwarze Auge©
Originalausgabe
Mit Dank an Bernhard Hennen
Prolog
Über ihm drehten sich die Sphären. Unter ihm verflochten die Elemente unermüdlich ihre Kräfte zu dem, was die Sterblichen ›Welt‹ nannten. Der goldene Drache umschlang die Thronpyramide so eng mit seinem Leib, dass ihre Kanten barsten und Statuen wankten. Die Echsen warfen sich in verzweifelter Anbetung auf den Straßen seiner Stadt nieder.
Er blickte aufwärts. Wo seine niederen Diener Himmel, Sterne und leere Weite sahen, nahmen seine Augen die schimmernden Strukturen der Sphären wahr. Ihr ewiges Mahlen, das Wabern des formlosen Limbus zwischen ihnen, das Bollwerk der toten Sterne und eine leuchtende Festung, deren Tore fest verschlossen waren.
DIES SOLLTE MEIN SEIN, sprach er zu der Welt. Die Vieldeutigkeit und Macht seiner Worte, die sich auffächernden Bedeutungsebenen von ›DIES‹, die Herrschaft, eine ferne Festung, sechs Sphären und sechs Elemente und einen Thron über seinesgleichen umfassten, ließen einige der Echsenpriester tot zu Boden sinken. Blut rann aus ihren Mäulern und leeren Augenhöhlen.
Seine Brüder …, die eine Hälfte fern in der Festung, hochmütig und auserwählt, unter Göttern zu weilen; die andere Hälfte zufrieden mit den ihnen übertragenen Aufgaben, zu wachen und zu schützen. Ersteres war ihm verwehrt geblieben ob des Makels seiner Entstehung und seines Paten. Zweiteres widersprach seinem Stolz. In Ruhe und Geduld ewige, immer stupide zyklische Befehle zu befolgen, war nicht möglich mit dem Feuer in seinen Knochen und der nimmer endenden Unruhe in seinem Geist.
Diese Sphäre, diese feste Welt, aus Elementen gesponnen und eifersüchtig von Göttern beobachtet? Sie nahm ihm immer nur. Wenn er zu schaffen versuchte, entglitten ihm die Werkzeuge seiner Macht. Die Wesen, die er heranzog, verrieten ihn für seinen lange verlorenen Meister. Jene, denen er Zivilisation, Wissen und Macht über die Elemente geschenkt hatte, richteten die Waffen gegen seine Heerführer. Diese Wunden brannten ebenso bitter wie die, die sein Bruder ihm im Kampf geschlagen hatte, als er ihm erneut das Tor der Festung verwehrte.
Seine Flügel öffneten sich und tauchten die Stadt in Schatten. Der reiche, grüne Wald, der sein Geschenk an die Echsen gewesen war, neigte sich unter der Sturmböe. Pyrdacor sah hinauf in die Sphären, wo der Riss in ihnen klaffte.
SIE NEIDEN MIR MACHT, WEGEN DIR, sandte er in die Finsternis.
Etwas regte sich. Ketten aus Zeit und Ewigkeit spannten sich. Ein einzelnes purpurnes Auge glomm auf.
SIE HASSEN MICH OB DEINER VERFEHLUNGEN. Der goldene Drache sank in einem Wirbel zusammen, zu der Gestalt eines fey, und das Schwinden der Masse erzeugte einen neuen Sturm. Golden gekrönt hob er die Hände in der Geste eines Priesters, wie die Echsen unter ihm ihn selbst um Gnade anflehten. Doch er würde nicht flehen. Er forderte.
SOLLEN SIE MICH HASSEN. Sein Geist streckte sich dem purpurnen Licht entgegen. LASSEN WIR ERNEUT DIE SPHÄREN ERZITTERN.
Das Licht erstarkte. Armeen würden marschieren. Das Licht versprach ihm Krone und Thron und einen Sieg über seine Brüder. Selbst wenn es Jahrhunderte des Krieges kosten würde, wenn er dafür Berge einebnen und Meere trockenlegen musste.
Macht gehörte nicht den Sanftmütigen und nicht den Dienern. Macht gehörte denen, die sie sich nahmen. Er würde diese Welt mit einem Griff umschließen, der sie neu formen würde. Er und sein Patron. Er und sein Pate. Er und sein Schöpfer.
Er hätte den Verräter nie verraten sollen.
Nicht Ordnung und nicht FriedenVerbleiben in der WeltVor langer Zeit entschiedenDas Urteil lang gefälltWas geht und was vergangenUnd was für immer fortUnd wessen ungestillt VerlangenVersiegelt letzter Hoffnung Hort.In gold’nem Schatten schwärtDes gold’nen Drachen GrollDem Gotteskron verwehrtUnd ungezahlt der ZollAls Herrscher über Himmelund Bote hoher Machtverbleibt ihm nur das Erdgewimmelund Purpurstern in schwarzer Nacht.Er fordert nun das Erbe,Legt Bruder Ketten anUnd wenn das Land verderbeIn seinem Wahn und BannDann mag es ihn verratenVerrät ihn alle WeltDann trägt er seine Wut und TatenZu jenem, der die Bresche hält.
Für tausend Jahre Schweigen,
worin ein Krieg kein Ende findet, sondern nur neue Orte, und die Diener dessen ohne Namen ohne Zahl zu sein scheinen.
Zu ihrer eigenen Überraschung spürte sie mehr Verachtung für ihre Angreifer als Erleichterung darüber, dass sie noch am Leben war. Mit der Muße und Klarheit von frisch überwundenem Schmerz und dem geschäftigen Schweigen eines Gewaltmarsches, gab sie innerlich zu, dass neben Glück und Wut auch die Dummheit ihrer Feinde zu einem guten Teil ein Grund war, warum sie nach zwei Jahrtausenden auf der Welt noch lebte. Speziell jetzt, in diesem Krieg und zu dieser Zeit und in dieser Situation, verstand sie diese Dummheit umso weniger.
Rostige Eisenketten schnitten tief in ihr Fleisch und ließen ihr gerade genug Freiheit, um sich auf den Beinen zu halten, während sie vorangetrieben wurde. Man hatte ihr einen abscheulich stinkenden Sack über den Kopf gezogen, der jedoch so fadenscheinig war, dass sie vage erkennen konnte, wohin es ging. Nicht, dass es viel zu sehen gegeben hätte. Es war Mitternacht und kein Stern am Firmament erhellte die Schwärze, sodass bei den meisten Wesen der Sack ohnehin überflüssig gewesen wäre, doch ihre Katzenaugen überblickten ein karges Hochplateau, über das ein eiskalter Wind heulte.
In diesem Wind ging das chaotische Stimmengewirr ihrer Peiniger fast unter, das zwischen langen Phasen des Schweigens an- und abschwoll. Es war eine bizarre Mischung aus verschiedensten ihr bekannten und fremden Sprachen, einige aufgeregt und ängstlich, andere kehlig und bedrohlich. Ebenso vielfältig waren die Schemen um sie herum. Einige der Kreaturen reichten ihr nur bis zu den Hüften und wuselten wie besessen zwischen den Beinen anderer umher, schnappten irre zischend nach ihren Knöcheln. Andere überragten sie um das doppelte ihrer Körpergröße und schritten wie riesige Windbrecher vor ihr her. Hin und wieder wurde eines der kleineren Wesen dennoch vom Sturm zu Boden gedrückt oder stolperte und wurde dann von den Füßen der größeren Geschöpfe zertrampelt, ohne dass sie auch nur die geringste Regung gezeigt hätten.
Nachdem sie auf diese Weise das andere Ende des Plateaus erreicht hatten, verstummte das Stimmengewirr abrupt und endgültig. Der Großteil der Horde war hinter ihr zurückgeblieben und hielt nun respektvoll Abstand von dem, was immer hier warten mochte. Wenige Schritte vor ihr hörte der Fels einfach auf. Sie ahnte, dass sie vor einem gähnenden Abgrund stand, aber auch dahinter erstreckte sich nur Schwärze, wo sie eigentlich weitere Bergrücken des Ehernen Schwerts erwartet hätte.
Eine langfingrige Hand riss Israni von hinten den Sack vom Kopf.
Das Bild wurde schärfer, doch viel zu sehen gab es nach wie vor nicht. Der Wind fegte aus dem Abgrund herauf und durch ihr Haar. Um sie herum stürzten einige der Geschöpfe auf die Knie. Etwas erhob sich aus der Tiefe vor ihr und näherte sich der Horde. Die wild gemischte Schar von Schraten und anderen Wesenheiten erhob die Stimmen in einem misstönenden, anschwellenden Chor voller Angst und Hingabe.
Israni hob das Kinn und schwieg. Sie war seit zwei Jahrtausenden über diese Welt gewandelt und war bereit, dem Tod gefasst ins Auge zu blicken.
Oder ihm erneut ins Auge zu spucken.
»Es hat sich noch keiner von eurer Art bis zu diesem Ort vorgewagt, fey.«
Ob die Stimme nur in ihrem Kopf erklang oder trotz des Jaulens des Windes und des Chors so klar ihren Weg an ihr Ohr fand, vermochte Israni nicht zu sagen. Auch wer sprach, war ihr nicht klar. Vor ihr erhob sich ein Schemen von der Größe eines gewaltigen Trolls, der sich vor der Finsternis der Nacht abzeichnete. Er schien das wenige Licht zu schlucken, das noch übrig war. Die Stimme sprach ihre Sprache, Asdharia, doch die Worte klangen leblos und verzerrt, einstimmig und ohne eigene Melodie und Harmonien.
»Weißt du, was dies für ein Ort ist? An welch heilige Stätte wir gezogen sind? Hier, wo du jetzt stehst, stand vor fast drei Jahrtausenden unser Heerführer, den ihr Maruk-Methai nennt …«
Die anwesenden Orks, Trolle und die kleineren, vielgliedrigen Geschöpfe flüsterten ehrfürchtig diesen Namen in den Chor, als würden sie ein Stoßgebet aussprechen: »Maruk-Methai! Maruk-Methai!«
Einige schluchzten vor Hingabe.
»Hier stand er und erblickte zum ersten Mal den neuen Kontinent, den er für unseren Herrn unterwerfen sollte.«
Israni konnte nicht anders, als den Kopf zu wenden. Von diesem Plateau inmitten der höchsten Gipfel des Ehernen Schwerts musste man bei Tageslicht einen atemberaubenden Blick über die Nordlande haben. In den letzten Monden, während der sie mit anderen Jägern und Kriegern die Hänge erklettert hatte, war ihr Blick so oft zurück nach Westen gewandert. Zurück zu den blassen Horizonten, die weite Länder und einsam gewordene Städte verbargen. Zum Himmelsturm Ometheons im Nordwesten, längst in die Hände des Feindes gefallen. Zu den endlosen Wäldern Simyalas im Südwesten, wo sie Kind gewesen war und Kinder verloren hatte. Aber auch zu den anderen Elfenstädten und dem gleißenden Tie’Shianna, Sitz des Hochkönigs Fenvarien, weit im Süden.
Die Kreatur vor ihr war aus den unbekannten Regionen hinter dem Ehernen Schwert gekommen, um alle Feinde der fey zu vereinen und das zu vernichten, was von ihrem Großreich geblieben war. Wälder, Türme, Festungen und zuletzt die Erinnerungen und Lieder. Zunächst fuhr der Trollartige aber mit seinem Geschwätz fort, in wirren Echos von seinem Chor an Dienern begleitet. Israni hatte für derlei wenig Geduld und nutze die Gelegenheit, um ihre letzten Reserven zu sammeln.
»Von hier begann er seinen glorreichen Feldzug und machte sich auf, den falschen Elfengott Simia zu erschlagen!«
Das dunkle Wesen war jetzt nähergekommen und sie konnte trotz des Windes die Kälte spüren, die von ihm ausging. Die letzten Worte hatte es hasserfüllt ausgespuckt und die Orks an Isranis Seite waren zurückgewichen. Stille senkte sich herab und es schien einen Moment so, als würden alle auf ihre Antwort auf eine ungestellte Frage warten.
Ja, Israni kannte die Geschichte, das Lied, wenn auch anders. Simia, der erste fey, der aus dem Licht in die Welt getreten war. Simia, dessen Name ihrer Heimatstadt Simyala gegeben worden war, hatte sich an der Spitze der Helden, Krieger und Zaubersänger den Invasoren unter dem Dämon Maruk-Methai entgegengestellt und den Heerführer im Zweikampf bezwungen, während rings um ihn das dhaza, das Unlicht, im Schatten und im Gefolge Maruk-Methais die Welt verdorben hatte. Vögel waren tot vom Himmel gefallen, das Gras verfault, die Bäume verdorrt. Selbst im Sieg hatte das dhaza auch Simia dahingerafft, der in Licht und Traum aufgegangen war für die fey.
»Die fey von heute sind nur noch ein schwaches Echo ihrer einstigen Größe. Sie sind uneins und ihr Reich zerfällt bereits. Sie sind im Krieg mit denen, die sie Götter hießen. In ihrer bodenlosen Arroganz glauben sie gar, keine Götter mehr zu brauchen! Mit diesem Größenwahn freveln sie dem goldenen Herrn des Weltenbrands und müssen vom Antlitz dieser Welt getilgt werden. Wir sind hier, um den Kontinent von dieser Plage zu säubern – bis hin zu ihrem Hochkönig Fenvarien, aber beginnend mit dir, kleine fey!«
Das Geschöpf, das aus Schatten zu bestehen schien, war jetzt so nahe heran, dass Israni seine Umrisse klarer erkennen konnte. Sie wusste nicht, welche Ungeheuer im Land jenseits des Ehernen Schwertes umgingen. Man sprach von barbarischen Trollstämmen und Kannibalen, Riesen mit mehreren Köpfen und Insektenwesen. Der namenlose Feldherr hatte die Ausmaße eines Trolls, aber die Aura des dhaza, die ihn umgab, war so stark, dass er nicht ganz von dieser Welt sein konnte.
»Doch was treibt dich hierher? Wie Schafe haben wir deine Leute abgeschlachtet und ihre Knochen aufgebrochen. Es waren nur eine Handvoll. Ist euer Wissen um eure und unsere Stärke so fehlgeleitet, dass ihr dies für eine ausreichende Menge haltet, um ein Wesen wie mich zu vernichten? Dass euer König es für ausreichend hielt, euch ins Herz meiner Streitmacht zu schleusen und uns meucheln zu lassen, wenn wir schlafend niederliegen? Sprich! Welche feige Tat brachte dich zu mir?«
»Fenvarien hat mich gesandt«, gab Israni freimütig zu. »König wider das dhaza. Erbe eines Reichs ohne Götter. Ich war schon da, als Amadena Pyrdona, Zunge des dhaza, in die Niederhöllen geschickt wurde. Er hoffte, ein Schoßhund Pyrdacors würde ähnlich enden, wo der goldene Drache nun ebenfalls das Haupt vor dem ohne Namen neigt.«
Sie streckte ihre Glieder, soweit es ihr möglich war. Das Eisen war nicht nur schwer, sondern zog an ihrem Geist und ihrem inneren Licht ähnlich wie an ihren Armen und Beinen. Doch so wie Israni niemals aufgegeben hatte, wenn sie ein verwundetes Kind oder einen toten Freund aus Schlachten heimgetragen hatte, so sehr ihre Kraft aufgezehrt sein mochte, so wenig würde sie die Kraft ihres Geistes in Eisen legen lassen. Still, nur in der Ruhe zwischen ihren Schläfen, im verborgenen Licht in ihrem Inneren, sang sie zur Welt und zögerlich begann die Welt zu antworten.
»Fünfzig Jahre Krieg der fenvar und Drachen sind genug, spricht Fenvarien«, fuhr sie fort. »Dich und deine Heerscharen aus dem Riesland zu rufen, wird Pyrdacor auch nicht retten.«
Das Schattending neigte sich vor und sein kalter, schaler Atem drang durch den eisigen Wind. Der Rachen der Kreatur roch nach frischem Blut und fauligem Fleisch. Dann lachte der Hüne.
»Wenn Tapferkeit zu Dummheit wird und Dreistigkeit zur Lüge«, grollte der Heerführer amüsiert. »Ich bin froh, den Befehl gegeben zu haben, dass deine Knochen nicht im Eis faulen sollen, dass ich mit dir sprechen wollte, Israni Katzenauge. Ich war neugierig, wie die Seele einer schmeckt, die schon so lange lebt, was sie ausmacht. Sturheit, wie es mir scheint.«
Das war eine Antwort, mit der sie sich zufriedengeben konnte. Zwei Jahrtausende und Kinder und Kindeskinder und sie alterte nicht, lebte weiter, und sie kannte ebenso wenig einen Grund dafür wie die anderen ihrer Art, denen ein ähnliches Schicksal zuteilgeworden war.
»Es heißt unter manchen Gelehrten, dass fey erst altern, wenn sie eine Lebensaufgabe erfüllt haben«, sagte sie so ruhig wie es ihr möglich war, während sie in ihrem Inneren einen glühenden Funken der Magie nährte, der gegen die kalte Schwere des Eisens ankämpfte. »Pyrdona in die Niederhöllen zu schicken, war am Ende doch nicht meine Aufgabe. Aber vielleicht bist du es?«
Erneut lachte die Kreatur, tief und grollend. »Ich bin vielleicht dein Ende«, sagte sie genüsslich und streckte eine Hand aus, deren Finger sich mühelos ganz um Isranis Kopf legten. Die graue, kaum im Dunkeln auszumachende Haut roch bitter und sauer zugleich.
Israni kämpfte gegen den Würgereiz, schluckte ihn herunter und beschwor stattdessen mit dem Feuer zusammen Wut und Starrsinn herauf.
»Deine Jammergestalt sicherlich nicht. Wenn, dann will ich durch etwas sterben, über das wenigstens große Geschichten erzählt werden. Nicht eine traurige Erscheinung, stinkend und überheblich, wie du es bist.«
Für einen Augenblick starrte der Heerführer mit seinen gerade eben als zwei glimmende Funken sichtbaren Augen auf Israni und war ansonsten vollkommen regungslos, so, als würde er nicht ganz verstehen, was sie da gerade gesagt hatte, oder als ob er ihre Arroganz nicht fassen konnte. Die Schratigen um ihn herum wichen ein paar Schritte vor ihm zurück, wimmerten leise. Dann warf der Schemen das, was er anstelle eines Kopfes hatte, in den Nacken und begann schallend zu lachen. Die mächtigen Finger spannten sich an, um Isranis Kopf zu zerdrücken, doch der Moment der Ablenkung hatte ihr gereicht, die letzte Nagelprobe ihrer Kraft zu beschwören und in ein Lied zu flechten, dass nun mehrstimmig und klar über ihre Lippen drang.
Ihr Leib ging in Flammen auf.
Innerhalb eines Augenblicks verwandelte sich ihr Haar in eine Lohe und ihr Fleisch in ein Inferno. Die Ketten glühten weiß auf und brachen dann mit einem schrillen Heulen. Der Heerführer hörte abrupt auf zu lachen, als das lebende Feuer die Haut von seiner Hand fraß und seine Knochen schwarz verkohlte.
Israni, frei von Fesseln und schwerelos, leicht wie aufwirbelnde Funken, sprang ihm mit ihrem verwandelten Körper ins Gesicht und unter Händen und Knien verkochte sein Fleisch in brodelnden Fontänen.
Statt eines wahnsinnigen Lachens stieß der Heerführer nun gellende Schreie aus, seine Untergebenen schnatterten, geiferten hilflos und duckten sich unter der Hitze weg. Israni hielt das Ende der glühenden Kette, die eben noch sie gefesselt hatte, in einer Hand und ließ sie wieder und wieder auf den Körper des riesigen Schemens niedersausen, während sie ihre brennenden Finger wie glühend heiße Klauen tiefer in sein Fleisch grub. Das Wesen schrie und schlug nach ihr, riss an ihrem Leib aus Flammen und schrie dann noch lauter. Sie packte die Kette mit beiden Händen und schlang sie um die Schwärze, die sie für seinen Kopf hielt. Die Finsternis des abstrusen Wesens schluckte das Licht der Flammen, aber die Augen spiegelten einzelne glühende Funken wider – und Furcht. Der Heerführer taumelte rückwärts auf den Abgrund zu, eine schreiende Säule aus brennenden Schatten. Die wimmelnden Kreaturen um ihn herum waren noch immer in Panik und blieben es auch noch einige Augenblicke, nachdem er mit Israni in Flammengestalt rücklings in die Tiefe gestürzt war.
Sie durchbrachen mehrere Eisschollen und landeten hart auf einer Felsnadel, nur um sofort abzurutschen und weiter in die Tiefe zu stürzen. Isranis brennender Leib wurde von den Pranken ihres Gegners zerdrückt, doch sie hatte sich in ihre Beute verbissen und schlang die glühende Kette immer fester. Lange würde sie den Flammenleib nicht mehr aufrechterhalten können. Sie gab die letzte Kraft, die ihren Gliedern noch innewohnte, und riss an der Kette – und plötzlich brach etwas ab. Ihr Feind schrie noch lauter auf, gurgelnd und heulend, und sie bekam etwas zu fassen. Öliges Blut spritze ihr entgegen und sie hielt ein schwarzes, gewundenes Horn in der Hand, ähnlich dem eines Einhorns.
Und da spürte sie, wie etwas den Körper des Heerführers verließ … eine Präsenz, tödlich, berechnend und erdrückend in ihrer Intensität. Der bittersüße, goldene Lockruf des dhaza lag um sie, ein Wispern in ihrem Schädel und eine erstickende Dunkelheit. Sie glaubte, eine Stimme in ihrem Kopf zu hören.
Wessen Stärke versiegt, der wird meine Stärke nicht tragen, wird allein ziehen und allein sterben.
Die unnatürliche Finsternis wich aus dem schreienden Wesen und sie erkannte, dass es tatsächlich eine Art Troll war, aber wie von der wahnsinnigen Hand eines Schülers Amadenas verwachsen und verwoben mit anderen Kreaturen. Auf den massigen Schultern warf sich der halb verbrannte Schädel eines Einhorns hin und her, dem nun jedoch die Stirnzier abgerissen und die Mähne versengt worden war.
Gemeinsam rutschten und stürzten Israni und die verstümmelte Kreatur weiter den Abhang hinab, dann sah sie im Licht ihres eigenen Feuers den Boden auf sich zu rasen und stieß sich von ihrem Feind ab, bevor ihre Kraft sie endlich verließ und mit ihr das Licht.
Calmador war in Panik, aber er gestand es sich noch nicht ein. In einer Hand hielt er ausgestreckt das juwelenbesetzte Kurzschwert seines Vaters, in der anderen die Axt, die seinem gefallenen Gefährten Gomalan gehört hatte. Beide Hände zitterten, als er durch den Tunnelkomplex huschte.
Er war der letzte, der noch übrig war. Alle anderen waren von der Dunkelheit verschluckt worden, und zwar – was Calmador am meisten beunruhigte – fast ohne einen Laut von sich zu geben. Sie waren einer nach dem anderen von einer namenlosen Monstrosität in die unermesslichen Tunnel unter dem Berg geschleift worden und hatten keine Schreie von sich gegeben, denen er hätte folgen können.
Zu zehnt waren sie aufgebrochen, um eben die Kreatur zu erlegen, die nun sie bis auf den letzten Zwerg gejagt hatte – und Calmador war dieser letzte Zwerg. Er hatte eine Pflicht gegenüber seiner Sippe, doch er hatte versagt. Das Wesen war wie aus dem Nichts gekommen, über die Verteidiger von Schtromonosch hergefallen wie ein Schatten und keiner hatte sie je erblickt. Die Wachen waren einfach verschwunden. Nur aus den wenigen Spuren, welche die Kreatur hinterlassen hatte, konnten die Zwerge ableiten, dass es sich um eine Art Tier handeln musste, das ihnen im Dunkeln nachstellte.
›Morbrosch‹ hatten sie es genannt, den Tod aus dem Felsen. »Eine neue Waffe der Drachen!«, hatte die Bergkönigin sofort vermutet. Seit Monden wurde Schtromonosch von Pyrdacors Horden belagert und die Angroschim der Sippe von Murkonaxa waren in ihren Hallen eingeschlossen. Nun schienen die Echsen ihnen durch ihre eigenen Tunnel eine neue Gefahr gesandt zu haben, die sie zermürben und nach und nach ausschalten sollte. Zehn Krieger hatten wie mehr als genug geschienen, als Calmador und seine Begleiter losgeschickt worden waren. Sehr schnell hatte sich herausgestellt, dass dies ein bitterer Irrtum gewesen war. Calmador hatte sich freiwillig gemeldet, um endlich eine Trophäe zu erlangen, die er in sein Gesellenstück für die Göttin Simia einarbeiten konnte – und jetzt war er allein in den tiefsten Tunneln seiner Stadt gestrandet, hatte völlig die Orientierung verloren und wusste, dass ihm sein Jäger bereits auf den Fersen war. Doch wenn er der Panik nachgab, würde er auf jeden Fall sterben. Wenn er jedoch den Verstand bewahren konnte, blieb ein Funken Hoffnung. Er suchte sich eine schützende Nische, legte die Axt ab und stützte sich kniend auf das Kurzschwert. Dann begann er das einzig Sinnvolle zu tun, nämlich zu seinen Göttern zu beten.
»Simia – holde Göttin aus dem Wald, Herrin der Kunstfertigkeit und der … ah … Weisheit. Der Weg des Schwertes und der Axt hat mich und meine Freunde in den Tod geführt, und Vater Angrosch wünscht offenbar, dass wir ihm unser Leben im Kampf darbringen. Falls du … die Sache anders siehst, Simia, dann zeig mir einen Ausweg aus diesem Schlamassel. Gib mir ein Zeichen, damit ich meinen Hintern hier wieder lebendig rausbekomme und …«
In der Finsternis glaubte Calmador ein Geräusch vernommen zu haben, kaum hörbar, doch in der absoluten Stille dieser Tunnel, gut Hundert Schritt unter den Hallen von Schtromonosch, das einzige Geräusch neben seiner eigenen Stimme. Es war eine Art Kratzen oder Schaben. Bisher hatten die Gespräche, das Atmen seiner Kampfgefährten oder das Klappern seiner Stiefel und Rüstung meist alles übertönt. Nun herrschte absolute Stille. Bis auf das Schaben, das langsam lauter wurde.
Calmador setzte sein Gebet stumm fort und achtete dabei genau auf das Schaben. Simia war keine altmodische Göttin. Angrosch akzeptiere sicher nur gesprochene Gebete, doch Simia hatte sich den Brillantzwergen erst vor einigen Jahrhunderten in ihrer Stadt namens Simyala offenbart, die die Elfen ihr geweiht hatten. Sie war den Brillantzwergen um ihren König Calaman in einer Vision erschienen und hatte ihnen einen ewigen Bund angeboten. Eine Göttin des Kunsthandwerks, eine Göttin der schönen Dinge, das passte besser zu diesem Zwergenschlag, der sich nicht über die Schwere der Axt oder des Biers definierte, sondern über Poesie in Form von Worten und Schmiedekunst. Simia würde auch ein stummes Gebet akzeptieren, solange es ansprechend formuliert war. Ihr zu Ehren hatte Calmador sogar mithilfe der Priester in Aradolosch ein paar Brocken der Elfensprache gelernt, die aus seinem Mund natürlich krude und roh klang. An schönen Worten, in welcher Sprache auch immer, mangelte es Calmador in diesem Moment leider sehr.
Das Schaben war lauter geworden. Calmadors Blick vermochte die Finsternis zwar zu durchdringen, doch nur einige Dutzend Schritt weit im sanften Glimmen eines letzten Funkens im Feuerkäfig an seiner Hüfte. Hinter dieser Grenze glaubte er vage Bewegungen in den Schatten ausmachen zu können. Hilf mir, dieses Monstrum mit in den Tod zu nehmen, Simia, dachte er. Sein Blut an den Wänden dieses toten Tunnels soll mein letztes Gemälde für dich sein.
Calmador griff Schwert und Axt wieder fester und machte sich auf den Anblick gefasst, der ihn erwartete. Was würde ihn gleich anfallen? Eine Art Höhlendrache? Vielleicht auch eines der vielgliedrigen Biester, wie die Horden des goldenen Drachen sie angeblich in ihren Reihen haben sollten? Eine gewaltige Spinne oder eine Art Gruftassel?
Keine dieser Vorstellungen kam der Wahrheit nahe. Als das Wesen sich schließlich ungelenk aus den Schatten schälte, mit Bewegungen und Gliedmaßen, die schlichtweg falsch waren, entflohen Calmador all seine Worte.
Der schneidende Gebirgswind weckte Israni, indem er ihr Schnee und fernes Geschrei in die Ohren wehte. Sie lag auf einem Felsvorsprung, zerschunden und zerkratzt, doch ihre Flammengestalt hatte sie vor den schlimmsten Folgen des Sturzes bewahrt. Allerdings war ihre schützende Winterkleidung verbrannt.
Der Tag war angebrochen und mit ihm war ein Schneesturm gekommen. Die Schwärze war einem heulenden Grau gewichen, in dem sie keine Spur mehr von ihrem Gegner ausmachen konnte. Der Boden der Schlucht erstreckte sich einige wenige Schritt unter ihr, doch in diesem Unwetter konnte sie nicht erkennen, ob sich dort etwas oder jemand befand. Die Schreie, die sie durch das Heulen des Sturmes hören konnte, drangen vom Plateau zu ihr heran. Es waren die Söldner des Namenlosen, die dort oben in Aufruhr waren. Sie war ausgelaugt, doch etwas Kraft war ihr noch geblieben. Sich in ihr Seelentier zu verwandeln, das gelang ihr auch unter den schlimmsten Umständen noch. Ihr Körper streckte sich in die Länge, ihre Eckzähne wurden zu Fängen und einige Augenblicke später erhob sich eine müde wirkende, weiß und schwarz gezeichnete Katze von fast drei Schritt Länge von der Felsspitze.
Träge ließ die Katze sich in die Tiefe fallen und landete federnd auf dem Boden der Schlucht. Israni konnte den Gestank ihres Feindes jetzt deutlicher wahrnehmen. Er war hier, wenige Schritte von ihr entfernt, in der Schlucht gelandet. Auch wenn es bereits einige Stunden geschneit haben musste, waren immer noch vage Umrisse seines Körpers im Schnee zu erkennen und sie erkannte auch noch Spuren von schwarzem, fauligem Blut. Das Wesen war entweder direkt in die Niederhöllen gefahren – doch so viel Glück hielt Israni für unwahrscheinlich – oder hatte sich blutend und geschlagen davongeschleppt, vermutlich zurück zu seinem Heerhaufen auf dem Plateau. Da fiel ihr das Horn wieder ein, dass sie der Troll-Chimäre abgerissen hatte. Sie sprang mit einigen Sätzen wieder auf den Vorsprung und folgte ihrer Nase, bis sie das seltsame gewundene Ding in einer Felsspalte gefunden und mit einigem Widerwillen mit dem Maul aufgenommen hatte. Es schmeckte bitter und verkohlt, wie Honig aus einem von Krankheit befallenem Bienenschwarm und verbranntes Haar.
Es war das Einzige, was sie für ihren Auftrag vorzuweisen hatte, der anderweitig zu einem immensen Fehlschlag geworden war. Während sie erschöpft und halb blind durch den Schnee hinkte, stellte sie sich testweise und unwillig dem Gefühl des Versagens.
Der Heerführer hatte recht gehabt, ihre Gefährten waren von seinen Schergen niedergemacht und sie recht einfach gefangen genommen worden. Die Größe und Effizienz des Heeres, das da über die kaum passierbaren Pässe des Ehernen Schwertes gequollen kam, hatte sie ebenso überrascht wie die beiden Hippogriffenreiter aus Tie’Shianna, die sie begleitet hatten. Es sollte eine simple Erkundungsmission werden und nun würde sie vermutlich nicht rechtzeitig in Fenvariens Königreich zurückkehren können, um die Allianz noch zu warnen.
Das Reich der fenvar, der Städtebauer und Zauberweber, im Krieg mit einem weiteren Wahnsinnigen auf der Suche nach dem Dasein als Gott. Selbst als die fenvar Pyrdacor oder Pyr’Dakon noch als Gott verehrt hatten, war der Drache ein gleichgültiger und zuweilen grausamer Herrscher gewesen, der Verehrung mit Missmut belohnte und für jede Gabe eine Gegengabe forderte. Sie erinnerte sich, wie er in Gestalt eines fey im Eis gestanden hatte, ohne zu merken, wie zu seinen Füßen fenvar im dunklen Wasser ertranken, während sie noch seinen Namen auf den Lippen hatten.
Zorn brannte in ihr, Zorn auf die Gesandte des Pyr’Dakon, die dem dhaza gedient und den Turm im Norden der Welt verdorben hatte. Zorn auf alle, die zunächst nicht glauben wollten, dass die Welt den fenvar nicht länger freundlich gesonnen war und in ihren geschickten Händen lag wie ein Juwel, das sie nach Belieben schleifen konnten.
Und heißer als alle anderen schwelenden Brände in ihrer Seele Zorn auf den Drachen selbst, der sich Gott nannte, der bedrängt und wirr und gierig nach mehr Macht als jede andere lebende Seele in dieser Sphäre oder einer anderen schließlich die Stimme ebenfalls an das dhazagewandt und den namenlosen Gott zu seinem Patron ernannt hatte. Ein Zorn, der so klar und dauerhaft war, dass sie ihn zu Hass reifen spürte.
Eigentlich hatte Hass keinen Platz mehr in ihrem Herzen oder generell in ihrem Leben gehabt. Hass hatte ihr nur sehr selten wirklich gedient und ihr im Gegenteil oft die Gelegenheit verdorben, das zu genießen, was ihr geblieben war. Aber alles, was das dhaza betraf … Sie konnte nicht anders, als es zu verabscheuen, es war ihre Natur. Das Horn in ihrem Maul war vom dhaza verseucht, sie konnte es schmecken, und immer wieder musste sie es würgend in den Schnee speien und mit ihrer Zunge über Fell und Fels fahren, um ihren Magen zu beruhigen.
Es erwies sich als schwierig, einen Weg heraus aus der Schlucht zu finden, der sie nicht zurück auf das Plateau führte. Sie würde die Späher des Feindes nicht noch einmal unterschätzen und einen großen Bogen schlagen müssen – im unwegsamen Gelände, mitten in einem Schneesturm, verletzt und am Ende ihrer Kräfte. Sie hatte Glück gehabt. Der Heerführer musste sie nach ihrem gemeinsamen Sturz für tot gehalten oder sie gar nicht erst entdeckt haben. Das war ihr einziger Vorteil und sie gedachte, ihn zu nutzen.
Auf nahezu lautlosen Pfoten erklomm sie steile Wände und presste sich mit gebogenem Rücken Felskämme entlang, bis sie wieder in das nächste Tal hinabrutschte, von wirbelndem Schnee begleitet.
Irgendwo im Wind erklang das Geräusch kehliger Stimmen und sie roch Schweiß, Rauch, verbranntes Fleisch und die widerliche Vermengung von Fäulnis und frischem Blut. Vorsicht war geboten. Sie erstarrte, blinzelte in den Sturm und verließ sich darauf, dass ihr Pelz im Zwielicht und wirbelnden Schnee mit der Welt verschmolz.
Irgendwo zu ihrer Rechten zogen Schemen vorbei, wispernd und grollend. Die Großen trieben die Kleinen an. Sie wagte es kaum, zu atmen. Erst als die Stimmen lange verklungen waren, setzte sie sich langsam wieder in Bewegung.
Selbst der dichte Pelz ihrer Katzengestalt hielt dem Heulen der dünnen, eisigen Luft nicht ewig stand. Ihre Hüfte, zu Beginn nur steif, zitterte bald und knickte mit jedem Schritt ein. Aus ihrer Kehle löste sich ein beständiges, dunkles Grollen, über das sie keine Kontrolle hatte.
Zeit verlor an Bedeutung und sie musste an Acuriën denken, wie er verloren in der Kälte in seinem Geist den Halt verloren hatte und immer wieder zu der Wanderung zurückkehrte, die sie in ihrer Jugend vom gefallenen Himmelsturm aus nach Süden bewältigt hatten. Sie verstand es ein wenig, jetzt, in der Gleichförmigkeit und brutalen Kälte, wie dies zu einem ewigen und gleichzeitig zeitlosen Ort werden konnte, der zu verschiedensten Fährnissen in einem Leben führen konnte, wie ein zentraler Knoten in einem Netz.
Den Rest des wenigen Tageslichtes nutzte sie für den Abstieg an einer Bergflanke hinab, einen mühseligen Schritt nach dem anderen. Manchmal hielt der Schnee unter ihren breiten Pfoten, manchmal brach sie ein und ihr Gewicht zog sie in die Tiefe. Wie eine ungeschickte Schwimmerin versuchte sie, an der Oberfläche zu bleiben und auch ja nicht mit den stetig abgehenden Schneebrettern in die Tiefe zu stürzen. In der Dämmerung schließlich blieb sie unter einem Überhang liegen, rollte sich in Katzenform zusammen und spuckte das Horn in den Schnee. Ihren langen, dicht bepelzten Schwanz ringelte sie um sich und legte ihn vor Augen und Nase, um endlich eine lang ersehnte Pause von den eisigen Nadeln des Sturms zu erhalten.
Der Wind legte sich mit der Nacht ein wenig. Sie erahnte Sterne am Himmel, aber vor allem konnte sie die Umrisse der Welt wieder ausmachen. In fiebrig wabernden Bändern von Licht und Schatten zogen sich Fels und Schnee dahin, und weit unter ihr ragten Baumspitzen aus dem trügerischen, weißen Grund. Bäume bedeuteten Schutz. Es blieb ihr nur zu hoffen, dass sie die richtige Seite des Gebirges hinabstieg und dies nicht eine Reise in unbekannte, dem dhaza verschriebene Landstriche war.
Sie hinkte weiter. Mehrfach würgte sie wässrige Magensäure hoch, wenn der Geschmack ihrer widerlichen Trophäe zu stark wurde. Sie musste eine Spur aus Gestank und Schmerz hinterlassen, der auch der schwächste Geruchssinn würde folgen können, doch ihr blieb keine Wahl.
Die Bäume knisterten geheimnisvoll in der stillen, schweren Kälte der finstersten Zeit kurz vor Morgengrauen, als sie sie erreichte. Sie rieb ihre Lefzen an dem ersten, verwundert darüber, es geschafft zu haben. Die Nadeln rochen nach Wärme, Harz und unverdorbener Natur und ein leises, dankbares Wimmern löste sich aus ihrer Brust.
Sie folgte den dunklen Spitzen und fand einen Rhythmus in ihrem Hinken und dem Wanken ihrer Gestalt, angetrieben von der Aussicht, tiefere Lagen erreichen zu können. Dann zog etwas Dunkles vor den Sternen entlang und schrie.
Sie drückte sich in den Schnee, hinein in die trockenen Zweige einer vom Wind gebogenen Kiefer. Weiter oben erwiderte jemand oder etwas den Schrei. Sie wollte weitergehen, wollte endlich ruhen dürfen, doch beides hieß Gefahr. Mühselig schob sie sich, so leise wie möglich und würdelos, durch den dunklen Schnee.
Die Zeit flackerte. Es war hell, dann dunkel. Schnee wich Fels, wich Sturm. Sie zitterte vor Kälte, dann vor Hitze. Eines ihrer Beine glich nur noch einem steifen Stock, auf dem sie ihren Leib wankend vorwärts schieben konnte. Schließlich waren die Bäume höher als sie selbst und winkten ihr mit Zweigen voll schwarzer Nadeln im Wind zu. Ein letztes Mal ließ sie das Horn aus ihren Fängen fallen und starrte die Grenze an, an der Leblosigkeit dem Leben wich. Sie hatte ihre Wanderung bald geschafft, glaubte sie. Der Wald roch wie Erinnerung und vertraute Zeit. Konnte sie innehalten? Nein. Nein, noch nicht.
Noch ein wenig weiter. Nur ein wenig. Sie nahm die Beute wieder auf und bewegte sich tiefer in den Wald hinein. Der Schnee gab langsam Höhlungen unter schweren Zweigen frei. Der Boden war kühl, aber nicht eisig, federnd unter ihren wunden Pfoten. Der geschützte Raum voll sanftem Duft nach träumenden Bäumen schien ihr wie eine warme Halle in einer Sala Simyalas, wenn im Licht von Zauber und zahmen Flammen Gelehrte und Familien beisammensaßen und Lieder in der Luft hingen. Wenn die Dryaden mit sanfter Miene die fey beobachteten, die in ihren Bäumen und ihren Herzen lebten und sie ihren Kopf an die Schulter eines anderen legen und die Augen schließen konnte, im sicheren Wissen, geborgen zu sein.
Simyala war tot.
Die Dryaden waren vergiftet und zerfressen. Aber Israni wanderte, plötzlich frei von Schmerzen, durch seine lichten Schatten der Erinnerung und schließlich, angekommen in einem Nest voll lachender Kinder mit grünen Augen, rollte sie sich ein und lauschte. Das Wispern der Bäume, das Murmeln ihrer Familie und das Gähnen von Katzen im Sonnenlicht auf dem Fenstersims legten sich wie eine schützende Decke um sie und hießen sie willkommen.
Sie hatte keine Ahnung, wie lange sie geschlafen hatte, als sie wieder zu sich kam, doch sie hatte sich in ihre Elfengestalt zurückverwandelt und in diese war eine Wärme eingekehrt, die sie für ein reines Traumgespinst gehalten hatte. Sie lag unter schweren Fellen und blickte empor zu einer hölzernen Zimmerdecke mit kunstvollen Verzierungen, die fey beim Jagen und Musizieren in den Wäldern des Nordens zeigten. Die fey bewegten sich, verschwammen und wurden wieder scharf, als Israni mit ihren zurückgekehrten Sinnen kämpfte. Irgendwo im Raum prasselte ein Feuer. Frische Gewänder, ein Becher mit Wasser und sogar das dämonische Horn lagen ordentlich neben ihrem Bett.
»Ihr habt wahrscheinlich keine Ahnung, wo Ihr seid und wie Ihr hierherkamt.« Die Stimme klang kehlig, ruhig und zurückhaltend. Sie kam von einem Torbogen, der den kleinen Raum offenbar mit einer größeren Halle verband.
»Alles andere würde mich auch sehr wundern, denn ihr habt lange geschlafen, sehr lange.« Aus dem verschwommenen Brei des Raumes löste sich eine Gestalt, die gänzlich in graue Roben gehüllt war. Sie trat näher und breitete dabei beschwichtigend ihre leeren, behandschuhten Hände aus. Auch ihr Gesicht war unter gewickelten Stoffstreifen verborgen, die nur gelblich-graue Augen freiließen.
Israni war nicht bereit, alle Vorsicht fahren zu lassen und glitt aus dem Bett, auch wenn ihre Beine unter ihr zitterten.
»Dann rede nicht vom Schlaf und sag mir, wer du bist, was du von mir willst und wo hier genau ist!«
Dieser Mann, sie war recht sicher, dass es ein Mann war, roch falsch. Er war sicherlich kein fey und auch kein Mensch oder Zwerg. Was hatte er in einer solchen Behausung zu suchen?
»Man nennt mich Narsharram.« Er verbeugte sich leicht. »Ich habe nicht vor, Euch zu schaden. Tatsächlich habe ich Euch gerettet. Ihr habt es auf eigene Faust bis fast zu diesem Wachturm der Fenvarien-Allianz geschafft, seid dann aber wenige Wegstunden entfernt im Schneesturm zusammengebrochen. Ich habe euch hierhergeschleppt und euch die letzten Wochen gesund gepflegt.«
»Wochen?!«, entfuhr es Israni. Ihr Herz, ihr gesamtes Inneres wurde mit einem Schlag kalt. Damit war ihr Auftrag endgültig gescheitert, die Armee aus dem Riesland musste längst in den Süden vorgedrungen sein.
»Ja … Es tut mir leid.« Narsharram senkte betrübt den Blick und schien zunächst nicht zu wagen, wieder zu Israni aufzusehen. »Ich habe alles versucht, um Euch wieder zu Bewusstsein zu bringen. Aber Ihr solltet wissen, dass es ohnehin keinen Unterschied gemacht hätte. Die Horden des Dunklen Gottes waren bereits vor Euch hier. Die Besatzung dieses Wachturms war dem Ansturm nicht gewachsen. Nachdem die Orks, Goblins, Trolle und anderen Kreaturen mit ihnen fertig waren, zogen sie rasch weiter, angetrieben von der Angst vor ihrem dunklen Heerführer.«
Israni sah nachdenklich zu dem Horn auf dem Nachttisch. »Eine Art Troll, komplett gehüllt in eine Aura der Schwärze?«, fragte sie und begann dann, sich anzukleiden.
»Ein trollgroßes Wesen, ja. Eine Art Chimäre. Was eine schwarze Aura angeht, so ist mir nichts dergleichen aufgefallen. Ich habe die Toten bestattet, so wie ich glaubte, dass es Brauch bei euch fey ist. Dann habe ich versucht, die schlimmsten Spuren des Kampfes zu beseitigen. Damit bin ich auch immer noch beschäftigt, aber letztlich habe ich darauf gewartet, dass Ihr Euer Bewusstsein wiedererlangt. Denn – es beschämt mich, das zugeben zu müssen – ich bin es am Ende, der Eure Hilfe benötigt.«
»Das wird warten müssen, Narsharram.« Israni streifte den Wintermantel über, den ihr Gegenüber für sie bereitgelegt hatte, zog die Gürtelschnallen fest und schaute sich im Raum nach einer Waffe um – die sie nicht fand. »Ich muss zurück zu meinem König Fenvarien. Der Krieg gegen Pyrdacor und den namenlosen Gott tritt in eine neue Phase ein und ich werde dort gebraucht. Ich danke dir für meine Rettung und ich bin sicher, es steckt eine interessante Geschichte dahinter, warum du mich hier gesucht und gefunden hast, aber ich habe jetzt keine Zeit dafür. Sollten wir das alles überleben, findest du mich in Tie’Shianna.«
Narsharram schaute verwundert zu ihr auf. »Ihr … Ihr versteht nicht. Es geht um etwas, das größer ist als der Krieg! Und ja, ich habe nach Euch gesucht und es muss Euch wie ein Wunder vorkommen, dass ich Euch im Schneesturm gefunden habe, aber es hat eine tiefere Bedeutung!«
Israni trank den Krug Wasser auf dem Nachttisch in einem Zug aus, steckte das Horn ein und durchmaß mit schnellen, aber noch etwas unsicheren Schritten den Raum. Die Halle war bei weitem nicht in so einem guten Zustand, wie es ihre Kammer gewesen war. Israni befand sich im ersten Stock des alten Wachturms und Narsharram hatte noch nicht alle zerstörten Möbel in Feuerholz verwandelt. Die Tür war aufgebrochen worden und überall lagen noch Granitbrocken und Trümmerteile herum. Der Baum, in dessen Wurzeln und Ästen die Wächter diese Festung erbaut hatten, hatte ebenfalls schwere Wunden erlitten und war so gut wie tot. Sie roch die erste Fäulnis im Holz.
Nahe beim Eingang musste es einen Waffenschrank geben, und wenn nicht, würde sie eben einen lebendigen Baum finden müssen und aus seinen Ästen einen Speer formen. Narsharram folgte ihr die Treppe hinab und plapperte weiter. Dabei erklang ein Geräusch, das Israni seltsam vorkam. Ein leichtes Schaben und Pochen. Sie schaute an ihrem Retter hinab und sah, dass sich aus seinen Roben ein geschuppter Echsenschwanz herausschlängelte, der gegen die Stufen geschlagen war. Sofort packte sie ihn am Kragen und konnte ihn ohne große Anstrengung trotz ihres ausgelaugten Körpers anheben. Er war bemerkenswert leicht.
»Echse!«, zischte sie. »Ich hätte es riechen sollen. Dienst du eurem Gottdrachen? Bist du ein Spion der namenlosen Horde?«
Narsharram sah sie unverwandt aus seinen halb im Schatten der Bandagen verborgenen Echsenaugen an und blieb ruhig. »Ich bin solches Misstrauen gewohnt. Aber jetzt interessiert Ihr Euch doch noch für mich. Erfreulich!«
»Ist das alles ein Trick? Bin ich in einem Gefängnis des Feindes?« Israni packte den Kragen des Echsenmannes noch fester.
»Wenn Ihr hinausgeht, werdet Ihr feststellen, dass Ihr überallhin gehen könnt, wie es euch beliebt, Israni, Heldin von Simyala. Dies ist weder ein Trick noch ein Gefängnis. Ich bin wegen einer ganz einfachen Wahrheit zu Euch gekommen: Es gibt eine Gelegenheit und Möglichkeit, Acuriën zu retten.«
Israni erstarrte. Sie suchte nach irgendetwas in den Augen der Echse, ohne selbst zu wissen, nach was genau. Den Ausdruck in ihnen konnte sie nicht lesen. Wortlos setzte sie ihn ab und presste die Handballen gegen ihre eigenen Augen, die plötzlich in den Höhlen brannten.
Acuriën. Acuriën und eine Schuld von tausend Jahren.
Narsharram hatte nicht gelogen. Die Tür stand ihr offen und hinter ihr erstreckten sich die schier endlosen, dunklen Wälder der Nordlande. Die Spuren der Horde waren tatsächlich Wochen alt, aber noch immer gut zu lesen. Im Waffenschrank hatte sie nichts mehr gefunden, also hatte sie aus dem Ast einer freistehenden Ulme, unter der Narsharram die Toten der Schlacht begraben hatte, einen Speer geformt. Nun saß sie selbst im Schatten jener Ulme und betrachtete ihr Werk im Licht der Abendsonne.
Narsharram saß im Schneidersitz neben ihr. Die Bandagen hatte er abgenommen und unter ihnen war die gewölbte Schnauze eines Echsenwesens zum Vorschein gekommen. Israni hatte gegen Achaz gekämpft, die Pyrdacor als treue Sklaven in die Schlacht warf, doch die perlfarbene Haut und die großen, gelblich-grauen Augen passten nicht zum Aussehen dieser vertrauten Art von Echsenwesen. Es gab noch weitere, die dem Gottdrachen hörig waren, manche schlangengleich und andere mit den mächtigen Kiefern von Sumpfjägern. Aber ein so zierliches, blasses Wesen hatte sie noch nicht in den Armeen und Reihen von Dienern ausmachen können. Unter der Kapuze seiner grauen Robe glaubte sie, feine Auswüchse wie Flossen oder Fächer ausmachen zu können.
Wo sie im ersten Moment als Soldatin gehandelt und den Feind gesehen hatte, erlaubte sie es sich nun, mit älteren Augen zu sehen. Mit der Erinnerung daran, wie die fey einst zwar Krieg geführt und Verbündete gewählt, aber anderen immer zuerst mit Neugierde entgegengetreten waren statt mit Hass.
»Acuriën mag Euer engster Vertrauter in dieser Welt gewesen sein«, erklärte Narsharram, »aber Ihr wusstet nicht alles über ihn. Auch ich nannte ihn einst Freund. Vor seiner Zeit im Himmelsturm Ometheons. Die Nachricht von seinem Tod in Simyala schmerzte mich zutiefst. Ich konnte es nicht ganz glauben, denn mein Orden hat Acuriën eine große Zukunft in seinen Reihen geweissagt, auch wenn er nie davon erfahren hat. Wir waren uns sehr sicher, dass diese Prophezeiung eintreten würde.«
»Und was ist das für ein Orden? Er hat nie von einem Orden von Echsenmenschen erzählt.«
Narsharram fauchte, Israni deutete es als Kichern. »Oh nein, der Orden setzt sich aus allen erdenklichen Völkern zusammen. Wir haben Vorurteile hinter uns gelassen und arbeiten gemeinsam daran, das Gefüge der Welt zusammenzuhalten. Vermutlich habt Ihr nie von uns gehört. Wir nennen uns den Orden der sechs Flügel Menacors.«
»Also doch Drachenanbeter.« Israni drehte den Speer in ihren Fingern hin und her, hörte aber weiter zu.
»Menacor ist der Herr des Limbus. Ein Hoher Drache, ungefähr so mächtig wie Pyrdacor. Er wacht über das Gefüge zwischen den Welten, beschützt unsere Sphäre vor den Dämonen und wahrt das Gleichgewicht. Unser Orden erforscht in seinem Namen das Weltengefüge. Wir verhindern Eingriffe in dieses zerbrechliche Gefüge.« Narsharram sprach langsam, so als würde er dies alles einem Kind erklären. Möglicherweise hatte Israni schon einmal davon gehört und es als unwesentlich abgetan.
Natürlich wusste sie von anderen Sphären, von Feenwelten und noch ferneren Reichen jenseits der Schöpfung, immerhin waren die fey selbst einst von dort aus dem Licht in die 3. Sphäre getreten. Sie hatte aber die Erfahrung gemacht, dass Pforten in andere Sphären sehr oft mit dämonischen Präsenzen einhergingen. Doch offenbar war es die Aufgabe dieser Menacor-Anbeter, genau diese zu vernichten. Sie nickte und bedeutete Narsharram damit nicht nur, dass sie verstanden hatte, sondern auch, dass sie sein Tun billigte.
»Die Welt ist in sieben Sphären unterteilt. Der Limbus teilt und verbindet diese Sphären gleichermaßen«, fuhr der Echsenmann fort. Dabei machte er eine ausladende Geste und zwischen seinen behandschuhten Klauen erschien eine sich drehende, durchscheinende Kugel, die offenbar mehrere kleinere Kugeln enthielt. Israni hob eine Augenbraue, kommentierte die Spielerei aber nicht weiter.
»Diese Sphären umschließen einander wie konzentrische Kreise. Die innerste, die 1. Sphäre ist ein besonders heiliger Ort. Sie ist unveränderlich und ewig, dort wird das Weltengesetz gehütet. Die 2. Sphäre ist der Ursprung der elementaren Kräfte, über die Pyrdacor zu herrschen gedenkt. In der 3. Sphäre wiederum wandeln wir. Die vierte und fünfte sind jenseitige Sphären, die Heimat der toten Seelen und von Göttern.«
Israni schnaubte. »Und aus welcher dieser Sphären glaubst du, dass wir fey stammen? Woher kamen wir, als wir Simia in diese Welt folgten?«
»Dazu gibt es viele Theorien, aber ich glaube – aus keiner dieser Sphären. Ihr stammt nicht von dieser Welt. Ihr gehört sozusagen gar nicht hierher und nach eurem Tod solltet ihr diese Welt auch wieder verlassen. Manche Mitglieder meines Ordens glauben, dass euch Simia eigens für den Kampf gegen das Namenlose in unsere Welt geführt hat. Gegen das dhaza, die Verderbnis. Er selbst, der Namenlose, der verbannte Gott, sitzt nicht in der 4. oder 5. Sphäre. Er wurde für seinen Frevel von dort verbannt und an den Sternenhimmel gekettet, an die 6. Sphäre, den Ursprung der Sternenkraft, der Magie, die Heimat der Stellare. Aus dieser Sternenkraft wurde einst ein Schutzwall gegen die 7. Sphäre geschaffen, doch der Namenlose riss diesen Wall ein, um die Dämonen in die Welt zu lassen.« Narsharram kratzte mit einer Klaue an der äußersten Kugel und ein Riss entstand darin, die äußere Schale begann zu verschrumpeln wie ein Apfel auf dem Herd. »Seitdem ist er dazu verdammt, den von ihm geschaffenen Riss zu bewachen.«
Diese Geschichte war Israni natürlich vertraut, und sie setzte sie so fort, wie sie sie vor unsagbar langer Zeit gehört hatte, während sie den Speer hin und her drehte: »Denn die 7. Sphäre ist keine Sphäre. Sie ist das Außerhalb, sie steht jenseits der Schöpfung, sie erstreckt sich unendlich in alle Richtungen und ist bevölkert von ungeschaffenen Kreaturen. Wer sie erblickt, verliert den Verstand. Die Dämonen dort neiden uns die Existenz und kennen nur ein Ziel: die anderen sechs Sphären zu vernichten.«
Narsharram nickte. »Das ist sehr nah an der Wahrheit. Tatsächlich können Dämonen deutlich vielschichtiger sein – und sie haben auch eine gewisse Freude daran, ihre Opfer zu korrumpieren. Sie mögen chaotisch sein, doch viele von ihnen schmieden langfristige Pläne, und genau darum geht es. Ihr wähnt Acuriën tot. Doch ich glaube, er ist nach wie vor am Leben.«
Israni versuchte, sich nicht anmerken zu lassen, wie sehr seine Worte sie aufwühlten, als sie den Blick von ihrem Speer hob, um den Echsenmann und sein Sphärenmodell zu betrachten.
»Als Pyrdonas Beschwörung in Simyala misslang, wurde Acuriën mit ihr in die Niederhöllen gerissen. Hierhin …« Narsharram zeigte auf eine vage Region in der dritten Sphäre und fuhr dann mit seiner Krallenhand eine Linie nach außerhalb der Schutzhülle der 6. Sphäre. Die Klaue hinterließ eine Spur in dem durchsichtigen Gebilde. »Doch dort gehört Acuriën nicht hin. Er ist nicht tot, denn nach seinem Tod sollte er ins Licht treten. Er ist auch keine verfluchte Seele, die die Dämonen in den Niederhöllen der 7. Sphäre beanspruchen dürfen. Acuriën ist nicht durch Untat oder Pakt in diese Lage geraten und ich denke, somit ist auch die Weissagung meines Ordens kein Fehler. Er darbt dort draußen jenseits der Sterne seit Jahrhunderten und hofft auf Rettung.«
Israni ließ langsam den Speer sinken und starrte mit leerem Blick zum Horizont. Ihre Augen brannten wieder. Jahrhunderte. Jahrhunderte dort, im Chaos, im Unvorstellbaren. Sie bemerkte, dass sie so fest die Kiefer aufeinanderpresste, dass ihre Zähne knackten und zwang sich zu einem tiefen Atemzug.
»Wieso bist du damit nicht früher auf mich zugekommen? Wieso musste mein Freund erst Jahrhunderte leiden?«
»Weil mein Orden mir diese Mission erst jetzt bewilligt hat. Die Oberen haben mir nicht geglaubt, und … für mich sind nicht so viele Jahre vergangen. Der Orden des Menacor hat seinen Sitz in einer Burg, die durch den Limbus reist. Dort verläuft die Zeit anders als hier. Wisst ihr, Zeit ist etwas, das an eine Sphäre gebunden ist, sie ist relativ. Auch für Acuriën mögen erst wenige Monate vergangen sein.« Als er sah, dass Israni weiter ruhig blieb, fuhr Narsharram mit seinen Ausführungen fort: »Der Orden hat mir diese Mission erst jetzt bewilligt, weil unsere Späher im Süden des Kontinents eine Spur aufgenommen haben. Eine Spur, die zu Acuriën führen könnte. Wir glauben, dass es den Krieg entscheiden könnte, ihn wieder in den Reihen des Guten zu haben. Aber über die genauen Umstände kann ich Euch nicht mehr erzählen.«
»Etwas genauer musst du schon werden, wenn du willst, dass ich dich begleite. Prophezeiungen, Schicksal …, das sind große, aber letztlich hohle Worte. Ihr Menacoriten wollt also, dass Pyrdacor den Krieg verliert?«
»Wir wollen, dass alles so eintritt, wie es im Sinne des Gleichgewichts der Sphären ist. Pyrdacor bedroht dieses Gleichgewicht. Er zapft die Kräfte der 2. Sphäre an. Er plant, das Gesetz der 1. Sphäre zu ändern, was niemandem gestattet ist. Er plant, die 5. Sphäre in Aufruhr zu versetzen, um selbst ein Gott zu werden. Er überzieht diese Sphäre mit Krieg. Er lässt sich mit dem Gefährlichsten, das wir kennen, ein, um seine Ziele zu erreichen und droht, noch mehr Ungeschaffene aus der 7. Sphäre in die Welt zu lassen. Das können wir nicht dulden.
Wir haben gesehen, dass Pyrdacor bald fallen wird. Ihm bleiben nur noch ein gutes Dutzend Jahrzehnte und er wird Pyrdona in die Verdammnis folgen. Pyrdacor ist vom Namenlosen verdorben und das möglicherweise von Grund auf. Doch wir Sterblichen werden ihn nicht in einer Feldschlacht bezwingen. Die Mächte des Schicksals haben sich bereits gegen ihn verschworen. Er wird stürzen, und wenn es soweit ist, wird es ein Machtvakuum geben und …«, Narsharram unterbrach sich, er schien mit einem Mal aufgeregt und wirkte um einiges kraftvoller als noch vor ein paar Augenblicken. Diese Begeisterung passte nicht zu seiner zuvor zurückhaltenden Art. »Ich habe bereits zu viel gesagt. Der Punkt ist, dass wir Acuriën zurückholen müssen, damit sich die Weissagungen erfüllen, und dafür müssen wir nach Süden reisen. In die Zwergenbinge Schtromonosch im Gebirge der schwarzen Gigantin.«
Israni hob eine Hand, und Narsharram schwieg, geduldig. Sie wog die Worte ab, versuchte, sie zu fassen zu bekommen. So viel, so viel Neues, Erhofftes und Unglaubwürdiges. Doch sie wollte glauben.
»Du bist ein seltsames Wesen, Narsharram«, sagte sie schließlich. »Ich weiß nicht, ob ich dir traue oder mit dir allein so weit reisen will, wenn ich ehrlich bin. Was sollen wir in dieser Zwergenstadt?«
»Es gibt einen Teil von Acuriën, der noch immer in dieser Sphäre weilt. Pyrdona hat ihm diesen entrissen. Seitdem streift er durch die Welt. Gerade befindet er sich in den Tiefen unter Schtromonosch und jagt Zwerge.«
Das Land zitterte und flirrte, aber immer nur, wenn er gerade nicht hinsah. Der Horizont kam näher und krümmte sich wirr und unmöglich. Acuriën sah in den bitterkalten Nebel.
»Ich bin mir nicht sicher«, sagte er und drehte sich um, doch er war allein. Er konnte sich nicht erinnern, wem die Worte galten.
Etwas stimmte nicht mit dem Eis. Seine Schatten waren nicht blau, in seinen Tiefen waren keine Farben verborgen. Tatsächlich besaß es überhaupt keine Tiefe, war nur eine stumpfweiße Oberfläche aus scharfen Kanten und gefrorenen Messern.
Langsam ließ er sich auf die Knie sinken und strich Schnee beiseite, um einen Blick auf das zu erhaschen, was unter dieser dünnen, bösartigen Schicht verborgen sein mochte. Er verlor dabei seine Haut in grau erfrorenen Fetzen, schon längst ohne Gefühl in den Fingern.
Das Eis war schwarz. Oder das, was darunter war, war schwarz. Er warf einen letzten Blick auf den Horizont, der wie eine Lawine auf ihn zu raste. Dann hauchte er auf den Grund und rieb mit den zerrissenen Händen darüber.
In der Schwärze öffneten sich Augen. Goldene, dann blaue, dann gänzlich weiße mit nur einem schwarzen Punkt als Pupille. Sie alle starrten ihn wütend und gierig und klagend an.
Der Horizont war heran und er war eine Welle aus Eis und geifernden Mäulern, wurde davongerissen und zermahlen, verlor sich in Echos von Fragen und zersplitterten Gedanken.
Schon wieder.
Ewigkeiten später sammelten sich seine Fragmente erneut. Er stand in der weißen Einöde und über ihm mahlte ein dunkler Himmel, aus dem wispernd Pfeile aus Eis herabsanken. Der Horizont war voll riesiger Schatten, die lautlos durch grauen Nebel dahinzogen. Sie jagten, etwas oder jemanden, doch nicht ihn.
Die Kälte war wie eine Wolke aus Nadeln auf jedem Streifen bloßer Haut. Seine Zähne schmerzten und seine Brust zitterte, als er zu atmen versuchte. Aber er erfror nicht, trotz der Umgebung, die alles andere Leben in wenigen Augenblicken zu Statuen aus Eis hätte erstarren lassen.
Er sah zum Himmel auf, an dem sich zwischen den Regenwirbeln aus Eisdornen schwer fassbare Gestalten wanden. Gliedmaßen, Köpfe, offene Mäuler, eingefallene oder aufgedunsene Leiber, alle verdreht und ineinandergefügt, um ein stets wachsames Firmament zu bilden.
»Ich bin mir nicht sicher«, begann er erneut und dann durchfuhr ihn Erinnerung mit derselben glühend kalten Intensität wie der Wind, der über das verfluchte Land raste.
Er und Kilgan und Israni waren im Sturm verloren. Sie würden erfrieren und mit ihnen die wenigen, kostbaren Erinnerungen an die größte Schöpfung der fenvar: Ometheon. Der Turm war gefallen und alle, die sich nicht seiner neuen Herrin beugten, waren abgeschlachtet oder aufs Eis hinausgetrieben worden.
Unter der Last der wiederkehrenden Bilder sank er auf die Knie. Sofort begann Frost seinen Leib hinaufzukriechen. Er krümmte sich. Das Eis dröhnte und knirschte unter ihm. Es waren Bilder von monströsen Kreaturen, die durch die Gänge krochen und Überlebende suchten, vom Drachen, der aus dem Himmel herabstieß, vom schwarzen Wasser unter dem Eis, das mit seinem gnadenlosen Griff den Versinkenden selbst den Atem für einen Verzweiflungsschrei nahm, von einem gottgleichen Wesen, das die fenvar Insekten gleich unbeachtet ließ, als sie um Hilfe flehten.
Acuriën hatte nicht mehr viel. Wenig mehr als diese Erinnerungen und Israni und Kilgan, die irgendwo dort draußen waren.
Er stand auf, und das Eis, das an ihm hinaufgewuchert war, zerbrach mit einem trockenen Knacken. Langsam, aber beharrlich begann er, einen Fuß vor den anderen zu setzen. Er hinterließ eine Spur aus totem Fleisch, doch der Schmerz in seinen Gliedern verblasste, während er eines nach dem anderen verlor.
Im summenden, klirrenden Gemisch aus schwarzem Himmel und weißem Schnee hing eine andere Gestalt. Bislang, seit er Israni und Kilgan verloren hatte, war Acuriën allein gewesen. Mit einem wortlosen, simplen Schrei der Hoffnung rang er seinen tauben Beinen erst ein stolperndes, rasches Vorwärtstaumeln ab und dann weite, seltsam schwerelose Sprünge. Die ebenso schwerelosen Kristalle hingen um ihn in der Luft, allesamt scharfkantig – und siebenstrahlig.
Die Gestalt war weiblich und die zarten Ohrenspitzen einer fey waren in dem Wirbel aus blassem Haar zu erkennen, der ihr Gesicht verbarg. Ihre Haut war nackt und makellos, aber unstet. Mal durchscheinend wie Eis, mal fest.
Er kam vor ihr zum Stehen und sah hinauf. Langsam sank sie herab, bis ihre bloßen Zehen, flackernd zwischen Wirklichkeit und Schein, die Schneewehen berührten. Sie näherte sich und ihr Haar wurde vom Wind nun auch um ihn herum gepeitscht wie ein silberner Vorhang. Ihr Gesicht war nun ganz nah, unbedeckt. Sie öffnete ihre goldenen Augen und er schrie, schlug mit den Armen um sich und befreite sich aus den Strähnen, die knisternd unter seinen Fingern brachen.





























