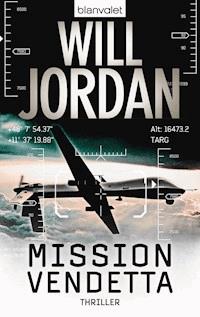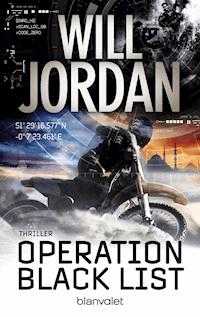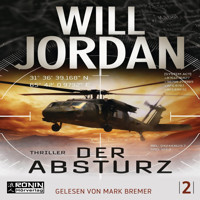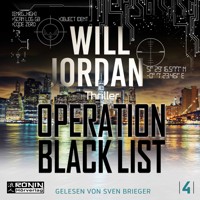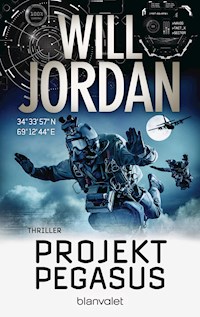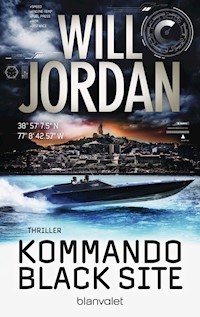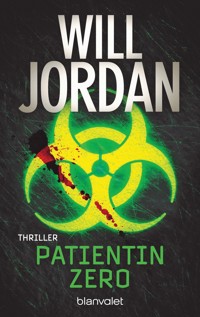
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Skrupellose Terroristen, ein tödliches Virus und ein verzweifelter Wettlauf gegen die Zeit.
Russische Terroristen haben eine verheerende Biowaffe an sich gebracht: eine Seuche, die Menschen zu rasenden Bestien macht, bevor sie die Wirte auf grausame Weise tötet. Der Sicherheitsspezialist Cameron Becker und die WHO-Seuchenexpertin Lori Dalton versuchen, die Verbreitung des Virus zu verhindern. Doch sie kommen zu spät. Infizierte Träger befinden sich bereits in Flugzeugen mit Zielen auf jedem Kontinent – die Seuche ist nicht mehr aufzuhalten. Becker und Dalton bleibt nur noch eine Möglichkeit, um die Menschheit zu retten. Damit ein Gegenmittel entwickelt werden kann, müssen sie den ersten Menschen finden, der die Krankheit überlebt hat – Patientin Zero.
Lesen sie auch die actionreiche Erfolgsserie um den CIA-Operator Ryan Drake. Beginnen Sie jetzt mit »Mission: Vendetta«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 545
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Buch
Russische Terroristen haben eine verheerende Biowaffe an sich gebracht: eine Seuche, die Menschen zu rasenden Bestien macht, bevor sie die Wirte auf grausame Weise tötet. Der Sicherheitsspezialist Cameron Becker und die WHO-Seuchenexpertin Lori Dalton versuchen, die Verbreitung des Virus zu verhindern. Doch sie kommen zu spät. Infizierte Träger befinden sich bereits in Flugzeugen mit Zielen auf jedem Kontinent – die Seuche ist nicht mehr aufzuhalten. Becker und Dalton bleibt nur noch eine Möglichkeit, um die Menschheit zu retten. Damit ein Gegenmittel entwickelt werden kann, müssen sie den ersten Menschen finden, der die Krankheit überlebt hat – Patientin Zero.
Autor
Will Jordan lebt mit seiner Familie in Fife in der Nähe von Edinburgh. Er hat einen Universitätsabschluss als Informatiker. Wenn er nicht schreibt, klettert er gerne, boxt oder liest. Außerdem interessiert er sich sehr für Militärgeschichte.
Die Ryan-Drake-Romane bei Blanvalet:
Mission: Vendetta
Der Absturz
Gegenschlag
Operation Blacklist
Codewort Tripolis
Das CIA-Komplott
Kommando Black Site
Projekt Pegasus
Angriffsziel Circle
Besuchen Sie uns auch auf www.instagram.com/blanvalet.verlag
und www.facebook.com/blanvalet.
WILL JORDAN
PATIENTIN
ZERO
Thriller
Aus dem Englischen
von Wolfgang Thon
Die Originalausgabe erschien 2022 unter dem Titel »Dark Harvest« bei Blackstone Publishing, Ashland.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Copyright der Originalausgabe © 2022 by Will Jordan
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2023 by Blanvalet
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: text in form / Gerhard Seidl
Coverdesign: © Johannes Frick unter Verwendung von Motiven
von iStock.com / matejmo und © Johannes Frick
HK · Herstellung: sam
Satz: KCFG–Medienagentur, Neuss
ISBN 978-3-641-28684-2V001
www.blanvalet.de
Für Lara, eine treue Freundin.
PROLOG
Schnee.
Schnee, schwarzer Fels und eiskalter Wind.
Der Sturm toste über den einsamen Gebirgspass, und jede bitterkalte Böe wirbelte einen neuen Hagel aus gefrorenem Schnee auf. Der Wind war stark genug, unvorsichtigen Wanderern das Gleichgewicht zu rauben und sie zwischen den scharfkantigen Felsen und dem steinigen Geröll ins Verderben zu stürzen.
Hoch oben tauchten die steilen Berggipfel in die bleiernen grauen Wolken ein, die wütend um sie herumwirbelten.
In dieser düsteren, feindlichen Umgebung kämpfte sich eine einsame Gestalt den Hang hinauf. Sich gebeugt gegen den aufkommenden Sturm stemmend, das Gesicht vom Wind abgewandt, der die nackte Haut wund peitschte, stapfte das Mädchen verbissen durch den immer tiefer werdenden Schnee. Jeder Atemzug kam als flacher, keuchender Seufzer, und Wärme und Feuchtigkeit des Ausatmens wurden sofort vom heulenden Wind weggerissen, als versuchte der Berg selbst, das Leben aus ihr herauszusaugen.
Sie trug weder einen Rucksack noch hatte sie eine schützende Plane, Ausrüstung oder Waffen dabei. Sie verfügte nicht einmal über einen Vorrat an Lebensmitteln, um sich auf ihrer strapaziösen Reise zu stärken. In dem Chaos ihres Aufbruchs hatte sie keine Zeit gehabt, etwas zusammenzupacken für ihre Flucht aus der beruhigenden Sicherheit ihres Dorfes, ihrer Heimat, ihres Volkes.
Vielmehr dem, was aus ihrem Volk geworden war.
Das Mädchen schüttelte sich bei dem Gedanken an etwas, das viel tiefer drang als der kühle Wind, als sie sich lebhaft an die Schrecken erinnerte, die sie einen Tag zuvor erlebt hatte. Die Szenen von Tod und schrecklicher Gewalt, begangen von Menschen, die einander bis dahin nur Liebe und Loyalität entgegengebracht hatten. Ein ganzes Dorf war ausgelöscht worden, eine ganze Gemeinschaft vernichtet. Jeder, den sie in den fünfzehn Jahren ihres Lebens gekannt und gemocht hatte, war für immer verloren. Und das alles wegen dieses Gegenstandes, den sie bei sich trug, in der kleinen Ledertasche, die sie über die Schulter gehängt hatte. Er wog schwer und schlug ihr bei jedem Schritt schmerzhaft gegen die Seite.
Der Geisterstein. Ein großer Splitter aus so schwarzem Gestein, wie sie es noch nie gesehen hatten. Die von vielen Facetten überzogene Oberfläche war vollkommen eben, die Kanten waren pfeilgerade, und die bizarren kristallinen Tiefen sogen den Blick und den Geist auf. Die einzige Unvollkommenheit seiner seltsamen Form stellte die grobe Bruchlinie entlang der Basis dar, wo er aus seinem angestammten Platz herausgebrochen worden war.
Das Mädchen erinnerte sich noch lebhaft an die aufregende Entdeckung vor einigen Tagen, als ihre Jagdgruppe auf eine bis dahin unbekannte Höhle hoch oben in den Bergen gestoßen war. Drei der stärksten und mutigsten Jäger hatten sich hineingewagt. Der flackernde Schein ihrer Fackeln verschwand in der Dunkelheit, und als sie schließlich wieder aus der schattigen Höhle heraustraten, erzählten sie eine haarsträubende Geschichte über sagenhafte sternenübersäte Höhlen, die dem Eingang in eine andere Welt glichen. Als Beweis für ihre Entdeckung hatten sie den Geisterstein mitgebracht, den sie aus einer Wand dieser seltsamen unterirdischen Welt geschlagen hatten.
Schwaches Tageslicht und schlechtes Wetter hatten weitere Expeditionen in diese unterirdische Höhle verhindert und sie gezwungen, mit ihrer seltsamen Beute in ihr Dorf zurückzukehren. Dennoch wurden sie als Helden und mutige Entdecker gefeiert, und schon bald redeten alle davon, in die Höhle zurückzukehren, um weitere Schätze zu suchen.
Dann brach die Krankheit aus. Es begann mit den jungen Männern der Jagdgesellschaft, aber rasend schnell griff die Krankheit auch auf andere über, bis sie wie ein Lauffeuer unkontrolliert in ihrem Dorf wütete. Selbst die versiertesten Heiler des Dorfes konnten nichts tun, um das Fortschreiten der Krankheit aufzuhalten.
Das Mädchen konnte es sich nicht erklären, aber tief in ihrem Inneren spürte sie es: Dieser Gegenstand, gepriesen als Geschenk der Geisterwelt, als Talisman der Macht, war die Quelle ihres Verderbens.
Das Böse wohnte ihm inne, und diese dunkle Bosheit, die in ihm lauerte, war irgendwie hinausgedrungen und hatte alles und jeden um sich herum infiziert. Sie verwandelte gute Menschen in mörderische Unholde.
Nur sie war verschont geblieben. Sie allein war noch bei Verstand, während alle anderen in den Wahnsinn abglitten.
Sie war am Leben geblieben, und sie wusste, was sie zu tun hatte. Der Geiststein musste in die Höhle zurückgebracht werden, aus der er geraubt worden war. Nur dann würden die Geister besänftigt werden und den bösen Fluch aufheben.
Das wusste sie so sicher, wie sie atmete.
Und doch schien sich jetzt alles gegen sie zu verschwören, um ihre Mission zu vereiteln. Noch während sie sich einen Weg durch die dicht bewaldeten Ausläufer bahnte und die unteren Hänge des Berges hinaufstieg, zogen von Norden her bedrohliche graue Wolken auf. Der Himmel verdunkelte sich, und ein kalter Wind kam auf. Der Winter stellte sich dieses Jahr sehr früh ein.
Es war eine schlechte Zeit für Expeditionen, selbst für erfahrene Reisende, die sich in fernste Gegenden wagten, ganz zu schweigen von einem mageren verängstigten Mädchen von kaum fünfzehn Jahren. Sie war keine Abenteurerin, die sich nach Gefahr und Aufregung sehnte. Ihr kurzes, behütetes Leben war ausschließlich von der Zugehörigkeit zu ihrer Familie erfüllt gewesen.
Sie mochte eine unwürdige Wächterin sein, aber es gab niemanden sonst mehr. Sie allein stand zwischen den bösen Geistern und der ahnungslosen diesseitigen Welt.
Also ging sie weiter, sammelte ihre schwindenden Kräfte und ihre Entschlossenheit, und jeder Schritt brachte sie weiter den Hang hinauf, ein kleines Stück näher zu ihrem Ziel. Sie wollte dem Pfad folgen, den ihre Jagdgruppe genommen hatte, bis sie die Höhle gefunden hatte, und dann würde sie sich von dieser verhassten Last befreien.
Eine plötzliche heftige Böe riss sie von den Füßen. Sie stolperte, klammerte sich an den vom beißenden Wind freigefegten Boden, und die scharfen Steine schnitten ihr in die Hände.
Mit in dem eisigen Wind tränenden Augen blickte sie zu dem großen Gipfel hinauf, der bruchstückhaft durch Lücken in der Wolkendecke zu sehen war. Der Berg ragte über ihr auf, unvorstellbar hoch und unüberwindlich, und glühte im abnehmenden Licht zornig rot. Bald würde die Dunkelheit hereinbrechen. Die klirrende Kälte wurde immer stärker, je mehr sich der Tag dem Ende zuneigte.
Ihre Zeit lief ab.
Das Mädchen stemmte sich hoch, stolperte weiter und hielt sich auf der Leeseite des Grats, wo die Felswände wenigstens etwas Schutz vor dem bitteren Wind boten. Als der Grat wieder abflachte und ebenerdig wurde, zitterte sie und schnappte in der eisigen Kälte nach Luft. Jeder Atemzug brannte ihr im Hals.
Ihre Füße und Hände waren taub, der Körper schmerzte vor Müdigkeit. Ihr Fuß blieb an einem unter dem Schnee verborgenen Stein hängen, sie fiel auf die Knie und stieß ein erschöpftes und hilfloses Schluchzen aus. Tränen liefen ihr über die Wangen und gefroren auf ihrer Haut. Es war töricht von ihr gewesen hierherzukommen und naiv zu glauben, sie könne diesen Berg mitten im Wintersturm besteigen. Es war ignorant von ihr gewesen, ihr Schicksal nicht vorausgesehen zu haben.
Dann, in einem dieser seltsamen Glücksfälle, die eintreten, wenn man es am wenigsten erwartet, riss die Wolkendecke für ein paar Sekunden auf und gab den Blick auf den Berg um sie herum frei. Sie sah den Grat, auf den sie sich mühsam hinaufgekämpft hatte, sah die dunklen Wälder und Seen, die schwindelerregend weit unter ihr lagen, sah den steilen Abhang, der nach rechts abfiel. Er führte zu …
Sie stieß einen Schrei aus, als sie die schmale Bresche in der windgepeitschten Monotonie entdeckte, eine Schlucht, die aussah, als hätte eine große Klinge in die Seite des Berges gehackt und eine tiefe, rohe Wunde im Hang hinterlassen.
Daran erinnerte sie sich! Sie war fast da!
Mit neuer Kraft kämpfte sich das Mädchen auf die Beine und eilte zu der Schlucht, während sich die Wolken wieder schlossen und der Sturm erneut auf sie einpeitschte. Ihr Körper mochte erschöpft sein, aber ihr Geist war frisch gestärkt. Sie stapfte weiter, umklammerte ihre schwere Last und stolperte schließlich in den Eingang der Schlucht.
Die Veränderung war tiefgreifend und unmittelbar. Sie seufzte vor Erleichterung, dass sie endlich den beißenden Wind hinter sich gelassen hatte. Hier gab es keine Vegetation, weder Büsche noch Gräser. Nicht einmal Moos oder Flechten schienen hier gedeihen zu können. Der Berg war vollkommen karg und tot.
Zu beiden Seiten ragten steile Felswände in die Höhe und hielten das spärliche Tageslicht ab, sodass der schmale gewundene Pass in tiefe Schatten getaucht war. Das zwang sie, ihr Tempo zu verlangsamen und vorsichtiger weiterzugehen.
Sie hielt sich an einer Seite der Felswand fest und tastete sich in der Dunkelheit mit den Händen weiter. Dann blieb sie plötzlich stehen, als die Felswand zu ihrer Rechten abrupt verschwand. Stirnrunzelnd blickte sie auf diese unerklärliche Leere und schrie dann erschrocken auf.
Ein dunkler schmaler Spalt im Felsen klaffte vor ihr auf. Er war von herabgestürzten Steinen teilweise verdeckt und lag im Schatten. Sie wäre fast daran vorbeigegangen, ohne ihn zu bemerken. Aber sie hatte ihn gesehen.
Wider Erwarten hatte sie die Höhle gefunden! Jetzt gab es nur noch eine letzte Aufgabe zu erfüllen.
Sie sah sich kurz um, trat in die Dunkelheit und ließ die Welt hinter sich.
Das heftige Heulen des Windes ebbte zu einem fernen, eindringlichen Stöhnen ab, als sie vorwärts schlich. Sie streckte die Hände aus, tastete mit einer Hand über den rauen Stein an ihrer Seite und hielt die andere vor sich.
Sie hatte weder Feuerstein noch Zunder mitgebracht und auch keine Fackel, um ihren Weg zu beleuchten. Dafür war keine Zeit gewesen. Und jetzt befand sie sich auf unbekanntem Terrain. Sie hatte die Jäger damals nicht begleitet, als sie sich hierhergewagt hatten, und kannte den Grundriss der Höhle nicht.
Sie konnte kaum noch etwas sehen, aber ihre anderen Sinne schärften sich und glichen es ein wenig aus. Sie atmete tief ein und schmeckte die Luft. Sie war kalt und sehr trocken, roch uralt und nach Staub, aber sonst verriet sie wenig. Es stank nicht nach Fäkalien oder verwesendem Fleisch. Höhlen boten natürliche Behausungen für Raubtiere, und die Kinder in ihrem Dorf lernten von klein auf, sich niemals allein in eine zu wagen.
Der Boden war von losen Steinbrocken übersät, die im Lauf der Jahrtausende von der Decke herabgefallen waren, und führte mit leichtem Gefälle in die Bergflanke hinein. Vorsichtig tastete sie sich weiter. Ihre Atemzüge hallten von den Wänden wider, bis sie gut zwanzig Schritte zurückgelegt hatte.
Das war mit Sicherheit weit genug.
Sie griff nach dem Beutel an ihrer Seite und wog das schwere Gewicht des Gegenstandes darin. Bald war sie diese Last los und konnte diesen verfluchten Ort für immer verlassen.
Dann musste sie sich der gewaltigen Aufgabe widmen, sicher wieder zurückzukehren, und konnte sich vielleicht sogar erlauben, um all das zu trauern, was sie verloren hatte …
Das Beben schien das Gestein um sie herum zu erschüttern, und die Vibrationen ließen sie von der Wand zurückweichen. Instinktiv wandte sie sich zum Höhleneingang, alarmiert durch ein lauter werdendes Brüllen von draußen, das viel tiefer und mächtiger klang als ein Sturm. Noch bevor sie reagieren konnte, steigerte sich das Gebrüll zu einem donnernden Crescendo, als die Lawine über den entfernten Eingang prasselte.
Oh nein …!
Der plötzliche Windstoß, der durch die Tausende Tonnen Schnee verursacht wurde, die draußen über die Flanke des Berges herabdonnerten, fegte wie ein Orkan in den Höhlentunnel und schleuderte sie buchstäblich zurück.
Sie spannte sich an, weil sie den schmerzhaften Aufprall auf dem felsigen Höhlenboden erwartete. Stattdessen blieben ihre Füße an dem wulstigen Rand einer in der Finsternis verborgenen Felsspalte hängen, bevor sie im Leeren verschwanden. Sie streckte die Arme aus, tastete mit den Fingern vergeblich nach einem Halt, und dann erfasste sie ein unangenehmes Gefühl von Schwerelosigkeit.
Nicht so!, dachte sie in diesem letzten Moment, als sie hilflos in die Leere stürzte und ihre Schreie von der Dunkelheit verschluckt wurden.
1. Februar 1959
Cholat Sjachl, Ural-Gebirge
»Verdammt«, murmelte Juri Wladmirowitsch Guschkin und kämpfte mit seinen von der Kälte betäubten Händen mit den Riemen seines Rucksacks.
Die Temperatur war in der Nacht stark gefallen, und obwohl die Sonne inzwischen über den Bergen aufgegangen war, blieb es bitterkalt, als die Wandergruppe ihr Lager abbrach.
»Komm schon, Juri«, neckte ihn seine Wandergefährtin Sinaida. Sie hatte alles gepackt und war bereit zum Aufbruch. Im Morgenlicht sah sie enervierend fröhlich aus, ihre Augen leuchteten hell, und ihre Wangen waren rosig. »Bis du so weit bist, ist es schon Frühling.«
Ihre harmlose Neckerei wurde von den anderen mit einem Lachen quittiert. Einige klangen gutmütig, andere weniger.
Juri warf ihr einen gereizten Blick zu. »Sehr witzig, Sinaida.«
»Ganz ruhig, mein Freund«, mischte sich Igor Djatlow ein, der Expeditionsleiter. »Das hier ist kein Wettrennen. Der Berg geht nirgendwohin.«
Juri ballte die Hände zu Fäusten, um den Kreislauf in Schwung zu bringen, und machte sich mit neuer Entschlossenheit an den Riemen zu schaffen, bis es ihm schließlich gelang, sie zu sichern, was ihm spöttischen Applaus der anderen einbrachte.
In kurzer Zeit hatte die Gruppe ihre Zelte abgebrochen und machte sich auf den Weg zum Pass, der sie zu dem weit entfernten Gipfel namens Otorten führen würde. Wenn alles gut ging, würden sie am heutigen Abend ihr Lager auf der anderen Seite des Passes aufschlagen und am nächsten Tag versuchen, den Gipfel zu erreichen.
Sie waren zu neunt, meist Studenten des Ural Polytechnischen Instituts, allesamt erfahrene Wanderer und Skifahrer, die schon Dutzende von Bergen bestiegen hatten. Es waren junge, kluge und motivierte Leute, die das Abenteuer und neue Herausforderungen suchten.
Ein Mitglied der Gruppe hatte vor ein paar Tagen wegen sich verschlimmernder medizinischer Probleme umkehren müssen, aber abgesehen davon war die Expedition gut vorangekommen. Der klare Himmel und die ruhigen Bedingungen unterstützten ihre Bemühungen. Die Stimmung war gut, jetzt, da ihr Ziel in Sicht war, und sie beschleunigten ihr Tempo, während sie weiterzogen und dabei scherzten.
So tief im Ural konnte man fast glauben, sie wären die einzigen Menschen auf der ganzen Welt. Dieser Gedanke erweckte in den meisten von ihnen ein Gefühl von Freiheit und Abenteuer, wie sie es im täglichen Leben nur selten spürten.
Es fing ganz harmlos an, nur eine kleine Änderung. Der Wind drehte nach Norden. Nichts, worüber man sich Sorgen machen musste. Die Gruppe schaute gelegentlich hoch und kommentierte mit schwachem Interesse die aufziehenden Wolken, das Auffrischen des Windes und das gelegentliche Schneegestöber. Aber erst als Semjon Solotarew, der mit Abstand älteste Bergsteiger der Gruppe, das Thema ansprach, schienen sie wirklich Notiz davon zu nehmen.
»Der Himmel sieht hässlich aus«, bemerkte er und betrachtete missmutig den bedeckten Himmel. Er schnaubte kalte Luft aus. »Ich glaube, es zieht ein Sturm auf.«
Solotarew war erst später zu der Gruppe gestoßen. Er hatte von ihren Plänen, den Otorten zu besteigen, erfahren und Djatlow um einen Platz in der Gruppe geradezu angebettelt. Mit achtunddreißig Jahren war er zu alt für einen Studenten und blieb ein Außenseiter in der Gruppe. Er selbst sprach nur wenig, schien aber immer wachsam und aufmerksam den Gesprächen der anderen zuzuhören.
Sein Alter, sein schroffes Auftreten und seine wortkarge Art machten ihn bei niemandem sonderlich beliebt, und es herrschte der unausgesprochene Verdacht in der Gruppe, er wäre von einem örtlichen Parteifunktionär entsandt worden, um sie im Auge zu behalten. Schließlich konnte man nicht wissen, welche subversiven Gedanken eine Gruppe beeinflussbarer junger Menschen äußern würde, wenn niemand sie im Zaum hielt.
Jedenfalls hatten sie gelernt, mit ihren Worten in seiner Nähe vorsichtig zu sein.
»Das kommt vor. Wir sind schon öfter durch Stürme gewandert«, meinte Juri verbindlich. Er fügte nicht hinzu, dass jeder von ihnen das Wanderzertifikat Klasse III anstrebte, die höchste Qualifikation für Bergwanderer in der Sowjetunion. Scheiterten sie, bedeutete das, dass sie die gesamte Aufgabe wiederholen mussten.
Solotarew zuckte mit den Schultern und sagte nichts.
»Meinst du, wir sollten umkehren und abwarten?«, erkundigte sich Sinaida mit einem Hauch von Besorgnis im Blick. Man konnte sie gewiss nicht als ängstlich bezeichnen, aber sie neigte auch nicht dazu, unnötige Risiken einzugehen.
Alle Blicke richteten sich auf Djatlow. Er war der Anführer der Expedition und traf die Entscheidungen. Jeder konnte zwar seine Meinung äußern, aber die endgültige Entscheidung lag bei ihm. Er schwieg eine Zeit lang, den Blick auf die sich verdunkelnden Wolken gerichtet, als könne er so die von ihnen ausgehende Gefahr einschätzen, bevor er nickte. »Wenn wir jetzt umkehren, verlieren wir einen ganzen Wandertag«, argumentierte er. »Wir halten uns an den Plan. Wir gehen weiter, überqueren den Pass und schlagen unser Lager auf der anderen Seite auf.« Er sah die anderen an und wartete auf Einwände oder Fragen. Niemand ergriff das Wort. Sie vertrauten seinem Urteil und waren begierig darauf weiterzuziehen, nachdem die Entscheidung gefallen war. Sie verschwendeten keine Zeit, schulterten ihre Rucksäcke und machten sich wieder auf den Weg.
Kaum eine Stunde später fegte der erste starke Windstoß über den Pass. Er kam frontal von vorn, presste ihnen die Jacken an den Körper und zwang die Skiwanderer, sich tief nach vorn zu beugen, während sie weitergingen. Sie kamen jetzt langsamer vorwärts, als der aufgewirbelte Schnee die Sicht verschlechterte. Ihre gute Laune vom Morgen wich nun wachsender Besorgnis angesichts des sich verschlechternden Wetters.
Sie gingen weiter, in der Erwartung, auf der anderen Seite des Passes den Abstieg zu beginnen und ein geschützteres, bewaldetes Gebiet zu erreichen, wo sie ihr Lager aufschlagen konnten. Aber der Boden stieg immer weiter an. Bei einer Sichtweite von kaum hundert Metern war es schwierig zu navigieren, und bald wurde klar, dass sie vom Kurs abgekommen waren.
Verärgert über ihr zähes Weiterkommen brach Djatlow den fruchtlosen Aufstieg ab und befahl, am Eingang einer engen Schlucht ein provisorisches Lager zu errichten, während er das weitere Vorgehen plante.
»In welcher Richtung liegt der Pass?«, rief Sinaida dicht an Djatlows Ohr, der sich über seine heftig flatternde Karte beugte. »Wir sollten längst den Abstieg begonnen haben.«
»Gib mir etwas Zeit«, erwiderte er, ohne aufzublicken. Sinaida zögerte, erstaunt über die Veränderung, die mit ihm vorgegangen war. Seine Stimme war zwar noch fest und ruhig, aber er schien nicht mehr so selbstsicher zu sein wie sonst. Er war besorgt. Irgendetwas war nicht in Ordnung.
»Haben wir uns verirrt, Igor?« Sie senkte ihre Stimme so weit wie unter diesen Umständen möglich.
»Nein.«
Sie berührte seinen Arm. »Da stimmt doch was nicht. Sei ehrlich!«
Jetzt blickte er von der Karte auf, und seine Antwort bestätigte ihren Verdacht. »Wir sind zu weit nach Westen abgekommen, auf die Schulter des Cholat Sjachl«, erklärte er und deutete auf einen Gipfel neben der geplanten Route.
Cholat Sjachl – der Tote Berg in der Sprache der Mansen, des indigenen Volkes der Region. Ein wenig ermutigender Name.
Die junge Frau starrte auf die Karte und runzelte die Stirn, als sie die Abweichung betrachtete und rasch nachrechnete. Die Strecke zurückzugehen, um wieder auf den richtigen Weg zu kommen, könnte sie Stunden kosten.
»Das Wetter wird immer schlechter. Schaffen wir es wieder zurück nach unten?«
»Wir schaffen das«, antwortete er, faltete die Karte und steckte sie ein. »Es wird schwer, aber wir müssen es schaffen.«
Er wandte sich an die anderen. Sie kauerten neben ihren Rucksäcken, um sich vor dem schlimmsten Sturm zu schützen, und er erklärte ihnen in aller Eile die Situation und seinen Plan.
»Nehmt euch fünf Minuten Zeit, esst etwas und kommt wieder zu Kräften. Von hier an geht es nur noch bergab, aber wir müssen uns beeilen. Wir müssen vor Einbruch der Dunkelheit von diesem Berg herunterkommen.«
Juri knurrte verärgert. Der Weg hierher war anstrengend gewesen, und nun mussten sie hinnehmen, dass er umsonst gewesen war. Die Aussicht, bei schlechtem Wetter den ganzen Weg zurückwandern zu müssen, trug wenig dazu bei, seine Stimmung zu verbessern.
»Wir haben einen ganzen Tag vergeudet. Wie zum Teufel ist das passiert, Igor?«
Djatlow schüttelte den Kopf. »Das spielt jetzt keine Rolle.«
»Was soll das heißen, es spielt keine …?«
Er machte einen Schritt auf Djatlow zu, als eine kräftige Hand seinen Arm umklammerte. Er drehte sich um und sah sich Solotarew gegenüber.
»Immer mit der Ruhe, Junge«, warnte ihn der Mann. In seiner Stimme schwang die leise Drohung eines Mannes mit, der es gewohnt war, anderen seinen Willen aufzudrücken.
Juris erster Instinkt war, seinen Arm loszureißen, aber der Blick Solotarews reichte aus, um ihn davon abzuhalten. Selbst wenn er Solotarew in einem Kampf hätte besiegen können, was an sich schon zweifelhaft war, blieb die Möglichkeit, dass dieser Mann mehr war, als er zu sein schien.
»Na gut. Wie du meinst.«
Der Mann lockerte den Griff, sodass Juri zurücktreten konnte.
»Ruht euch aus, kommt zu Atem«, wies Djatlow die Gruppe an. »Wir machen erst wieder Rast, wenn wir unser Lager aufgeschlagen haben.«
»Ich gehe mal pissen«, verkündete Juri, der allein sein wollte.
Djatlow sah ihn an und nickte dann zögernd. »Geh nicht zu weit weg«, riet er ihm. »Nicht, dass du dich verirrst.«
Juri drehte sich um und stapfte ohne ein weiteres Wort davon. Der Wind peitschte heftig durch die enge Schlucht und zwang Juri, sich an den gefrorenen Fels zu klammern, während er vorwärtsstolperte und sich weiter von den anderen Kletterern entfernte, als es nötig war. Er wollte Abstand zwischen sich und die anderen bringen.
Als er um eine Kurve trat, öffnete er den Reißverschluss seiner Hose, stützte sich an der Felswand ab und erleichterte sich.
»Verdammte Idioten«, murmelte er und sah zu, wie die dampfende Flüssigkeit von den Steinen zu seinen Füßen abperlte und innerhalb von Sekunden gefror. Stunden des mühsamen Kletterns umsonst, und alles nur, weil Djatlow nicht richtig navigiert hatte. Er würde diesen Fehler auf jeden Fall vermerken, wenn die Gruppe ihren Bericht zur offiziellen Benotung einreichte. Versunken in seine kleinlichen Schuldzuweisungen, registrierte er kaum, wie der Wind nachließ und die Richtung wechselte. Das Erste, was er wahrnahm, war ein tiefes Dröhnen, ein seltsames Murmeln, das sich fast wie eine menschliche Stimme anhörte, die vor Schmerzen stöhnte. Sofort spürte er, wie sich die Härchen auf seinem Nacken aufrichteten. »Was zum Teufel …?«
Als er die Vertiefungen der Schlucht musterte, entdeckte er zufällig einen Spalt in der nahen Felswand, der teilweise durch Schatten, Schneeverwehungen und herabgestürzte Steine verdeckt war. Es war eine Art Höhle oder Öffnung. Sie war so unauffällig, dass er nur wenige Meter davon entfernt hätte stehen können, ohne sie zu bemerken. Wäre da nicht das ungewöhnliche Geräusch gewesen, das der Wind erzeugte, wenn er am Eingang vorbeipfiff.
Fasziniert näherte er sich vorsichtig dem Spalt und schob mit seinen Stiefeln den Schnee beiseite, der sich um den Eingang angesammelt hatte. Es war eine schmale Öffnung, gerade fünf Fuß hoch und nur ein paar Fuß breit, sodass selbst ein kleiner Mann in die Hocke gehen musste, um hineinzugelangen.
Was befand sich dort? Wie weit reichte diese geheimnisvolle Höhle in den Berg hinein? Von seiner Position aus konnte er das nicht feststellen. Die einzige Möglichkeit wäre, sich hineinzuwagen.
Höhlen und unterirdische Gänge hatten schon immer eine starke Faszination auf Juri ausgeübt; dieses jugendliche Interesse hatte ihn nie ganz verlassen. Sie waren eine Welt für sich, unberührt von Witterung und Zeit, und manchmal enthielten sie Geheimnisse, die über Jahre oder sogar Jahrtausende hinweg unberührt bleiben konnten. In den tiefen Höhlen der Erde stand die Zeit still, und der Gedanke, dass er der erste Mensch sein könnte, der jemals seinen Fuß in diese entlegene unterirdische Kammer gesetzt hatte, weckte eine vertraute kindliche Aufregung in ihm. Aber wenn man eine unbekannte Höhle allein erforschte, sollte man nicht leichtsinnig vorgehen. Er blickte die Schlucht hinunter und dachte daran, seine Begleiter zu verständigen. Aber er machte weder Anstalten, zu ihnen zurückzugehen, noch sie um Hilfe zu rufen.
Die meisten Mitglieder der Gruppe froren, waren müde und warteten ungeduldig darauf weiterzugehen. Sie hatten sicher keine Lust, Zeit mit seinem geologischen Hobby zu verschwenden. Sie würden Vorwände finden und ihm raten, an einem anderen Tag wiederzukommen, wenn das Wetter besser wäre, er mehr Zeit habe und sie ihn nicht begleiten müssten. Nur würde er diesen Ort wahrscheinlich nie wiederfinden.
Es konnte nicht schaden, einen Blick hineinzuwerfen, nur ein paar Minuten.
Ohne weiter nachzudenken, setzte er seinen sperrigen Rucksack ab und legte ihn vor dem Höhleneingang auf den Boden, atmete tief durch und betrat das Innere der Höhle. Der Strahl seiner Taschenlampe durchdrang die Dunkelheit.
Der Gang war niedrig und eng und zwang ihn, sich seitwärts zu drehen, sodass ihn der kalte, harte Fels von beiden Seiten bedrohlich einzwängte, während er vorwärtsrückte. Doch nach etwa zwanzig Metern öffnete sich der Gang zu einer größeren Höhle, die breit genug war, dass er mit ausgestreckten Armen stehen konnte. Sie erstreckte sich bis in eine unbekannte Tiefe, die der schwache Strahl seiner Taschenlampe nur spärlich erhellen konnte.
In der Tat schien das Licht von Sekunde zu Sekunde schwächer zu werden. Die Glühbirne flackerte, und er wusste genau, warum. Er hatte die Batterie austauschen wollen, bevor er heute Morgen losgezogen war, aber er war von der üblichen Eile, in der sie ihr Lager abbrachen, vereinnahmt worden und hatte vergessen, diese Aufgabe zu erledigen.
Verärgert über sein Versäumnis, schlug er mit der flachen Hand auf die Lampe. Der Lichtstrahl wurde für einen Moment heller, flackerte dann, erlosch und stürzte Juri in absolute Dunkelheit.
»Scheiße«, sagte er mit einem Seufzer und wusste, dass sein kleiner unterirdischer Streifzug ein vorzeitiges Ende gefunden hatte. Ohne Licht konnte er nicht weitergehen.
Er wandte sich dem Eingang zu und griff nach der felsigen Wand, um seine Schritte zurückzuverfolgen. In diesem Moment überkam ihn in dieser absoluten Dunkelheit ein Augenblick der Orientierungslosigkeit. Instinktiv machte er einen kleinen Schritt zurück, um sein Gleichgewicht wiederzuerlangen.
Zu seinem Entsetzen landete sein Fuß jedoch nicht auf dem staubigen Höhlenboden. Stattdessen sank er einfach weiter, als ob der Boden unter ihm verschwunden wäre. Er verlor das Gleichgewicht, kippte nach hinten und fiel in die Tiefe, zu überrascht, um auch nur aufzuschreien.
»Verdammt, Juri«, murmelte Djatlow und blickte in die Schlucht. »Wie lange braucht der Mann zum Pissen?«
»Vielleicht erleichtert er sich auf andere Weise?«, spottete Alexander.
Djatlow ignorierte das leise Lachen. Er war beunruhigt. Er trug die Verantwortung für diese Expedition und für die Sicherheit der Gruppenmitglieder.
»Es ist mir egal, was er tut«, verkündete Sinaida und verschränkte die Arme vor der Brust. »Ich will nur weg von hier.«
Djatlow dachte einen Moment nach und traf dann eine Entscheidung. »Nikolai, Alexander, kommt mit«, befahl er und stand auf. »Wir gehen ihn suchen.«
Juri stöhnte auf und öffnete die Augen. Er lag auf dem Rücken auf einem harten und sehr unbequemen Steinboden. Um ihn herum herrschte absolute Dunkelheit.
Er hatte keine Ahnung, wie tief er gefallen war; er wusste nur, dass er sich anscheinend nichts gebrochen hatte. Aber seine Taschenlampe war kaputt. Sie war ihm beim Sturz entglitten, und er hatte das Knirschen und Klirren gehört, als die Glasscheibe beim Aufprall zersplitterte.
»Du dummes Arschloch, Juri«, murmelte er, setzte sich mit einem unbehaglichen Stöhnen auf und fragte sich, wie vehement ihn seine Kollegen für seine Dummheit zurechtweisen würden.
Wie töricht war er gewesen, sich allein in eine unerforschte Höhle zu wagen! Es geschah ihm recht, dass er gestürzt war und sich verletzt hatte. Es war pures Glück, dass der Felsvorsprung, von dem er gestürzt war, nicht zu hoch gelegen hatte. Er hätte genauso gut für immer in einer riesigen Höhle oder Spalte verschwinden können, auf Nimmerwiedersehen.
Er sah sich um, fand aber keinerlei Anhaltspunkte, was seine Umgebung betraf. Die Dunkelheit, die ihn umgab, war absolut. Er wedelte mit einer Hand vor seinem Gesicht, konnte aber nichts sehen. Ein Anflug von Angst durchfuhr ihn, als ihm klar wurde, dass alles Mögliche mit ihm hier unten sein konnte. Er atmete durch die Nase ein und roch die Luft. Sie war eiskalt, extrem trocken und abgestanden, als wäre sie seit vielen Jahren nicht mehr bewegt worden. Seine brachiale Landung hatte offenbar eine Staub- oder Sandschicht aufgewirbelt, die sich auf dem Boden abgesetzt hatte. Was auch immer es war, es kitzelte unangenehm in seiner Kehle und löste einen Hustenanfall aus. Juri brauchte einige Zeit, bis er sich wieder beruhigt hatte. Er zog sicherheitshalber seinen dicken Schal über den Mund.
Panik bildete einen Knoten in seinem Magen, als ihm der Gedanke durch den Kopf schoss, hier gefangen zu sein, verirrt und vergessen, bis er schließlich an Unterkühlung starb oder verhungerte.
»Beruhige dich, Juri«, ermahnte er sich, und seine Stimme klang seltsam hohl und körperlos in der leeren Kammer. Er konnte fast das Pochen des Pulses in seinen Ohren hören. »Bleib ruhig und benutze deinen Kopf.«
Er musste herausfinden, wo er gelandet war und, was noch wichtiger war, wie er wieder herauskam. Was er auf keinen Fall riskieren konnte, war, seine Position zu verändern, zumindest bis er seine Lage genau kannte. Es war sehr gut möglich, dass er direkt am Rand eines noch tieferen Abgrunds lag. Eine falsche Bewegung, und er könnte über den Rand in die Tiefe stürzen.
Für heute hatte er sein Glück bereits ausgereizt.
Er zog einen Handschuh aus und tastete behutsam den Boden um sich herum ab. Seine Finger stießen auf kleine Steine, grobes Gestein mit winzigen Einschlüssen und gelegentlich auf Glassplitter von der zerbrochenen Taschenlampe.
Abgesehen von ein paar Rissen konnte er jedoch keine großen Spalten oder Lücken entdecken, in die er hätte fallen können. Im Gegenteil, der Boden war unter der Schuttschicht erstaunlich flach und glatt.
Er begann sich gerade ein wenig zu entspannen, als seine Hand plötzlich etwas berührte. Etwas Kaltes und Steifes, das ihm furchtbar vertraut war.
Er schreckte bei der Berührung zurück und schrie vor Angst laut auf.
Mit gesenktem Kopf und gebeugtem Rücken ging Djatlow die trostlose windgepeitschte Schlucht hinunter. Seine Anspannung wuchs von Sekunde zu Sekunde. Sie konnten Juris Spuren in dem Schneetreiben leicht folgen, aber von dem Mann selbst gab es keine Spur. Warum hatte er sich so weit von den anderen entfernt? Und wo war er jetzt? War er verletzt?
Tot?
Er hielt plötzlich inne, als Nikolai vor ihm rief: »Hier drüben! Ich habe Juris Rucksack gefunden!«
Die drei liefen zu Nikolai und scharten sich um den Rucksack, der an der Wand der Schlucht lag und bereits mit einer weißen Schicht Pulverschnee bedeckt war. Er schien eher absichtlich abgestellt als fallen gelassen worden zu sein, aber von seinem Besitzer gab es keine Spur.
»Juri!«, schrie Alexander. »Wo bist du?« Er bekam keine Antwort.
»Er muss in der Nähe sein«, vermutete Djatlow und ließ den Blick durch die felsenübersäte Schlucht schweifen. »Verteilt euch.«
Er hielt inne, aufgeschreckt durch einen schwachen, hallenden Schrei, der von der Brise zu ihm getragen wurde. Es war ein ängstlicher, entsetzter Schrei, der ihm das Blut in den Adern mehr gefrieren ließ als das Winterwetter.
»Habt ihr …?«, begann er.
Alexander neben ihm nickte. »Ja, ich habe es auch gehört.«
»Da! Es kommt von da drüben!« Nikolai deutete auf die gegenüberliegende Wand der Schlucht, wo ein Haufen von Felsen und Geröll herabgestürzt war. Dahinter befand sich ein schmaler Spalt, den sie bisher nicht bemerkt hatten.
Djatlow wandte sich an die anderen. »Taschenlampen.«
Die drei Männer hakten Taschenlampen von ihren Gürteln und traten ins Innere der Höhle. Sie mussten wie Juri die sperrigen Rucksäcke ablegen und gingen im Gänsemarsch, angeführt von Djatlow. Nachdem sie sich durch einen Engpass am Anfang der Höhle geschoben hatten, fanden sie sich in einer größeren Kammer wieder.
»Juri!«, rief Djatlow. »Wo bist du?«
»Igor! Gott sei Dank!« Juris Stimme hallte von unten zu ihnen herauf. »Sei vorsichtig, da ist ein Loch im Boden.«
Sie blickten hinab, und tatsächlich, die Strahlen der Lampen erhellten eine große Lücke direkt vor ihnen. Es handelte sich offenbar um einen Riss oder eine Spalte, die zu einem darunterliegenden Hohlraum führte. Sie scharten sich um das Loch und blickten auf ihren Freund hinunter, der inmitten dieser zweiten Kammer stand, zerschrammt, zerzaust und deutlich erschüttert, aber sehr lebendig.
»Juri, geht es dir gut?«, rief Djatlow zu ihm hinunter. »Was ist passiert?«
»Was glaubst du, was passiert ist? Ich bin hineingefallen! Holt mich hier raus!«
»In Ordnung, bleib ruhig. Wir lassen ein Seil hinunter.«
»Werft mir eine Lampe runter.«
Nikolai warf seine Taschenlampe in den Spalt. Juri fing sie auf und richtete den Lichtstrahl auf etwas, das außerhalb ihrer Sichtweite lag, und schrie erneut entsetzt auf.
»Was ist denn los?«, rief Djatlow.
»Hier liegt noch jemand drin«, rief Juri, der wie angewurzelt dastand. »Ich habe sie in der Dunkelheit gespürt. Aber ich konnte es nicht glauben.«
Die drei Männer wechselten einen besorgten Blick. »Noch jemand?«, rief Djatlow schließlich. »Wer?«
»Eine Frau. Sie muss in die Höhle gefallen sein, genau wie ich.«
»Lebt sie noch?«, wollte Alexander wissen.
»Nein.«
»Bist du sicher? Vielleicht solltest du …«
»Ich erkenne eine Leiche, wenn ich eine sehe!«, schrie Juri wütend zurück. »Glaubt mir, die hier ist schon verdammt lange tot.«
Djatlow verzog mitfühlend das Gesicht. Todesfälle waren eine bedauerliche Realität beim Bergsteigen, sei es durch Unfälle, Lawinen oder unvorhersehbares Wetter. Manchmal blieben die erfrorenen Toten über Jahre, ja sogar Jahrzehnte unentdeckt.
Alexander blickte in die Höhle hinunter und war hin- und hergerissen. Was sollten sie unternehmen? »Wir sollten zumindest herausfinden, wer sie ist. Vielleicht wird sie ja von ihrer Familie gesucht.«
»Zum Teufel mit ihr!«, gab Juri zurück. »Wenn du sie dir näher ansehen willst, dann komm gern runter. Ich gehe nicht mehr in ihre Nähe.«
»Wenn du da drin gestorben wärst, würdest du dann nicht auch wollen, dass deine Familie das erfährt?«, erkundigte sich Alexander. Er war ein Idealist, immer bemüht, das Richtige zu tun.
»Ich wäre hier drin fast gestorben. Und jetzt holt mich gefälligst raus!«
Nikolai war der Einzige, der ein ausreichend langes Seil bei sich hatte. Er wickelte es ab und ließ ein Ende widerstrebend durch den Spalt nach unten herab. Sie sahen zu, wie Juri es sich um die Brust band und zweimal zog, um sicherzugehen, dass es fest war.
»Ich bin bereit. Zieht mich hoch!«
Die drei Männer hängten sich mit aller Kraft in das Seil und zogen ihren gefangenen Kollegen Zentimeter für Zentimeter nach oben, bis er sich am Felsvorsprung festklammern konnte. Gezogen von seinen Kameraden hievte sich Juri keuchend über die Kante.
»Verdammt noch mal, Juri!«, maßregelte ihn Djatlow. Er schwitzte nach der Anstrengung sichtlich. »Was hast du dir dabei gedacht, allein hier hineinzugehen?«
Juri schüttelte den Kopf, griff nach der Wasserflasche an seiner Hüfte und nahm einen tiefen Schluck. Er hustete anhaltend, als hätte er irgendetwas Unangenehmes eingeatmet.
»Geht es dir gut?«, erkundigte sich Nikolai.
Juri schüttelte erneut den Kopf und räusperte sich.
»Halte mit den anderen das Seil!«, befahl Alexander. »Ich gehe runter und sehe mir das an.«
Juri ergriff Alexanders Arm. »Nein! Geh nicht da runter.« Seine Miene verzog sich zu einem gequälten, ängstlichen Ausdruck. »Ich will weg von hier, Alexander. Diese Höhle strahlt etwas Übles aus.«
»Was redest du da? Es ist eine Höhle, nichts weiter.«
Nikolai, der fast genauso verängstigt wirkte wie Juri, stimmte ihm zu. »Juri hat recht. Wir können ohnehin nichts mehr für sie tun. Soll sie in Frieden ruhen. Wir melden es der Polizei, wenn wir zurückkommen.«
Djatlow überlegte einige Sekunden. In ihm rang die Pflicht, für einen abgestürzten Bergsteiger zu tun, was er konnte, mit seiner Verantwortung gegenüber den noch lebenden Bergsteigern.
»Also gut«, räumte er schließlich widerstrebend ein. »Die Polizei kann sich darum kümmern. In der Zwischenzeit sollten wir von diesem Berg verschwinden.«
In wenigen Minuten hatten die vier Männer ihre Rucksäcke geholt, stapften die Schlucht entlang zurück und trafen wieder auf den Rest der Gruppe, die sich in dem spärlichen Schutz, den sie finden konnte, zusammenkauerte. Ihre Kleidung war von Schnee bedeckt, und ihre Mienen verrieten, wie unwohl sie sich fühlten.
»Wo warst du, Juri?«, fragte Sinaida und schlug ihm auf den Arm. »Wir haben uns den Arsch abgefroren, während wir auf dich gewartet haben!«
»Darüber reden wir später«, mischte sich Djatlow ein und blickte mit besorgter Miene den Weg zurück, den sie gekommen waren. »Lasst uns erst einmal hinuntersteigen.«
Als sie wieder aufbrachen, ließen sie dankbar die trostlose Schlucht mit ihrer tückischen Höhle hinter sich und kletterten den Grat hinab, der sie zurück zum Pass führte. Das Wetter hatte sich während ihres kurzen Abstechers noch weiter verschlechtert. Heftige Windböen und Schneegestöber erschwerten die Kommunikation.
Die Sonne ging bereits unter, und der kurze Wintertag neigte sich dem Ende zu. Djatlow wusste, dass sie bald anhalten und ein Lager aufschlagen mussten, doch er ging weiter, begierig darauf, diesen grimmigen, imposanten Berg zu verlassen, auf den sie durch Zufall gestoßen waren. Vorhin hatte er noch nichts gesagt, aber insgeheim hatte er Juris dringlicher Bitte zu gehen zugestimmt.
Diese einsame Höhle strahlte tatsächlich etwas Beunruhigendes aus, etwas, das bereits ein Leben gefordert hatte und heute beinahe ein weiteres gekostet hätte. Sie vermittelte ein Gefühl von etwas Falschem, was in ihm eine primitive Urangst auslöste.
»Igor!«
Aus seinen bedrückten Gedanken gerissen, wandte er sich um, als Sinaida zu ihm stolperte. Sie hatte die Kapuze gegen den eisigen Wind fest zugezogen.
»Was ist?«
»Juri. Ist es dir nicht aufgefallen?« Sie zeigte den Weg zurück, den sie hinabgestiegen waren.
Die anderen der Gruppe waren ganz in der Nähe hinter ihnen und bewegten sich im Gänsemarsch mit vielleicht fünf Metern Abstand. Sie waren müde nach einem langen und fruchtlosen Klettertag, aber sie bewegten sich dennoch entschlossen und zielstrebig. Juri folgte ihnen in großem Abstand, stapfte mit unsicheren Schritten vorwärts, hielt den Kopf gesenkt und ließ die Schultern hängen.
»Er sieht nicht gut aus«, gab Djatlow zu und ärgerte sich, dass ihm das nicht früher aufgefallen war. Er war immerhin für Juri verantwortlich.
Sinaida sah zu ihm auf. »Vielleicht ist er ja verletzt.«
Djatlow nickte und wartete, bis die anderen vorbeigegangen waren, dann ging er zurück zu seinem sich abmühenden Kameraden.
»Wie fühlst du dich, Juri?«
Der junge Mann antwortete nicht, sondern stapfte einfach weiter. Selbst in dem heulenden Wind hörte Djatlow sein keuchendes Atmen.
»Juri, sieh mich an.«
Er packte den Arm seines Freundes, was dessen Aufmerksamkeit endlich erregte. Bedächtig wandte Juri ihm den Kopf zu, und Djatlow wich bei dem Anblick einen Schritt zurück.
Juris Gesicht war blass und teigig, seine Augen waren blutunterlaufen und von dunklen Ringen umgeben, als hätte er seit Tagen nicht geschlafen. Bei dem eisigen Wetter war es schwer zu erkennen, aber Djatlow glaubte, eine dünne Schweißschicht auf der Haut seines Freundes zu erkennen.
»Du bist krank, Genosse«, sagte er und versuchte, seine Beunruhigung zu verbergen.
Juri machte eine wegwerfende Handbewegung, aber selbst diese Geste war träge und mühsam. »Verpiss dich. Mir geht’s gut.«
»Du siehst aber nicht gut aus.«
»Ich muss nur aus diesem verdammten Sturm herauskommen«, murmelte Juri.
Bevor Djatlow noch etwas sagen konnte, wurde er durch Alexanders Schrei abgelenkt. Er hatte sich an die Spitze der Kolonne gesetzt.
»Igor! Komm hierher!«
Er warf einen Blick auf Sinaida, die neben ihm wartete. »Bleib bei Juri.«
Sie nickte, und Djatlow eilte an den anderen vorbei zu Alexander.
Der Grund für den dringenden Ruf wurde sofort klar. Ein Fremder hatte sich der Wandergruppe in den Weg gestellt. Es war ein junger Mann, noch ein Jugendlicher, mit dem für das indigene Volk der Mansen charakteristischen tiefschwarzen Haar, den schrägen Augen und der schweren Pelzkleidung.
Seinem wütenden Gesichtsausdruck und seinen Gesten nach zu urteilen, verlief die Begegnung alles andere als freundlich. Djatlow war sich auch des Messers am Gürtel des jungen Mannes bewusst, auf dem seine Hand nun ruhte, sowie des Jagdbogens, der über seiner Schulter hing.
»Was gibt es für ein Problem?«
»Sag du es mir«, sagte Alexander verärgert. »Er spricht kein Wort Russisch.«
Der junge Mann sprach laut und gestikulierte in Richtung des Berges hinter ihnen, aber Djatlow konnte seine Worte nicht verstehen.
»Wir verstehen Sie nicht«, sagte er langsam, wohl wissend, dass dies nichts nützen würde.
»Ich verstehe ihn«, meldete sich Solotarew zu Wort.
Djatlow drehte sich um und sah seinen älteren Kameraden an. »Sie sprechen Mansisch?«
»Meine Großmutter wuchs bei den Stämmen auf, noch vor dem Ersten Weltkrieg. Sie hat etwas davon an uns weitergegeben. Die verschiedenen Stämme haben zwar unterschiedliche Dialekte, aber ich kann es versuchen.«
Er trat vor und wandte sich an den jungen Mann vor ihnen. Er sprach langsam und zögerlich, während er nach den richtigen Worten suchte. Die anfängliche Verwirrung des Jünglings wich bald Einsicht, und er setzte sofort zu einer neuen Tirade an.
Solotarew musste ihn immer wieder auffordern, langsamer zu sprechen, aber es schien, als hätten sie zumindest eine gemeinsame Verständigungsbasis gefunden, auch wenn dem Älteren von beiden offensichtlich nicht gefiel, was er hörte.
»Er sagt, wir sollten nicht hier sein«, erklärte Solotarew schließlich, während der Jugendliche aufgeregt weitersprach. »Er sagt, wir müssen sofort von diesem Berg runter. Es ist … ein besonderer Ort für sein Volk.«
»Ein heiliger Ort?«, spekulierte Alexander.
»Nein, ich … glaube, nicht.« Solotarew runzelte die Stirn. »Ich glaube, das Wort bedeutet abgeschottet oder eingeschränkt.«
Djatlow ahnte, worauf er hinauswollte. »Verboten.«
»Ja, verboten.« Als der Junge weitersprach, bemühte sich Solotarew, seinen Ausführungen zu folgen. »Es ist ein Ort des Todes. Ein verfluchter Ort.«
Ein verfluchter Ort. Und sie waren direkt hineingestolpert. Der Gedanke war alles andere als angenehm.
»Sagen Sie ihm, wir haben uns im Schneesturm verirrt und dachten, wir wären auf der anderen Seite des Passes. Wir sind sofort umgekehrt, als wir unseren Fehler bemerkten.« Djatlow machte eine Pause, bevor er hinzufügte: »Und fragen Sie ihn, ob jemand von seinen Leuten auf diesem Berg verschwunden wäre. Eine Frau.«
Solotarew warf ihm einen fragenden Blick zu, dann stellte er die Frage.
»Er will wissen, warum wir das fragen.« Er wandte sich an Djatlow. »Und ich auch, Genosse Djatlow.«
»Wir haben eine Leiche in einer Höhle oben auf dem Berg gefunden, als wir Juri retteten. Sie trug die gleiche Kleidung wie die Mansen-Stammesangehörigen. Vielleicht wird sie von seinem Stamm vermisst.«
Solotarew übersetzte, und sein finsterer Gesichtsausdruck machte deutlich, dass ihm die Antwort nicht gefiel. »Er sagt immer wieder das Gleiche. Wir müssen diesen Ort verlassen. Er hört nicht auf vernünftige Argumente.«
»Was glaubt er, was wir vorhaben?«, fuhr Alexander hoch und hielt seine Kapuze fest, die der Wind ihm vom Kopf zu reißen drohte. »Sagen Sie diesem Idioten, dass wir keine Zeit für seinen abergläubischen Unsinn haben!«
»Ihn zu beleidigen wird uns nicht weiterhelfen«, konterte Solotarew.
Ihr gereiztes Gespräch wurde jedoch durch einen Schrei hinter ihnen unterbrochen. Als Djatlow sich umdrehte, sah er Sinaida, die sich abmühte, den sichtlich angeschlagenen Juri, der in ihren Armen zusammengebrochen war, festzuhalten.
»Hilfe!«, rief sie, als sie unter seinem Gewicht zu Boden sank. »Juri geht es nicht gut!«
»Genug davon. Schafft den Kerl hier weg!«, rief Djatlow, als er hastig zu Sinaida eilte, um ihr zu helfen.
Solotarew gab den Befehl weiter, und als der Jüngling zu protestieren begann, griff er zu seinem Eispickel und hakte ihn von seinem Ausrüstungsgürtel ab. Der Eispickel war eher ein Werkzeug als eine Waffe, aber Solotarew hatte während des Krieges an der Front gedient und kannte sich im Nahkampf aus. Sein harter Gesichtsausdruck verriet das sehr deutlich.
»Du solltest jetzt lieber gehen«, knurrte er, schwang die Axt, und seine dunklen Augen glühten wie Kohlen. »Mach schon, Junge! Verschwinde von hier!«
Der Junge sah von dem Mann zu der Waffe in seiner Hand und erkannte, dass er es ernst meinte. Er drehte sich um und ging widerwillig davon.
Er rief etwas in Mansisch über die Schulter zurück und warf einen besorgten Blick in Juris Richtung.
»Ihr müsst runter vom Berg, ihr alle! Ich habe euch gewarnt!«, übersetzte Solotarew seine Worte später für die Gruppe.
Nicht weit von ihm entfernt kniete Djatlow am Boden, um Juri zu untersuchen, der noch schlimmer aussah als zuvor, wenn das überhaupt möglich war. Er zitterte heftig, seine Haut war totenbleich, und er biss die Zähne zusammen.
»Er ist einfach zusammengebrochen«, sagte Sinaida. Ihre Stimme zitterte. »Ich weiß nicht, was mit ihm los ist.«
Noch während sie sprach, kippte Juri plötzlich um und erbrach sich heftig. Sein Körper verkrampfte sich bei jedem schmerzhaften Würgen.
»Wir können nicht weitermachen, wenn Juri so krank ist«, schlussfolgerte Alexander. »Seht ihn euch an. In diesem Zustand schafft er nicht einmal eine halbe Meile.«
»Was ist mit dem Jungen?«, fragte Nikolai. »Er hat uns doch aufgefordert, hier zu verschwinden.«
Alexander sah zu ihm hoch. »Hast du jetzt Angst vor kleinen Jungs?«
Nikolai blickte zurück. »Er könnte mit einigen seiner Leute zurückkommen, und wir haben keine Waffen. Diese Art von Ärger können wir nicht gebrauchen.«
Ein weiterer eisiger Windstoß fuhr durch die Gruppe. Die Kälte drang durch Kleidung und Haut.
»Wir können hier nicht tatenlos herumsitzen.« Solotarew blickte zur Sonne hoch, die kaum mehr als ein etwas hellerer Fleck am undurchdringlich grauen Himmel war. »Das Licht wird schwächer. Entweder steigen wir weiter nach unten, oder wir schlagen ein Lager auf und sitzen den Sturm aus.«
Djatlow schloss die Augen und verfluchte seine Entscheidung, nicht den Befehl zur Umkehr gegeben zu haben, als sie noch die Gelegenheit dazu hatten. Er hatte das Gefühl, dass ihm die Situation entglitt, und jeder seiner Versuche, sie unter Kontrolle zu bringen, machte alles nur noch schlimmer.
Bleib ruhig, Igor, ermahnte er sich und unterdrückte diese düsteren Gedanken. Bergsteigen war eine gefährliche Angelegenheit, und man schaffte es nicht, wenn man in Panik geriet. Die Gruppe brauchte jetzt einen klaren Kopf und kluge Entscheidungen.
»Wir bleiben und schlagen ein Lager auf«, entschied er dann. »Juri muss sich ausruhen, und wir brauchen Schutz vor diesem Wetter. Baut das Zelt auf. Los geht’s!«
Während zwei aus der Gruppe über den zunehmend ins Delirium verfallenden Juri wachten, machten sich die anderen an die Arbeit, das Zelt aufzubauen, wobei sie sich abmühten, die flatternde Plane festzuhalten, während der Wind sich alle Mühe gab, sie ihnen aus den Händen zu reißen. Es war schon dunkel, als sie ihre Arbeit endlich beendet hatten und ihren bewusstlosen Kameraden hineintragen konnten. Im Inneren entledigten sie sich dankbar ihrer schweren äußeren Kleidungsstücke.
Ein paar Stunden später hockten sie alle nach dem langen und schwierigen Tag im Zelt, erschöpft und nicht gerade glücklich über ihre Lage. Selbst das warme Essen und die Getränke, die sie auf einem kleinen Gaskocher erhitzten, trugen wenig zur Verbesserung der Stimmung bei.
»Der Junge hat mir nicht gefallen«, bemerkte Nikolai, als er seine schneebedeckten Wanderstiefel auszog und sich die kalten Füße massierte. »Er könnte mit einem Haufen Männern seines Stammes zurückkehren. Es gab schon früher Ärger mit den Mansen.«
Alexander schüttelte den Kopf. »Hör dir den tosenden Sturm da draußen an«, sagte er und deutete auf die wild klatschende Plane. »Die müssten verrückt sein, wenn sie heute Nacht rausgehen. Uns wird hier nichts geschehen.«
Djatlow richtete seine Aufmerksamkeit auf Sinaida, die sich um Juri kümmerte. »Wie geht es ihm?«
Die Anspannung war der jungen Frau anzusehen. Sie machte einen zutiefst besorgten Gesichtsausdruck. »Ich wünschte, ich wüsste es. Er hat Fieber, und sein Puls ist sehr hoch. Sein Körper kämpft gegen irgendetwas an, aber ich weiß nicht, was es ist.«
Juri schien zu schlafen, aber es war ein unruhiger, rastloser Schlaf, er stöhnte und wälzte sich ständig hin und her. Selbst in dem orangefarbenen Schein ihrer Taschenlampen sah er totenblass aus, und auf seiner klammen Haut schimmerte eine Schweißschicht.
»Heute Morgen ging es ihm noch gut«, erklärte Nikolai. »Vielleicht hat er etwas Verdorbenes gegessen?«
»Wir haben alle die gleichen Rationen gegessen«, sagte Djatlow. »Fühlt sich einer von euch unwohl?«
Niemand sagte ein Wort. Abgesehen von ihrer schlechten Laune und allgemeiner Müdigkeit wirkten sie völlig gesund.
In diesem Moment sprach Solotarew etwas an, was ihn schon den ganzen Abend beunruhigt hatte. »Erzählen Sie mir von der Frau.«
Djatlow sah ihn an. »Was?«
»Diese tote Frau in der Höhle auf dem Berg.« Er beugte sich vor. »Was haben Sie in der Schlucht gefunden, Genosse Djatlow?«
Djatlow seufzte und wechselte einen Blick mit Alexander. Es war klar, dass sein Kamerad die Wahrheit sagen würde, wenn er log.
»Juri ist in eine Höhle gestürzt, in der wir ihn gefunden haben«, antwortete er. »Er sagte, da drin läge eine Leiche. Die einer Frau.«
»Was?« Sinaida schnappte nach Luft. »Was meinst du damit?«
»Warum hast du uns das nicht früher gesagt?«, wollte Rustem wissen.
»Seid still!«, schnauzte Solotarew sie an und brachte die anderen damit sofort zum Schweigen.
Obwohl er seine Stimme nur selten im Zorn erhob, strahlte dieser Mann, dieser Fremde, der so viel älter und zurückhaltender war als die anderen der Gruppe, eine stille Bedrohung aus. Er war während des Großen Vaterländischen Krieges kein Kind mehr gewesen wie sie, sondern hatte aktiv an der Front gekämpft. Eine solche Erfahrung schmiedete jeden Mann zu einer gewissen Härte.
Solotarews Blick war jetzt auf Djatlow gerichtet. »Erzählen Sie uns, was Sie gesehen haben, Igor.«
»Nur Juri hat sie sehen können. Er glaubte, dass sie schon lange dort läge. Hier oben ist es so kalt, dass die Leichen jahrelang gefroren bleiben.« Er nickte vor sich hin. »Es war meine Entscheidung, sie zurückzulassen. Die Sicherheit meiner Gruppe steht an erster Stelle.«
»Wir wollten es melden, wenn wir nach Hause zurückkehren«, fügte Alexander in dem Versuch hinzu, einen Teil der Schuld auf sich zu nehmen. Obwohl er sich dagegen ausgesprochen hatte, die Leiche zurückzulassen.
»Es war meine Entscheidung«, beharrte Djatlow.
»Ja, das war es«, stimmte der ältere Mann zu. Seine Miene war düster und ernst.
Djatlow blickte ihn an und fragte sich erneut, warum er hier war. War er tatsächlich ein Spion der Regierung, der sie beobachten sollte, würden Djatlows heutige Entscheidungen sorgfältig untersucht, dessen war er sich sicher.
»Was ist, wenn Juri sich etwas von der Leiche eingefangen hat?«, brach Nikolai das angespannte Schweigen.
Solotarew runzelte die Stirn. »Wie meinen Sie das?«
»Ich meine, vielleicht ist diese Frau an einer Krankheit oder einem Leiden gestorben. Und Juri hat sich angesteckt.«
Es herrschte eine bedrückte Stille, die nur durch Juris röchelnden Atem unterbrochen wurde. Er schien Mühe zu haben, Luft zu bekommen. Er hustete schwach, was rasch in eine Reihe von schmerzhaften Krämpfen überging.
Sinaida, die ihm am nächsten hockte, stieß plötzlich einen entsetzten Schrei aus. »Mein Gott, Igor! Sieh doch, seine Augen!«
Djatlow trat näher und blickte in das Gesicht seines Kameraden. Er schrak bei diesem Anblick unwillkürlich zurück. Aus Juris Augen quollen dicke Tropfen einer dunklen, zähen Flüssigkeit und liefen ihm über die Wangen. Es sah so aus, als würde er Blut weinen.
Nikolai sah es auch und wich zurück. »Was zum Teufel ist los mit ihm?« Panik schwang in seiner Stimme mit. »Was, wenn er uns alle infiziert hat?«
»Beruhige dich, Nikolai«, bat Djatlow ihn.
Juris Krämpfe hörten abrupt auf, und im Zelt wurde es unheimlich still. Niemand rührte auch nur einen Muskel oder sagte ein Wort.
»Ist er tot?«, brach Alexander schließlich das Schweigen. Zögernd beugte sich Sinaida dichter zu ihm, um ihn zu untersuchen.
Sie streckte ihre Hand aus und fühlte den Puls an seinem Hals. »Juri?«, flüsterte sie unsicher.
Plötzlich öffneten sich die blutverschmierten Augen, und ihr Blick richtete sich auf sie. Sie waren erfüllt von Wahnsinn und animalischer Gier. Mit einem primitiven, wütenden Knurren sprang Juri auf Sinaida zu und schlug die junge Frau zu Boden. Er hämmerte blindlings mit den Fäusten auf sie ein und zerkratzte mit den Fingernägeln ihre Haut.
Im Zelt brach Chaos aus. Die Leute schrien panisch und versuchten, entweder zu fliehen oder ihr zu Hilfe zu kommen. Solotarew stürzte sich auf Juri und versuchte, ihn von seinem zu Tode verängstigten Opfer wegzuzerren. Blut aus Sinaidas Hals bespritzte die Innenwände des Zeltes, aber im selben Moment stürzte sich der junge Mann auf Solotarew und griff ihn mit noch größerer Wut an.
Alexander schnappte sich Solotarews Eispickel, um damit den mörderischen Kameraden niederzuschlagen. Dabei riss er versehentlich einen Schlitz in die Zeltwand.
Er schlug weiter wie wild um sich, und die Klinge grub sich tief in Juris Schulter. Es knirschte schrecklich, als Knochen zermalmt wurden, doch selbst diese grausame Verletzung schien er kaum wahrzunehmen.
»Raus hier!« Djatlow bahnte sich einen Weg durch das zerfetzte Segeltuch und zerrte die verletzte Sinaida mit sich, während der tödliche Kampf im Inneren des Zeltes an Wucht zunahm.
Wind, Kälte und blendender Schnee hüllten sie ein, als sie hastig davonstolperten, ohne auf die Richtung zu achten, in die sie liefen. Sie wollten einfach nur weg von diesem Zelt und den entsetzlichen Schreien, die nach draußen drangen.
Keiner von ihnen wusste, wie viele von den anderen es ins Freie geschafft hatten, in welche Richtung sie geflohen waren oder wie lange ihre Kameraden in dem tödlichen Sturm umherirren würden, bevor die Kälte sie schließlich zur Strecke bringen würde. Sie rannten mit der blinden Panik gejagter Tiere davon, die nur eins im Sinn hatten – dem Ding zu entkommen, das sie töten wollte.
Ihre erfrorenen Leichen wurden etwa drei Wochen später von einem Such- und Rettungsteam gefunden.
TEIL EINS
ENTHÜLLUNG
Am 2. April 1979 wurden in einer sowjetischen militärischen Forschungseinrichtung in der Nähe der Stadt Swerdlowsk versehentlich Anthraxsporen freigesetzt. Man geht davon aus, dass der darauffolgende Ausbruch über hundert Menschen das Leben gekostet hat. Die genaue Zahl der Opfer bleibt unbekannt.
1
28. August 2019, Bagdad, Irak
Staub.
Staub und Sand.
Überall in diesem Land war es dasselbe. Staub, Sand, Hitze und grelles Sonnenlicht.
Cameron Becker fegte mit siebzig Meilen pro Stunde über die von Schlaglöchern übersäte Autobahn und beobachtete, wie ein kleiner Wirbelsturm aus Staub, ein Staubteufel, über den Asphalt tanzte, bevor er im Sog eines vorbeibrausenden Tanklasters verschwand.
Reihen von tristen, zweistöckigen Häusern säumten die Straße. Die Fenster waren mit Läden verschlossen, die Türen vergittert – kleine Außenposten der Menschheit, die um ihre Existenz kämpften. Sie versuchten, den Tag zu überstehen, um morgen den gleichen Kampf wiederaufzunehmen.
Die Außentemperatur betrug fast vierzig Grad, wovon er allerdings nichts merkte, da die Klimaanlage des Ford Explorer auf Hochtouren arbeitete. Er wollte sich auch nicht beschweren. Als Veteran der Invasion von 2003 hatte er lange genug in Löchern im Dreck gehockt, während ihm Schweiß und Sand in den Augen brannten, sodass er jetzt die kleinen Annehmlichkeiten des Lebens zu schätzen wusste.
Zu seiner Linken erstreckte sich ein Freiluft-Markt von der Größe eines Fußballfeldes. An den winzigen Ständen wurde alles Mögliche verkauft – von DVDs über Teppiche, Lederhandtaschen, gefälschte Levi’s, Kinderspielzeug, Gemälde, Wasserflaschen, gestohlene Militärrationen und sogar Dartscheiben mit Bildern des gestürzten Saddam Hussein. Der Mann war seit mehr als einem Jahrzehnt tot, aber sein verhasstes Erbe lebte weiter.
Die Fahrt durch Städte wie Bagdad war für ihn wie eine Reise in die Vergangenheit. Anmutige Torbogen, geschlossene Fensterläden, Kuppeln und kunstvolle Brunnen standen Seite an Seite neben Büro- und Wohnblocks der 1970er-Jahre. Handymasten ragten neben alten Minaretttürmen in den blauen Himmel.
Hin und wieder kamen sie an den Überresten eines Gebäudes des früheren Regimes vorbei, das durch alliierte Bombenangriffe zerstört worden war. Ob das im ersten oder zweiten Golfkrieg geschehen war, war oft schwer zu sagen. Eines Tages würde sich eine neue Regierung daranmachen, die Gebäude wiederaufzubauen.
Eines Tages …
Der Verkehr bestand aus einer Mischung aus hochmodernen 4x4-Cruisern (ein sicheres Zeichen für eine ausländische Führungskraft), Luxuslimousinen und klapprigen alten Rostlauben, die durch notdürftiges Flickwerk und schiere Willenskraft zusammengehalten wurden. Ob alt oder neu, alle Fahrzeuge waren von einer braunen Staubschicht bedeckt, und alle ließen ihre Motoren kräftig aufheulen.
Es war keine gute Idee, in dieser Gegend langsam zu fahren, schon gar nicht, wenn man einen teuren Wagen fuhr. Die Gefahr von Entführungen und Terroranschlägen war allgegenwärtig, und Becker hatte nicht die Absicht, als Geisel in den Zehn-Uhr-Nachrichten zu enden.
Es wäre schon von Berufs wegen höchst peinlich.
»Sie sind ja nicht gerade sehr gesprächig«, bemerkte sein Passagier.
Becker warf einen Blick in den Rückspiegel und betrachtete den übergewichtigen, alternden Salonlöwen, der die Rückbank mit Beschlag belegte. Mit seinem schütteren, nach hinten gegeltem Haar, der dicken Brille, dem offenen Hemd, das seinen fetten Bauch kaum verbarg, und dem pummeligen Gesicht mit den Aknenarben aus der Jugendzeit bot er sicherlich keinen Anlass für lange, bewundernde Blicke. Sein Name war Luka Belikow, und er war ein russischer Geschäftsmann, den Becker für die nächsten Tage durch den Irak begleiten sollte. Er konnte nicht genau sagen, womit der Mann seinen Lebensunterhalt verdiente – irgendetwas mit chemischer Verfahrenstechnik erinnerte er vage. Aber die Bezahlung war gut und die Arbeit einfach, also beschwerte er sich nicht.
Er saß bequem in einem klimatisierten Auto und verdiente das Dreifache dessen, was er als Army Ranger verdient hatte.
»Ich werde dafür bezahlt, Sie zu beschützen«, antwortete Becker in einem professionell neutralen Tonfall. »Nicht, um mich mit Ihnen anzufreunden … Sir.«
Draußen rannte eine Gruppe von Kindern in schmutziger, zerlumpter Kleidung am Straßenrand entlang und sammelte den Müll ein, der von vorbeifahrenden Autofahrern weggeworfen wurde.
»Kommen Sie, Mann. Seien Sie locker, und amüsieren Sie sich ein bisschen.« Belikow trank einen Schluck Mineralwasser. Sein Kehlkopf hüpfte auf und ab. »Ich rede gerne. Reden ist gut.«
Na klar tust du das, dachte Becker gereizt.
»Sie sind beim Militär, ja?«
»War ich mal.«
»Jetzt nicht mehr?«
»Jetzt nicht mehr.« Mehr hatte Becker zu diesem Thema nicht zu sagen.
»Jetzt sind Sie ein Söldner.«
Becker schnaubte amüsiert. Es gab viele Ex-Militärs, die ihren Beruf im privaten Sicherheitssektor ausübten, und noch mehr Möchtegernsöldner, die sich einen Namen machen wollten. Aber richtige Söldner, die durch die ganze Welt reisten und die Kriege anderer Leute ausfochten, waren eine seltene Spezies.
»Ich bin nur ein einfacher Sicherheitsberater.«
»Wie lange sind Sie schon im Irak?«
»Lange genug, um mich einigermaßen auszukennen.«
»Gefällt es Ihnen hier?« Belikow wollte oder konnte nicht erkennen, dass Becker an einer Plauderei nicht interessiert war.
»Mir gefällt der Gehaltsscheck.« Becker sah ihn wieder im Rückspiegel an. »Mit dem Rest arrangiere ich mich.«
Zu seiner Überraschung warf Belikow den Kopf zurück und lachte, als hätte er gerade den lustigsten Witz seines Lebens gehört. »Das ist schon besser! Entspannen Sie sich, Cameron! Wir gehen schließlich nicht auf eine Beerdigung.«
Das ist schade, dachte Becker. Sein Geduldsfaden wurde merklich dünner.
»Machen Sie Musik an, Mann!«, befahl Belikow.
Becker verdrehte die Augen, was seine Sonnenbrille zum Glück verbarg, und schaltete das Radio ein. Aus den Lautsprechern drang so etwas wie das arabische Äquivalent von Justin Bieber.
Belikow grinste. Ihm gefiel es offensichtlich, und bald nickte er im Takt der Musik.
Becker wurde bald von wichtigeren Dingen abgelenkt. Sein Funkgerät knisterte, und eine Stimme durchdrang das Rauschen. »Chef, hier spricht Escort.« Die weibliche Stimme hatte einen deutlichen New Yorker Akzent. »Sieht aus, als hätten wir ein Verkehrschaos voraus. Ein Lastwagen hat seine Ladung über den ganzen Highway verteilt. Es herrscht das blanke Chaos.«
Escort war sein Begleitfahrzeug, das etwa fünfzig Meter hinter ihm fuhr. Darin saßen Shawn Griffin und Naomi Westbrook, zwei Freiberufler wie er, mit denen sich Becker angefreundet hatte. Beide waren zuverlässige Leute und verfügten über genügend Feuerkraft, um sie aus allen Schwierigkeiten herauszuballern, die sich ihnen in den Weg stellten.
Becker runzelte die Stirn und spähte durch die Motorabgase und den aufgewirbelten Staub nach vorn. Tatsächlich begann sich der Verkehr zu stauen. Etwa eine Meile vor ihm sah er eine Menge Bremslichter.