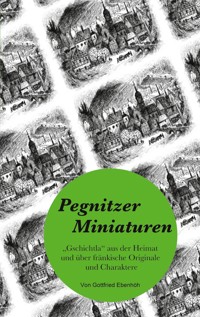
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Geschichten und Schnurren aus einer liebenswerten fränkischen Kleinstadt namens Pegnitz, mit Schilderung von Originalen und Charakteren. Einzelne Beiträge entstammen den Sterngeschichten des Autors, wie auch die dazugehörigen Illustrationen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 115
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
„Ein echter Pegnitzer“?
Der Schlossberg
Der „Goldene Stern“
Pegnitzer Originale
„Flussgeschichten“ - Abenteuer an Pegnitz und Fichtenohe
Pegnitzer Originale
Hans Gentner
Die Maibaumdiebe von 1967
Pegnitzer Originale
Die Karlsbrücke von Pegnitz
Pegnitzer Originale
„Und sündhaft ist der Mensch im Ganzen ...“
Die „Große Fränkische Diebes- und Räuberbande“ des Franz Troglauer
Pegnitzer Originale
Pegnitzer Originale
Die Bahnhofstraße
Pegnitzer Originale
Pegnitzer Originale
Der Posthalter
Pegnitzer Originale
Tonkünstler – nicht nur im „Stern“
Pegnitzer Originale
Die Schlossberghalle
Pegnitzer Originale
Ein Bürgermeister im Schnee
Pegnitzer Originale
Pegnitzer Originale
Pegnitzer Originale
Der große Streik 1954
Pegnitzer Originale
Pegnitzer Originale
Mein Franken – Lobeshymne auf die Heimat
Advent – auch eine Rückschau
Quellen und Grundtexte
„Ein echter Pegnitzer“?
Eigentlich bin ich neudeutsch gesprochen ein Mensch mit „Migrationshintergrund“. Nicht nur in meinem jetzigen Biotop in Hessen, wohin ich vor Jahren umsiedelte.
Schon damals in Pegnitz war ich es - gewissermaßen - denn meine Eltern waren Sudetendeutsche. Im Zusammenhang mit „Migration“ heutzutage und hierzulande nicht mehr unbedingt von besonderem Ansehen.
Aber ich bin stolz darauf, denn das Süddeutsch-Böhmische und das dazugehörige Österreichische hat mich gleichwohl geprägt. Und das harmoniert auch besonders mit dem Fränkischen, wie man weiß.
Großgeworden, „herangereift“, bin ich in Franken, in diesem tief-provinziellen Nest, namens Pegnitz in Oberfranken.
Es gibt Städte, Städtchen, die über eine größere Geschichte, über mehr Kunst und Kultur und Bekanntheit verfügen. Aber diesen „Krähwinkel“ liebe ich bis heute.
Dort durfte ich werden, was ich bin. Dort begegneten mir Menschen, die mir nie (offenkundig) maliziös erschienen, nie (übermäßig) aufgeblasen, nie (auffallend) gehässig waren. In Pegnitz wurde auch ein gewisses „anders-Sein“ toleriert.
Ich fand hier nicht „kriechende Betbrüder und gewesene Nazis“, die man heute gerne ausfindig machen möchte - und wenn es die vielleicht auch gegeben hat.
Kommt es daher, dass die „Eingeborenen“ früh mit diesen Flüchtlingen aus Schlesien und Böhmen konfrontiert wurden. Dass sie spürten – wie schon Jahre zuvor mit Bergleuten aus Sachsen, die dort angesiedelt wurden - dass man mit diesen Menschen etwas gewinnt?
Am Ende des Krieges hatte Pegnitz knapp 4000 Einwohner, Anfang der fünfziger Jahre waren es schon 8000. Pegnitz hat eine gewaltige Infusion von „Migranten“ erhalten. Die vormals fast rein protestantische Stadt wurde damit beinahe katholisch.
Die positiven Gefühle zu Pegnitz und den Pegnitzern habe ich besonders meinen Eltern zu verdanken, die als Geschäftsleute mit einer Gastwirtschaft und Metzgerei im Ort große Anerkennung fanden.
Sie hatten es verinnerlicht und gelebt: „So wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus“. Und die Resonanz, die auch ich erfahren durfte, war gut.
Im „Goldenen Stern“ verlebte ich eine glückliche und unbeschwerte Kindheit und Jugend. Die Begegnung mit Menschen unterschiedlicher sozialer Prägung und auch vielfältigen charakterlichen Eigenschaften hat mich beeinflusst.
Ich kann auch nichts Negatives über meine Schule und meine Lehrer sagen, wie es „à jour“ wurde. Im Gegenteil. Eine solche Schule, wie das Gymnasium in Pegnitz mit seinem Lehrkörper damals, würde ich mir heute für meine Enkel wünschen. Die Schulzeit war für mich überwiegend eine glückliche Epoche, nicht nur wegen der späteren Erfolge.
Pegnitz, das ist nicht nur „meine Welt von gestern“.
Auch wenn ich viele Jahre, Jahrzehnte schon von dort weg bin: Es ist und bleibt die Heimat! Von dem Franken Jean Paul soll der Satz stammen: „Die Erinnerung ist das einzige Paradies, aus welchem wir nicht vertrieben werden können“.
Die folgenden „Gschichtla“ und Charakterisierungen stammen aus diesem, meinem Paradies. Und sie sind allen „echten Pegnitzern“ gewidmet, denen ich viel zu verdanken habe.
Gottfried Ebenhöh
Pegnitz – Tuschezeichnung von Ferdinand Dunkel
Der Schlossberg
Pegnitz ohne den Schlossberg, das wäre wie Paris ohne den Eiffelturm, Hamburg ohne den Michel, Nürnberg ohne die Burg ...
Die Vergleiche mögen übertrieben klingen, doch der Schlossberg ist das eigentliche Wahrzeichen von Pegnitz. Ohne diesen Hintergrund wäre das Bühnenbild unseres Städtchens, mit Rathaus und den beiden Kirchen, bestimmt weniger eindrucksvoll.
Und jeder echte Pegnitzer verbindet mit dem Schlossberg gewiss auch ganz eigene Erinnerungen.
Als Pegnitzer Schulkind bestimmt mit „Gregori“: Mit den Spielen auf der Wiese, dem Bratwurstduft, Limo –
oder auch Bier, von einem „wohlwollenden“ Erwachsenen gespendet. Mancher hat da seinen ersten „Rausch“ ausgestanden.
Die Sportveranstaltungen vom Männerturnverein und dem ASV; die Faustballer trainierten und spielten regelmäßig dort. Dann Bundesjugendspiele: Es gab an der Wiese eine Sprunggrube und auf einem ebenen Waldweg war eine 50-m-Bahn abgesteckt; manchmal verschwand ein von der Wiese geworfener Schlagball irgendwo im Wald.
Am Nordhang des Berges, auf einer Schneise mit Blick auf den Kleinen Kulm, gab es eine Rodelbahn.
Als die Schlossberghalle noch stand: die Faschingsnachmittage, Theateraufführungen und Konzerte.
Später dann draußen „Open-Air“-Konzerte und „Waldstock“.
Die Gedenkfeiern zum Volkstrauertag vor dem eindrücklichen Kriegerdenkmal. Wen haben dort nicht die unzähligen, eingemeißelten Namen betroffen gemacht - von Pegnitzern, die in den beiden Weltkriegen umgekommen sind.
Spaziergänge auf den ausgedehnten Waldwegen um und an dem Berg.
Jeder „echte Pegnitzer“ hat einmal den Aussichtsturm bestiegen und von dort den großartigen Blick über unsere wunderbare Heimat genossen.
Der Schlossberg hat sich nicht immer so bewaldet und romantisch gezeigt, wie heutzutage. Erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurde die einst kahle Kuppe überwiegend mit Fichten aufgeforstet. Dann auch mit Laubbäumen, die jetzt zu dem schönen Farbenspiel vor allem im Herbst beitragen.
Ich erinnere mich, dass einmal fast der ganze Laubbestand am Schlossberg von Maikäfern aufgefressen wurde. Wir Schulkinder wurden damals unter Führung von Rektor Meier zum Maikäfer-Lesen eingesetzt.
Aber, es gibt ja keine Maikäfer mehr ...
Wer hat nicht am Schlossberg mit seinem oder seiner Angebeteten ein erstes Stelldichein veranstaltet: Liebe und Romantik ... und die Zuversicht, in dem weitläufigen Gelände ungestört zu sein. Besonders in heißen Sommern lud der Schlossberg nicht nur dazu zum Verweilen ein.
„Schlossberg“ - weil es auf der einstmals noch unbewaldeten Höhe mal so etwas Ähnelndes gab. Verbürgte Ansichten von diesem „Schloss“ gibt es nicht.
Das Modell, das jahrelang an der Pegnitzquelle zu bewundern war, ist mit Sicherheit eine beschönigendhistorisierende Darstellung. Denn der oder das „Böheimstein“ war weniger ein „Schloss“, als eben nur eine kleinere mittelalterliche Wehranlage.
Wie haben wir Kinder uns nicht bemüht, unterhalb des Aussichtsturms noch Reste davon ausfindig zu machen. Da gab es dann tatsächlich noch ein paar alte Steintrümmer, die uns entzückten.
Das meiste vom „Schloss“ hatte man in den zurückliegenden Jahrhunderten davongetragen und in den umliegenden Dörfern und in der Stadt für seine Anwesen verbaut; wie bei so vielen Burgen oder „Schlössern“ auch in der Umgebung.
Pegnitz besitzt keine besonders beeindruckenden oder besonders außergewöhnliche historische Bauten. Aber es hat Charme, trotz mancher neuzeitlichen Veränderungen.
Da es in eine außergewöhnliche Landschaft eingebettet ist. Am Fuß eines Berges gelegen, der bei jedem, der ihn erwandert, erfahren und erlebt hat, das Gefühl von Heimat aufkommen lassen muss.
Der „Goldene Stern“
Der „Goldene Stern“ ist um 1870/71 erbaut worden.
Er war dann beim Bau der Bahnstrecke von Nürnberg in Richtung Norden um 1875 die Marketenderei für die Bahnarbeiter.
Bis 1908 gab es eine eigene kleine Brauerei zum Gasthof. Dann kaufte der Brauer A. Knopf alles auf.
Sein erster Pächter war der Pegnitzer Altbürgermeister Hans Gentner, der aber bald politische Karriere machte (s. S. 39). Ihm folgte bis 1951 Konrad Raum, anschließend mein Vater Georg Ebenhöh, der 10 Jahre lang die alte Tradition als „Gasthof mit Metzgerei“ noch hochhielt.
Der Gasthof wurde 1954 modernisiert und mit einem damals sehr modernen und ansprechenden Saalbau versehen. Beim Umbau stieß man in dem Gebäude auf einen 10 m tiefen Brunnen über der früheren „Speis“. Der Brunnen war nur notdürftig abgedeckt worden und der lieferte angeblich früher das Brauwasser für die Stern-Brauerei.
Das frühere Brauereigebäude – inzwischen abgerissen - beherbergte später die Arbeitsräume der Metzgerei; dazu eine Garage, einen Stall und dazu eine kleine aufgelassene Tischlerwerkstatt – nach dem letzten Betreiber „Jobst-Stube“ genannt.
Das Wirtschaftsgebäude lag oberhalb des Gasthauses, parallel zur Bahnhofstraße. Direkt darunter befand sich ein Bierkeller, in der Art, wie man ihn oft in Franken findet. Der war gewissermaßen in den Fuß des Kellerbergs getrieben und ausgekleidet mit großen Kalksteinquadern, sodass hier stets eine gleichbleibende Temperatur um die 10° herrschte.
Zum Anwesen gehörte natürlich denn seit je auch der mit schattenspendenden Lindenbäumen bepflanzte Biergarten: Das Schmuckstück des Stern-Anwesens, das leider zuletzt viel zu wenig und schließlich gar nicht mehr genutzt wurde.
Der Stern war lange Zeit das Traditionslokal der Pegnitzer Arbeiterschaft, beherbergte in den 50er Jahren auch das Büro des Deutschen Gewerkschaftsbund und war beim ersten großen Metallarbeiterstreik in der jungen Bundesrepublik 1954 auch das Streiklokal.
Wer vom Bahnhof kam, wer von der AMAG, dem Bergwerk oder von der Post seinen Weg in die Stadt nahm oder weiter in die „Siedlung“ musste, kam am Stern vorbei. Man ging noch zu Fuß von der Arbeit nach Hause und fast alle liefen durch die Unterführung am „Bahnhofsteig“, die heute noch wie ein finsteres Loch unter den Bahngleisen durchführt - gleich vor oder neben dem Sterngarten.
Gegenüber dem Stern hatte die „Hammerand-Else“ ihren Milchladen. Dann weiter hinten, jenseits der „Schleifers-Wiese“ lag das Kalkwerk der Firma Wiesend. Zum Wiesend-Areal gehörte auch ein Bauernhof, den die Familie Schleifer, Flüchtlinge aus Schlesien gepachtet hatten. Links am Bahnhofsteig in Richtung Stadt, nach dem Wohnhaus der Familie Wiesend lag das Amtsgericht und dann wieder rechts gegenüber das Forstamt. An das Amtsgericht schloss sich die Kolonialwarenhandlung der Horvaths an und im Hintergebäude führte der damalige, erste Chefarzt des Pegnitzer Krankenhauses, Dr. Mauelshagen eine Allgemein-Praxis.
Von diesen „Destinationen“ am Bahnhofsteig ist nichts mehr geblieben, außer der „berüchtigten“ Bahnunterführung vor dem Goldenen Stern.
Pegnitzer Originale
Der alte Kreisbaumeister
Einer der exquisiten Stammgäste im Stern war der alte Kreisbaumeister, unbestritten ein Pegnitzer Original. Er kreuzte meistens im Winter auf und dann, wenn es im Stern Schlachtschüssel gab. Damals war er schon weit über 80 Jahre alt, aber trotz seines Greisenalters hatte er etwas Kerniges, Unverwüstliches - schließlich war er ja auch Jäger.
Wenn er im Stern auftauchte, gegen Mittag, eben, wenn die „Schipf“ fertig sein musste, erschien er in voller Ausrüstung: schwere Filz-Jagdstiefel mit Wickelgamaschen, Lederhose, ein gewalkter Jagdrock über einem Strickjanker und auf dem Kopf einen Jagdhut von der Art, wie ich ihn nur einmal auf einem Bild des alten Prinzregenten Luitpold gesehen hatte.
Über der Schulter trug er eine Jagdflinte. In seinem Gefolge erschien der Max, ein ebenfalls schon betagter Rauhaardackel mit einem ungemein herzigen Blick, halt dem richtigen Dackelblick.
Der alte Kreisbaumeister Weiß war nicht unbedingt von beeindruckender Statur, eher untersetzt, vielleicht war er früher mal einen Meter fünfundsechzig groß gewesen. Sein rundes Gesicht wurde von zahllosen Falten durchzogen, die mir in der Erinnerung als Lachfalten erscheinen, denn sie gaben seinem Gesicht etwas Verschmitztes, auch wenn seine Mimik durch einen Alters-Parkinson schon etwas eingeschränkt war.
Dagegen hatte er lebhaft bewegte Äuglein mit einem Blinzeln, welches auf Alterssichtigkeit oder einen grauen Star schließen ließ - sicher ein nachteiliger Umstand für einen passionierten Jäger und Schützen.
Seinen rundlichen Schädel zierten spärliche, schlohweiße Haare und unter der Unterlippe trug er ein neckisches Bärtchen, eine sogenannte Fliege, wie sie einst Ludwig XIV. zur Mode machte.
Er erschien nie mit einer Jagdtrophäe im Stern, obwohl er immer den Anschein vermittelte, dass er geradewegs von der Pirsch kam.
Sowie draußen Schnee lag, hinterließen seine mächtigen Stiefel beim Gehen eine Wasserspur von der Garderobe bis hin zu seinem Stammplatz am unteren Ende des Stammtisches. Man schlussfolgerte deshalb, dass er wohl nicht von der Entenjagd kam, denn man erzählte am Stammtisch immer, dass der Alte auf Entenjagd im Schnee nur mit fünf Paar Socken an den Füßen, nie aber mit Stiefeln unterwegs sei - zwecks der Geräuschunterdrückung beim Pirschen.
Das Hinterlassen von „Feuchtigkeit“ war eine Eigentümlichkeit des alten Kreisbaumeisters. Dazu komme ich später.
Sobald er das Lokal betrat und wenn es draußen Schnee gab, sauste sofort jemand vom Personal los, um einige Flaschen „Märzen“ im Hof - einsehbar von seinem Stammplatz - in den Schnee zu stecken. Er misstraute den damaligen Kühlvorrichtungen und wollte stets auch den sichtbaren Beweis für ein eisgekühltes Bier haben. Das war eine Marotte, welche auch den Dokter auszeichnete, doch das ist eine andere Geschichte.
Es waren im Laufe des Tages so deren zehn, nicht selten fünfzehn Flaschen Märzenbier, die der Kreisbaumeister in sich hineingoss.
Bezüglich des Essens, bei der Schipf, war er sehr eigen. Er verlangte als unverzichtbaren Bestandteil immer einen „Dreckbohrer“, d.h. den Schweinsrüssel.
Der musste - wie auch die Schweinsbacken, Ohren, Haxen - unbedingt „zweckert“ sein, das heißt auf Fränkisch „net lätschert“, auf Deutsch vielleicht „kernig“ - eben halt zweckert.
Die sechs bis acht Liter Bier vom Mittag bis zum Abend zeigten natürlich ihre Wirkung. Wenn der Kreisbaumeister anfangs noch den Weg ins „Häusl“ fand, wurde das nach und nach für ihn anstrengender und war schließlich gar nicht mehr möglich. Der Körper wird nämlich, gewaltig von Märzen durchtränkt, schwer wie Blei. Aber Bier sucht nach den physiologischen Gesetzen unaufhaltsam einen Weg nach draußen. Für die Umgebung war das kein Problem, wenn der „alte Weiß“ seine Lederhose anhatte. Am Verhalten vom Max war das Malheur zu erkennen, indem plötzlich sein sprichwörtlicher Dackelblick noch treuherziger wurde und ein leises Winseln zu vernehmen war. Dazu überkam das Hundchen eine auffallende motorische Unruhe - eine Unruhe, die seinem Herrn absolut abging.
Der Max hatte seinen Ruhe- und Warteplatz direkt unter der Bank, hinter den Füßen seines Herrn. Ging der nach draußen, ins Häusl oder sonst wo hin, stand auch der Max auf und begleitete ihn in seiner gemächlichen, dackelbeinigen Fortbewegungsart.
Manchmal soll er dort auch gewisse unverdaute Magen- Absonderungen seines Herrchens beseitigt haben, wie erzählt wird.
Der Nachhauseweg war nach so einer Jagdtour mit Einkehr bis weit in die Nacht natürlich ein Problem.
Da kam dann mein Onkel, der „Reiniger Sepp“ ins Spiel. In ihn setzte der alte Herr das größte Vertrauen, was den Automobilismus und andere moderne praktische Angelegenheiten betraf.





























