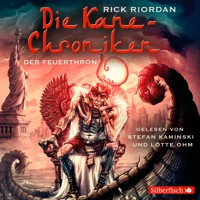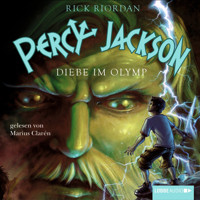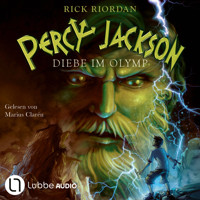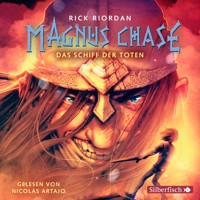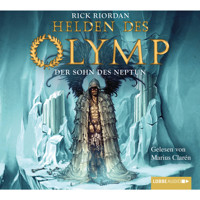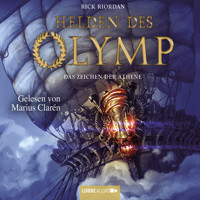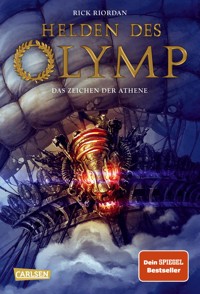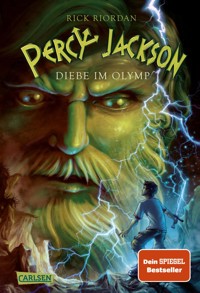
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Action, Humor und ein bisschen Götterdrama Auf den ersten Blick ist der zwölfjährige Percy Jackson ein ganz normaler Jugendlicher: Nicht gerade ein Überflieger und in Sachen Selbstbewusstsein ist noch Luft nach oben. Wären da nicht diese merkwürdigen Vorkommnisse, die ihm ständig Ärger einbringen: So wie die Mathelehrerin, die sich in eine Furie verwandelt oder der überaus aggressive Minotaurus, der ihm auf den Fersen ist. Doch dann erfährt Percy endlich, warum ihn die fiesesten Gestalten der griechischen Mythologie ins Visier genommen haben: Er ist ein Halbgott und sein Vater ist der mächtige Meeresgott Poseidon! Damit verändert sich alles, denn Percy muss ins Camp Half-Blood, eine Zuflucht für Jugendliche wie ihn. Dort soll er lernen, seine göttlichen Kräfte zu beherrschen. Denn nur gemeinsam mit den anderen Halbgöttern hat er eine Chance gegen die unheilvollen Titanen zu bestehen und die Welt vor dem Untergang zu bewahren. Die Jugendbuch-Bestsellerserie mit nachtragenden Ungeheuern und schrulligen Göttern Als Percy Jackson erfährt, dass er ein Halbgott ist und es die Kreaturen aus der griechischen Mythologie wirklich gibt, verändert das alles. Von nun an stehen ihm und seinen Freunden allerlei Monster, göttliche Streitigkeiten und epische Quests bevor. Gespickt mit Heldentum, Chaos und Freundschaft ist die Fantasy-Reihe rund um den Halbgott Percy Jackson inzwischen millionenfach verkauft. Der Mix aus Spannung, Witz und Mythologie begeistert Jung und Alt aus mehr als 40 Ländern und es ist die bekannteste Serie von Rick Riordan. ***Griechische Götter in der Gegenwart: chaotisch-wilde Fantasy für junge Leser*innen ab 12 Jahren und für alle Fans der griechischen Mythologie***
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 506
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Rick Riordan:
Percy Jackson – Diebe im Olymp
Aus dem Englischen von Gabriele Haefs
Percy versteht die Welt nicht mehr. Jedes Jahr fliegt er von einer anderen Schule. Ständig passieren ihm seltsame Unfälle. Und jetzt soll er auch noch an dem Tornado schuld sein! Langsam wird ihm klar: Irgendjemand hat es auf ihn abgesehen. Als Percy sich mit Hilfe seines Freundes Grover vor einem Minotaurus ins Camp Half-Blood rettet, erfährt er die Wahrheit: Sein Vater ist der Meeresgott Poseidon, Percy also ein Halbgott. Und er hat einen mächtigen Feind: Kronos, den Titanen. Die Götter stehen Kopf – und Percy und seine Freunde vor einem unglaublichen Abenteuer …
Alle Bände der »Percy Jackson«-Serie: Percy Jackson – Diebe im Olymp (Band 1) Percy Jackson – Im Bann des Zyklopen (Band 2) Percy Jackson – Der Fluch des Titanen (Band 3) Percy Jackson – Die Schlacht um das Labyrinth (Band 4) Percy Jackson – Die letzte Göttin (Band 5) Percy Jackson – Der Kelch der Götter (Band 6) Percy Jackson – Auf Monsterjagd mit den Geschwistern Kane (Sonderband)
Percy Jackson erzählt: Griechische Göttersagen Percy Jackson erzählt: Griechische Heldensagen
Und dann geht es weiter mit den »Helden des Olymp«!
Wohin soll es gehen?
Buch lesen
Glossar
Viten
Das könnte dir auch gefallen
Leseprobe
Liebe Sterbliche, die ihr dies lest:
Ich habe beim Fluss Styx geschworen, dass alles, was in diesem Buch erzählt wird, pure Erfindung ist.
Es gibt keinen zwölf Jahre alten Jungen Perseus »Percy« Jackson. Die griechischen Gottheiten sind einfach nur alte Mythen. Und selbstverständlich zeugen sie im einundzwanzigsten Jahrhundert keine Kinder mit Sterblichen. Es gibt keinen Ort wie Half-Blood Hill, ein Sommercamp für Demigottheiten auf dem östlichen Long Island. Percy ist niemals einem Satyrn oder einer Tochter der Athene begegnet. Und ganz bestimmt haben sie sich nicht zusammen auf den Weg quer durch die USA gemacht, um den Eingang zur Unterwelt zu finden und einen schrecklichen Krieg zwischen den Göttern zu verhindern.
Nachdem dies gesagt ist, muss ich euch dringend bitten, euch gut zu überlegen, ob ihr dieses Buch lesen wollt. Wenn ihr beim Lesen spüren solltet, dass sich in euch etwas regt, wenn euch der Verdacht kommt, dass diese Geschichte etwas aus eurem eigenen Leben beschreiben könnte – dann hört sofort mit Lesen auf. Andernfalls trage ich für die Folgen keinerlei Verantwortung.
Mögen die Gottheiten des Olymps (die es nicht gibt!) über euch wachen.
Mit besten Grüßen
Chiron Kentauros
Schriftleiter im Camp Half-Blood HillEhrenmitglied im Rat der behuften Älteren
Aus purem Zufall lasse ich meine Mathelehrerin in Dampf aufgehen
Echt, ich hab nicht darum gebeten, als Halbblut auf die Welt zu kommen.
Wenn ihr das hier lest, weil ihr auch gern eins wärt, dann rate ich euch: Klappt das Buch ganz schnell zu. Glaubt alle Lügen, die eure Eltern euch über eure Geburt erzählt haben, und versucht ein normales Leben zu führen.
Ein Halbblut zu sein ist gefährlich. Beängstigend. Meistens führt es zu einem schmerzhaften, scheußlichen Tod.
Wenn ihr ganz normale Menschen seid und das hier lest, weil ihr es für einen Roman haltet, alles klar. Weiterlesen. Ich beneide euch darum, glauben zu können, dass das alles nie passiert ist.
Aber wenn ihr euch in diesen Seiten wiedererkennt – wenn sich in euch etwas regt –, dann hört sofort mit Lesen auf. Vielleicht gehört ihr ja zu uns. Und wenn ihr das erst wisst, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis auch sie es spüren und sich auf die Suche nach euch machen.
Behauptet nicht, ich hätte euch nicht gewarnt.
Ich heiße Percy Jackson.
Ich bin zwölf Jahre alt. Bis vor ein paar Monaten habe ich die Yancy Academy besucht, ein Internat für Problemkinder, das in der Nähe von New York liegt.
Bin ich ein Problemkind?
Ja. Das kann man durchaus so sagen.
Ich könnte an jedem Punkt meines kurzen, elenden Lebens anfangen, um das zu beweisen, aber richtig schlimm wurde alles erst im vergangenen Mai, als wir eine Klassenfahrt nach Manhattan gemacht haben – achtundzwanzig durchgeknallte Kids und zwei Lehrer in einem gelben Schulbus, unterwegs zum Metropolitan Museum of Art, um sich antiken griechischen und römischen Kram anzusehen.
Ich weiß, es klingt wie pure Folter. Die meisten Schulausflüge von Yancy waren pure Folter.
Aber diese Fahrt wurde von Mr Brunner geleitet, unserem Lateinlehrer, und da hab ich mir doch Hoffnungen gemacht.
Mr Brunner war ein Mann in mittleren Jahren, der in einem motorisierten Rollstuhl saß. Er hatte schütteres Haar, einen struppigen Bart und trug eine ausgefranste Tweedjacke, die immer nach Kaffee roch. Eigentlich würde man ihn gar nicht für cool halten, aber er erzählte Geschichten und Witze und ließ uns im Unterricht Spiele machen. Und er hatte eine umwerfende Sammlung von römischen Rüstungen und Waffen, deshalb war er der einzige Lehrer, bei dem ich im Unterricht nicht eingeschlafen bin.
Ich hoffte also, dass dieser Ausflug ganz nett sein würde. Zumindest hoffte ich, dass ich ausnahmsweise einmal keinen Ärger kriegen würde.
O Mann, da lag ich ja so was von falsch!
Bei Klassenfahrten habe ich einfach immer Pech. Wie damals, als wir das Schlachtfeld von Saratoga besucht haben. Da passierte dieses Unglück mit der Kanone aus dem Unabhängigkeitskrieg. Ich hatte natürlich nicht auf den Schulbus gezielt, aber von der Schule gefeuert wurde ich trotzdem. Und auf der Schule davor hab ich, als wir im Haifischpark hinter die Kulissen schauen sollten, auf dem Steg aus Versehen den falschen Hebel berührt und die ganze Klasse musste unerwartet eine Runde schwimmen. Und auf der Schule davor … na ja, ihr wisst schon, was ich meine.
Auf diesem Ausflug also sollte alles gut gehen, dazu war ich fest entschlossen.
Während der ganzen Fahrt in die Stadt sah ich tatenlos zu, wie Nancy Bobofit, die rothaarige, sommersprossige Kleptomanin, meinem besten Freund Grover immerzu Stückchen von einem Erdnussbutter-Ketchup-Sandwich an den Hinterkopf warf.
Grover war ein leichtes Opfer. Er war schwächlich. Er weinte, wenn etwas schiefging. Sicher hatte er mehrere Klassen wiederholen müssen, er war der Einzige bei uns, der Akne und den ersten Bartflaum im Gesicht hatte. Und zu allem Überfluss war er auch noch behindert. Er hatte es schriftlich, dass er bis an sein Lebensende vom Sportunterricht befreit war, weil er irgendeine Art Muskelkrankheit in den Beinen hatte. Er hatte einen komischen Gang, jeder Schritt schien ihm wehzutun, aber davon sollte man sich nicht täuschen lassen. Ihr hättet ihn mal loswetzen sehen sollen, wenn es in der Schulmensa Enchiladas gab.
Jedenfalls beschmiss Nancy Bobofit ihn mit Brotklumpen, die in seinen braunen Locken kleben blieben, und sie wusste, dass ich ihr nichts tun würde, weil ich ohnehin auf Bewährung war. Der Rektor hatte mir mit sofortigem Rausschmiss gedroht, wenn auf diesem Schulausflug irgendetwas Schlimmes, Peinliches oder auch nur leicht Amüsantes passierte.
»Ich bring sie um«, murmelte ich.
Grover versuchte mich zu beruhigen. »Ist schon gut. Ich ess gern Erdnussbutter.«
Er wich einem weiteren Brocken von Nancys Mittagessen aus.
»Das reicht.« Ich wollte aufstehen, aber Grover zog mich zurück auf meinen Sitz.
»Du bist auf Bewährung«, mahnte er. »Und du weißt, wem sie die Schuld zuschieben werden, wenn irgendwas schiefgeht.«
Im Nachhinein wünschte ich, ich hätte Nancy Bobofit an Ort und Stelle eine reingesemmelt. Von der Schule zu fliegen wäre noch gar nichts gewesen im Vergleich zu den Scherereien, die ich nun bald haben würde.
Mr Brunner führte uns durch das Museum.
Er fuhr in seinem Rollstuhl vor uns her durch weite Galerien mit lautem Echo, vorbei an Marmorstatuen und Glaskästen voller uralter schwarzer und orangefarbener Töpfersachen.
Ich konnte es einfach nicht fassen, dass dieser Kram zwei- oder dreitausend Jahre überlebt hatte.
Mr Brunner versammelte uns vor einer fast vier Meter hohen Steinsäule, auf der eine Sphinx saß, und erzählte uns, dass das eine Grabsäule sei, eine Stele, für ein Mädchen in ungefähr unserem Alter. Er erzählte uns, was an den Seiten in den Stein geritzt war. Ich versuchte, mir das alles anzuhören, weil es ja irgendwie doch interessant war, aber alle um mich herum quasselten, und immer, wenn ich »Haltet doch mal die Klappe« sagte, starrte die andere Lehrerin, Mrs Dodds, mich wütend an.
Mrs Dodds war eine kleine Mathelehrerin aus Georgia und trug immer eine schwarze Lederjacke, obwohl sie schon fünfzig war. Sie sah fies genug aus, um auf einer Harley voll in deinen Schrank zu brettern. Sie war mitten im Schuljahr nach Yancy gekommen, als unsere letzte Mathelehrerin einen Nervenzusammenbruch erlitten hatte.
Vom ersten Tag an war Mrs Dodds hin und weg von Nancy Bobofit, mich dagegen hielt sie für die reine Teufelsbrut. Sie zeigte immer wieder mit ihrem krummen Finger auf mich und sagte honigsüß: »So, mein Herzchen«, und dann wusste ich, dass mir ein Monat Nachsitzen bevorstand.
Einmal, nachdem ich bis nach Mitternacht Auflösungen aus alten Mathebüchern hatte ausradieren müssen, sagte ich zu Grover, dass ich mir gar nicht vorstellen könnte, dass Mrs Dodds ein Mensch sei. Er schaute mich mit ganz ernster Miene an und sagte: »Du hast ja so Recht.«
Mr Brunner redete noch immer über griechische Grabkunst.
Da riss Nancy Bobofit einen blöden Witz über den nackten Typen oben auf der Stele und ich fuhr herum und sagte: »Kannst du jetzt endlich mal die Klappe halten?«
Das sagte ich lauter, als ich es vorgehabt hatte.
Die ganze Gruppe prustete los. Mr Brunner hörte mitten in der Geschichte auf.
»Mr Jackson«, sagte er. »Möchten Sie einen Kommentar abgeben?«
Mein Gesicht war knallrot. Ich sagte: »Nein, Sir.«
Mr Brunner zeigte auf eins der Bilder auf der Stele. »Vielleicht könnten Sie uns sagen, was dieses Bild darstellt?«
Ich schaute mir die in Stein geritzte Zeichnung an und war total erleichtert, weil ich das Bild erkannte. »Das ist Kronos, der seine Kinder frisst, nicht?«
»Ja«, sagte Mr Brunner, war damit aber offenbar noch nicht zufrieden. »Und das hat er getan, weil …«
»Na ja …« Ich zerbrach mir den Kopf, um mich zu erinnern. »Kronos war der König der Götter und …«
»Götter?«, fragte Mr Brunner.
»Titanen«, korrigierte ich mich. »Und … er misstraute seinen Kindern, die Götter waren. Und also, ähem, hat Kronos sie aufgegessen, stimmt’s? Aber seine Frau hatte den kleinen Zeus versteckt und Kronos stattdessen einen Felsen zu essen gegeben. Und als Zeus dann später größer wurde, hat er seinen Papa, Kronos, dazu gebracht, seine Geschwister auszukotzen …«
»Uääh!«, sagte eins von den Mädchen hinter mir.
»… und dann gab es einen wütenden Kampf zwischen Göttern und Titanen«, fügte ich hinzu. »Und die Götter haben gewonnen.«
In der Gruppe kicherten einige.
Hinter mir murmelte Nancy Bobofit einer Freundin zu: »Als ob wir das im wirklichen Leben zu irgendwas brauchen könnten. Als ob uns bei einer Jobbewerbung irgendwer sagen wird, bitte, erklären Sie uns, warum Kronos seine Kinder verspeist hat.«
»Und warum, Mr Jackson«, sagte Brunner, »um Miss Bobofits hervorragende Frage anders zu formulieren, spielt das im wirklichen Leben eine Rolle?«
»Reingefallen«, murmelte Grover.
»Fresse«, zischte Nancy und ihr Gesicht war jetzt noch röter als ihre Haare.
Wenigstens war Nancy jetzt auch erwischt worden. Mr Brunner war der Einzige, der jemals hörte, wenn sie etwas Falsches sagte. Der Mann hatte wirklich Radarohren.
Ich dachte über seine Frage nach und zuckte mit den Schultern. »Ich weiß es nicht, Sir.«
»Aha.« Mr Brunner machte ein enttäuschtes Gesicht. »Na, immerhin ein halber Punkt, Mr Jackson. Zeus hat Kronos in der Tat eine Mischung aus Senf und Wein gegeben, worauf der seine anderen fünf Kinder auswürgte, die, als unsterbliche Gottheiten, vollständig unverdaut im Magen des Titanen überlebt hatten und herangewachsen waren. Die Götter überwältigten dann ihren Vater, schnitten ihn mit seiner eigenen Sense in Stücke und verstreuten seine Überreste im Tartarus, dem dunkelsten Teil der Unterwelt. Und an dieser fröhlichen Stelle legen wir jetzt die Mittagspause ein. Mrs Dodds, würden Sie uns wieder nach draußen führen?«
Die Klasse wanderte los, den Mädchen war das auf den Magen geschlagen, die Jungs rempelten sich an und benahmen sich wie Idioten.
Grover und ich wollten gerade hinterhergehen, als Mr Brunner sagte: »Mr Jackson?«
Ich wusste, was jetzt kommen würde.
Ich sagte zu Grover: »Geh schon mal vor.« Dann drehte ich mich zu Mr Brunner um. »Sir?«
Mr Brunner hatte einen Blick, der einen einfach nicht losließ – intensive braune Augen, von denen man denken konnte, sie wären tausend Jahre alt und hätten alles schon gesehen.
»Du musst die Antwort auf meine Frage finden«, sagte Mr Brunner nun.
»Über die Titanen?«
»Über das wirkliche Leben. Und was der Unterrichtsstoff damit zu tun hat.«
»Ach.«
»Was du von mir lernst«, sagte er, »ist von ungeheurer Bedeutung. Und ich werde von dir nur das Beste akzeptieren, Percy Jackson.«
Ich wurde wütend, dieser Typ setzte mich dermaßen unter Druck.
Ich meine, klar, es konnte schon lustig sein, wenn er an Wettkampftagen eine römische Rüstung anlegte, »Waffen, ho!« brüllte und uns, Schwertspitze auf die Kreide gerichtet, aufforderte, an die Tafel zu rennen und alle Griechen und Römer aufzuzählen, die je gelebt hatten, und zu erklären, wer ihre Mutter gewesen war und welche Gottheiten sie verehrt hatten. Aber Mr Brunner erwartete, dass ich genauso gut war wie alle anderen, obwohl ich Legastheniker und hyperaktiv war und in meinem ganzen Leben nie eine bessere Note als befriedigend gehabt hatte. Nein, das stimmt nicht – er erwartete nicht, dass ich ebenso gut war, ich sollte besser sein. Und ich konnte mir diese ganzen Namen und Fakten einfach nicht merken, mal ganz zu schweigen davon, sie richtig zu schreiben.
Ich murmelte etwas von größere Mühe geben, während Mr Brunner einen langen, traurigen Blick auf die Stele warf, als ob er bei der Beerdigung des Mädchens zugegen gewesen wäre.
Dann sagte er, ich sollte nach draußen gehen und meinen Sandwich essen.
Die Klasse hatte sich auf der Vordertreppe des Museums versammelt, wo wir den Verkehr auf der Fifth Avenue beobachten konnten.
Über uns braute sich ein gewaltiger Sturm zusammen, mit schwärzeren Wolken, als ich das jemals in der Stadt gesehen hatte. Ich nahm an, das lag an der Klimakatastrophe, denn im ganzen Staat New York war das Wetter seit Weihnachten schon komisch gewesen. Wir hatten heftige Schneestürme gehabt, Überschwemmungen und Lauffeuer, die durch Blitzeinschläge entstanden waren. Es hätte mich nicht im Geringsten überrascht, wenn hier ein Hurrikan heraufgezogen wäre.
Die anderen schienen nichts davon zu bemerken. Die Jungs bewarfen die Tauben mit Salzkräckern. Nancy Bobofit versuchte, etwas aus der Handtasche einer vorübergehenden Frau zu klauen, und Mrs Dodds kriegte natürlich rein gar nichts mit.
Grover und ich setzten uns auf den Brunnenrand, weit weg von den anderen. Wir dachten, dann würde vielleicht nicht alle Welt wissen, dass wir auf diese Schule gingen – die Schule für Versager, die nirgendwo anders zurechtkamen.
»Nachsitzen?«, fragte Grover.
»Nö«, sagte ich. »Das macht der Brunner doch nicht. Aber ich wünschte, er könnte mich mal in Ruhe lassen. Ich bin eben kein Genie.«
Grover schwieg eine Weile. Dann, als ich schon mit einem tiefsinnigen philosophischen Kommentar rechnete, der meine Laune verbessern sollte, fragte er: »Kann ich deinen Apfel haben?«
Ich hatte keinen besonderen Appetit, deshalb gab ich ihn ihm.
Ich sah mir die vielen Taxis auf der Fifth Avenue an und dachte an die Wohnung meiner Mom, die gar nicht weit entfernt lag. Ich hatte Mom seit Weihnachten nicht mehr gesehen. Ich hätte mich am liebsten in ein Taxi gesetzt, um nach Hause zu fahren. Mom hätte mich umarmt und sich gefreut, mich zu sehen, aber sie wäre auch enttäuscht gewesen. Sie hätte mich sofort nach Yancy zurückgeschickt und mich daran erinnert, dass ich mir größere Mühe geben müsste, dass das hier meine sechste Schule in sechs Jahren war und dass ich vermutlich wieder fliegen würde. Ich würde ihren traurigen Blick nicht ertragen.
Mr Brunner hielt in seinem Rollstuhl unten vor der Rollstuhlrampe. Er aß Sellerie und las in einem Taschenbuch. Ein roter Regenschirm ragte hinten aus seinem Stuhl auf und dadurch sah der Stuhl aus wie ein motorisierter Cafétisch.
Ich wollte gerade mein Butterbrot auspacken, als Nancy Bobofit mit ihren hässlichen Freundinnen vor mir auftauchte – sie hatte es wohl satt, Touristinnen zu beklauen – und die Reste ihres Proviants in Grovers Schoß fallen ließ.
»Huch.« Sie grinste mich an und zeigte dabei ihre schiefen Zähne. Ihre Sommersprossen waren so orange, als ob jemand ihr Gesicht mit flüssigen Cheetos besprüht hätte.
Ich versuchte, ganz cool zu bleiben. Das hatte der Schulpsychologe mir eine Million Mal geraten. »Zähl bis zehn, dann kriegst du deine Wut in den Griff.« Aber ich war so wütend, dass ich nicht mehr denken konnte. In meinen Ohren schien eine Welle zu brausen.
Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich sie angefasst habe, aber plötzlich saß Nancy im Brunnen auf ihrem Hintern und kreischte: »Percy hat mich geschubst!«
Sofort stand Mrs Dodds neben uns.
Ein paar von den anderen flüsterten: »Habt ihr gesehen …«
»… das Wasser …«
»… als ob es sie gepackt hätte …«
Ich hatte keine Ahnung, wovon sie redeten. Ich wusste nur, dass ich jetzt neuen Ärger hatte.
Kaum hatte Mrs Dodds sich davon überzeugt, dass die arme kleine Nancy nicht verletzt war, und ihr versprochen, ihr im Museumsladen ein neues Hemd zu kaufen und überhaupt und so weiter, machte sie sich über mich her. In ihren Augen brannte ein triumphierendes Feuer, als ob ich etwas getan hätte, auf das sie schon das ganze Schuljahr wartete. »So, mein Herzchen …«
»Ich weiß«, knurrte ich. »Einen Monat Bücher radieren.«
Das war nicht die passende Antwort.
»Komm mit«, sagte Mrs Dodds.
»Halt«, schrie Grover. »Ich war das. Ich hab sie geschubst.«
Ich starrte ihn verblüfft an. Ich konnte es nicht fassen, dass er versuchte mich zu retten. Grover hatte eine Sterbensangst vor Mrs Dodds.
Sie starrte ihn so wütend an, dass seine flaumigen Wangen zitterten.
»Das glaube ich nicht, Mr Underwood«, sagte sie.
»Aber …«
»Sie – bleiben – hier!«
Grover sah mich verzweifelt an.
»Schon gut, Mann«, sagte ich zu ihm. »Danke, dass du’s versucht hast.«
»Herzchen«, bellte Mrs Dodds mich an. »Sofort!«
Nancy Bobofit feixte.
Ich verpasste ihr mein Dich-bring-ich-nachher-um-Glotzen. Dann drehte ich mich zu Mrs Dodds um, aber die war nicht da. Sie stand vor dem Museumseingang, ganz oben auf der Treppe, und winkte mir ungeduldig zu.
Wie war sie da so schnell hingekommen?
Ich habe oft solche Momente, in denen mein Gehirn einschläft oder so was, und als Nächstes weiß ich dann, dass ich etwas verpasst habe – als sei ein Puzzlestück aus dem Universum gefallen und ich könne nur noch die leere Stelle dahinter anstarren. Der Schulpsychologe hat mir gesagt, dass das mit ADHD zu tun hat. Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Desaster. Mein Gehirn deutet alles Mögliche falsch.
Ich bin mir da nicht so sicher.
Ich lief hinter Mrs Dodds her.
Auf halber Höhe der Treppe drehte ich mich zu Grover um. Er sah blass aus und sein Blick jagte zwischen mir und Mr Brunner hin und her, als wolle er Mr Brunner darauf aufmerksam machen, was hier passierte. Aber Mr Brunner war in seinen Roman vertieft.
Ich schaute nach oben. Mrs Dodds war schon wieder verschwunden. Jetzt stand sie im Museum, hinten in der Eingangshalle.
Na gut, dachte ich. Bestimmt muss ich jetzt im Laden für Nancy ein neues Hemd kaufen.
Aber das hatte Mrs Dodds dann offenbar doch nicht vor.
Ich folgte ihr weiter ins Museum hinein. Als ich sie endlich eingeholt hatte, befanden wir uns wieder in der griechisch-römischen Abteilung.
Außer uns war niemand dort.
Mrs Dodds stand mit verschränkten Armen vor einem großen Marmorfries, der die griechischen Gottheiten darstellte. Sie stieß ein seltsam kehliges Geräusch aus, wie ein Knurren.
Auch ohne dieses Geräusch wäre ich nervös geworden. Es ist komisch, mit einem Lehrer oder einer Lehrerin allein zu sein, und das gilt vor allem für Mrs Dodds. Sie starrte den Fries auf eine so seltsame Weise an, als wollte sie ihn mit ihren Blicken zu Staub zermahlen …
»Du machst uns wirklich Probleme, Herzchen«, sagte sie.
Ich ging auf Nummer sicher. Ich sagte: »Ja, Ma’am.«
Sie zupfte an den Ärmeln ihrer Lederjacke. »Hast du wirklich gedacht, du würdest damit durchkommen?«
Ihr Blick war jetzt mehr als nur böse. Er war verrückt.
Sie ist eine Lehrerin, dachte ich nervös. Natürlich wird sie mir nichts tun.
Ich sagte: »Ich … ich werde mir noch größere Mühe geben, Ma’am.«
Donnerschläge ließen das Gebäude erbeben.
»Wir sind keine Trottel, Percy Jackson«, sagte Mrs Dodds. »Es war nur eine Frage der Zeit, bis wir dich finden würden. Gib alles zu und du wirst nicht so sehr leiden müssen.«
Ich wusste nicht, wovon sie redete.
Alles, was mir einfiel, war, dass die Lehrer offenbar herausgefunden hatten, dass ich in meinem Zimmer einen illegalen Süßigkeitenhandel betrieb. Vielleicht wussten sie auch, dass ich meinen Aufsatz über Tom Sawyer aus dem Internet abgeschrieben und das Buch nie gelesen hatte, und jetzt wollten sie mir eine schlechtere Note geben. Oder, schlimmer noch, mich zwingen es zu lesen.
»Na?«, fragte sie gebieterisch.
»Ma’am, ich weiß nicht …«
»Deine Zeit ist um«, fauchte sie und ihre Augen glühten wie Grillkohlen. Ihre Finger wurden länger und verwandelten sich in Krallen. Ihre Jacke zerschmolz zu großen, lederartigen Flügeln. Sie war kein Mensch. Sie war eine runzlige Hexe mit Fledermausflügeln und Krallen und einem Maul voller gelber Hauzähne und sie wollte mich in Fetzen reißen.
Dann wurde alles noch seltsamer.
Mr Brunner, der noch eine Minute zuvor vor dem Museum gesessen hatte, kam mit einem Kugelschreiber in der Hand durch die Galerie gerollt.
»Waffen, ho, Percy«, rief er und warf den Kugelschreiber durch die Luft.
Mrs Dodds sprang auf mich zu.
Ich schrie auf, duckte mich und fühlte, wie Krallen neben meinem Ohr durch die Luft sausten. Ich fing den Kugelschreiber auf, doch als er meine Hand berührte, war er kein Kugelschreiber mehr. Sondern ein Schwert. Mr Brunners Bronzeschwert, das er immer bei Schulwettbewerben schwenkte.
Mrs Dodds fuhr mit mörderischem Blick zu mir herum.
Meine Knie waren wie aus Pudding. Meine Hände zitterten dermaßen, dass mir das Schwert fast runtergefallen wäre.
Sie fauchte: »Stirb, Herzchen!«
Und dann flog sie auf mich zu.
Mich durchfuhr ein Gefühl absoluten Entsetzens. Ich tat das Einzige, was mir natürlich vorkam: Ich schwang mein Schwert.
Die Metallklinge traf ihre Schulter und durchschnitt ihren Körper wie Wasser. Ssssssss.
Mrs Dodds war eine Sandburg, die in einen Ventilator geraten war. Sie explodierte zu gelbem Staub und verdampfte auf der Stelle, und nichts blieb von ihr übrig außer Schwefelgestank und einem kalten Gefühl von Bosheit in der Luft, als starrten ihre glühend roten Augen mich noch immer an.
Ich war allein.
Ich hielt einen Kugelschreiber in der Hand.
Mr Brunner war nicht da. Niemand war da außer mir.
Meine Hände zitterten noch immer. Offenbar hatte mein Proviant Magic Mushrooms oder so was enthalten.
Hatte ich mir das alles nur eingebildet?
Ich ging wieder nach draußen.
Es regnete.
Grover saß vor dem Brunnen und hatte sich einen Plan des Museums über den Kopf gelegt. Nancy Bobofit stand nach ihrem Bad im Brunnen noch immer triefend da und knurrte ihre hässlichen Freundinnen an. Als sie mich sah, sagte sie: »Ich hoffe, Mrs Kerr hat dir den Arsch versohlt.«
Ich fragte: »Wer?«
»Unsere Lehrerin. Du Idiot!«
Ich kniff die Augen zusammen. Wir hatten keine Lehrerin namens Mrs Kerr. Ich fragte Nancy, wovon sie redete.
Sie verdrehte nur die Augen und ließ mich stehen.
Ich fragte Grover, wo Mrs Dodds stecke.
Er fragte: »Wer?«
Aber vorher zögerte er kurz und er sah mich nicht an. Ich dachte, er wollte mich auf den Arm nehmen.
»Reiß hier keine Witze, Mann«, sagte ich. »Das ist ernst.«
Über uns grollte der Donner.
Ich sah Mr Brunner unter seinem roten Schirm sitzen, er las sein Buch, als ob er sich keinen Zentimeter bewegt hätte.
Ich ging zu ihm hinüber.
Er schaute auf und wirkte ein wenig zerstreut. »Ach, das ist sicher mein Kugelschreiber. Bitte bringen Sie in Zukunft eigene Schreibgeräte mit, Mr Jackson.«
Ich reichte ihm den Kugelschreiber. Ich hatte nicht einmal gemerkt, dass ich ihn noch immer in der Hand hielt.
»Sir«, fragte ich. »Wo ist Mrs Dodds?«
Er starrte mich verständnislos an. »Wer?«
»Die Lehrerin, die mitgekommen ist. Mrs Dodds. Unsere Mathematiklehrerin.«
Er runzelte die Stirn und beugte sich mit leicht besorgter Miene vor. »Percy, hier ist keine Mrs Dodds mitgekommen. Soviel ich weiß, hat es an der Yancy Academy nie eine Mrs Dodds gegeben. Bist du vielleicht krank?«
Drei alte Damen stricken die Socken des Todes
An seltsame Erlebnisse ab und zu war ich ja gewöhnt, aber meistens gingen die schnell vorbei. Aber diese Wahnsinnshalluzination war zu viel für mich. Das ganze restliche Schuljahr über schienen alle mich nur noch auf den Arm nehmen zu wollen. Die anderen benahmen sich, als seien sie durch und durch davon überzeugt, dass Mrs Kerr – eine lebhafte blonde Frau, die ich zum ersten Mal in meinem Leben gesehen hatte, als sie am Ende des Ausflugs in unseren Bus gestiegen war – schon seit vor Weihnachten bei uns Mathe unterrichtet hätte.
Immer wieder erwähnte ich den anderen gegenüber Mrs Dodds, in der Hoffnung, ihnen einen Kommentar zu entlocken, aber sie starrten mich an wie einen Superpsycho.
Fast hätte ich ihnen am Ende geglaubt – es hatte niemals eine Mrs Dodds gegeben.
Fast.
Aber Grover konnte mich nicht an der Nase herumführen. Wenn ich ihm gegenüber den Namen Dodds nannte, zögerte er, um dann zu behaupten, nie von ihr gehört zu haben. Aber ich wusste, dass er log.
Irgendetwas lief hier ab. Irgendetwas war im Museum passiert.
Tagsüber hatte ich nicht viel Zeit, darüber nachzudenken, aber nachts ließen mich Visionen von Mrs Dodds mit Krallen und Lederflügeln in kaltem Schweiß gebadet aus dem Bett auffahren.
Das Wetter blieb weiterhin seltsam, was meine Stimmung nicht gerade hob. Eines Nachts blies der Wind die Fenster aus unserem Schlafsaal. Einige Tage später wütete der größte jemals im Tal des Hudson beobachtete Tornado knappe fünfundsiebzig Kilometer von der Yancy Academy entfernt. Und ein aktuelles Thema, das wir im Sozialkundeunterricht besprachen, war die ungewöhnlich hohe Anzahl von Sportflugzeugen, die in diesem Jahr bei plötzlichen Windböen in den Atlantik gestürzt waren.
Ich war meistens gereizt und genervt. Meine Noten wurden immer schlechter. Dauernd geriet ich mit Nancy Bobofit und ihren Freundinnen aneinander. In fast jeder Unterrichtsstunde wurde ich auf den Gang geschickt.
Als mich dann Mr Nicoll, unser Englischlehrer, zum millionsten Mal fragte, wieso ich zu faul sei, um für die Rechtschreibtests zu lernen, drehte ich durch. Und nannte ihn einen alten Hahnrei. Ich wusste nicht mal, was das bedeutete, aber es hörte sich gut an.
In der folgenden Woche schickte der Rektor meiner Mom einen Brief, in dem es offiziell verkündet wurde: Im nächsten Schuljahr war ich nicht mehr Schüler der Yancy Academy.
Schön, sagte ich mir. Mir nur recht.
Ich hatte Heimweh.
Ich wollte bei meiner Mom in unserer kleinen Wohnung in der Upper East Side sein, auch wenn ich dann auf eine öffentliche Schule gehen und mich mit meinem widerlichen Stiefvater und seinen blödsinnigen Pokerrunden abfinden müsste.
Aber trotzdem … es gab in Yancy Dinge, die mir fehlen würden. Der Blick vom Schlafsaalfenster auf die Wälder, der Hudson River in der Ferne, der Duft der Fichten. Grover würde mir fehlen. Er war ein guter Freund gewesen, wenn er auch ein wenig seltsam war. Ich fragte mich besorgt, wie er ohne mich das kommende Schuljahr überleben sollte.
Und der Lateinunterricht würde mir fehlen – Mr Brunners verrückte Wettbewerbe und seine Überzeugung, dass ich gute Leistungen erbringen könnte.
Als die Examenswoche näher rückte, büffelte ich nur für die Lateinklausur. Ich hatte nicht vergessen, dass Mr Brunner mir gesagt hatte, für mich sei das ein lebenswichtiges Thema. Ich wusste nicht, warum, aber inzwischen glaubte ich ihm.
Am Abend vor der Klausur war ich so frustriert, dass ich mein Lexikon der griechischen Mythologie quer durch den Schlafsaal schleuderte. Die Wörter begannen von der Seite zu rutschen, sie wirbelten vor meinen Augen hin und her, die Buchstaben fuhren Achten wie mit einem Skateboard. Es war einfach unmöglich, sich den Unterschied zwischen Chiron und Charon oder zwischen Polydektes und Polydeukes zu merken. Und die Konjugation der lateinischen Verben? Vergesst es.
Ich lief im Zimmer hin und her und hatte das Gefühl, dass unter meinem Hemd Ameisen herumkrochen.
Ich dachte an Mr Brunners ernste Miene, an seine tausend Jahre alten Augen. Ich werde von dir nur das Beste akzeptieren, Percy Jackson.
Ich holte tief Luft. Dann hob ich das Lexikon auf.
Ich hatte noch nie einen Lehrer um Hilfe gebeten. Aber wenn ich Mr Brunner fragte, würde er mir vielleicht ein paar Tipps geben. Und ich könnte mich schon mal für die miese Note entschuldigen, die ich in seiner Klausur fabrizieren würde. Ich wollte ihn nicht in dem Glauben zurücklassen, ich hätte es nicht versucht.
Ich ging nach unten zu den Arbeitszimmern der Lehrer. Die meisten waren dunkel und leer, aber Mr Brunners Tür stand offen, das Licht aus dem Fenster seiner Tür fiel in den Gang.
Ich war drei Schritte von der Türklinke entfernt, als ich aus dem Zimmer Stimmen hörte. Mr Brunner stellte eine Frage. Eine Stimme, die einwandfrei Grover gehörte, sagte: »… Sorgen um Percy, Sir.«
Ich erstarrte.
Ich lausche sonst nicht an Türen, aber ich wette, ihr würdet auch zuhören, wenn euer bester Freund sich mit einem Erwachsenen über euch unterhält.
Ich schlich mich näher an die Tür.
»… allein in diesem Sommer«, sagte Grover gerade. »Ich meine, eine Wohlgesinnte hier in der Schule! Jetzt wissen wir es mit Sicherheit und sie wissen es auch.«
»Wir würden alles nur noch schlimmer machen, wenn wir ihn zur Eile antrieben«, sagte Mr Brunner. »Der Junge muss erst noch reifer werden.«
»Aber vielleicht hat er keine Zeit mehr. Die Sommersonnenwende ist Stichtag und …«
»Wir müssen ohne ihn entscheiden, Grover. Soll er seine Unwissenheit genießen, solange das noch möglich ist.«
»Sir, er hat sie gesehen …«
»Einbildung«, sagte Mr Brunner eindringlich. »Die Undurchsichtigkeit des Ganzen wird ihn davon überzeugen.«
»Sir, ich … ich darf nicht noch einmal meine Pflicht vernachlässigen.« Grovers Stimme bebte. »Sie wissen, was das bedeuten würde.«
»Du hast deine Pflicht nicht vernachlässigt«, sagte Mr Brunner freundlich. »Ich hätte sie gleich durchschauen müssen. Aber jetzt wollen wir uns den Kopf darüber zerbrechen, wie wir Percy bis zum nächsten Herbst am Leben erhalten können …«
Das Lexikon der griechischen Mythologie rutschte mir aus der Hand und knallte auf den Boden.
Mr Brunner verstummte.
Mit hämmerndem Herzen hob ich das Buch auf und schlich rückwärts den Gang entlang.
Ein Schatten glitt über das bunte Glas in Mr Brunners Arbeitszimmertür, der Schatten von etwas viel Größerem als meinem an den Rollstuhl gefesselten Lehrer, etwas, das dem Bogen eines Schützen zum Verwechseln ähnlich sah.
Ich öffnete die nächstbeste Tür und verschwand in einem Zimmer.
Einige Sekunden darauf hörte ich ein langsames Klapper-di-klapp, wie von mit Stoff umwickelten Holzklötzen, und dann schien direkt vor der Tür ein Tier herumzuschnüffeln. Eine große dunkle Gestalt blieb vor dem Türfenster stehen und ging endlich weiter.
Ein Bächlein aus Schweißtropfen lief über meinen Nacken.
Irgendwo auf dem Gang hörte ich Mr Brunner. »Nichts«, murmelte er. »Seit der Wintersonnenwende bin ich mit den Nerven zu Fuß.«
»Ich auch«, sagte Grover. »Aber ich hätte schwören können …«
»Geh wieder auf dein Zimmer«, sagte Mr Brunner zu ihm. »Morgen hast du einen langen Tag voller Klausuren.«
»Erinnern Sie mich bloß nicht daran.«
Das Licht erlosch.
Ich wartete in der Dunkelheit, eine Ewigkeit, wie mir schien.
Endlich schlüpfte ich hinaus auf den Gang und ging nach oben in den Schlafsaal.
Grover lag auf seinem Bett und büffelte Latein, als ob er den ganzen Abend nichts anderes getan hätte.
»Hallo«, sagte er und sah mich mit roten Augen an. »Meinst du, du schaffst die Klausur?«
Ich gab keine Antwort.
»Du siehst schrecklich aus.« Er runzelte die Stirn. »Ist irgendwas passiert?«
»Bin nur … müde.«
Ich drehte mich um, damit er mein Gesicht nicht sehen konnte, und tat so, als wollte ich einschlafen.
Ich begriff nicht, was ich da gerade gehört hatte. Ich hätte gern geglaubt, dass ich mir das alles nur einbildete.
Aber eins stand fest: Grover und Mr Brunner redeten hinter meinem Rücken über mich. Und sie glaubten, dass mir irgendeine Gefahr drohte.
Am nächsten Nachmittag kam ich aus der dreistündigen Lateinklausur und meine Augen trieften von den vielen griechischen und römischen Namen, die ich falsch geschrieben hatte. Da rief Mr Brunner mich noch einmal herein.
Einen Moment lang hatte ich Angst, er könnte herausgefunden haben, dass ich ihn am Vorabend belauscht hatte, aber das schien nicht der Fall zu sein.
»Percy«, sagte er. »Nimm es dir nicht so zu Herzen, dass du Yancy verlassen musst. Es ist … es ist besser so.«
Er hörte sich freundlich an, aber seine Worte waren mir doch peinlich. Obwohl er leise sprach, konnten die anderen, die gerade mit der Klausur fertig wurden, ihn hören. Nancy Bobofit feixte und machte mit dem Mund spöttische kleine Kussbewegungen.
Ich murmelte: »Schon gut, Sir.«
»Ich meine …« Mr Brunner rollte seinen Stuhl vor und zurück und schien nicht recht zu wissen, was er sagen sollte. »Das ist nicht der richtige Ort für dich. Es war nur eine Frage der Zeit.«
Meine Augen brannten.
Hier erzählte mir mein Lieblingslehrer vor den Ohren der ganzen Klasse, dass ich nicht gut genug sei. Nachdem er das ganze Schuljahr behauptet hatte, an mich zu glauben, gab er jetzt zu, dass ich den Rausschmiss verdient hätte.
»Na gut«, sagte ich zitternd.
»Nein, nein«, sagte Mr Brunner. »Ach, verflixt noch mal. Was ich zu sagen versuche … Du bist nicht normal, Percy. Das ist kein Grund zur …«
»Danke«, platzte es aus mir heraus. »Vielen Dank, Sir, dass Sie mich daran erinnern.«
»Percy …«
Aber ich war schon nicht mehr da.
Am letzten Schultag stopfte ich meine Klamotten in meinen Koffer.
Die anderen Jungs juxten herum und redeten über ihre Ferienpläne. Einer würde in der Schweiz wandern gehen. Ein anderer wollte für einen Monat auf Karibikkreuzfahrt. Sie waren Problemjugendliche wie ich, aber sie waren reiche Problemjugendliche. Ihre Papis waren Geschäftsführer oder Botschafter oder Promis. Ich war ein Niemand und kam aus einer Familie von Niemanden.
Sie fragten mich, was ich im Sommer machen würde, und ich sagte, ich wollte zurück in die Stadt.
Was ich ihnen nicht sagte, war, dass ich mir einen Sommerjob suchen müsste. Ich würde Hunde ausführen oder Zeitschriftenabos verkaufen und mir in meiner Freizeit darüber den Kopf zerbrechen, wo ich eine neue Schule für den Herbst finden würde.
»Ach«, sagte ein Typ. »Klingt klasse.«
Dann redeten sie weiter, als ob es mich niemals gegeben hätte.
Der Einzige, bei dem es mir vor dem Abschied grauste, war Grover, aber dann stellte sich heraus, dass das nicht nötig gewesen wäre. Er wollte mit demselben Bus wie ich nach Manhattan fahren und da saßen wir wieder zusammen, unterwegs in die Stadt.
Die ganze Busfahrt über starrte Grover nervös den Mittelgang und die übrigen Fahrgäste an. Mir ging auf, dass er immer nervös und fahrig war, wenn wir Yancy verließen. Er schien mit irgendeinem Unglück zu rechnen. Bisher hatte ich angenommen, er habe Angst davor, schikaniert zu werden. Aber hier im Bus war niemand, der ihn schikanieren könnte.
Endlich hielt ich es nicht mehr aus.
Ich fragte: »Hältst du Ausschau nach Wohlgesinnten?«
Grover wäre fast an die Decke gegangen. »Wa… wovon redest du?«
Ich gestand, dass ich in der Nacht vor der Klausur ihn und Mr Brunner belauscht hatte.
Grovers Augenlider zuckten. »Wie viel hast du gehört?«
»Ach … nicht viel. Was bedeutet das mit der Sommersonnenwende als Stichtag?«
Er wand sich. »Hör mal, Percy … Ich hab mir einfach Sorgen um dich gemacht, verstehst du? Ich meine, wo du Halluzinationen von dämonischen Mathelehrerinnen hast …«
»Grover …«
»Und ich habe Mr Brunner gesagt, dass du vielleicht übermäßig unter Stress stehst. Es gibt schließlich gar keine Mrs Dodds und …«
»Grover, du bist ein richtig mieser Lügner.«
Seine Ohren wurden rosa.
Dann fischte er eine schmuddelige Visitenkarte aus seiner Hemdtasche. »Behalt die einfach, ja? Falls du mich in diesem Sommer irgendwann brauchst.«
Die Karte war in Schnörkelschrift bedruckt, der pure Mord für meine legasthenischen Augen, aber endlich konnte ich so ungefähr Folgendes lesen:
Grover Underwood – Hüter
Half-Blood Hill
Long Island, New York
(800)009–0009
»Was ist Half…«
»Sag das nicht laut«, keuchte er. »Das ist meine … ähem, Sommeradresse.«
Mein Herz wurde schwer. Grover hatte ein Sommerhaus. Ich hatte nie darüber nachgedacht, dass er so reich wie die anderen in Yancy sein könnte.
»Na gut«, sagte ich düster. »Falls ich, also falls ich dein Landhaus besuchen will.«
Er nickte. »Oder … oder wenn du mich brauchst.«
»Warum sollte ich dich brauchen?«
Das klang gröber, als es gemeint gewesen war.
Grover errötete bis hinunter zu seinem Adamsapfel. »Hör mal, Percy, Tatsache ist, ich … ich muss dich sozusagen beschützen.«
Ich starrte ihn an.
Das ganze Schuljahr hindurch war ich in Schlägereien verwickelt gewesen, um ihn vor Schikanen zu retten. Ich hatte nicht schlafen können vor Angst, dass er nächstes Jahr ohne mich zusammengeschlagen werden könnte. Aber er führte sich auf, als wäre er derjenige, der mich verteidigte.
»Grover«, sagte ich. »Und wovor genau beschützt du mich?«
Unter unseren Füßen hörten wir ein lautes, bohrendes Geräusch. Schwarzer Rauch quoll aus dem Armaturenbrett und im ganzen Bus stank es wie faule Eier. Der Fahrer fluchte und fuhr den schlingernden Bus auf den Seitenstreifen des Highways.
Nachdem er sich einige Minuten lang mit Klappern und Klirren am Motor zu schaffen gemacht hatte, verkündete der Fahrer, dass wir aussteigen müssten. Grover und ich kletterten mit allen anderen Fahrgästen nach draußen.
Wir befanden uns irgendwo auf offener Strecke – es war keine Gegend, die man sich merken würde, wenn man dort nicht eine Panne hatte. Auf unserer Straßenseite gab es nur Ahornbäume und Abfall, der aus vorüberfahrenden Autos geworfen worden war. Auf der anderen Seite, hinter vier in der Nachmittagshitze flirrenden Fahrspuren, stand eine altmodische Obstbude.
Das Obst, das da verkauft wurde, sah richtig gut aus: überquellende Kisten mit blutroten Kirschen und Äpfeln, Walnüssen und Aprikosen und Apfelweinflaschen in einem mit Eis gefüllten Holzbottich. Es gab keine Kundschaft, es gab nur drei alte Damen, die in Schaukelstühlen im Schatten der Ahornbäume saßen und das größte Paar Socken strickten, das ich je gesehen hatte.
Also, es waren Socken, groß wie Pullover, aber es waren einwandfrei Socken. Die Frau rechts strickte die eine Socke. Die Frau links strickte die andere. Die Frau in der Mitte hatte einen riesigen Korb voll elektrisch-blauem Garn auf dem Schoß.
Alle drei sahen uralt aus, sie hatten bleiche, verschrumpelte Gesichter, silberne, mit schwarzen Kopftüchern nach hinten gebundene Haare und knochige Arme, die aus verschossenen Baumwollkleidern ragten.
Das Seltsamste war, dass sie mich alle anzuschauen schienen.
Ich blickte zu Grover hinüber, um eine Bemerkung darüber zu machen, und sah, dass sein Gesicht leichenblass geworden war. Seine Nase zuckte.
»Grover?«, fragte ich. »He, Mann.«
»Sag mir, dass sie dich nicht ansehen. Aber das tun sie. Oder?«
»Ja. Komisch, was? Glaubst du, die Socken würden mir passen?«
»Das ist nicht witzig, Percy. Das ist überhaupt nicht witzig.«
Die alte Dame in der Mitte zog eine riesige Schere hervor – golden und silbern und lang wie eine Schafschere. Ich hörte, wie Grover den Atem anhielt.
»Wir steigen wieder in den Bus«, sagte er zu mir. »Los.«
»Was?«, fragte ich. »Da drinnen sind tausend Grad.«
»Komm schon.« Er öffnete die Tür und stieg ein, ich blieb jedoch stehen.
Die alten Damen starrten mich noch immer von der anderen Straßenseite her an. Die in der Mitte zerschnitt den Faden und ich hätte schwören können, dass ich das über die vier Fahrspuren hinweg gehört hatte. Ihre beiden Freundinnen rollten die elektrisch-blauen Socken auf und ich fragte mich, für wen die wohl bestimmt sein könnten, für Sasquatch oder Godzilla.
Hinten am Bus riss der Fahrer ein riesiges rauchendes Metallteil aus dem Motor. Der Bus bebte und der Motor erwachte brüllend zum Leben.
Die Fahrgäste jubelten.
»Ja, verdammt«, schrie der Fahrer. Er schlug mit seinem Hut gegen den Bus. »Und jetzt alle wieder an Bord!«
Als wir wieder losfuhren, hatte ich das Gefühl, Fieber zu haben, wie bei einer Grippe.
Grover sah nicht viel besser aus. Er zitterte und seine Zähne klapperten.
»Grover?«
»Ja.«
»Was verheimlichst du mir?«
Er fuhr sich mit dem Ärmel über die Stirn. »Percy, was hast du da vorhin an der Obstbude gesehen?«
»Du meinst die alten Damen? Was ist denn mit denen, Mann? Die sind nicht wie … Mrs Dodds, oder?«
Seine Miene war schwer zu deuten, aber ich hatte den Eindruck, dass diese Obstverkäuferinnen etwas viel, viel Schlimmeres waren als Mrs Dodds. Er sagte: »Erzähl mir einfach, was du gesehen hast.«
»Die in der Mitte hat eine Schere hervorgezogen und das Garn durchgeschnitten.«
Er schloss die Augen und bewegte seine Finger, wie um sich zu bekreuzigen, aber es war kein Kreuzzeichen. Es war etwas anderes, etwas noch Älteres.
Er sagte: »Du hast gesehen, wie sie den Faden durchtrennt hat.«
»Ja. Na und?« Aber noch während ich es sagte, wusste ich, dass es sehr wichtig gewesen war.
»Das kann einfach nicht sein«, murmelte Grover. Er fing an, an seinem Daumen zu nagen. »Ich will nicht, dass es wieder so kommt wie beim letzten Mal.«
»Wie beim letzten Mal?«
»Immer in der 6. Klasse. Darüber kommen sie nie hinaus.«
»Grover«, sagte ich, denn jetzt machte er mir wirklich Angst. »Wovon redest du?«
»Lass mich dich vom Busbahnhof nach Hause bringen. Versprich mir das.«
Die Bitte kam mir seltsam vor, aber ich sagte zu.
»Ist das so eine Art Aberglaube?«, fragte ich.
Keine Antwort.
»Grover – das Fadendurchtrennen. Bedeutet das, dass jemand sterben muss?«
Er starrte mich verzweifelt an, als überlegte er sich schon, welche Blumen ich am liebsten auf meinem Sarg hätte.
Grover verliert überraschend seine Hose
Und jetzt die Beichte: Ich ließ Grover sitzen, sowie wir den Busbahnhof erreicht hatten.
Ich weiß, ich weiß. Das war gemein. Aber Grover machte mich einfach fertig. Er starrte mich an wie einen Toten, murmelte: »Warum passiert das immer wieder?«, und: »Warum muss es immer in der 6. Klasse sein?«
Und wann immer er sich aufregte, drehte Grovers Blase durch, deshalb war ich gar nicht überrascht, als er mich, kaum waren wir aus dem Bus gestiegen, bat, auf ihn zu warten, und dann zu den Toiletten wetzte. Aber statt zu warten, holte ich meinen Koffer, lief nach draußen und setzte mich ins erstbeste Taxi.
»Ecke East One Hundred and Fourth und York«, sagte ich dem Fahrer.
Kurz etwas über meine Mutter, ehe ihr sie kennenlernt.
Sie heißt Sally Jackson, und sie ist der beste Mensch auf der Welt, was meine Theorie bestätigt, dass die besten Menschen das größte Pech haben. Ihre Eltern sind bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen, als sie fünf war, und sie wurde von einem Onkel großgezogen, der sich kaum um sie kümmerte. Sie wollte Schriftstellerin werden und deshalb sparte sie die ganze High-School-Zeit hindurch, um dann ein College mit gutem Unterricht für Kreatives Schreiben besuchen zu können. Dann bekam ihr Onkel Krebs und sie musste im letzten Jahr von der Schule abgehen, um ihn zu pflegen. Nach seinem Tod saß sie da, ohne Geld, ohne Familie und ohne Schulabschluss.
Das einzig Gute, was ihr je passiert ist, war, dass sie meinen Vater kennengelernt hat.
Ich kann mich nicht an ihn erinnern, ich weiß nur, dass da so ein warmes Glühen war, vielleicht eine Spur seines Lächelns. Meine Mom spricht nicht gern über ihn, das macht sie traurig. Fotos von ihm hat sie nicht.
Ihr müsst wissen, dass sie nicht verheiratet waren. Sie hat mir erzählt, dass er reich und wichtig war und dass sie ihre Beziehung deshalb geheim halten mussten. Dann ging er eines Tages auf irgendeine dringende Reise über den Atlantik und kam nie zurück.
Auf See geblieben, hat meine Mom mir erzählt. Nicht tot. Auf See geblieben.
Sie hat dann allerlei Jobs angenommen und Abendkurse gemacht, um ihren Schulabschluss zu schaffen, und sie hat mich allein großgezogen. Hat sich nie beklagt, wurde nie wütend. Kein einziges Mal. Aber ich weiß, dass ich kein pflegeleichtes Kind war.
Dann hat sie Gabe Ugliano geheiratet, der in den ersten dreißig Sekunden, die wir ihn kannten, nett war und sich dann als Mistkerl von Weltklasse entpuppte. Als ich kleiner war, hab ich ihn Gabe den Stinker genannt. Tut mir leid, aber so ist es eben. Der Kerl stinkt wie schimmelige Knoblauchpizza, die in eine Turnhose gewickelt ist.
Er und ich gemeinsam haben meiner Mom das Leben ganz schön schwer gemacht. So, wie Gabe der Stinker sie behandelt hat, wie er und ich uns gefetzt haben … Also, meine Heimkehr ist da ein gutes Beispiel.
Ich betrat unsere kleine Wohnung und hoffte, dass meine Mom schon von der Arbeit nach Hause gekommen wäre. Aber im Wohnzimmer saß nur Gabe der Stinker mit seinen Kumpels beim Pokern. Der Fernseher brüllte. Auf dem Teppich lagen überall Pommes und Bierdosen.
Er schaute kaum auf, sondern nuschelte, seine Zigarre im Mund: »Da bist du ja wieder.«
»Wo ist meine Mom?«
»Bei der Arbeit«, sagte er. »Hast du Geld?«
Das war’s. Kein Willkommen zu Hause. Schön, dich zu sehen. Wie waren denn die letzten sechs Monate so für dich?
Gabe hatte zugenommen. Er sah aus wie ein Walross ohne Stoßzahn, in Kleidern von der Heilsarmee. Er hatte ungefähr drei Haare auf dem Kopf, die er sorgfältig auf seinem kahlen Schädel verteilt hatte, als ob ihn das verschönen könnte.
Er leitete den Electronics Mega Mart in Queens, aber meistens saß er zu Hause herum. Ich habe keine Ahnung, warum sie ihn nicht schon längst gefeuert hatten. Er holte einfach weiter sein Gehalt ab und gab das Geld für Zigarren aus, von denen mir schlecht wurde, und natürlich für Bier. Immer Bier. Wenn er zu Hause war, erwartete er von mir Geld für seine Pokerrunden. Das nannte er »unser Geheimnis unter Jungs«. Was bedeutete, dass er mich zu Brei schlagen würde, wenn ich meiner Mom davon erzählte.
»Ich hab kein Geld«, sagte ich.
Er hob eine schmierige Augenbraue.
Gabe konnte Geld riechen, wie ein Bluthund eben Blut riecht, und das fand ich überraschend, schließlich hätte sein eigener Gestank eigentlich alle anderen neutralisieren müssen.
»Du hast am Busbahnhof ein Taxi genommen«, sagte er. »Hast vermutlich mit einem Zwanziger bezahlt. Hast sechs oder sieben Eier zurückgekriegt. Und wer hier unter diesem Dach leben will, muss sich an den Kosten beteiligen. Hab ich Recht, Eddie?«
Eddie, der Hausmeister bei uns im Block, schaute mich mit einem Hauch von Mitgefühl an. »Hör doch auf, Gabe«, sagte er. »Der Kleine ist ja gerade erst angekommen.«
»Hab ich Recht?«, fragte Gabe noch einmal.
Eddie schaute düster in eine Schüssel mit kleinen Brezeln. Die beiden anderen Typen ließen einträchtig einen fahren.
»Schön«, sagte ich. Ich fischte ein paar Dollars aus meiner Tasche und warf das Geld auf den Tisch. »Hoffentlich verlierst du.«
»Dein Zeugnis ist gekommen, Superhirn!«, rief er hinter mir her. »Ich an deiner Stelle wäre nicht so hochnäsig.«
Ich knallte mit der Tür zu meinem Zimmer, das im Grunde gar nicht mein Zimmer war. In den Schulmonaten war es Gabes »Arbeitszimmer«. Er arbeitete dort zwar nicht, er vertiefte sich einfach nur in alte Autozeitschriften, aber er fand es wunderbar, meine Sachen in den Schrank zu stopfen, seine schmutzigen Stiefel auf meine Fensterbank zu stellen und sich ansonsten große Mühe zu geben, dass alles nach seinem widerlichen Rasierwasser und seinen Zigarren und abgestandenem Bier roch.
Ich ließ meinen Koffer auf das Bett fallen. Trautes Heim, Glück allein.
Gabes Gestank war fast schlimmer als meine Albträume von Mrs Dodds oder das Geräusch, mit dem die Obstverkäuferin den Faden durchgeschnitten hatte.
Bei diesem Gedanken kriegte ich gleich wieder weiche Knie. Mir fiel Grovers panische Miene ein – und wie ich ihm hatte versprechen müssen, mich von ihm nach Hause bringen zu lassen. Mir wurde plötzlich eiskalt. Ich hatte das Gefühl, dass irgendwer – irgendwas – nach mir Ausschau hielt und vielleicht gerade die Treppe hochkam und dabei lange, entsetzliche Krallen ausfuhr.
Dann hörte ich die Stimme meiner Mom: »Percy?«
Sie öffnete die Zimmertür und meine Angst schmolz dahin.
Meine Mutter kann dafür sorgen, dass ich mich wohl fühle, einfach indem sie ins Zimmer kommt. Ihre Augen funkeln und ändern im Licht ihre Farbe. Ihr Lächeln ist warm wie eine Decke. Sie hat in ihren langen braunen Haaren ein paar graue Strähnen, aber für mich ist sie niemals alt. Wenn sie mich ansieht, dann scheint sie alle meine guten Seiten zu sehen und keine der schlechten. Ich habe nie gehört, dass sie laut geworden ist oder zu irgendwem ein unfreundliches Wort gesagt hat, nicht einmal zu Gabe.
»Ach, Percy!« Sie drückte mich an sich. »Ich kann es nicht fassen. Du bist seit Weihnachten gewachsen.«
Ihre rot-weiß-blaue Sweet-on-America-Uniform duftete nach allem, was auf der Welt wunderbar ist: Schokolade, Lakritz und was sie in dem Süßigkeitenkiosk in der Grand Central Station sonst noch verkaufte. Sie hatte mir eine riesige Tüte voller »Gratisproben« mitgebracht, das machte sie immer, wenn ich nach Hause kam.
Wir setzten uns nebeneinander auf die Bettkante. Während ich mich über die Blaubeergummischnecken hermachte, fuhr sie mir mit der Hand durch die Haare und wollte alles hören, was nicht in meinen Briefen gestanden hatte. Meinen Rausschmiss erwähnte sie mit keinem Wort. Der schien sie nicht weiter zu interessieren. Aber war alles in Ordnung mit mir? Ging es ihrem Kleinen wirklich gut?
Ich sagte: »Du drückst mich ja tot« und »Hände weg« und so, aber insgeheim freute ich mich ganz schrecklich darüber, sie zu sehen.
Aus dem Nachbarzimmer brüllte Gabe: »He, Sally, wie wär’s mit etwas Bohnendip, hä?«
Ich knirschte mit den Zähnen.
Meine Mom ist die liebste Frau auf der ganzen Welt. Sie müsste mit einem Millionär verheiratet sein, nicht mit einem Mistkerl wie Gabe.
Ihr zuliebe versuchte ich, mich ziemlich fröhlich anzuhören, was meine letzten Tage in der Yancy Academy anging. Ich behauptete, dass der Rausschmiss mir nicht so schrecklich viel ausmachte. Ich hatte doch immerhin fast ein ganzes Jahr durchgehalten. Ich hatte ein paar neue Freunde gefunden. In Latein war ich ziemlich gut geworden. Und ehrlich, die Prügeleien waren nicht so schlimm gewesen, wie der Rektor behauptet hatte. Die Yancy Academy hatte mir gefallen. Wirklich. So, wie ich es erzählte, klang das Jahr richtig gut. Fast hätte ich mir selbst geglaubt. Ich redete immer weiter, über Grover und Mr Brunner. Plötzlich kam mir nicht einmal mehr Nancy Bobofit so schrecklich vor.
Bis ich zu dem Ausflug ins Museum kam.
»Was?«, fragte meine Mom. Ihre Blicke zupften an meinem Gewissen und versuchten, ihm seine Geheimnisse zu entlocken. »Hat dir da irgendwas Angst gemacht?«
»Nein, Mom.«
Ich fand es schrecklich, sie anzulügen. Ich hätte ihr so gern von Mrs Dodds und den drei alten Damen mit dem Faden erzählt, aber ich dachte, das würde sich blödsinnig anhören.
Sie schob die Lippen vor. Sie wusste, dass ich ihr etwas verschwieg, aber sie bedrängte mich nicht.
»Ich hab eine Überraschung für dich«, sagte sie. »Wir fahren an den Strand.«
Ich machte große Augen. »Montauk?«
»Drei Nächte – in derselben Hütte.«
»Wann?«
Sie lächelte. »Ich muss mich nur noch schnell umziehen.«
Ich konnte es nicht fassen. Meine Mom und ich waren zwei Sommer nicht mehr in Montauk gewesen, weil Gabe behauptete, wir hätten nicht genug Geld.
Gabe erschien in der Tür und knurrte: »Bohnendip, Sally, hast du mich nicht gehört?«
Ich hätte ihm gern eine gescheuert, aber ich fing den Blick meiner Mom auf und wusste, dass sie mir ein Geschäft vorschlug: Sei jetzt erst mal nett zu Gabe. Nur bis wir nach Montauk aufbrechen können. Und dann sind wir ja weg von hier.
»Ich war schon unterwegs, Schatz«, sagte sie zu Gabe. »Wir mussten nur kurz über unseren Ausflug reden.«
Gabe kniff die Augen zusammen. »Den Ausflug? Soll das heißen, dass das wirklich dein Ernst war?«
»Ich hab es ja gewusst«, knurrte ich. »Er lässt uns nicht weg.«
»Natürlich tut er das«, sagte meine Mom gelassen. »Dein Stiefvater macht sich nur Sorgen wegen des Geldes. Das ist alles. Außerdem«, fügte sie hinzu, »muss Gabriel sich nicht mit Bohnendip zufriedengeben. Ich werde ihm genug Sieben-Lagen-Dip für das ganze Wochenende machen. Guacamole. Sour Cream. Alles.«
Das besänftigte Gabe ein wenig. »Und das Geld für euren Ausflug … das nimmst du also aus deiner Kleiderkasse, ja?«
»Sicher, Schatz«, sagte meine Mutter.
»Und du fährst mit meinem Wagen nur direkt hin und zurück, sonst aber nirgendwohin.«
»Wir werden sehr vorsichtig sein.«
Gabe kratzte sein Doppelkinn. »Vielleicht, wenn du dich mit diesem Superdip beeilst … und wenn der Kleine sich dafür entschuldigt, dass er meine Pokerpartie unterbrochen hat.«
Vielleicht, wenn ich dich in deine Weichteile trete, dachte ich. Und wenn du dann eine Woche lang Sopran singen kannst.
Aber der Blick meiner Mutter bat mich, ihn nicht zu reizen.
Warum ließ sie sich von diesem Typen so viel gefallen? Ich hätte schreien können. Was interessierte es sie denn, was er dachte?
»Tut mir leid«, murmelte ich. »Tut mir wirklich leid, dass ich deine unvorstellbar wichtige Pokerrunde unterbrochen habe. Bitte, geh jetzt sofort weiterspielen.«
Gabe kniff die Augen zusammen. Vermutlich versuchte sein Minigehirn, in meinen Worten irgendeinen Sarkasmus zu entdecken.
»Na, von mir aus«, entschied er.
Er ging zurück zu den anderen.
»Danke, Percy«, sagte meine Mom. »In Montauk reden wir dann über … über das, was du mir zu erzählen vergessen hast, okay?«
Einen Moment lang glaubte ich, in ihren Augen Besorgnis zu sehen – dieselbe Furcht, die ich auf der Busfahrt bei Grover entdeckt hatte –, und auch meine Mom schien diese seltsame Kälte in der Luft wahrzunehmen.
Aber dann war ihr Lächeln wieder da und ich nahm an, dass ich mich geirrt hatte. Sie strich mir noch einmal durch die Haare und ging dann in die Küche, um Gabe seinen Superdip zu machen.
Eine Stunde darauf waren wir aufbruchbereit.
Gabe unterbrach seine Pokerpartie gerade lang genug, um zuzusehen, wie ich Moms Taschen in den Wagen wuchtete. Er jammerte und klagte die ganze Zeit darüber, dass ihm jetzt das ganze Wochenende lang ihre Kochkünste – und, schlimmer noch, sein 78er Camaro – fehlen würden.
»Nicht einen Kratzer auf meinem Wagen, Superhirn«, warnte er mich, als ich die letzte Tasche hineinhob. »Nicht den geringsten kleinen Kratzer.«
Als ob ich selber fahren würde. Ich war zwölf. Aber Gabe war das egal. Auch wenn eine Möwe auch nur den kleinsten Klecks auf den Autolack fallen ließe, dann würde er mich dafür verantwortlich machen.
Während ich zusah, wie er zum Wohnblock zurückschlurfte, wurde ich so wütend, dass ich etwas tat, was ich nicht erklären kann. Als Gabe die Tür erreichte, machte ich die Handbewegung, die Grover im Bus gemacht hatte, eine Art Geste, die das Böse abwehren soll: Ich hielt eine Hand gekrümmt über mein Herz und schob sie dann in Gabes Richtung. Die Tür knallte dermaßen hart zu, dass sie ihn am Hintern traf und wie aus einer Kanone geschossen die Treppe hochfliegen ließ. Vielleicht lag es nur am Wind, vielleicht war mit den Türangeln etwas nicht in Ordnung – ich blieb nicht mehr lange genug, um das herausfinden zu können.
Ich stieg in den Camaro und bat meine Mom, Gas zu geben.
Die Hütte, die wir schon häufiger gemietet hatten, lag am Südufer, ziemlich weit oben an der Spitze von Long Island. Sie sah aus wie eine halb in den Dünen versunkene kleine pastellfarbene Schachtel mit verschossenen Vorhängen. Immer gab es Sand im Bettzeug und Spinnen in den Schränken und meistens war das Meer zu kalt zum Schwimmen.
Ich fand es wunderbar dort.
Wir waren schon hergekommen, als ich noch ein Baby gewesen war. Meine Mom sogar noch länger. Sie hatte es nie wirklich gesagt, aber ich wusste, warum dieser Strand ihr so wichtig war. Hier hatte sie meinen Dad kennengelernt.
Als wir uns Montauk näherten, schien sie immer jünger zu werden, Jahre der Sorge und der Arbeit verschwanden aus ihrem Gesicht. Ihre Augen nahmen die Farbe des Meeres an.
Wir trafen bei Sonnenuntergang ein, rissen alle Fenster auf und machten wie immer erst mal alles sauber. Dann liefen wir über den Strand, fütterten die Möwen mit blauen Maischips und aßen blaue Gummibärchen, blaues Salzwassertoffee und die vielen anderen Gratisproben, die meine Mom aus dem Laden mitgebracht hatte.
Ich sollte das mit den blauen Süßigkeiten wohl erklären.
Gabe hatte meiner Mom einmal gesagt, blaue Süßigkeiten gebe es nicht. Darüber stritten sie sich, was mir damals reichlich unwichtig vorkam. Aber seither hat meine Mom sich immer wieder alle Mühe gegeben, blau zu essen. Sie backte blaue Geburtstagskuchen. Sie mixte Blaubeersmoothies. Sie kaufte Tortillachips aus Blaumais und brachte blaue Bonbons aus dem Laden mit. Und das – sowie die Tatsache, dass sie ihren eigenen Namen behielt, Jackson, statt sich Mrs Ugliano zu nennen – bewies doch, dass Gabe sie nicht total eingewickelt hatte. Sie hatte eine rebellische Seite, so wie ich.
Als es dunkel wurde, machten wir ein Feuer. Wir brieten Hot Dogs und Marshmallows. Mom erzählte mir von früher, als sie noch klein gewesen war, bevor ihre Eltern bei dem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen waren. Sie erzählte von den Büchern, die sie irgendwann schreiben wollte, wenn sie genug Geld gespart hätte, um im Süßigkeitenkiosk aufzuhören.
Endlich fasste ich mir ein Herz und brachte sie auf das Thema, an das ich immer denken musste, wenn wir nach Montauk kamen: meinen Vater. Mom traten Tränen in die Augen. Ich nahm an, sie werde dasselbe sagen wie immer, aber ich bekam es nie über, es zu hören.
»Er war lieb, Percy«, sagte sie. »Groß, gut aussehend und mächtig. Aber auch sanft. Du hast seine dunklen Haare, weißt du, und seine grünen Augen.«
Mom fischte ein blaues Gummibärchen aus der Tüte. »Ich wünschte, er könnte dich sehen, Percy. Er wäre so stolz.«
Ich hätte gern gewusst, wieso sie das meinte. Was war denn so toll an mir? Ein legasthenischer, hyperaktiver Junge mit einem miesen Zeugnis, der soeben von der sechsten Schule in sechs Jahren geworfen worden war.
»Wie alt war ich?«, fragte ich. »Ich meine … als er gegangen ist.«
Sie schaute in die Flammen. »Er war nur einen Sommer bei mir, Percy. Hier an diesem Strand. In dieser Hütte.«
»Aber … er hat mich doch als Baby gekannt.«
»Nein, mein Schatz. Er wusste, dass ich ein Baby erwartete, aber er hat dich nie gesehen. Er musste uns noch vor deiner Geburt verlassen.«
Ich versuchte, diese Auskunft mit der Tatsache in Übereinstimmung zu bringen, dass ich doch glaubte mich zu erinnern … an irgendetwas, das mit meinem Vater zu tun hatte. Ein warmes Glühen. Ein Lächeln.
Ich war immer davon ausgegangen, dass er mich als Baby gekannt hatte. Meine Mom hatte das nie so gesagt, aber trotzdem hatte ich das Gefühl gehabt, dass es so sein musste. Und jetzt zu hören, dass er mich nie auch nur gesehen hatte …
Ich war wütend auf meinen Vater. Vielleicht war das blöd von mir, aber ich war sauer auf ihn, weil er auf diese Seereise gegangen war, weil er meine Mom nicht vorher geheiratet hatte. Er hatte uns verlassen und jetzt saßen wir da mit Gabe Ugliano.
»Wirst du mich wieder wegschicken?«, fragte ich sie. »Auf ein anderes Internat?«
Sie zog ein Marshmallow vom Feuer.
»Ich weiß es nicht, mein Schatz.« Ihre Stimme klang belegt. »Ich glaube … ich glaube, wir werden etwas unternehmen müssen.«
»Weil du mich nicht im Haus haben willst?« Ich bereute diese Frage, sowie ich sie ausgesprochen hatte.