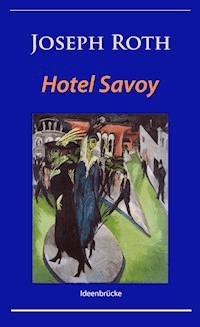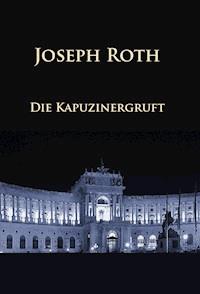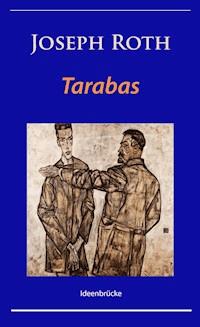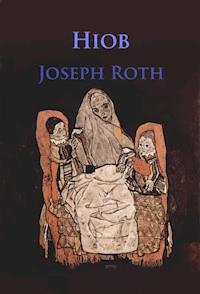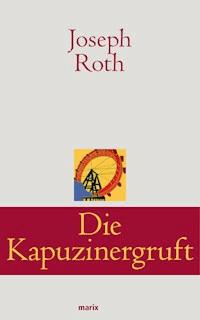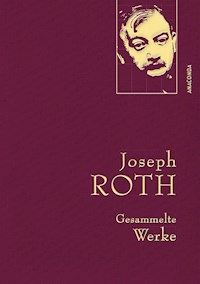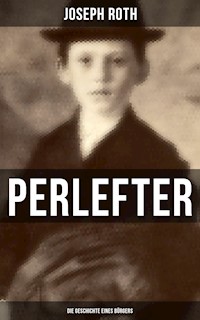
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Joseph Roth's Roman 'Perlefter: Die Geschichte eines Bürgers' ist ein Meisterwerk der modernen Literatur, das den Leser in eine faszinierende Welt des Bürgertums entführt. Der Roman erzählt die Geschichte von Perlefter, einem Mann, der in einer Zeit politischer Unruhe und gesellschaftlicher Umbrüche lebt. Roth's literarischer Stil ist geprägt von einem tiefen Verständnis für die menschliche Natur und einer scharfen Beobachtungsgabe für die feinen Nuancen des Alltags. Mit subtiler Ironie und feinsinniger Sprache entwirft er ein eindrucksvolles Porträt eines Mannes, der sich in einer Welt voller Widersprüche zu behaupten versucht. 'Perlefter: Die Geschichte eines Bürgers' ist ein zeitloses Meisterwerk, das die Leser mit seiner psychologischen Tiefe und literarischen Raffinesse fesseln wird.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 138
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Perlefter: Die Geschichte eines Bürgers
Inhaltsverzeichnis
I
Ich heiße Naphtali Kroj.
Die Stadt, in der ich geboren wurde, war nach westeuropäischen Begriffen keine Stadt. Fünfzehnhundert Menschen bewohnten sie. Darunter waren tausend jüdische Händler. Eine lange Straße verband den Bahnhof mit dem Friedhof. Der Zug hielt einmal im Tage. Die Reisenden waren Hopfenhändler. Denn unsere Stadt lag in einer Hopfengegend. Es gab bei uns ein großes Hotel und ein kleines. Das große hatte Wolf Bardach erbaut.
Seine Mutter war die Besitzerin des Schwitzbades gewesen. Sie starb, vierundfünfzig Jahre alt, an einer rätselhaften Hautkrankheit, ein Opfer ihres Berufes. Ihr Sohn, der im Westen Jus studiert hatte und Notar werden wollte, verkaufte das Schwitzbad, um das Hotel Esplanade zu erbauen. Das Hotel sollte ganz westeuropäisch, ja amerikanisch aussehen. Zu diesem Zweck mußte es mindestens sechs Stockwerke haben und vierhundert Zimmer.
Vergeblich waren die vernünftigen Äußerungen vieler Juden, daß in unsere Stadt niemals vierhundert Fremde kommen würden. Herr Bardach entwarf selbst die Pläne. Er ließ aus den großen Städten der Gegend viele Männer kommen. Das kleine Häuschen eines Branntweinhändlers riß er nieder. Er selbst leitete die Arbeiten. Er war groß, dick und kurzsichtig wie viele studierte Menschen. Einen goldenen Kneifer, das Abzeichen der Bildung, trug er an einem schwarzen breiten Moireebändchen. Er stand barhäuptig, in den grauen Kittel die dicke Gestalt gepreßt, mit einem Stock in der Hand, wenn die Sonne schien, mit einem Regenschirm, wenn es regnete. Er ließ ein so zuverlässiges Gerüst bauen, daß er es mit seinem großen Gewicht besteigen konnte, ohne zu beschädigen.
Als das dritte Stockwerk fertig war, bemerkte er, daß er kein Geld mehr hatte.
Er verkaufte das Grundstück und seine Pläne dem reichen Herrn Ritz, dem es auf ein paar Tausender nicht ankam, und reiste, tief beschämt und heimlich, nach Wien, um Notar zu werden.
Der Herr Ritz ließ einen Ingenieur kommen, der viel Geld verdienen wollte und sich mit sechs Stockwerken nicht begnügte. Er baute sieben. Als die sieben Stockwerke fertig waren, feierten die Maurer der ganzen Gegend ein Fest. Der Ingenieur trank Schnaps, trat an den Rand des Gerüsts und fiel hinunter. Er kam so zerfetzt an, daß man nicht mehr feststellen konnte, ob er Christ oder Jude gewesen war. Man begrub ihn auf dem schmalen Pfad, der den christlichen vom jüdischen Friedhof trennte. Später schenkte ihm der reiche Herr Ritz ein schönes marmornes Grabmal, um ihn zu entschädigen.
Das Hotel erhielt den Namen Hotel Esplanade, einen Namen aus goldenen Lettern. Herr Zitron aus Amerika, von dem man sich erzählte, daß er drüben ein Mädchenhändler gewesen, bekam die Verwaltung des Hotels. Es hatte jetzt vierhundertfünfzig Zimmer. Aber weil alle Welt wußte, daß der Erbauer abgestürzt war, kamen nur wenige Reisende.
Um auf mich selbst zurückzukommen: Ich bin der Sohn eines Droschkenkutschers. Es gab vierundzwanzig Droschken bei uns, für jede Stunde eine. Mein Vater hatte die Droschke Nummer 17. Heute noch liebe ich diese Zahl.
Mein Vater fuhr jeden Tag zum Bahnhof, um die Reisenden abzuholen. Er war ein starker, bärtiger Mann, der nichts gelernt hatte. Man sah von seinem Angesicht nur die rote knollige Nase und den rötlichen Vollbart. Seine kurze Stirn, seine blauen, feuchten Augen beschattete das lederne Dach seiner Sportmütze. Er trank leider viel infolge seines Berufes. Manchmal mußte er die Reisenden tagelang in unserer Gegend herumführen, in der es keine Bahnen gab. In jedem Gasthof machte man halt. Mein Vater trank Schnaps, um sich zu erwärmen. Weil er billig, zuverlässig, kühn und stark war, hatte er die meisten Kunden. Er fürchtete sich weder vor Wölfen noch vor Räubern. Und je mehr Reisende er bekam, desto mehr trank er. Einmal, als er ohne Gäste des Nachts von einem entlegenen Gasthof heimkehrte, fiel er mit Schlitten und Pferd in den Schnee und schlief sofort ein.
Am nächsten Morgen war er erfroren.
Meine Mutter war schon lange tot. Ich hätte gerne Schlitten und Pferd übernommen, obwohl ich etwas gelernt hatte: nämlich lesen und schreiben bei Lehrer Tobias. Der war ein kleines altes Männchen. Als er jung war, hatte er einen hüpfenden Gang gehabt. Er ging noch als ein Alter auf den Zehenspitzen, aber er scharrte dabei mit den Sohlen. Weil es in den Häusern der Stadt an Schreib material mangelte, trug er Tinte und Gänsekielfeder bei sich, von einem Schüler zum andern. Zu Hause schrieben wir die Aufgaben mit Kohle an den Ofen. Der Lehrer Tobias war der einzige Mensch mit einem Zylinder in unserer Stadt. Weil er Löcher in den Taschen hatte, mußte er einen Zylinder tragen. Auf dem Kopf barg er bequem Tintenfaß und Feder. Das hatte den Nachteil, daß er niemanden grüßen konnte. Er legte immer den Zeigefinger an den Rand des Zylinders.
Ich wäre, wie gesagt, gerne ein Kutscher geworden. Aber die dreiundzwanzig Kollegen meines Vaters waren froh, daß sie nun unter sich waren. Der reichste von ihnen, der Kutscher Manes, kaufte unser Pferd, unsern Schlitten, unsere Droschke. Von nun an fuhr er mit zwei Pferden. Er schaffte sich eine neue Peitsche an mit lackiertem Stiel und einem Griff aus geflochtenem Stroh. Alle andern hatten Peitschen aus gewöhnlichem Weichselholz. An dem Peitschenriemen des Kutschers Manes befanden sich nicht weniger als sechs Knoten. Die Peitsche knallte wie ein Gewehr.
Die Hälfte des Geldes für Wagen und Pferd bekam ich, die andere Hälfte der Schankwirt Grzyb, ein Gläubiger meines Vaters. Die Kutscher hielten eine Versammlung ab und beschlossen, daß ich kein Kutscher werden sollte, weil ich etwas gelernt hatte. Sie sagten, es wäre am besten, wenn ich zu meinem reichen Verwandten Perlefter käme, der in Österreich einen großen Holzhandel betrieb. Vom Herrn Perlefter ging das Gerücht um, daß er Millionär sei. Man sprach seinen Namen nur mit Ehrfurcht aus. Die Kutscher tranken eines Tages sechsundvierzig Schnäpse und bekamen Mut. Sie ließen den Schreiber Tobias kommen und ihn einen langen Brief an meinen Verwandten Perlefter aufsetzen. Der reiche Herr Ritz wußte und verriet die Adresse. Man schickte den Brief ab und wartete auf Antwort. Ich aß jeden Tag bei einem andern Kutscher.
Der Winter verging; und als die Eiszapfen an den Dächern zu schmelzen begannen und der junge Regen dazukam, um dem Schnee den Garaus zu machen, wurde ich ganz trunken vor Lust, in die Welt zu wandern. Ich wußte bestimmt, daß von Perlefter ein Brief kommen würde.
An einem der ersten Märztage kam ein kurzer Brief von Herrn Perlefter. Er wollte mich gerne aufnehmen.
Einen Monat lang packte ich. Inzwischen verhandelte man mit Tewje, dem Tabakschmuggler, der mich über die Grenze bringen sollte. Ostern war schon vorüber, als die Verhandlungen abgeschlossen wurden. Fast zu gleicher Zeit war mein Koffer fertig. In einer regnerischen Nacht überschritt ich mit Tewje und fünf Deserteuren die Grenze. Der Zollwächter wartete, bis wir verschwunden waren, dann schoß er aus Pflichtgefühl dreimal in die Luft.
Am achtundzwanzigsten April des Jahres 1904 kam ich nach Wien. Es war sechs Uhr früh. Die Straßen der großen Stadt erwachten gerade. Die großen zuerst und dann die kleinen. Es war wie der Morgen bei einer Familie: Zuerst stehen die Erwachsenen auf und dann die Kinder.
Ungeheure Wagen kamen vom Lande mit Grünzeug und Bauern. Auf andern Wagen klirrten Milchkannen. Die Häuser schienen mir unermeßlich hoch. Hinter ihnen kroch die Sonne empor. Es war noch kühl. Frauen mit Besen kehrten vor den Türen. Die ersten Straßenbahnen kreischten unwillig auf den Schienen. Die Motorführer klingelten, obwohl die Geleise frei waren. Sie klingelten aus morgendlichem Übermut. Ehrwürdig wie stolze Fürsten sahen die Polizisten aus. Sie trugen blendend weiße Handschuhe. Manche Straßen waren königlich, weit und still und sauber und von Bäumen bewacht. Vieles lag in der Luft; eine ländliche Stille und die schlafende Riesenstimme einer Welt. Der Duft schlug aus den Gärten in die Straßen. Zum ersten Mal in meinem jungen Leben sah ich den Goldregen. Ich hatte noch niemals Märchen gelesen. Dennoch wußte ich sofort, daß diese Sträucher Märchenbäume sind. Bei uns zu Hause gab es keinen Goldregen. Als ich die Stadt verließ, war der Frühling noch nicht da. Bei uns fing der Schnee eben an zu schmelzen. Hier hörte man schon den Sommer reiten ...
II
Ich glaube, daß es jetzt nötig ist, Ihnen den Vornamen Perlefters zu nennen: Er hieß Alexander. Es ist gewiß ein bedeutungsloser Zufall, daß er gerade so hieß, und ich will dem verführerischen Drange, eine gewaltsame Beziehung zwischen Wesen und Vornamen meines Helden herzustellen, nicht gerne nachgeben. Dennoch kann ich nicht umhin, zu erzählen, daß ich meine Achtung vor Alexander Perlefter zum ersten Mal verlor, als ich von dem großen mazedonischen König Alexander hörte, der den Gordischen Knoten mit dem Schwerte zerhieb, und als ich mir vorstellte, daß der Herr Perlefter etwas Ähnliches niemals getan hätte. Im Gegenteil: Alexander Perlefter liebte, wie ich schon einmal erzählt habe, nicht die entschiedenen Handlungen und die unwiderruflichen Entschlüsse. Er ging nicht gerne in jene Gegenden, aus denen keine geraden und bequemen Wege zurückführen. Er liebte es, auf den Brücken zu verweilen, die das Hier mit dem Dort verbinden und demjenigen, der sie betritt, es gestatten, sich weder für das Hier noch für das Dort zu entscheiden. Alexander Perlefter ging immer über Brücken. Alles, was er erreichte, hatte er seiner vorsichtigen Natur zu verdanken. Er war das Resultat seiner eigenen Erfahrungen. Er blieb vorsichtig.
Er hätte Florian, Ignatz oder Emanuel heißen müssen, und meine Achtung wäre von längerer Dauer gewesen. Er war der erste Alexander, den ich in meinem jungen Leben kennengelernt hatte. Dieser Name gefiel mir wie alles, was der Herr Perlefter besaß. Aber als ich mich für den großen mazedonischen König Alexander begeisterte, mußte der Vergleich zuungunsten des Herrn Perlefter ausfallen. Ja, schon wenn ich ihn ansah, mußte ich lachen. Auf den ersten Blick war er unauffällig wie nur je ein gleichgültiger Mensch. Aber wenn ich ihn genauer betrachtete, die einzelnen Partien seines Gesichts voneinander sonderte, sein rechtes Profil und sein linkes prüfte, erkannte ich, daß manche Geheimnisse in ihm verborgen lagen, die zu heben der Mühe lohnen würde; erkannte ich vor allem, wie der Name Alexander gar nicht zu ihm paßte und daß es solch einen Namen, wie er zu ihm gepaßt hätte, überhaupt nicht gibt. Es müßte ein Wort sein, zäh und weich, verklingend über die eigenen Grenzen in fremde Klänge, unkenntlich und doch besonders und von einer ungewöhnlichen Gewöhnlichkeit. Solchen Namen gibt es leider nicht. Solche Worte gibt es nicht.
Die körperliche Größe Perlefters war unbestimmt. Er konnte ganz klein gewachsen scheinen und wiederum sehr groß. Wenn er unglücklich war, aber auch, wenn er vorgab, es zu sein, sank er in sich zusammen wie ein Körper aus schlaffem Gummi. Er konnte manchmal auf einem kleinen Kinderstuhl Platz finden und ein anderes Mal einen großen ledernen Klubsessel ausfüllen. Ja, ich befinde mich in keiner geringen Verlegenheit, wenn ich sagen soll, ob der Herr Perlefter groß, klein oder mittelgroß war.
Er konnte auch, je nach Bedarf, stark und schwach erscheinen, hinfällig, aber auch machtvoll, er konnte, wahrscheinlich ohne es zu wissen, seinen Bauch irgendwo verlieren, und weil er von Natur eine schmale Brust und zarte Schultern hatte, aber im Laufe der Zeit Fett und Fleisch gewann, blieb es ungewiß, ob er eigentlich breitschultrig oder schmalgebaut war.
Er hatte einen runden und kahlen Kopf und über dem Nacken eine kleine glänzende Beule, so daß es aussah, als hätte das Gehirn in seiner natürlichen Schale keinen Platz gefunden und sich eine Art Nebengelaß selbst geschaffen. Man wußte nicht, wo die Stirn aufhörte und wo einmal die Haare begonnen hatten. Der kahle Schädel verlieh der ganzen Persönlichkeit Perlefters etwas Nacktes, Glänzendes, überflüssig Enthülltes, als hätte er sich entblößt und als müßte man sich schämen. Die Ohren standen sehr weit ab, waren klein, frauenhaft und wären auch noch zierlich zu nennen gewesen, wenn man sie näher an den Schädel gepreßt hätte. Sie standen wie Lauscher, Horcher in die Welt auf weit vorgeschobenem Posten.
Die Farbe der Augen habe ich niemals feststellen können. Sie wechselte nicht etwa, nein, sie blieb immer die gleiche, aber sie war keine Farbe, sondern wie von den Überresten verschiedener und auf einer alten Palette durcheinandergeflossener Farben zusammengemischt. Braun, Grau, Grün und Bernsteingelb an den Rändern. Bei Tag, bei Nacht und im Zwielicht, immer waren diese Augen so, von unbestimmter Farbe, rund, klein, aufgerissen und wie unbekleidet. Es waren eigentlich die Augen eines schwer begreifenden, immer verwunderten und gutmütigen Menschen. Sie standen sehr weit auseinander, so, daß die Nasenwurzel Platz hatte, sich auszubreiten; und dennoch schickte sie eine schmale, wohlgeformte, am Ende etwas abgeplattete Mädchennase in die Welt, die weiß, wie Elfenbein, zwischen den runden und rosagetönten Wangen leuchtete. Auch der Mund war klein und rund und die Lippen rot. Um so merkwürdiger war das breite, in der Mitte gebuchte te Kinn, in dem eigentlich die ganze Majestät Perlefters ruhte und aus dem sie strahlte.
Ja, Majestät, denn Perlefter besaß trotz allem eine Art Majestät, wie die meisten Menschen, denen es gutgeht. Es war nicht die Majestät der Größe, aber einfach die des Wohlergehens. Er sah ganz unschuldig aus, wenn er sich freute, wie ein pausbäckiges Kind. Und dennoch schlummerte schon die Bitterkeit in seiner Freude. Und ebenso, wie er die entschiedenen Taten nicht liebte, hatte er keine entschiedenen Empfindungen. Wenn er sich freute, machte er sich zugleich Sorgen. Wenn er tief bekümmert war, hoffte er schon. Er konnte nicht lieben und nicht hassen. Er mochte jemanden, oder er mochte ihn nicht. Dennoch war es ihm gegeben, um seine Kinder zu zittern, ohne daß er sie geliebt hätte. Denn er fürchtete den Verlust. Was er besaß, wollte er behalten. Er wollte sogar seine Frau behalten, obwohl sie ihn langweilte und er für sie nur das übrig hatte, was man für eine Haushälterin übrig hat. Menschen seiner Art lieben gewöhnlich Tiere. Perlefter aber hatte Angst vor Tieren, vor großen und kleinen, sogar den Vögeln wäre er aus dem Wege gegangen, wenn sie nicht vor ihm davongeflattert wären. Die frommen Droschkenpferde, denen er auf der Straße begegnete, betrachtete er mit scheuen Blicken, denn er traute den Wesen nicht, die er nicht verstand. Und er schätzte die Polizei, nicht nur, weil sie Diebe, Räuber und Mörder verfolgte, sondern auch, weil sie Hundesperren zu verfügen liebte. In dem Hause, das Perlefter gehörte, gab es Katzen, und er hätte sie schießen mögen, wenn er ein Schießwerkzeug besessen und nicht Angst gehabt hätte, damit umzugehn. Nein, Perlefter liebte die Tiere nicht, und die Menschen waren ihm gleichgültig. Dennoch galt er als der sorglichste Familienvater, der liebebedürftigste Mensch, der gefühlvollste Bürger, denn die Tränen kamen ihm leicht, er konnte weinen wie ein Schauspieler, wenn es die Situation von ihm verlangte. Er konnte sich freuen an dem Glück der andern, er konnte Liebe, Haß, Freundschaft, Feindschaft spielen, die Aufregung, die Leidenschaft, Krankheiten, sogar den Rausch, wenn er nur ein bißchen getrunken hatte. Er trank nicht viel, er trank sehr selten, und er hatte keine Freude am Alkohol. Dennoch setzte er seinen Gästen gute Weine vor und gab an, sie zu kennen. Er schnalzte mit der Zunge, wenn er diese oder jene Sorte lobte, und wenn man ihm glauben durfte, so hatte er schon viel in seinem Leben getrunken. Vielleicht hätte ihm sogar der Alkohol Freude gemacht, wenn er nicht fortwährend gefürchtet hätte, im Rausch Haltung und Geständnisse zu verlieren, wahrscheinlich auch Geld. Deshalb führte er in letzter Zeit als Entschuldigung Krankheiten an, aber er war nicht krank. Und auch nicht gesund. Er konnte krank sein, wenn er wollte oder wenn er sich vor der Krankheit fürchtete.
Denn noch teurer als das Leben seiner Kinder war ihm sein eigenes Leben. In stillen, nächtlichen Stunden hörte er den Tod galoppieren. Mit fürchterlichen Schreckbildern bedrohte ihn die Phantasie. Wenn der Herr Perlefter rheumatische Schmerzen im Bein hatte, erlebte er schon eine Amputation, sah er eine Krücke, einen Rollstuhl, einen Operationstisch und scharfe Messer. Und er hatte oft rheumatische Schmerzen im Bein und andere an anderen Stellen. »Schonen Sie sich!« rieten ihm seine Freunde. "Schon dich!« rief seine Frau, und der Schrecken lag in ihrer Stimme, wie die Stimmen der Freunde vor freundlichem und frohem Mitleid bebten. Perlefter schonte sich, aber seine Angst war größer als seine Pflege. Mitten in der Schonzeit überfiel ihn Furcht und gebar ihm Schmerzen. Deshalb klagte seine Familie: »Er schont sich nicht! ... «