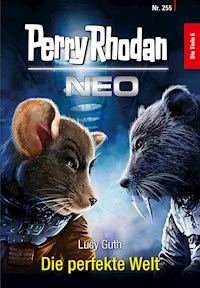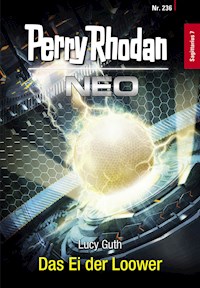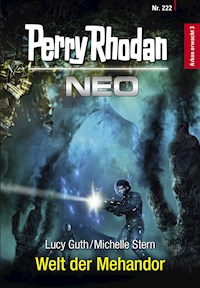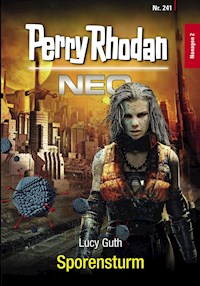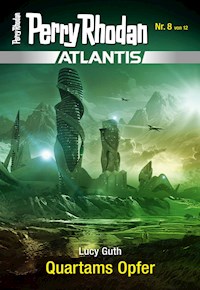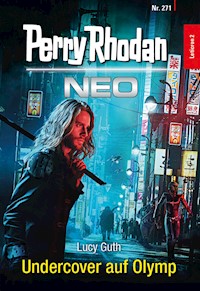Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- E-Book-Herausgeber: Perry Rhodan digitalHörbuch-Herausgeber: Eins A Medien
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Perry Rhodan Neo
- Sprache: Deutsch
Vor sieben Jahrzehnten ist Perry Rhodan auf Außerirdische getroffen. Seither ist die Menschheit zu den Sternen aufgebrochen und hat fremde Welten besiedelt, wird aber oft in kosmische Konflikte verwickelt. Seit sechs Jahren umkreisen Erde und Mond eine fremde Sonne. Die Gewaltherrschaft der Überschweren auf den terranischen Welten ist jedoch beendet. Auch im Sternenreich der Arkoniden, wohin sich die Besatzer zurückgezogen haben, verlieren sie ihre Machtbasis. Doch die Terraner werden erneut von einer perfiden Hinterlassenschaft der Überschweren heimgesucht. Viele Menschen verändern sich auf unheimliche Weise, auf dem Mars bricht Chaos aus. Reginald Bull, Perry Rhodans ältester Freund, kämpft auf dem Roten Planeten gegen einen heimtückischen Feind – es schlägt DIE STUNDE DES PROTEKTORS ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 224
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Band 297
Die Stunde des Protektors
Lucy Guth
Cover
Vorspann
Prolog
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Epilog
Impressum
Vor sieben Jahrzehnten ist Perry Rhodan auf Außerirdische getroffen. Seither ist die Menschheit zu den Sternen aufgebrochen und hat fremde Welten besiedelt, wird aber oft in kosmische Konflikte verwickelt.
Seit sechs Jahren umkreisen Erde und Mond eine fremde Sonne. Die Gewaltherrschaft der Überschweren auf den terranischen Welten ist jedoch beendet. Auch im Sternenreich der Arkoniden, wohin sich die Besatzer zurückgezogen haben, verlieren sie ihre Machtbasis.
Doch die Terraner werden erneut von einer perfiden Hinterlassenschaft der Überschweren heimgesucht. Viele Menschen verändern sich auf unheimliche Weise, auf dem Mars bricht Chaos aus.
Reginald Bull, Perry Rhodans ältester Freund, kämpft auf dem Roten Planeten gegen einen heimtückischen Feind – es schlägt DIE STUNDE DES PROTEKTORS ...
»Hast du heute schon das Schicksal herausgefordert?
Dies fragt Weidenburn.«
Prolog
Da stand er vor ihr, mit seinen seltsamen, dunkelblonden Haaren, die graublauen Augen spöttisch auf sie gerichtet, ein leichtes Lächeln im Gesicht.
Perry Rhodan – bei den Sternengöttern, ich hasse diesen Kerl! Ihin da Achran presste die Lippen aufeinander, zwang sich dann, durchzuatmen.
»Ich habe Arkon hinter mir gelassen«, hielt sie ihrem Gegenüber vor.
»Das hast du nicht freiwillig getan.« Seine Stimme war genauso gelassen, wie sie sie in Erinnerung hatte. Für die Arkonidin zeugte das von Überheblichkeit, und seine Worte bestätigten das. »Deine Welt ist zerstört. Das Große Imperium gibt es nicht mehr.«
»Das musst du mir nicht sagen«, zischte sie. »Zwanzigtausend Jahre Kultur – zerstört von Verrätern und Emporkömmlingen. Der Kristallthron und seine Erhabenheit wurden von Essoya geschändet.«
»Das Volk hat seinen Willen durchgesetzt«, widersprach Rhodan.
»Das Volk? Das Volk ist eine Erfindung der Terraner. Auf Arkon gibt es nichts so Profanes wie ›das Volk‹.«
»Jetzt schon.«
Sie ballte die Hände. »Und wer ist schuld daran? Der Verräter Mascaren da Gonozal!«
»Der letzte Imperator.«
»Er war eines Imperators unwürdig. Er hat seine Familie verraten, ebenso wie die Khasurne und alle, die an ihn geglaubt und ihm vertraut haben.« Die Arkonidin schrie fast.
Rhodan legte den Kopf fragend schief. »Ist es wirklich nur Atlan, auf den du wütend bist?«
Da Achran erstarrte. Das war ein wunder Punkt. Denn eigentlich, das musste sie zugeben, war sie auch zornig auf sich selbst. Erst vor Kurzem hatte sie Rhodan und Atlan sogar geholfen bei deren erstem Versuch, die Amöbophagen auszuschalten, mit denen die Gon-Mekara sich die Unterstützung des arkonidischen Adels verschafft hatten. Am Ende hatten die beiden im zweiten Anlauf sogar Erfolg gehabt. Die Sache war jedoch gänzlich anders ausgegangen, als da Achran geplant hatte. Sie empfand das als schmählichen Verrat.
Dabei ist Verrat ein unersetzlicher Baustein im Spiel der Kelche – ich sollte mich damit auskennen.
Sie verkrampfte die Fäuste so sehr, dass ihre sorgsam manikürten Fingernägel sich schmerzhaft ins Fleisch ihrer Handballen drückten. »Lenk nicht ab! Atlan ist der Feind, und er wird dafür büßen. Ebenso wie du, deine geliebten Menschen und die Kolonie im Larsafsystem, die dem geschätzten Zhdopanthi so am Herzen liegt. Oder das, was derzeit noch davon übrig ist.«
Sie wartete darauf, dass das arrogante Lächeln von Rhodans Gesicht verschwand, doch das Hologramm fror einfach ein. Vielleicht war die zuständige Nebenpositronik mit dieser Simulation überlastet, obwohl da Achran das bei der überlegenen Technologie ihres Schaltschiffs DIADEM nicht glaubte.
Einen Wimpernschlag später ertönte die sanfte, weibliche Stimme der Schiffsintelligenz: »Wir erreichen das Solsystem.«
»Sehr gut. Kurs auf den vierten Planeten!« Da Achran wandte sich wieder dem Hologramm zu und verpasste Rhodans Gesicht kurz entschlossen einen kräftigen Schlag. Natürlich fuhr ihre Hand mühelos hindurch – aber irgendwie war es trotzdem befreiend. »Warte nur ab, Rhodan! Auf dem Planeten, auf dem der kümmerliche Rest deines Volkes sich verkrochen hat, werde ich sicher eine Möglichkeit finden, mich zu rächen. Fir'tun, beende die Holosimulation!«
Die als Vogel gestaltete Kleinpositronik auf da Achrans Schulter piepste bestätigend, und Perry Rhodans Bild erlosch.
Die Hauptpositronik meldete sich wieder: »Vom Mars wird ein offener Funkruf gesendet. Es handelt sich um eine offizielle Warnung.«
Ihin da Achran horchte auf. »Welcher Art?«
»Eine Seuchenwarnung.«
1.
Der Single Malt glänzte golden im Glas. Er war zwanzig Jahre alt und Cask Strength – genau nach Reginald Bulls Geschmack. Dennoch starrte er lediglich in das Whiskyglas, statt den edlen Tropfen anzurühren. Ihm ging zu viel durch den Kopf.
Obwohl Perry Rhodan, der Hoffnungsträger und ersehnte Heilsbringer vieler Menschen, im vorigen Monat wieder aufgetaucht war, fühlte sich Bull noch immer, als laste das Gewicht der Welt auf seinen Schultern – was es gewissermaßen auch tat, immerhin war er der Protektor des Solsystems und aller Kolonien.
Wenngleich die Erde und der Mond nach wie vor fern aller Gefahren im Akonsystem verweilten, trug er die Verantwortung für den Rest der Terranischen Union, hatte sie die ganzen Jahre getragen, hatte zum Wohl der Menschheit Kreide gefressen – nur um sich nach all dem wie ein Verräter zu fühlen.
Dabei wusste er ganz genau, dass sein Handeln während der fünfeinhalbjährigen Besatzung sinnvoll und logisch gewesen war, ja, dass er gar nicht anders gekonnt hatte, als mit Leticron und dessen Überschweren zu kooperieren.
Er wusste das, sein Freund Perry wusste das, die meisten seiner Verbündeten und sogar seine Gegner wussten das. Viele derer, die er eigentlich schützen hatte wollen, sahen es jedoch nicht ein. Es war nicht leicht, die meistgehasste Person im Sonnensystem und darüber hinaus zu sein.
Bull nahm nun doch einen großen Schluck und genoss das Aroma des Whiskys auf seiner Zunge. Das Zeug ist wirklich gut! Das Getränk stammte aus einer der letzten Flaschen, die ihm Conrad Deringhouse geschenkt hatte. Auf dein Wohl, alter Freund!
Er war nie der Typ gewesen, der zu Selbstmitleid neigte, und er konnte sich selbst nicht ausstehen, wenn er in dieser Stimmung war. Aber er konnte sich nicht helfen, an diesem Tag hatte er ein Gefühl, als ob etwas in der Luft läge.
»It's the end of the world as we know it ...«, summte er leise einen alten Song, der ihm plötzlich in den Kopf kam.
Er stand von dem Hocker auf, der zur Einrichtung seiner kleinen Wohnung gehörte. Sie war kein Vergleich zu dem Haus am Goshunsee auf der zurzeit so fernen Erde. Doch seit erst seine Töchter und später seine Frau Autum ausgezogen waren, war ihm jenes Anwesen ohnehin unsinnig groß vorgekommen. Nach Autums Tod hatte er es dort fast gar nicht mehr ausgehalten.
Die Wohnung auf dem Mars bestand im Wesentlichen aus lediglich zwei Hauptzimmern: einem Schlafraum und einem großen Wohn-Ess-Bereich, in dem es auch eine Küchentheke samt Barhockern gab. Anfangs hatte sich Bull in diesem Apartment nur zum Schlafen aufgehalten – manchmal nicht mal das. Wenn es besonders hektisch zuging, hatte er kein Problem damit, auf seiner Couch im Büro des Asaph Hall Buildings zu nächtigen, des primären Regierungsgebäudes auf dem Roten Planeten. Der Mars Council war zwar wenig angetan gewesen, hatte dem Protektor nach dem Verschwinden der Erde jedoch klaglos angemessene Amtsräume zur Verfügung gestellt.
Seit einiger Zeit war er zudem noch seltener in seinem Domizil, sondern verbrachte seine Freizeit vornehmlich in der Wohnung von Stella Michelsen. Die Administratorin der Terranischen Union, der TU, und Bull waren sich in den vergangenen Jahren nähergekommen. Ihre Beziehung war sogar so intensiv, dass sie überlegten, sie endgültig öffentlich zu machen – für die in privaten Dingen eher zurückhaltende Michelsen ein enormer Schritt.
Bislang war fast nur innerhalb der Regierungskreise bekannt, dass sie ein Paar waren; sogar das hatte schon zu Problemen geführt. Man hatte Michelsen Befangenheit vorgeworfen, wenn es um Bulls Person ging. Nicht nur deswegen hatten sie darauf geachtet, dass ihr Privatleben nicht an die breite Öffentlichkeit drang. Er wunderte sich ohnehin, dass es ihnen so lange gelungen war, dieses Geheimnis zu bewahren. Politische Gegner ließen sich eine solche Gelegenheit nur selten entgehen.
Im Moment jedoch war er allein. Michelsen hatte er seit Tagen kaum noch gesehen, nur im Flur zwischen irgendwelchen Terminen. Die aktuellen Geschehnisse hielten sie beide auf Trab.
Er wollte gerade zur Couch gehen und ein Trividprogramm aufrufen, um sich etwas abzulenken, als ihn das Akustiksignal einer Kommunikationsanfrage aufhorchen ließ.
»Wer ist das?«, fragte er die Wohnungspositronik.
»Olive Morford«, kam die prompte Auskunft.
Bull runzelte die Stirn. Das war Michelsens persönliche Assistentin. Warum meldete sich seine Partnerin nicht selbst, wenn sie ihn sprechen wollte? War etwas passiert? Er nahm den Anruf an, und vor ihm baute sich das Holobild einer jungen blonden Frau auf. Was das Äußere anging, war sie das komplette Gegenteil ihrer eher unauffälligen Chefin. Trotz Morfords meist knallrotem Lippenstift und des wenig dezenten Make-ups hielt Michelsen große Stücke auf ihre Assistentin, was Bull mal wieder daran erinnerte, dass er sich gern von Äußerlichkeiten täuschen ließ.
»Olive, nett, Sie zu sehen. Wie kann ich Ihnen helfen?« Bull stellte sein Glas auf dem Couchtisch ab. Er rechnete nicht damit, dass es um etwas so Profanes wie einen Sitzungstermin ging – diese wurden ihm automatisch an sein Multifunktionsarmband übermittelt.
Morford strich sich eine Strähne ihres toupierten Haars aus der Stirn. »Hallo, Mister Bull!« Bull hatte sie mehrfach aufgefordert, ihn Reginald zu nennen, doch sie ignorierte dieses Angebot immer wieder. »Ich habe den Auftrag, Ihnen eine Nachricht von Administratorin Michelsen zu übermitteln. Ehrlich gesagt, weiß ich auch nicht so recht, was ich davon halten soll ...« Sie klimperte mit den künstlichen, grünen Wimpern, was ihre Verwirrung unterstrich.
Die Beunruhigung in Morfords auffallend tiefer Stimme ging auf Bull über. Normalerweise war sie eine gelassene Person. »Lassen Sie hören!«
»Sie hat es als schriftliche Notiz auf meinem Schreibtisch hinterlassen, als sie heute Mittag gegangen ist. Das macht sie normalerweise nur, wenn es um irgendwelche Kleinigkeiten geht – neue Naschereien für den Besuchertisch besorgen zum Beispiel. Aber diese Nachricht ...« Nervös hielt sie einen kleinen, gelben Klebezettel in die Aufnahmeoptik.
»Sag Reg, dass ich ihn heute nicht sehen kann«, stand darauf.
Die wenigen Worte versetzten Bull in Alarmbereitschaft. Morford war eine der Personen, die über den Beziehungsstatus von Bull und Michelsen informiert waren. Dennoch war es seltsam, dass Stella eine solche Notiz einfach auf dem Schreibtisch ihrer Assistentin platziert haben sollte, wo jeder sie sehen konnte. Außerdem ...
Bull kniff die Augen zusammen. »Ist das wirklich Michelsens Schrift?«
»Das habe ich mich auch gefragt.«
Michelsen hatte eine sehr ordentliche, runde Handschrift. Diese Wörter indes waren gekritzelt und zackig. Dennoch, dieser kleine Haken am großen R, das war ein Merkmal ihres individuellen Schriftbilds.
»Haben Sie seither etwas von Stella gehört, Olive?«
»Leider nein. Sie hätte heute Nachmittag zwei Termine gehabt – ein Gespräch mit dem Exekutivkomitee des Mars Councils und eine Sitzung des Finanzausschusses. Zu beiden ist sie nicht erschienen. Sie hat sich nicht mal entschuldigt. Die Nachfragen deswegen sind bei mir gelandet, offensichtlich hat sie ihre Kommunikation auf mich umgestellt.«
Diese Auskunft irritierte Bull noch viel mehr. »Das ist nicht Stellas Art! Hat sie etwas gesagt, bevor sie gegangen ist?«
»Ich war gerade nicht an meinem Platz, als sie verschwunden ist. Ich dachte, sie sei zu einem privaten Termin unterwegs oder dass sie zu Tisch gegangen ist.« Morford knibbelte nervös an ihren überlangen, spitz zugefeilten und blau lackierten Fingernägeln. »Ich mache mir Sorgen, Mister Bull. Aber ich hatte keinen Anlass, etwas Ungewöhnliches zu vermuten.«
»Das weiß ich, Olive.«
»Soll ich den Sicherheitsdienst informieren? Heute ist allerdings einiges los, ich weiß nicht ...«
»Es ist bestimmt nichts Ernstes. Stella steht unter enormem Druck, vielleicht brauchte sie einfach etwas Ruhe.« Ich klinge fast, als ob ich das glaube. »Ich mache mich gleich mal auf dem Weg zu ihr und sehe nach, ob alles in Ordnung ist.«
Die Erleichterung war Olive Morford deutlich anzumerken. »Danke, Mister Bull. Sagen Sie ihr gute Besserung, wenn sie sich tatsächlich unwohl fühlen sollte.«
Wenige Minuten später war Reginald Bull unterwegs. Er überlegte kurz, ob er einen Dienstgleiter anfordern sollte, um ihn abzuholen. Aber bis das Fahrzeug sich beim aktuellen Feierabendverkehr zu seiner Wohnung durchgekämpft hätte, wäre er längst zu Fuß bei Michelsens Wohnung angekommen, die nur drei Straßen entfernt war.
Sobald Bull das Gebäude verlassen hatte, in dem sein Apartment lag, wurde ihm klar, dass es die richtige Entscheidung gewesen war. Die Zustände auf den Straßen von Bradbury Central waren chaotisch, was prinzipiell nichts Neues war.
Aber heute ist es besonders konfus. Es scheinen mehr Menschen als sonst unterwegs zu sein – die meisten zu Fuß.
Die ersten hundert Meter war er zu abgelenkt, um weitere Absonderlichkeiten zu bemerken. In Gedanken war er bereits bei Stella Michelsen und bereitete sich auf die unterschiedlichsten Szenarien vor, die ihn erwarten könnten.
War sie krank, verletzt, möglicherweise bewusstlos? Würde er sich gewaltsam Zugang zu ihrer Wohnung verschaffen müssen? Oder war sie womöglich gar nicht zu Hause, sondern zu einer unbekannten Verabredung aufgebrochen und deshalb bei den Terminen verhindert gewesen? Oder war mit ihr alles in Ordnung, und sie würde ihn mit ihren großen, braunen Augen erstaunt ansehen und in schallendes Gelächter ausbrechen, sobald sie von seiner Sorge erfuhr? Das war die peinlichste Option – die sich Bull aber trotzdem am meisten wünschte.
An der nächsten Ecke kam er an seiner Lieblingsbäckerei vorbei, wo er sich jeden Morgen einen extrastarken Kaffee und einen Donut mit Vanillefüllung besorgte, ehe er in den Dienstgleiter stieg, der ihn zum Regierungsgebäude flog. Eigentlich hätte er auch diese Strecke stets problemlos zu Fuß bewältigen könne. Doch die Regierungsheinis – unter ihnen Michelsen – bestanden darauf, dass er aus Sicherheitsgründen mit dem Gleiter kam. Automatisch hob er den Kopf, um Ersoy zuzuwinken, der ihm täglich seine doppelte Koffeinration bereitstellte. Verblüfft blieb Bull stehen.
Ersoy hatte ihn nicht bemerkt, denn er war damit beschäftigt, sich in dem Bäckereicafé hektisch einen Donut in den Mund zu stopfen. In den Händen hielt er weitere Donuts, und kaum hatte er den einen hinuntergeschluckt, stopfte er sich den nächsten in den Mund und griff gierig in die Theke, die schon ziemlich geplündert aussah.
Für einen Moment war Bull nicht in der Lage, den Blick von dieser seltsamen Szene abzuwenden. Dann zwang er sich, weiterzugehen. Was auch immer Ersoy für ein Problem hatte, es ging Bull nichts an, und er hatte momentan auch keine Zeit dafür. Michelsen brauchte ihn – vielleicht.
Schon eine halbe Straße weiter erlebte er den nächsten Zwischenfall. Ihm kamen drei Gestalten entgegen, die gleichzeitig gut gekleidet und abgerissen wirkten.
Wie Yuppies, die in einen Müllcontainer gefallen sind.
Ihre blauen Anzüge waren verdreckt und zerfetzt, ihre akkurat geschnittenen Haare zerwühlt. Die Augen in ihren bartlosen Gesichtern waren blutunterlaufen.
Während Bull an ihnen vorbeiging und sich fragte, ob er vielleicht einen neuen Modetrend verpasst hatte, zeigte einer der drei – der größte und schlaksigste – mit dem Finger auf Bull. »Hey, da ist ja Leticrons Handpuppe!«
Das Interesse der anderen beiden erwachte sofort.
»Der hochgeschätzte Protektor Bull.« Der kleinste der drei, ein Kerl mit leichtem Bauchansatz und einer dicken Golduhr, blieb feixend stehen.
Die anderen beiden hielten ebenfalls an und musterten Bull.
»Handpuppe ist, glaube ich, das falsche Wort, Gino.« Der Dritte im Bunde, ein Neu-Marsianer mit den typisch grauen Haaren der umweltangepassten Siedler, verschränkte die Arme vor der Brust. »Bei einer Handpuppe hat der Puppenspieler seine Hand tief im Allerwertesten des Püppchens. Im Fall von Bull und Leticron war es eher andersherum: Unser verehrter Volksvertreter ist der Exemplarischen Instanz ganz schön in den ...«
»Haha«, sagte Bull gezwungen höflich und wollte weitergehen. Er war es gewohnt, in der Öffentlichkeit beschimpft zu werden. Denn er kannte den Ruf, den er sich als Leticrons Sprachrohr über die Jahre erworben hatte.
Aber als ihn etwas Hartes am Rücken traf, war er doch verblüfft. Er drehte sich um und sah eine Kartoffel auf dem Boden liegen. Der schlaksige Gino hatte sich aus der Auslage eines Obst- und Gemüseladens bedient und hielt bereits weitere Wurfgeschosse in den Händen. Auch Mister Golduhr und der Marsianer hatten sich mit Äpfeln und Tomaten ausgestattet und holten nun aus. Bull sprang hinter einen am Straßenrand abgestellten Gleiter in Deckung, als die ersten Tomaten geflogen kamen.
»Na los, zeigen wir ihm, was wir von ihm halten!«, brüllte Gino.
Danke, das weiß ich schon, dachte Bull und duckte sich, als vor ihm eine Tomate auf die Sichtscheibe des Gleiters klatschte.
So etwas war ihm bislang noch nicht passiert. Klar, die Leute waren nicht gut auf ihn zu sprechen, aber er war noch nie spontan körperlich angegriffen worden. Hilfe suchend sah er sich um. Die anderen Passanten gingen derart unbeteiligt ihrer Wege, als bekämen sie die Auseinandersetzung gar nicht mit.
Seltsam! Selbst wenn sie sich nicht daran beteiligen, sollten sie zumindest hastiger gehen oder sich ducken.
Doch nichts davon geschah. Alle schienen mit sich selbst beschäftigt zu sein.
Ein Polizeigleiter bog um die Straßenecke und hielt auf den Schauplatz des Konflikts zu. Bull atmete auf. Die Sicherheitsbeamten würden dem Spuk schnell ein Ende machen. Der Bodenschweber hielt vor dem Lebensmittelgeschäft an, und Bull richtete sich auf. Seine drei Kontrahenten stellten ihre Würfe ein und sahen den beiden aussteigenden Polizisten, einer Marsianerin und einem Kolonisten, feindselig entgegen.
Bull hob beschwichtigend die Hände. »Es ist alles in Ordnung. Nur eine kleine Meinungsverschiedenheit.«
Die Polizisten beachteten ihn überhaupt nicht.
»Mann, habe ich einen Heißhunger auf Trauben!«, sagte die Marsianerin zu ihrem Kollegen und ging an Bull vorbei in den Laden.
Der andere Polizist nickte. »Bei mir sind es Bananen. Ich könnte eine ganze Staude verschlingen.«
Bull sah den Uniformierten verblüfft hinterher. Die drei Obst- und Gemüsewerfer waren nur kurz irritiert, dann nahmen sie wieder Angriffsposition ein.
»Wo waren wir stehen geblieben?«, fragte Gino.
»Lasst es bleiben, Jungs!« Bull reichte der Unsinn, er musste dringend weiter zu Michelsen. »Ich denke, wir haben alle keine Lust, unsere Zeit mit diesem Unsinn zu verschwenden. Ihr habt sicher Dringenderes zu tun.«
»Eigentlich nicht«, sagte Gino und warf eine Olympbirne, die weit an Bull vorbeiflog, an der nahen Hauswand zerplatzte und dort orangerote Schlieren hinterließ.
Seine beiden Kumpane hingegen waren von Bulls Worten abgelenkt.
»Ich muss ...noch was einkaufen.« Golduhr ließ das Obst einfach fallen und ging davon.
»Und ich ...hab Hunger.« Statt die Tomate in seiner Hand zu werfen, biss der Marsianer herzhaft hinein, sodass der rote Saft nur so spritzte. Es hätte komisch sein können, wenn sein Blick dabei nicht so seltsam leer und in die Ferne gerichtet gewesen wäre.
Irgendwas stimmt hier nicht, dachte Bull beunruhigt. Diese eigenartige Unkonzentriertheit schien viele Menschen zu betreffen – zu viele für seinen Geschmack.
Laut sagte er: »Sehr gut. Dann gehe ich weiter, und ihr macht auch das, was ihr vorher tun wolltet.«
Ginos Gesicht wurde grüblerisch. »Vorher? Was wollte ich denn vorher tun?«
Bull ließ ihn einfach stehen und setzte seinen Weg fort. Noch ein halbherzig geworfener, blauer Ferrolapfel flog an ihm vorbei, dann war von den drei Streitlustigen nichts mehr zu sehen und zu hören.
Während Bull weitereilte, bemerkte er immer mehr Menschen, die sich sonderbar verhielten. Eine Frau riss in einem Geschäft Kleider vom Haken und zog sie an, ließ das Anprobierte achtlos zu Boden fallen und griff sofort nach dem nächsten. Eine andere Frau hatte sich neben einem Kinderwagen einfach auf den Boden gelegt und schlief tief und fest, während das Baby im Wagen brüllte. Ein Marsianer beschmierte die Wand eines Tourismusbüros mit roter Farbe, zwei andere hatten einen runden, kniehohen Straßenreinigungsroboter gepackt und warfen ihn sich gegenseitig zu.
Als Reginald Bull schließlich Stella Michelsens Wohnung erreichte, hatte er so viele beunruhigende Dinge gesehen, dass er auf das Schlimmste gefasst war. Nervös hämmerte er an ihre Tür und rief ihren Namen.
Als ihm bereits nach kurzer Zeit geöffnet wurde, war er erleichtert – doch dann sah er Michelsen. Ihre dunklen, kinnlangen Haare fielen ihr wirr in die Stirn, ihr Blick war unstet.
»Reg, was machst du hier?«, fragte sie abwesend.
»Ich will nach dir sehen. Olive und ich haben uns Sorgen gemacht.« Bull trat hinter ihr in das Apartment, weil sie sich einfach umdrehte und ihn in der offenen Tür stehen ließ. Was er dort entdeckte, erschreckte ihn noch mehr. Die sonst stets gepflegte und top aufgeräumte Wohnung war völlig verwüstet.
»Hat jemand bei dir eingebrochen?«, fragte er alarmiert.
»Was? Nein ...Ich habe etwas gesucht. Ein altes Erinnerungsstück.« Sie schlurfte zum Sofa und ließ sich in die Polster fallen.
»Was ist los, Stella? Bist du krank?«
»Nein. Mir geht es gut.« Sie nahm ein gerahmtes Foto in die Hand, das auf dem Tisch lag, und betrachtete es versonnen.
»So sieht es aber nicht aus. Soll ich dich ins Krankenhaus bringen?«
Sie antwortete nicht und starrte weiter auf das Foto. Bull erkannte die Aufnahme von drei jungen Frauen.
Michelsens Roboterhund Diamond, mit dem sich Bull nur langsam hatte anfreunden können, sprang zu ihr auf das Sofa und wollte auf ihren Schoß kriechen, wie er es immer tat. Sie packte ihn und schleuderte ihn achtlos quer durch den Raum. Der kleine Roboter knallte gegen einen Schrank, wo er schwach piepsend liegen blieb.
Dieses Verhalten gab für Bull den Ausschlag. »Es reicht, Michelsen – mit dir stimmt etwas nicht! Du hast das Gleiche wie die Leute auf der Straße. Ich bringe dich ins Zentralkrankenhaus von Bradbury Central.« Er ging auf sie zu, um ihr aufzuhelfen.
Sie sprang mit einem Fauchen auf die Füße. »Den Teufel wirst du tun. Lass mich in Ruhe!«
Sie warf den Bilderrahmen nach ihm. Bull, an ungewöhnliche Wurfgeschosse gerade gewöhnt, wich aus, und das Bild prallte gegen die Wand. Das Glas zerbrach klirrend, als es auf den Boden aufschlug.
»Stella, du bist nicht du selbst! Lass dir helfen!«
Bull wusste nicht, woher sie die Waffe hatte. Aber plötzlich hielt sie einen Paralysator in der Hand.
»Lass mich in Ruhe!«, schrie sie wieder und schoss.
Bull gelang es, auszuweichen. Das war erstaunlich. Denn Michelsen, die regelmäßig Schießübungen im Trainingszentrum des Sicherheitsdienstes absolvierte, war eine zielsichere Schützin und hätte ihn normalerweise nicht verfehlt. Das zeigte Bull, wie sehr sie neben sich stand. Er sprang geduckt auf sie zu, packte sie und entwand ihr die Waffe. Er richtete sie auf seine Partnerin und drückte ab. Stella Michelsen sackte auf dem Sofa zusammen.
Erschüttert betrachtete er die sonst so gefasste und abgeklärte Administratorin der TU. Sie sah aus wie eine Puppe, der man die Fäden durchgeschnitten hatte, klein und zerbrechlich.
Diamond kam schlurfend näher; eins seiner Hinterbeine schien beschädigt zu sein. Er leckte seiner Herrin das Gesicht und legte sich mit einem anklagenden Heulen neben sie.
2.
»Hey Mann, pass doch auf!«
Erschrocken wich Harkon von Bass-Teth dem Ferronen aus, der ihn beinahe umgerempelt hätte. Entschuldigend hob der Akone die Hände, aber der Blauhäutige war bereits weitergegangen.
Alle ziemlich gereizt heute! Das war das dritte Mal, dass Harkon fast mit jemandem zusammengestoßen wäre, und zuvor war es nicht seine Schuld gewesen. Diesmal schon, denn er war in die Lektüre einer Nachricht vertieft gewesen, die er über seine Datenbrille empfangen hatte. Dank der Gläser, die sich im Sonnenlicht verdunkelt hatten, sah niemand, dass er mit anderen Dingen beschäftigt war, statt achtsam die Hauptstraße von Bradbury Central Richtung Stadtzentrum hinaufzugehen. Wenn er nicht aufpasste, würde er wirklich noch in jemanden hineinrennen. Und so aggressiv, wie alle sind, wird das böse enden ...
Er tastete nach dem fingernagelgroßen Anhänger, den er an einem Armband trug. Der hellblaue Stein fühlte sich glatt und rund an. Sein Glücksbringer. Seine Versicherung.
Kurz entschlossen ließ sich Harkon auf einen Stuhl fallen, der zu einem kleinen Café gehörte. Es war nicht ausdrücklich eine Kaschemme, aber auch nicht viel besser. Normalerweise wäre das Lokal nicht seine erste Wahl gewesen, im Moment konnte er jedoch nicht wählerisch sein. Er musste die Nachricht noch mal lesen und seine Gedanken klären.
Er mochte nach wie vor nicht glauben, was er vor kaum einer halben Stunde erfahren hatte, also rief er die Nachricht erneut auf. Er verfügte noch immer über seine nur halb legalen Informationskanäle aus der Zeit des Widerstands gegen die Exemplarische Instanz. Außerdem hatte er mittlerweile recht zuverlässige Kanäle nach Drorah im Akonsystem von M 3 aufgebaut.
Schon während der Herrschaft der Überschweren wäre ihm das möglich gewesen, doch damals hatte er wie alle anderen Eingeweihten versucht, den Verbleib von Terra und Luna vor den Besatzern geheim zu halten. Jede noch so gut getarnte Kommunikation mit seinem Heimatsystem wäre ein Risiko gewesen, das er nicht hatte eingehen wollen. Inzwischen war die Geheimhaltung zwar nicht mehr nötig. Er wollte aber trotzdem nicht, dass jeder mitbekam, woher er seine Informationen bezog.
»Bomben auf dem Erdmond gezündet. Mehrere Tote, zahlreiche Verletzte. Verantwortlicher und Kopf der ›New Roots‹ ist mutmaßlich Tatcher a Hainu. Anweisungen?«
Wieder und wieder las er die Zeilen. Er konnte es nicht fassen. Tatcher a Hainu war ein Attentäter! Harkon hatte keinen Grund, an den Worten seiner Quelle zu zweifeln. Er bekam nur Informationen, die genau geprüft waren, keine Gerüchte und Vermutungen.
»Kann ich Ihnen etwas bringen?« Die Stimme klang melodisch und freundlich.
Harkon sah auf. Vor ihm stand eine Kellnerin, eine junge Marsianerin.
»Oh ...einen Latte Marsiano, bitte.« Er war fast süchtig nach diesem Heißgetränk, einer Mischung aus irdischem Kaffee und der Milch von Sandziegen. Dem Vernehmen nach hatte die Milch der auf dem Mars neu gezüchteten Ziegen einen von Natur aus salzigeren Geschmack als bei ihren terranischen Vorfahren. Das lag wohl an den Marskräutern, die sie fraßen und die auf dem Roten Planeten seit dem fortschreitenden Terraforming vielerorts gediehen. Sollte er eines Tages nach Drorah zurückkehren, würde er den Latte Marsiano am meisten vermissen. Falls er je zurückging – denn längst hatte er auf dem Mars Wurzeln geschlagen.
Die Marsianerin gab die Bestellung in ihre kleine, flache Handpositronik ein und musterte ihn halb mitleidig, halb neugierig. »Alles in Ordnung mit Ihnen? Sie wirken irgendwie ...verstört.«
Ich wirke haargenau wie jemand, der gerade erfahren hat, dass er mitschuldig an einem Terroranschlag ist ...
Er zwang sich zu einem Lächeln. »Es scheinen heute alle ein wenig durch den Wind zu sein, oder?«
Die Kellnerin sah sich unbehaglich um. »Haben Sie es noch nicht gehört?«
»Was denn?«
»Es soll sich um eine neue Krankheit handeln. Verbreitet sich wie eine Grippe. Die Leute sind unkonzentriert und werden teilweise aggressiv.« Sie wies auf einen älteren Mann, der auf der anderen Straßenseite über den Gehweg taumelte.
Sein Blick irrte unstet umher. In der Hand hielt er eine durchsichtige Bioplastflasche mit einer transparenten Flüssigkeit, die er nun fallen ließ. Sie klirrte geräuschvoll. Er achtete nicht darauf. Er griff in seine Manteltasche und förderte ein weiteres kleines Fläschchen ans Tageslicht, das er hastig aufschraubte und in einem Zug leer trank.
»Der Gute scheint mir eher ein Alkoholproblem zu haben«, kommentierte Harkon.
Der Alte warf das Fläschchen fort, es rollte über die Straße und blieb wenige Schritte vor dem Akonen und der Marsianerin liegen.
Während der Mann weiterschwankte, hob die Kellnerin die Flasche auf und las das Etikett. Mit hochgezogenen Augenbrauen zeigte sie es Harkon. »Alkoholproblem? Wohl kaum ...«
Erstaunt nahm er die Flasche und untersuchte sie, schnüffelte an der Öffnung. Tatsächlich war es nur eine simple Zitronenlimonade gewesen.