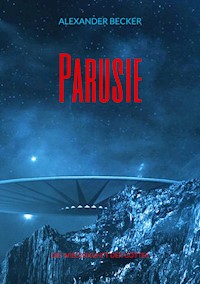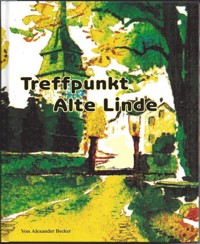11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Reclam Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Reclams Universal-Bibliothek
- Sprache: Deutsch
Philosophie ist eine Tätigkeit, kein Wissen, so Platon. Seine Politeia will den Leser entsprechend dazu verführen, selbst zu philosophieren und nicht bloß vorgefertigte Gedanken anderer passiv zu übernehmen. Verhandelt wird in dem philosophischen Klassiker – unter der Hauptfrage, was Gerechtigkeit ist – nicht nur die Möglichkeit von Erkenntnis (im berühmten Höhlengleichnis), sondern auch Fragen nach Glück, Tugend, dem guten Staat oder dem Anspruch von Kunst und Dichtung. Der systematische Kommentar rekonstruiert und diskutiert den Argumentationsgang und bietet auf diese Weise jede erforderliche Verständnishilfe für Schüler und Studenten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 408
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Alexander Becker
Platons »Politeia«
Ein systematischer Kommentar
Reclam
Für Wolfgang Detel
2017, 2022 Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Bibliographisch aktualisierte und ergänzte Ausgabe 2022
Covergestaltung: Cornelia Feyll, Friedrich Forssman
Gesamtherstellung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Made in Germany 2022
RECLAM ist eine eingetragene Marke der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
ISBN978-3-15-961280-5
ISBN der Buchausgabe 978-3-15-019477-5
www.reclam.de
Inhalt
Einleitung
Übersicht über den Aufbau der Politeia
Buch I: Gespräche Sokrates – Kephalos / Polemarchos / Thrasymachos
Buch II–X: Gespräch Sokrates – Glaukon / Adeimantos
Buch I
Vorbemerkung
Die Situation des Gesprächs (327a–328c)
Kephalos und Sokrates (328c–331b)
Polemarchos und Sokrates (331c–336a)
Thrasymachos und Sokrates I (336b–343a)
Thrasymachos und Sokrates II (343b–347e)
Buch II: Die Leitfrage (357a–369b)
Drei Alternativen (357a–358d)
Glaukon zur allgemeinen Auffassung der Gerechtigkeit (358e–362d)
Adeimantos zur allgemeinen Auffassung der Gerechtigkeit (362d–367e)
Buch II–III: Der Entwurf des Modellstaats und das Erziehungsprogramm
Vorspann zur Vorgehensweise (367e–369c)
Der Entwurf des Modellstaats (369d–373e)
Die Wächter (373e–376d)
Die Erziehung der Wächter (376d–412b)
Die Rolle der Dichtung in der Erziehung der Wächter (376e–398b)
Die Rolle der Musik in der Erziehung der Wächter (392c–403c)
Die Rolle der Gymnastik in der Erziehung der Wächter (403d–412b)
Auswahl der Herrscher und die Einführung des Drei-Stände-Modells (412b–417b)
Buch IV: Die Definition der Gerechtigkeit in Staat und Seele
Das Glück der Wächter (419a–427d)
Die Tugenden im Staat und die Definition der Gerechtigkeit (427d–434d)
Die Tugenden in der Seele (434d–445c)
Die Teile der Seele (434d–441c)
Die Bestimmung der Tugenden in der Seele (441c–445c)
Buch V–VI. Philosophen und Philosophenstaat
Frauen, Kinder und Philosophen im Modellstaat (449a–474b)
Was ist ein Philosoph? (474b–480a)
Wonach Philosophen streben (474b–476b)
Das Wissen der Philosophen (476b–480a)
Die Philosophen und der Staat, oder: Wer ist ein Philosoph? (484a–504a)
Buch VI–VII: Das Gute und die drei Gleichnisse
Der höchste Lehrgegenstand: Das Gute (504a–509c)
Einführung des Guten (504a–506e)
Das Sonnengleichnis (507a–509c)
Eine formale Theorie des Guten
Das Linien- und das Höhlengleichnis (509d–541b)
Das Liniengleichnis (509d–511e)
Das Höhlengleichnis und seine Auslegung (514a–518b)
Die Ausbildung des Philosophen (518b–541b)
Buch VIII–IX: Formen der Ungerechtigkeit in Staat und Seele
Vorbemerkung
Die Timokratie (545b–550b)
Die Oligarchie (550c–555a)
Die Demokratie (555b–562a)
Die Tyrannis (562a–576b)
Buch IX: Drei Beweise, warum der Gerechte glücklich ist
Vorbemerkung
Erster Beweis (577b–560c)
Zweiter Beweis (580d–583a)
Dritter Beweis (583b–587a)
Abschluss: Der Nutzen von Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit (587b–592b)
Buch X: Dichtung und Unsterblichkeit
Vorbemerkung
Kritik der Dichtung (595c–608b)
Nachahmung (595c–598d)
Anwendung auf die Dichtung (598d–602c)
Wirkung der Dichtung auf die Seele (602c–608b)
Die Unsterblichkeit der Seele und das Schicksal der Seelen nach dem Tod (608c–621d)
Argumente für die Unsterblichkeit der Seele (608c–612a)
Der Lohn der Tugend im irdischen Leben (612a–614a)
Der Lohn der Tugend nach dem Tod: der Mythos von Er (614a–621d)
Literaturhinweise
Vorbemerkung zu den 2022 aktualisierten Literaturhinweisen
Textausgabe und ausgewählte Übersetzungen
Ausgewählte Sekundärliteratur
[9]Einleitung
Platons Politeia ist ein sehr berühmter Text. Manche Passagen, allen voran das Höhlengleichnis, haben es zu regelrechter Popularität gebracht; andere zum zweifelhaften Ruf, den totalitären Regimes des 20. Jahrhunderts Anregungen geliefert zu haben. Vor allem anderen aber ist die Politeia ein umfangreiches Buch, dessen Lektüre einiges an Durchhaltevermögen erfordert. Und das wirft die Frage auf: Warum sollte man sich mit einem derart umfangreichen Buch heute überhaupt noch beschäftigen?
Betrachtet man die Anzahl der verhandelten Themen – Ethik, politische Philosophie, Pädagogik, Theologie, Ästhetik, Psychologie, Erkenntnistheorie, Ontologie –, könnte man auf den Gedanken kommen, dass man es mit einem jener Werke zu tun hat, die das ehrfurchtgebietende Prädikat »Hauptwerk« verdienen. Hauptwerke sind normalerweise Bücher, in denen der Autor seine zentralen Gedanken systematisch darlegt und zeigt, was alles aus diesen Gedanken folgt. Die Politeia wurde und wird immer noch gerne als ein Hauptwerk in diesem Sinne aufgefasst. Doch ist sie das wirklich?
Die Antwort ist weder ein klares »ja« noch ein klares »nein«. Der griechische Titel Politeia, wörtlich »Bürgerschaft« oder »Verfassung«, ist der älteste überlieferte Titel des Werks.1 Er legt nahe, dass es in erster Linie um politische Philosophie geht (daher auch die übliche deutsche Übersetzung »Der Staat«).
In der späteren Antike wurde die Politeia auch unter dem Titel Peri dikaiou – »Über das Gerechte« – geführt.2 Dieser Titel entspricht der Art und Weise, wie das Thema der Gerechtigkeit das Werk organisiert, am besten. In Buch I dreht sich das [10]Gespräch um die Definition der Gerechtigkeit; zu Beginn von Buch II wird an Sokrates die Frage gestellt, warum man gerecht leben solle, und diese Frage wird am Ende von Buch IX beantwortet. Die Frage, was Gerechtigkeit sei, wird also mit einer lebenspraktischen Frage verbunden. Und damit geht es in der Politeia um die zentrale Frage der antiken Philosophie überhaupt: Wie sollen wir leben?
Diese Grundfrage erhält hier obendrein eine konstruktive Antwort. Das mag nicht sonderlich erwähnenswert erscheinen, ist bei Platon allerdings die Ausnahme – viele seiner Dialoge enden in »Aporien«, also in der Feststellung, dass man auf die Leitfrage eines Gesprächs zwar ein paar Antworten als falsch aussortieren konnte, einer positiven Antwort aber (anscheinend) letztlich nicht näher gekommen ist. In der Politeia findet man eine solche Aporie am Ende von Buch I; im Hauptteil, von Buch II bis Buch IX, wird Sokrates jedoch von zwei jungen, aufgeschlossenen Leuten, Glaukon und Adeimantos, in die Pflicht genommen, ihnen zu zeigen, warum ein gerechtes Leben das bessere Leben ist.
So gesehen, verdient die Politeia sicherlich, ein Hauptwerk genannt zu werden – aber wer von ihr erwartet, so etwas wie Platons philosophisches Gesamt-System zu finden, der wird enttäuscht werden. Dazu bleibt viel zu viel andeutungs- und lückenhaft. Viel eher könnte man die Politeia ein »protreptisches« Werk nennen – ein Werk, das zur Philosophie hinführen und in sie einführen soll. Das liegt unter anderem an den Personen, mit denen Sokrates sich hier unterhält: Glaukon und Adeimantos, die ab Buch II als Gesprächspartner fungieren, sind keine professionellen Philosophen, sondern »interessierte Laien«.
Nun ist es hinwiederum auch nicht so, dass man in der Politeia gar keine Hinweise auf Platons philosophisches Denken finden würde; im Gegenteil, es geht immerhin auch um solch grundlegende Fragen wie zum Beispiel, was Philosophie [11]überhaupt ist und welches ihr höchster Gegenstand sei. Diese Themen werden aber nicht in der Weise systematisch aufbereitet, wie man das von einer philosophischen Abhandlung erwartet. Hat Platon in der Politeia womöglich aus didaktischer Zurückhaltung ein systematisches Gedankengebäude bloß angedeutet, das der moderne Leser nun mehr schlecht als recht aus den Andeutungen rekonstruieren muss?
Dass für die Leser der Politeia viel zu tun bleibt, ist richtig. Dies liegt aber nicht daran, dass Platon seinen Lesern etwas vorenthalten wollte, was er auch hätte klar ausdrücken können. Platons Philosophieverständnis ist nämlich mit der Idee eines »Hauptwerks« unverträglich, sofern man unter einem Hauptwerk ein fertig gepacktes Gedankenpaket versteht, das man als Leser übernehmen oder bei Nichtgefallen im Gedankenregal abstellen kann.
Philosophie heißt für Platon: philosophieren, das heißt, selbst tätig zu werden, nicht bloß passiv die vorgefertigten Gedanken anderer Leute zu übernehmen. Die Aufgabe eines philosophischen Textes besteht demnach darin, seine Leser zum Philosophieren zu bringen. Dass Platon Philosophieren als Tätigkeit auffasst, hat verschiedene Gründe.
Es hat mit der für die gesamte antike Philosophie selbstverständlichen Auffassung zu tun, dass Philosophie letztlich ein praktisches Ziel hat: nämlich, zu einem »geprüften Leben« zu verhelfen, d. h. zu einem Leben, in dem man sich selbst Rechenschaft darüber ablegen kann, warum man so lebt, wie man lebt. Ein solch persönliches Ziel kann man sich nur selbst erarbeiten, da es aus den je eigenen Vormeinungen, Neigungen und dem eigenen Charakter heraus erfasst werden muss. Es ist nicht wie ein Fertigprodukt vom Autor auf den Leser übertragbar.
Ein anderer Grund verbindet sich mit der berühmten sokratischen Formel »ich weiß, dass ich nichts weiß«. Auf diese [12]Haltung stößt man auch beim Sokrates der Politeia immer wieder – wenn auch in einer etwas milderen Form. Sokrates hat zwar zu verschiedenen Themen durchaus Meinungen, denn ohne eigene Meinungen auf den Tisch zu legen, könnte er kaum die Aufgabe erfüllen, die Glaukon und Adeimantos ihm gestellt haben. Aber es sind eben bloße Meinungen, und Sokrates selbst weiß nicht, ob es sich dabei tatsächlich um Wissen handelt, also um etwas, das gegen spätere Revisionen gefeit ist. Wenn man als Lehrer aber nicht weiß, ob das, was man meint und glaubt, Wissen ist, dann ist das Beste, was man tun kann, seine Schüler in die Suche nach Wissen einzuführen. Aus diesem Grund ist die Politeia als ein Werk angelegt, das seine Leser in die Philosophie hineinführt. Obendrein hat die Einführung in die Suche nach Wissen auch unmittelbar mit der Frage zu tun, wie man leben soll. Denn ein gerechtes und gutes Leben ist für Platon idealerweise ein Leben, das auf Wissen basiert – allen voran auf dem Wissen, was gut ist. Nach einem guten Leben zu streben bedeutet daher, nach Wissen zu streben.
Es ist keineswegs ausgeschlossen, dass man sich auch als moderner Leser von der Politeia auf den Weg der Philosophie führen lässt. Man muss ja nicht jeden der Vorschläge übernehmen, die Sokrates macht und denen Glaukon und Adeimantos überwiegend zustimmen. Die erkenntnistheoretische bzw. epistemische Offenheit, die das platonische Philosophieverständnis charakterisiert, ist geradezu darauf angelegt, dass der Leser sich über die Angebote, die der Text ihm macht, eigene Gedanken macht. Die Skizzen- und Lückenhaftigkeit dieser Angebote zwingt den Leser ohnehin zu eigener Aktivität.
Doch auch ein Leser, der sich nicht von der Politeia in die Philosophie hineinführen lassen möchte, vielleicht weil er schon einen eigenen Weg eingeschlagen hat, wird einiges finden, was die Lektüre der Politeia lohnend macht.
Da ist zunächst die immense thematische Breite des Werks [13]zu nennen. Die verschiedenen Gebiete stehen nicht nebeneinander, sondern sie werden miteinander verflochten. Man kann der Politeia ausreichend klare Thesen über den Zusammenhang von Ethik und Ontologie, Ontologie und Epistemologie oder Pädagogik und Ästhetik entnehmen, um sie als Material für eigene Diskussionen über die Verbindung verschiedener Wissensbereiche zu verwenden – Verbindungen, die in der aktuellen Wissenschaftslandschaft eher zu kurz kommen. Das Prinzip der Verknüpfung, das der Politeia zugrunde liegt, geht über bloße Berührungspunkte und Überlappungen hinaus (auf die man sich heute meistens beschränkt), ist jedoch auch kein hierarchisches Verfahren, in dem aus einem Anfangspunkt alles abgeleitet wird. Tragend für die Verbindung ist die Frage, wozu etwas gut ist. Das ist eine Frage, deren Beantwortung automatisch über den jeweils betrachteten Bereich hinausweist; ausreichend beantwortet ist sie erst dann, wenn man alle Bereiche des Wissens so zueinander ins Verhältnis gebracht hat, dass man von allen sagen kann, wozu sie jeweils gut sind.
Außerdem ist die Politeia auch eine Quelle systematisch interessanter ethischer Überlegungen. Ihr Leitthema, die Gerechtigkeit, gilt normalerweise als ein soziales Organisationsprinzip; hier wird sie aber mit dem höchsten Gut als Ziel des individuellen Lebens zusammengebracht. Wie stehen beide im Verhältnis zueinander?3 Was Platon in der Politeia vorschlägt, ist auf den ersten Blick eine unzeitgemäße Auffassung vom Verhältnis von Gerechtigkeit und Lebensziel: Denn nach moderner Auffassung – ein Orientierungspunkt wäre hier etwa John Rawls (1921–2002) – ist Gerechtigkeit ein soziales Ordnungsprinzip, das jedem so weit wie möglich erlaubt, nach [14]eigener Façon glücklich zu werden. Das heißt, die Gerechtigkeit sollte von der Auffassung, was jeweils gut für eine Person ist, unabhängig – ja, sie sollte in gewisser Weise sogar dem höchsten Gut übergeordnet sein: Über das höchste Gut gibt es verschiedene Auffassungen, und Gerechtigkeit ist das soziale Prinzip, das es jedem erlaubt, seine eigene Vorstellung zu verwirklichen.
Dagegen ist nach Platons Auffassung Gerechtigkeit dem höchsten Gut untergeordnet. Wir müssen zuerst wissen, was das höchste Gut ist, und erst dann können wir ein entsprechendes Konzept der Gerechtigkeit entwickeln. Gerechtigkeit dient dem Guten und hat in ihrer Ausgestaltung ihm zu folgen. Eine solche Auffassung ist überhaupt nur dann sinnvoll, wenn wir wissen können, was für die Menschen im Allgemeinen gut ist – wenn wir also einen objektiven Begriff vom höchsten Gut bilden können. Aus der Perspektive einer liberalen Tradition scheint das unsinnig, geradezu gefährlich – eine Wurzel jeglichen Übergriffs des Staates auf den Einzelnen.
Nun hat sich aber in den letzten Jahrzehnten das theoretische Blatt etwas gewendet, und zwar aus einer Richtung, die zunächst gar nichts mit Platon zu tun zu haben scheint: In dem Maße, in dem Biologie als Leitwissenschaft vorgerückt ist, hat auch wieder das Interesse an Anthropologie zugenommen: an einer allgemeinen Theorie des Menschen, an einer allgemeinen Antwort auf die Frage »Was ist der Mensch?« – eine Antwort, die dann auch Auskunft darüber geben sollte, was ein guter Mensch ist, was ein gutes Leben ist, und somit auch: was das höchste Gut im Leben ist.4 Platon ist zwar alles andere als ein Naturalist, aber sein Zugang zur Ethik, die Gerechtigkeit zu einem Teil der Anthropologie zu machen, ist durch diese Veränderung wieder modern geworden.
[15]Schließlich gibt es prominente zeitgenössische Philosophen, die versuchen, das Angebot, das man der Politeia entnehmen kann, in eine moderne ethische Theorie einzubauen. Sie greifen dabei auf, dass Platon sowohl in seiner Konzeption des Guten wie in seiner Konzeption der Gerechtigkeit auf eine inhaltliche Füllung weitgehend verzichtet. Hier ist insbesondere Christine Korsgaard zu nennen:5 Platons Theorie der Gerechtigkeit ist für sie eine Theorie darüber, was eine Person zu einer Einheit macht; diese Einheit ist für sie wiederum die Quelle von Normativität. Denn die Einheit der Person ist die Voraussetzung von Autonomie; die Autonomie wiederum ist Voraussetzung von Verantwortung als einer notwendigen Bedingung von Moralität. (Es bleibt zu fragen, ob diese Einheit an sich schon ein Wert ist – und zwar ein moralischer Wert, nicht bloß ein funktionaler Wert, oder anders gesagt, ob die Einheit der Person hinreichend für moralische Normativität ist.) Man kann ein solches Projekt eine »formale Ethik« nennen. Gelänge es, Moral ein so formales, weil handlungstheoretisches Fundament wie die Einheit der Person zu geben, dann könnte man unbesorgt von einem objektiven höchsten Gut ausgehen, denn für seine inhaltliche Füllung bliebe ein weiter Spielraum. Tatsächlich glaube ich, dass diese formalistische Lesart recht nahe an dem ist, was Platon mit dem »Guten« meinte, so dass die systematische Theorie, die Korsgaard aus Platon entwickelt hat, auch eine gute Basis für das Verständnis der Politeia liefert.
Bei einem so facettenreichen und offenen Werk wie der Politeia ist es wenig überraschend, dass in der langen Rezeptionsgeschichte die unterschiedlichsten Auffassungen an es herangetragen bzw. aus ihm herausgezogen wurden. Diese Einführung macht hier keine Ausnahme. Selbstverständlich [16]präsentiert sie eine Lesart der Politeia, die den Text aus zeitgenössischen metaphysischen und ethischen Debatten heraus deutet und für diese Debatten zu erschließen versucht. Hinzu kommt eine verstärkte Aufmerksamkeit für die literarischen Eigenarten und Techniken von Platons Schreiben, denn die Politeia ist auch ein herausragender Gegenstand für die Debatte zum Verhältnis von Philosophie und Literatur. In diesem Sinne ist diese Einführung ein systematischer Kommentar. Dennoch steht sie unter der Maßgabe, dem Werk auch in seinen sperrigen Aspekten gerecht werden zu wollen. Doch ist es womöglich nicht gar so schwer, beide Ziele miteinander zu verbinden. Im Gegenteil: Dass die Politeia sich auch mehr als 2000 Jahre nach ihrer Entstehung ohne große Anstrengung der Interpretation öffnet, kann man durchaus als ein Zeichen für die allerhöchste Qualität betrachten, die ein philosophischer Text überhaupt erreichen kann.
Abschließend noch einige Hinweise zur Benutzung dieser Einführung: Sie ist als fortlaufender Text angelegt, so dass man sie durchlesen kann, wenn man sich über den Inhalt der Politeia informieren will. Sie ist aber so unterteilt, dass man sie auch als Erläuterung zu einzelnen Abschnitten verwenden kann. Am besten liest man diese Einführung natürlich parallel zur Lektüre der Politeia selbst. Dazu stehen verschiedene Übersetzungen zur Verfügung (z. B. von Friedrich Schleiermacher, Otto Apelt, Karl Vretska und Rudolf Rufener sowie jüngst von Gernot Krapinger), die alle verwendbar sind, unter denen aber neuere Übersetzungen wie die von Rufener oder Krapinger wegen ihrer Balance zwischen Texttreue und Lesbarkeit zu bevorzugen sind. An diesen beiden orientieren sich auch die Übersetzungen in dieser Einführung.
Ich habe die Belegstellen jeweils mit der genauen sogenannten »Stephanus-Paginierung« (z. B. »327a 1«) versehen. Diese Zählung der platonischen Werke geht auf eine Ausgabe von [17]Henricus Stephanus aus dem 16. Jahrhundert zurück und hat sich als Standard eingebürgert, der alle Ausgaben und Übersetzungen miteinander vergleichbar macht. Die Angaben gehen dabei auf die neueste kritische Ausgabe des Originaltextes von Simon R. Slings (Oxford 2003) zurück. Ferner habe ich zentrale Ausdrücke auch im griechischen Wortlaut angegeben. Bei der dabei verwendeten Umschrift werden die langen Vokale Eta und Omega durch ê und ô angegeben. An den Stellen, an denen es grammatikalisch erforderlich war, habe ich diese Ausdrücke in den Plural gesetzt (Pluralendungen sind z. B. -oi und -ai). Im Laufe der Politeia ist viel von einem Modellstaat die Rede; da zu Platons Zeiten der politische Bezugsrahmen der Stadtstaat war und der Modellstaat daher immer auch eine Modellstadt ist, habe ich mir erlaubt, frei zwischen »Staat« und »Stadt« zu variieren.
In einer Einführung von begrenztem Umfang muss zwangsläufig vieles unter den Tisch fallen. Ich habe mich dennoch bemüht, auf alle wichtigen Punkte im Text einzugehen, um den Leserinnen und Lesern auch bei verwirrenden Wendungen im Gespräch wenigstens ein Interpretationsangebot zu machen. Das größte Opfer ist das Fehlen einer ausführlicheren Diskussion der Sekundärliteratur; sie wird nur dort erwähnt, wo ich mich ausdrücklich auf Interpretationen aus der Literatur beziehe. Angesichts der immensen Forschungsliteratur zur Politeia ist ein annähernd vollständiger Überblick ohnehin illusorisch. Wer sich in die aktuellen Diskussionen einarbeiten will, der sei auf die in jüngerer Zeit erschienenen Aufsatzsammlungen von Giovanni R. F. Ferrari, Otfried Höffe und Gerasimos Santas verwiesen, ferner auf den derzeit ausführlichsten Kommentar zur Politeia, der in italienischer Sprache von Mario Vegetti herausgegeben wurde. Die ausgiebigsten Informationen zu Platon insgesamt findet man im von Manfred Erler verfassten Band zu Platon, im Grundriß der Geschichte der [18]Philosophie. Gute Einführungen zu einzelnen Themen findet man im Platon-Handbuch, herausgegeben von Christoph Horn, Jörn Müller und Joachim Söder.
Gedankt sei an dieser Stelle Paul Hasselkuss und Tim Willmann (Düsseldorf), die Vorfassungen des Textes gründlich gelesen haben, sowie Matthias Tögel (Marburg), der mich in der Endredaktion unterstützt hat – und nicht zuletzt den Teilnehmerinnen und Teilnehmern meiner Seminare in Düsseldorf, Frankfurt a. M. und Gießen, mit denen ich die Überlegungen der folgenden Seiten diskutieren konnte.
[19]Übersicht über den Aufbau der Politeia
Buch I: Gespräche Sokrates – Kephalos / Polemarchos / Thrasymachos
Gespräch Sokrates – Kephalos: Ist Gerechtigkeit das Begleichen von Schulden? (328a–331b)
Gespräch Sokrates – Polemarchos: Ist Gerechtigkeit, jedem zu geben, was ihm zukommt? (331c–336a)
Gespräch Sokrates – Thrasymachos: Ist gerecht, was dem Stärkeren nützt? Ist es besser, ungerecht als gerecht zu sein? (336b–347e)
Buch II–X: Gespräch Sokrates – Glaukon / Adeimantos
Buch II: Themenstellung / Erläuterung der Leitfrage (357a–369b)
Buch II–IV: Entwicklung eines in drei Stände gegliederten Modellstaats, um die Gerechtigkeit »im Großen« zu bestimmen (369b–427d) (Entstehung der Stadt 369b–376c; Rolle der Dichtung in der Erziehung 376e–398b; Rolle der Musik 398c–403c; Rolle der Gymnastik, Medizin 403c–412b; Auswahl der Herrscher 412b–415d; Leben der Wächter 415d–324d; Erziehung und Gesetzgebung 423d–427d.)
Buch IV (Rest): Bestimmung der Gerechtigkeit (Bestimmung der Gerechtigkeit im Staat 427d–434d; Übertragung auf den einzelnen Menschen: Darstellung der Lehre von der dreigeteilten Seele 434d–441c; Übertragung der Bestimmung der Gerechtigkeit anhand des Modellstaats auf die menschliche Seele 441c–445c.)
Buch V: Details des Modellstaats; Philosophenherrschaft (Philosophenherrschaft 472b–474b; Einführung des Unterschieds zwischen Philosophen und Nichtphilosophen: [20]Philosophen verfügen über Wissen, während Nichtphilosophen nur über Meinungen verfügen, Unterscheidung zwischen Wissen und Meinung 474b–480a.)
Buch VI: Weiteres zur Philosophenherrschaft; der höchste Gegenstand der Philosophie (Rechtfertigung der Philosophenherrschaft 484a–490e; Gefährdung und Missbrauch der Philosophie 490e–497a; die Philosophen und der Staat 497a–502c; Ausbildung der Philosophen, Auswahl und Erziehung der zur Philosophie geeigneten Kinder 502d–504a; Vorstellung des höchsten Wissensgegenstands, des »Guten« oder der »Idee des Guten« 504a–506e; Sonnengleichnis 507a–509c; Charakterisierung des philosophischen Wissens im Liniengleichnis 509d–511e.)
Buch VII: Weiteres zur philosophischen Bildung (Darstellung des philosophischen Bildungsgangs im Höhlengleichnis 514a–517a; Auslegung des Höhlengleichnisses durch die Konkretisierung der philosophischen Ausbildung 517b–534e; Weiteres zur Auswahl und Ausbildung der Herrscher 535a–541b.)
Buch VIII–IX: Formen der Ungerechtigkeit in Staat und Seele(vier schlechte Verfassungen des Staates / vier schlechte Verfassungen des Menschen: Timokratie 545b–550b; Oligarchie 550c–555a; Demokratie 555b–562a; Tyrannis 562a–577b.)
Buch IX (Rest): Die abschließende Beantwortung der Leitfrage (Drei Beweise für das Unglück der Ungerechten und dafür, dass es nützlich ist, gerecht zu sein (577b–588b); der Nutzen von Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit 588b–592b.)
Buch X: Ein »Nachtrag« zur ontologischen Stellung der nachahmenden Kunst und ein Mythos über das Schicksal der unsterblichen Seele nach dem Tod. (Der ontologische Status der Nachahmung 595a–598d; Kritik der Dichtung 598d–608b; der Lohn der Gerechtigkeit nach dem Tod 608b–614a; der Mythos von Er 614a–21d.)
[21]Buch I
Vorbemerkung
Die Frage nach dem gerechten Leben, die den größten Teil der Politeia prägt und zusammenhält, wird erst zu Beginn des zweiten Buches gestellt. Das erste Buch ist zwar thematisch mit dieser Frage verbunden – auch hier geht es um Gerechtigkeit –, aber es steht außerhalb dieses großen Bogens. Das ist ein Grund, warum überlegt wurde, ob vielleicht erst spätere Herausgeber Buch I mit den restlichen Büchern zu einem Werk zusammengebunden haben. Hinzu kommen stilistische Gründe: Buch I entspricht im Stil eher Dialogen wie Laches, Menon oder Phaidon, die einer frühen Werkphase zugeordnet werden, während der Stil der restlichen Politeia Werken wie Theätet oder Phaidros ähnelt, die zur mittleren Phase in Platons Schaffen gehören.6 Obendrein tritt Sokrates in Buch I anders auf als in den anderen Büchern. Anstatt konstruktiv eigene Thesen vorzutragen, agiert er hier wie in den Frühdialogen anscheinend7 destruktiv: Er lässt die anderen Thesen formulieren, die [22]er durch Nachfragen prüft. Dabei geraten seine Gesprächspartner immer mehr in Schwierigkeiten, bis am Ende alle ohne greifbares Resultat dastehen.8 Allerdings folgt aus solchen Eigenarten nicht zwingend, dass die Politeia, so wie sie uns vorliegt, von Platon nicht als einheitliches Werk konzipiert wurde – schließlich kann Platon selbst einen früher verfassten Text als Eröffnung in die Politeia integriert haben. Dafür spricht, dass Platon in den weiteren Verlauf des Gesprächs eine ganze Reihe von Bezügen zu Buch I eingebaut hat. Letztlich hängt die Antwort auf die Frage nach der Einheit des Werks wesentlich davon ab, ob sich eine plausible, den Text möglichst umfassend integrierende Lesart finden lässt. Und mit Blick auf das erste Buch heißt dies wiederum vor allem: Kann man ihm eine überzeugende Funktion für den Leser zuweisen? Denn die Gesprächspartner des ersten Buchs treten im restlichen Werk in den Hintergrund, der Leser aber bleibt derselbe.
Für die Einschätzung der Funktion ist immer der Blick auf die Gesprächspartner hilfreich. Glaukon und Adeimantos9, die ab Buch II als Gesprächspartner auftreten, sind zwar keine [23]Philosophen, aber sie möchten von Sokrates etwas lernen. Damit beweisen sie nicht nur ihre Offenheit gegenüber einer philosophischen Herangehensweise, die sie ein vielstündiges Gespräch durchstehen lässt. Vor allem zeigen sie, dass sie zumindest ahnen, nicht zu wissen, was Gerechtigkeit ist. Die Gesprächspartner im ersten Buch sind dagegen auf unterschiedliche Weise davon überzeugt, schon zu wissen, was Gerechtigkeit ist: Kephalos wird gar kein Bedürfnis verspüren, sich belehren zu lassen, Polemarchos glaubt, die Dichter hielten die Antwort parat, und Thrasymachos ist ohnehin von sich überzeugt wie kaum jemand anderer. Zudem stehen Kephalos und Polemarchos für ein vorphilosophisches, in einer bestimmten sozialen Schicht verankertes Verständnis von Gerechtigkeit – sie verfügen über Besitz, sind aber als Metöken10 von der politischen Mitwirkung ausgeschlossen. Thrasymachos erscheint philosophisch gewitzter; er vertritt eine Haltung, die man in Athener Politikerkreisen antreffen konnte,11 die aber auch heutzutage hier und da vorkommen soll: Wer sich an die Regeln der Gerechtigkeit hält, ist dumm.
Diese Punkte zusammengenommen, scheint es mir nicht [24]schwer zu verstehen, warum Platon dem Hauptteil der Politeia das erste Buch vorgeschaltet hat: Er lädt den Leser dazu ein, sich selbst im Feld vorphilosophischer Intuitionen zur Gerechtigkeit zu orientieren und die Schwierigkeiten, die der Begriff bereithält, zu entdecken, um sich von der eventuellen Überzeugung, schon zu wissen, was Gerechtigkeit denn nun sei, zu befreien.
Die Situation des Gesprächs (327a–328c)
Dem Gespräch geht eine kurze Schilderung der Ausgangssituation voraus, aus der heraus sich das Gespräch entwickelte. Sokrates ist mit Glaukon auf dem Heimweg von einem Fest, da wird er plötzlich von hinten am Mantel festgehalten: Polemarchos hatte einen Sklaven geschickt, um Sokrates aufzuhalten, und es entspinnt sich ein kurzer, von Schlagfertigkeit und Augenzwinkern geprägter Wortwechsel, in dem sich Sokrates schließlich überreden lässt, nicht nach Hause zu gehen, sondern den Nachmittag in Polemarchos’ Haus zu verbringen, um am Abend noch den Fackelzug zu bestaunen, mit dem das Fest beendet werden soll.
Für den Leser, der den Rest des Buches kennt, ist diese Szene voller Anspielungen: Wir erleben einen schaulustigen Sokrates, der zum Hafen hinabgegangen war und folglich wieder auf dem Weg nach oben ist; schon das erinnert an das Bild des Höhlengleichnisses.12 Umso mehr gilt das für die von Fackeln erleuchtete nächtliche Szenerie, in die sich Sokrates nach dem Gespräch begeben wird. Der Sklave stoppt Sokrates mit einer körperlichen Interaktion, noch bevor das erste Wort [25]gesprochen war. Jemanden einfach am Mantel festzuhalten, war sicherlich auch im antiken Athen eine eher grobe Form der Annäherung. Fast könnte man etwas Gewaltsames darin sehen, was wiederum an das Höhlengleichnis erinnert: Dort wird der Höhlenbewohner mit Gewalt gezwungen, sich auf den Weg nach oben zu begeben. Auch wenn es allzu gezwungen erschiene, aus diesen Anspielungen eine ordentliche Parallele zum Höhlengleichnis zu machen, erscheint diese Eröffnung wie eine Einladung an den Leser, aktiv mit dem Text umzugehen, der vor ihm liegt, d. h. ihm nicht nur linear zu folgen, sondern vor- und zurückzulesen und über die Erfahrungen bei der ersten Lektüre zu reflektieren.
Kephalos und Sokrates (328c–331b)
Im Haus des Polemarchos angekommen, unterhält sich Sokrates zunächst mit dem Hausherrn, dem alten Kephalos. Das ist nicht nur dem Respekt geschuldet; es hat auch eine Funktion für die Einführung des Themas. Denn mit Kephalos wird nicht nur eine bestimmte Vorstellung von Gerechtigkeit eingeführt, sie wird auch mit einem Typus von Person verbunden.
Das Erste, was wir über Kephalos erfahren, ist, dass er das Alter nicht nur negativ empfindet, weil es ihn von vielen »rasenden Gebietern« befreit hat – gemeint sind Triebe und Bedürfnisse, allen voran der Sexualtrieb. Dass Kephalos deren Abnahme als wohltuend empfindet, zeigt, dass er die Triebe als Störenfriede einer als wohltuend empfundenen Ordnung betrachtet – er sieht mithin, dass es außer der Befriedigung der Triebe noch anderes gibt, was wertvoll ist, anderes, was Lust bereitet: etwa die Freude an der Unterhaltung (328d 4 f.), vor allem aber eine Wohlordnung (329d 5; das dort verwendete griechische Wort lautet kosmios und ist von kosmos, dem [26]allgemeinen Begriff für eine gute Ordnung, abgeleitet). Diese Ordnung kam für Kephalos jedoch nicht aus eigener Kraft zustande; sie hat sich gleichsam naturwüchsig eingestellt, als Folge des Alters.
Ferner erfahren wir, dass Kephalos wohlhabend ist. Und wieder ist es nicht der Besitz an sich, der Lust bereitet, sondern dass er dabei helfen kann, von Angst zu befreien. Denn im Alter werde man von Angst vor Strafen nach dem Tod geplagt (330d 9). Wenn man Geld habe, könne man noch vor seinem Tod eventuell begangenes Unrecht ausgleichen (330e 5 f.). Mit dem Wort »Unrecht« wird nun zum ersten Mal jenes Begriffsfeld betreten, das das Zentrum des ganzen restlichen Gesprächs bilden wird.
Welche Vorstellung von Gerechtigkeit ist in diesen Aussagen von Kephalos enthalten? Gerechtigkeit ist für ihn offensichtlich etwas, das sich durch materielle Güter herstellen lässt und somit in materiellen Gütern bemisst. Es handelt sich um eine Art der Güterverteilung. Welche Güterverteilung nun eine gerechte Verteilung ist, sagt Kephalos nicht ausdrücklich, da er nur von Ungerechtigkeit spricht; die ist aber dann gegeben, wenn ein vorher bestehender Zustand der Güterverteilung gestört wurde. Der gerechte Zustand ist demnach einer, in dem überkommene Besitzverhältnisse gewahrt bleiben. Dazu passt, dass Kephalos sein Vermögen ererbt und in etwa auf der gleichen Höhe gehalten hat: Er hat es also weder vermehrt – sprich: anderen nichts weggenommen –, noch hat er es vermindert und somit auch seinen Söhnen nichts weggenommen.
Entfernt man sich für einen Moment vom Kontext des 5. Jahrhunderts v. Chr., dürfte man in dieser kephaleischen Vorstellung von Gerechtigkeit eine wohlvertraute Auffassung wiederfinden: Denn es handelt sich um ein Konzept von Gerechtigkeit, das einen großen Teil unseres bürgerlichen Lebens prägt.
[27]Nachdem Kephalos seine Ansichten zum Thema dargelegt hat, startet Sokrates in der für ihn gewohnten Weise mit der Prüfung. Er beginnt mit einem Gegenbeispiel: Wenn man jemandem etwas zurückgibt – also das überkommene Besitzverhältnis wieder herstellt –, der Empfänger aber mit dem wiedererlangten Besitz etwas Schlechtes tun wird: Kann das gerecht sein?
Die Art der Argumentation, die Sokrates hier eröffnet, hat zwei Voraussetzungen. Erstens setzt sie voraus, dass die zu prüfende These als Definition formuliert ist, die mit strikter Allgemeingültigkeit gilt. Denn sonst könnte man sie nicht durch ein Gegenbeispiel widerlegen. So spricht denn Sokrates in der Tat sogleich auch von einer Definition (horos, 331d 2) und reicht die entsprechende allgemeine Formulierung nach:13
D1 Gerechtigkeit ist, die Wahrheit zu sagen und zurückzugeben, was man genommen14 hat. (331d 2 f.)15
Zweitens kann Sokrates’ Beispiel nur dann als Gegenbeispiel fungieren, wenn man eine weitere Prämisse hinzunimmt, nämlich, dass alles, was gerecht ist, auch gut ist. Damit ergibt sich nun folgendes Argument:
[28]P1 Alles, was eine Handlung des Zurückgebens von Genommenem ist, ist gerecht. (Folgerung aus D1)
P2 Alles, was eine gerechte Handlung ist, ist eine gute Handlung. (Zusätzliche Annahme)
K1 Wenn man jemandem, der vor Wut rast, sein Schwert zurückgibt, dann ist das gerecht. (Anwendung von P1)
K2 Wenn man jemandem, der vor Wut rast, sein Schwert zurückgibt, dann ist das gut. (Folgerung aus K1 und P2)
K3 Wenn man jemandem, der vor Wut rast, sein Schwert zurückgibt, dann ist das nicht gut. (Einschätzung des gesunden Menschenverstands)
Die Konklusionen K2 und K3 widersprechen sich. Dieser Widerspruch kann nur geschlichtet werden, wenn man eine der Prämissen aufgibt. Dafür kommen im Prinzip P1 oder P2 in Frage – doch da P2 nicht thematisiert wird, sondern als Hintergrundannahme herangezogen wurde, steht es nicht zur Disposition (tatsächlich wird sich der neu hinzugekommene Begriff »gut« als das heimliche Zentrum des ganzen Gesprächs erweisen). Fehlerhaft muss also P1 sein – und damit auch D1. Die in eine Definition gegossene Ansicht des Kephalos hat also der Prüfung nicht standgehalten.
Ich habe dieses einfache Argument so ausführlich dargestellt, weil es erstens ein Musterbeispiel für die Art und Weise ist, wie Sokrates in den sogenannten »Tugenddialogen«16 argumentiert und weil es zweitens auf eine überschaubare Weise zeigt, wie ein »sokratisches Gespräch« funktioniert – bzw. was es heißt, dass die Meinungen eines Gesprächspartners auf den Prüfstand gestellt werden. Wer sich auf ein sokratisches Gespräch einlässt, sieht sich dazu verpflichtet, auf einer Ebene der Allgemeinheit zu argumentieren und sich an logische [29]Prinzipien wie Ableitungsregeln und das Prinzip vom zu vermeidenden Widerspruch zu halten. Und die Meinungen, die er selbst äußert oder akzeptiert, werden auf ihre Widerspruchsfreiheit geprüft.
Kephalos bezeichnete sich zwar als einen Freund der Worte, doch als Sokrates nachzufragen beginnt, entzieht er sich rasch der weiteren Diskussion – er will ein Opfer darbringen, also auf seine Weise praktisch Gerechtigkeit herstellen. Polemarchos, sein Sohn, steht aber bereit, das »Erbe« der väterlichen Auffassung von Gerechtigkeit anzutreten. Damit beginnt der eigentliche argumentative Teil des Buchs I.
Polemarchos und Sokrates (331c–336a)
Polemarchos nimmt sein »Erbe« an, sucht aber zunächst nach Beistand bei einer nicht-philosophischen Autorität, dem Dichter Simonides. Dieser habe Folgendes gesagt:
D2 Jedem das Schuldige zurückzugeben ist gerecht. (331e 3 f.)
Diese neue Definition scheint D1 sehr ähnlich; mit dem »Schuldigen« wird lediglich ein allgemeinerer Begriff als »was man genommen hat« verwendet. So aufgefasst, scheitert Simonides natürlich auch an Sokrates’ Gegenbeispiel; eine andere Lesart muss also her. Polemarchos liefert sie auch gleich nach:
D3 Dass Freunde Freunden etwas Gutes tun, Schlechtes aber nicht, [das ist gerecht]. (332a 9 f.)
Polemarchos ergänzt auf Nachfrage, dass man den Feinden Schlechtes schulde (332b 7). Damit lässt sich Sokrates’ Beispiel [30]nun endlich integrieren: Sollte es sich bei der Person, deren Schwert man in Verwahrung hatte, um einen Freund handeln, ist es nicht gerecht, das Schwert zurückzugeben, denn damit tut man dem vor Wut rasenden Freund nichts Gutes; handelt es sich aber um einen Feind, dann ist es gerecht, das Schwert zurückzugeben. Sokrates ist allerdings mit der Formulierung noch nicht ganz zufrieden – und man kann ahnen, warum: D3 schränkt D2 auf eine Gruppe von Adressaten ein. Es ist keine universelle Definition der Gerechtigkeit. Er bringt Polemarchos daher dazu, einer Variante zuzustimmen:
D4 Gerecht ist, jedem das ihm Zukommende zu geben. (332c 2 f.)
Das griechische Wort »das Zukommende« (to proshêkon) unterscheidet sich von dem in D2 verwendeten Begriff »das Schuldige« (ta opheilomena) nur in der Ausrichtung: Die Schuld liegt beim Gebenden, das Kriterium für das Zukommen beim Empfänger. Von D3 unterscheidet sich D4 nur dadurch, dass wieder ein universell anwendbares Kriterium als Definiens der Gerechtigkeit dient.
Mit D4 ist nun die Definition gefunden, die im restlichen Gespräch mit Polemarchos der Prüfung unterzogen wird; sie reicht von 332c 5 bis 336a 10. Diese Prüfung unterscheidet sich nicht nur der Länge nach von der kurzen Prüfung von D1. Ihr Aufbau ist komplexer, die Hilfsannahmen sind zahlreicher. Als Ergebnis kommen jedoch erneut Widersprüche heraus, die diesmal Polemarchos als Adressaten von Sokrates’ Argumentation ratlos zurücklassen – und ebenso wohl den Leser, zumindest bei der ersten Lektüre.
Die Prüfung vollzieht sich in zwei Phasen. Die erste Phase reicht bis 334b; nach einer Argumentationskette, die beim Leser wegen ihrer dichten Staffelung leichten Schwindel [31]auslösen mag, endet sie mit der Konklusion, dass Gerechtigkeit eine Art von Diebeskunst sei. Polemarchos ist verwirrt, gibt aber nicht auf, sondern wiederholt seine Definition. Die zweite Phase endet 335e mit der Feststellung, dass der Gerechte überhaupt niemandem schaden kann, dies im Widerspruch zu D3. Polemarchos gibt nun seine Definition auf. Die Argumentation wirkt in diesem Abschnitt mitunter übertrieben ausführlich; ein Leser, der darüber die Geduld verliert, wird Thrasymachos’ nachfolgende Intervention umso leichter nachempfinden können.
Die erste Phase von 332c 5 bis 334b 7 basiert auf dem Vergleich der Gerechtigkeit mit einer Kunst(fertigkeit) (technê).17 Sokrates rechtfertigt diesen Vergleich nicht explizit; er unterstellt, dass er angemessen ist, da doch die Gerechtigkeit in D4 als etwas definiert wurde, das einen Effekt oder ein Produkt hat (nämlich das Zukommende zuzuteilen; vgl. 332d 2). Da eine Kunst sich für Sokrates unter anderem über ihr Anwendungsfeld definiert – so sind Gesundheit und Krankheit das Anwendungsfeld der Medizin, die Schifffahrt das Anwendungsfeld der Seemannskunst –, lautet die Folgefrage: Welches Anwendungsfeld hat jene Kunst, genannt Gerechtigkeit?
Polemarchos wittert hier noch keine Schwierigkeit, liefert D3 doch anscheinend eine Antwort: Das Anwendungsfeld sind Freunde und Feinde. Sokrates fragt aber nach etwas anderem – nicht nach den Adressaten, sondern nach der Art der Aufgabe, dem Gegenstands- oder Tätigkeitsbereich, der für die Gerechtigkeit spezifisch ist. Polemarchos schlägt daraufhin als [32]Anwendungsgebiet den Krieg vor – was plausibel klingt, denn dort ist die Unterscheidung zwischen Freunden und Feinden wesentlich: Sobald klar ist, wer Freund und wer Feind ist, weiß man, was man zu tun hat. Doch ist dieses Anwendungsgebiet für eine allgemeine Definition der Gerechtigkeit zu eng, denn Gerechtigkeit gibt es auch im Frieden (333a 1). Hier nun scheint aber jedes denkbare Anwendungsgebiet durch ein spezifisches Handwerk bereits abgedeckt. Polemarchos bringt als Anwendungsbereich Verhandlungen ins Spiel (333a 13). Sokrates lenkt diesen Vorschlag sogleich auf die soziale Dimension der Verhandlungen um: Jede Verhandlung setzt eine Gemeinschaft voraus – und dieser Gemeinschaft kann man wiederum, insofern sie handelt, ein bestimmtes Gebiet zuweisen, durch das sie sich definiert. Dieses Gebiet sei im Falle der Gerechtigkeit das Geld, meint Polemarchos schließlich (333b 10). Es ist ein passender Vorschlag, denn das Geld ist ebenso wenig an spezifische Bereiche gebunden wie die Gerechtigkeit – doch genau das lädt dazu ein, wieder nach dem Anwendungsbereich zu fragen: Geld an sich ist nutzlos, einen Effekt hat es erst dann, wenn man es für etwas ausgibt. Da nun für die Verwendung des Geldes in den einzelnen Anwendungsfeldern wieder die speziellen Kunstfertigkeiten zuständig sind, bleibt für die Gerechtigkeit als Anwendungsbereich nur dasjenige Geld übrig, das nicht ausgegeben wird (333c 11 f.). Verallgemeinert man dieses Resultat, heißt das: Die Gerechtigkeit hat einen positiven Effekt im Gegenstandsbereich X genau dann, wenn X nicht gebraucht oder benutzt wird (333e 1 f.).
Schon damit hat Sokrates Polemarchos’ Verständnis der Gerechtigkeit eigentlich ad absurdum geführt. Er setzt jedoch noch einmal nach: Wer eine Technik beherrscht, kann sie zum Guten und zum Schlechten anwenden (333e 2 ff.). Die Kunstfertigkeit der Gerechtigkeit besteht darin, etwas nicht zu gebrauchen, mithin etwas aufzubewahren; und da das schlechte [33]Gegenstück des Aufbewahrens das Stehlen ist, beweist sich die Kunst der Gerechtigkeit folglich auch darin, Geld zu stehlen. Gerechtigkeit ist also eine Art von Diebeskunst (334b 3 f.). Polemarchos ist damit an einen Punkt geführt worden, der der ursprünglichen Intuition – ausgedrückt in D1 – diametral entgegengesetzt ist.18
Man kann den Eindruck kaum von der Hand weisen, dass Sokrates hier mit einem intellektuell unterlegenen Polemarchos sein böses Spiel getrieben hat. Denn zumindest an einigen Stellen sind die Fehler in der Argumentation offensichtlich. Selbst wenn Gerechtigkeit eine Kunst des Nicht-Gebrauchens wäre, folgte daraus nicht, dass sie eine Kunst des Aufbewahrens ist. Wenn man Sparsamkeit als eine Kunst betrachtet, Geld nicht zu gebrauchen, ist sie doch verschieden von der Kunst des Safebauers. Und während ein Safebauer wohl auch weiß, wie man Safes knackt, gilt dies für einen bloß sparsamen Menschen keineswegs. Auch die Art und Weise, wie Sokrates den Vorschlag aufgreift, das Anwendungsfeld der Gerechtigkeit seien Verhandlungen, lässt eine offensichtliche Leerstelle: Gewiss verhandelt man um einer Sache willen, aber könnte die Kunst der Gerechtigkeit nicht in der Art und Weise der Verhandlungsführung bestehen? Vor allem letztere Auslassung kann man als einen Hinweis an den Leser auffassen, der Idee, Gerechtigkeit könnte gar keinen spezifischen Anwendungsbereich haben, sondern in einer Verfahrensweise bestehen, besondere Aufmerksamkeit zu schenken.
Was ist von der Behandlung der Gerechtigkeit als Kunst zu halten? Sie rückt ab von der Vorstellung, Gerechtigkeit bestehe in einem Zustand der Güterverteilung, der explizit D1 und [34]implizit auch D2–D4 zugrunde lag. Damit eröffnet sie eine neue Perspektive auf die Gerechtigkeit, und zwar im eben erwähnten Sinn einer Eigenschaft von Verfahrensweisen. Die Frage, welches das Anwendungsgebiet der Gerechtigkeit sei, ist zwar offensichtlich die Wurzel der Schwierigkeiten, in die Polemarchos gerät. Sie ist jedoch insofern nicht völlig abwegig, als man durchaus nach dem Nutzen der Gerechtigkeit fragen kann – das »Zukommende«, das die Gerechtigkeit nach D4 verschaffen soll, ist zwar dem Wortlaut nach nichts weiter als das, auf das man einen Anspruch hat, es liest sich jedoch leicht mit einem positiven Unterton: Gerechtigkeit ist etwas, das dem Adressaten einer gerechten Handlung etwas Gutes verschaffen soll.
Diese erste Phase der Prüfung hinterlässt einen verwirrten Polemarchos; doch wer verwirrt ist, vermag eben nicht zu erkennen, ob und wo er sich geirrt hat. Darum ist es konsequent, wenn Polemarchos seinen ursprünglichen Vorschlag D3 wiederholt (334b 8 f.), der so zum Ausgangspunkt der zweiten Phase wird (334c 1–336a 10). Sokrates eröffnet sie mit einem zwar nicht unwichtigen, aber dennoch scheinbar abseitigen Punkt, nämlich der Frage, ob wir uns nicht manchmal darin irren, ob jemand ein Freund ist. Natürlich tun wir das. Aber was hat ein solcher epistemischer Punkt – ein Punkt, der die Anwendung von D3 betrifft – mit der Korrektheit der Definition zu tun? Polemarchos jedenfalls scheint leichtes Spiel damit zu haben, Sokrates’ neues Problem zurückzuweisen: Wir müssen der Definition bloß hinzufügen, dass diejenigen, denen Gutes zu tun gerecht ist, nicht bloß als Freunde erscheinen, sondern es auch sind (334e 10 f.).
Was nun folgt, ist einer jener Abschnitte, die auch einem gutwilligen Leser dank einer haarspalterisch anmutenden Auseinandersetzung die Geduld rauben können: Worauf will Sokrates hier überhaupt hinaus? Immerhin führt er wieder [35]eine neue Bestimmung unter der Hand ein, nämlich die Definition des Begriffes »Freund«. Freund sei, wer »rechtschaffen« (chrêstos) ist (334c 1 f.). Das Wort, das Sokrates hier benutzt, bedeutet, wenn man es auf Dinge anwendet, »nützlich«. Auf Menschen angewendet, ist dies keine angemessene Übersetzung, doch hat Sokrates mit dieser neuen Formulierung auf die Wertung, die in der Rede von Freund und Feind mitschwingt, neues Licht geworfen. Denn nun hängt, ob jemand Freund ist, von einem Kriterium ab, das in einem objektivierbar Guten besteht. Wer mein Freund ist, mag eine ganz und gar willkürliche Sache sein; die Beantwortung der Frage, wer rechtschaffen ist – man könnte sagen: wer ein wahrer Freund ist –, ist keine Angelegenheit bloßer Willkür mehr. Daher ist es konsequent, wenn Sokrates am Ende dieses Abschnitts den Freund schließlich als den Guten bestimmt (335a 3).
D3 erhält auf diese Weise einen neuen Klang: Gerecht zu sein heißt demnach, jemandem, der gut ist, etwas Gutes zu tun, und jemandem, der schlecht ist, etwas Schlechtes zu tun (335a 8 f.). Der neue Klang kommt dadurch zustande, dass der Effekt der Gerechtigkeit nun in einem intrinsischen Verhältnis zur Verfassung des Adressaten der gerechten Handlung steht.
Das ist ein Baustein der Argumentation, die Sokrates hier aufbaut. Der andere Baustein hängt mit einem für die platonische und überhaupt die antike Ethik zentralen Begriff zusammen, dem der aretê, der hier (335b 8) zum ersten Mal in der Politeia auftaucht: aretê meint zwar auch das, was man heute mit dem Wort »Tugend« wiedergibt. Allgemeiner gesehen geht es aber eher um eine »gute innere Verfassung« (der Begriff wird daher oft mit »Tüchtigkeit«, manchmal auch mit »Fähigkeit« übersetzt). Die Gerechtigkeit ist eine menschliche aretê (335c 4) – Sokrates lässt sich dies ausdrücklich von Polemarchos bestätigen. Kann man nun durch eine eigene aretê die Verfassung – die aretê – eines anderen Menschen schlechter [36]machen? Anders gefragt: Kann der Gerechte einen anderen Menschen in seiner aretê schlechter machen? So nämlich muss man nun die Behauptung aus D3 auffassen, dass es gerecht sei, seinen Feinden zu schaden. Das scheint unmöglich zu sein: Eine Tugend kann man durch eine Tugend nur besser, nicht schlechter machen. Damit ist D3 aus dem Spiel, wie Sokrates und Polemarchos übereinstimmend feststellen (335e).
Was ist von dieser Argumentation zu halten? Auf einige nicht ausgewiesene und daher nicht begründete Annahmen habe ich schon hingewiesen; sie werden sich als Vorgriffe erweisen. Offen bleibt, ob mit der Widerlegung von D3 auch D4 aus dem Spiel ist oder ob vielleicht die erste Phase der Argumentation gegen D4 und die zweite spezifisch gegen D3 gerichtet war.
Vor allem scheint mir aber wichtig zu sein, einen Widerspruch in den Argumentationsstrategien beider Phasen festzuhalten. Denn in der ersten Phase hatte Sokrates die Gerechtigkeit als eine Kunstfertigkeit verstanden und daraus unter anderem abgeleitet, dass man die Gerechtigkeit, wie jede Kunst, zum Guten wie zum Schlechten einsetzen kann. Die Einstufung der Gerechtigkeit als aretê des Menschen ist mit dieser Konsequenz aber nicht vereinbar; wenn man daher an der Prämisse der zweiten Argumentationsphase, dass die Gerechtigkeit als aretê nur gute Effekte haben kann, festhalten möchte, dann kann man sie nicht länger als eine Kunstfertigkeit im üblichen Sinne behandeln.19
Fassen wir kurz den Stand der Dinge zusammen: Die [37]Gespräche mit Kephalos und Polemarchos sollten, so mein Vorschlag, nicht-philosophische, bürgerliche Intuitionen über Gerechtigkeit ins Spiel bringen, Intuitionen, in denen wir uns auch heute noch leicht wiederfinden können: Gerechtigkeit ist eine Frage der Güterverteilung, und ihren Maßstab entnimmt sie den überkommenen Verhältnissen. Erben ist darum keine Ungerechtigkeit, Stehlen dagegen durchaus. Sokrates hat mit seinem ersten Gegenbeispiel auf eine Schwierigkeit aufmerksam gemacht, die sich wiederum leicht nachvollziehen lässt: Gerechte Verhältnisse stehen noch unter einem anderen Maßstab, für den in pauschaler Weise das Wort »gut« steht. Wer heute überkommene Besitzverhältnisse als ungerecht kritisiert, der beruft sich auf einen solchen Maßstab. Was darauf in der Auseinandersetzung mit Polemarchos folgte, war nicht sonderlich dazu angetan, für weitere Klarheit zu sorgen; dazu hat Sokrates zu viele neue Begriffe ins Spiel gebracht und Analogien gezogen, die durch seine eigene Argumentation in Frage gestellt werden. Wenn man diesen Argumentationen eine Funktion mit Blick auf die Erarbeitung des Themas der Gerechtigkeit zuweisen wollte, dann wäre es am ehesten die einer Erweiterung des Feldes: Ist die Gerechtigkeit eine Kunstfertigkeit, eine Methode? Wenn sie kein spezielles Anwendungsgebiet hat, wie lässt sich ihre Universalität erklären? Oder hat Polemarchos vielleicht doch recht, und das Feld der Gerechtigkeit sind Verhandlungen, sei es im privaten, sei es im politischen Bereich? Wie verhält sich die Intuition, dass Gerechtigkeit eine Frage der Güterverteilung ist, zur Idee, dass Gerechtigkeit eine Tugend und damit in erster Linie eine Eigenschaft einzelner Menschen ist? Für Kephalos ist der gerechte Mensch einer, der alle seine Schulden beglichen hat. Lässt sich die [38]individuelle Gerechtigkeit auf diese Weise bestimmen, oder ist es nicht zuallererst eine innere Haltung, die sich dann womöglich in gerechten Handlungen auswirkt?
Thrasymachos und Sokrates I (336b–343a)
Bevor sich das Gespräch einer konstruktiven Antwort auf derartige Fragen zuwendet, hat Platon noch eine ganz andere Auseinandersetzung um die Gerechtigkeit gestellt, nämlich mit dem Sophisten Thrasymachos20, der dem bisherigen Gespräch mit wachsender Ungeduld zugehört hatte und nun nicht mehr an sich halten kann. Wie ein »wildes Raubtier« stürzt er sich in die Diskussion (336b 5).
Dem eigentlichen Gespräch geht ein Geplänkel zwischen Sokrates und Thrasymachos voraus, das in mehrfacher Hinsicht interessant ist (336b 1–338c 1). Erstens charakterisiert es die neue Gesprächssituation. Thrasymachos greift Sokrates zunächst nicht inhaltlich, sondern auf der Ebene der Gesprächsführung an. Dadurch entsteht der Eindruck, es handele sich um Gegner »auf Augenhöhe«, die die Methoden des anderen jeweils durchschauen. Außerdem wird die Atmosphäre aggressiver, aber auch spannungsreicher: Es geht von nun an um einen intellektuellen Kampf, der nach einem Sieger verlangt.
Wie sind die Vorwürfe einzuschätzen, die Thrasymachos gegen Sokrates’ Vorgehensweise erhebt? Zum einen verlangt er, Sokrates solle aufhören, bloß Fragen zu stellen, sondern sich mit eigenen Thesen selbst angreifbar machen (336c, 337a, [39]337e). Zum anderen wirft er Sokrates vor, seine Begriffe seien unpräzise (336d 3). Wie gesehen, agierte Sokrates gegenüber Polemarchos in einer Weise, die man durchaus als unfair charakterisieren könnte. Und in der Tat brachte Sokrates viele Thesen und Begriffe ins Spiel, ohne sich letztlich um ihre Klärung zu kümmern. Trotzdem treffen die Einwände ihr Ziel nicht exakt.
Sollte Sokrates meinen, dass der bisherige unbefriedigende Gesprächsverlauf nicht bösem Willen, sondern mangelndem Wissen geschuldet war, so entspricht das seiner tatsächlichen Haltung. Es ist keine Verstellung, wie ihm Thrasymachos vorwirft (337a). Sokrates kann keine einfache und kurze Antwort auf die Frage geben, was Gerechtigkeit sei, auch wenn er – wie die restlichen Bücher der Politeia zeigen werden – weit ausführlichere Thesen im Kopf hat, als er bis jetzt hat durchscheinen lassen, so dass sein Agieren gegenüber Polemarchos ohne Zweifel etwas Strategisches hatte. Außerdem schießt Thrasymachos’ Kritik an den Begriffen weit übers Ziel hinaus, denn er möchte alle Begriffe ausschließen, die die Gerechtigkeit in die Nähe des Guten bringen und damit Sokrates die Position verbieten, die diesem voraussichtlich am nächsten liegt. Wie man gleich sehen wird, hält sich Thrasymachos selbst aber nicht ganz an seine Vorgabe (wie auch Sokrates nicht vergisst anzumerken, vgl. 339a 6 f.). Die Kritik bekommt dadurch etwas von einem wilden Umsichschlagen.
Man darf allerdings nicht vergessen, dass wir es hier mit einer keineswegs neutralen Darstellung zu tun haben, denn der eigentliche Berichterstatter – Sokrates – ist eine der Parteien.21[40]Ohne Zweifel spiegelt sich aber in der Parteilichkeit der Schilderung das Klima, das Thrasymachos in das Gespräch hineingetragen hat.
Worum geht es nun inhaltlich? Welche Perspektive auf die Gerechtigkeit bringt Thrasymachos ins Spiel? Dessen Auftritt ist auch deshalb so dramatisch gestaltet, weil so der Anspruch unterstrichen wird, den Gerechtigkeitsbegriff völlig neu zu definieren.22 Thrasymachos will sich nicht nur von philosophischen Haarspaltereien, er will sich auch von der bürgerlichen Vorstellung eines Kephalos oder Polemarchos absetzen. Platon bringt so mit der Figur des Thrasymachos nicht nur eine bestimmte politische Gerechtigkeitsvorstellung ins Spiel. Er wirft auch die Frage auf, inwieweit es überhaupt möglich ist, einen Begriff neu zu definieren. Thrasymachos beginnt mit folgendem Definitionsvorschlag:
D5 Das Gerechte ist nichts anderes als das dem Stärkeren Nützliche (338c 2 f.)
Es wirkt etwas skurril, wenn er sich sofort danach Beifall heischend umschaut. Sokrates’ erste Reaktion wirkt, als wolle er ein wenig Luft aus dem aufgeblasenen Thrasymachos herauslassen: Er fasst »stärker« als »physisch stärker« auf und schließt so aus Thrasymachos’ Definition, dass beispielsweise Rindfleisch zu essen gerecht sei, wenn es denn starken Männern nützlich ist. So hat Thrasymachos es natürlich nicht gemeint, denn ihm ging es um politische Macht, und so reformuliert er seine Definition (338e 1–339a 4):
[41]D6 (1) Gerecht ist, was in einer Gesellschaft als positives Recht besteht.
(2) Was in einer Gesellschaft als positives Recht besteht, ist zum Nutzen der Herrscher.
Denn das positive Recht, also die Gesetze, ist vom Herrscher aufgrund seiner Macht durchgesetzt worden; und da jeder tut, was für ihn von Vorteil ist, ist das positive Recht immer zum Vorteil der Herrschenden. Eine besondere Pointe dieser Definition liegt darin, dass ihr zufolge der Herrscher immer auch festlegt, worauf das Prädikat »ist gerecht« anzuwenden ist. Anders gesagt: Der Herrscher legt mit den Gesetzen auch die Extension des Gerechtigkeitsbegriffs fest.
Das wirft unmittelbar die Frage auf, warum es sich bei D6 überhaupt um eine Definition der Gerechtigkeit