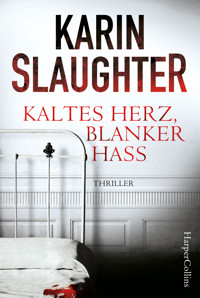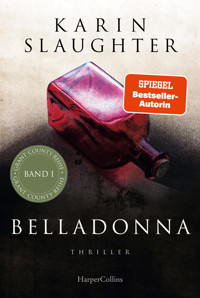Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Harper Audio
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
März 1991. Nach einer Party kehrt die 19-jährige Julia nicht nach Hause zurück. Die eher halbherzig geführten Ermittlungen laufen ins Leere. Eine Leiche wird nie gefunden. Weder die Eltern noch die beiden Schwestern der Vermissten werden je mit dem Verlust fertig. Vierundzwanzig Jahre später erschüttert eine brutale Mordserie den amerikanischen Bundesstaat Georgia. Und die frisch verwitwete Claire ist vollkommen verstört, als sie im Nachlass ihres verstorbenen Mannes brutales Filmmaterial findet, in dem Menschen ganz offensichtlich vor der Kamera auf grausame Weise ermordet werden. Eines der Opfer glaubt sie zu erkennen. Doch was hatte ihr verstorbener Mann damit zu tun? Wer war der Mensch wirklich, den sie über zwanzig Jahre zu kennen glaubte? Claire begibt sich auf eine lebensgefährliche Spurensuche, die sie immer dichter an eine unfassbare Wahrheit führt. Und an den eigenen Abgrund ... "Das klingt spekulativer, als es dann ist: Bei der Darstellung von Gewalt bleibt Slaughter vergleichsweise dezent, die größte Stärke des Romans liegt in der Empathie, mit der sie von der sukzessiven Wiederannäherung zweier Frauen erzählt, die aufgrund eines traumatischen Erlebnisses in ihrer Jugend - die dritte Schwester verschwand spurlos - sich selbst und einander jahrzehntelang entfremdet waren." (Marcus Müntefering, SPIEGEL ONLINE) "Ihre Thriller gehören zum Härtesten, was man zwischen zwei Buchdeckeln finden kann. […] Großartige bis verstörende Spannungsliteratur" (Stephan Bartels, BRIGITTE) "Typisch sind auch ihre psychologischen Studien sowie nervenaufreibende Szenen, denen es weder an Brutalität noch an detaillierter Gewaltdarstellung fehlt. […] "Pretty Girls" ist nicht einfach blutiger Thrill, sondern Abbild einer Seite des Lebens, die Slaughter - im Gegensatz zu anderen Krimi-Autor(inn)en - heranzoomt und sie in ihrer Schrecklichkeit darstellt. Wer Slaughter liebt - und das sind Millionen Leser weltweit - wird sich davon nicht abschrecken lassen und zu ihren Thrillern greifen. ‘Pretty Girls‘ gibt eine nervenaufreibende Geschichte aus der Opfer-Perspektive wieder." (DPA, Frauke Kaberka) "In ihrem jetzt erschienenen Werk ‘Pretty Girls‘ steht kein Ermittler im Zentrum, brutal - und sehr spannend - wird es aber auch hier." (Gala Online) "Definitiv eine der besten Thriller-Autorinnen unserer Zeit." Gillian Flynn "Karin Slaugher bietet weit mehr als unterhaltenden Thrill." SPIEGELonline über "Pretty Girls "Karin Slaughters Helden sind weder strahlend noch fehlerfrei, und deswegen überzeugend." Frauke Kaberka, dpa "Stoff für schlaflose Nächte!" buchjournal
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
HarperCollins
HarperCollins® Bücher erscheinen in der HarperCollins Germany GmbH, Valentinskamp 24, 20354 Hamburg
Copyright © 2015 HarperCollins in der HarperCollins Germany GmbH Deutsche Erstveröffentlichung
Titel der nordamerikanischen Originalausgabe: Pretty Girls Copyright © 2015 by Karin Slaughter erschienen bei: HarperCollins Publishers, New York
Covergestaltung von Hafen Werbeagentur, Hamburg Coverabbildung von Lyn Randle / Trevillion Images, Groundback Atelier / Shutterstock Redaktion: Silvia Kuttny-Walser eBook-Herstellung: GGP Media GmbH, Pößneck ISBN 978-3-95967-986-2
www.harpercollins.de
Widmung
„Eine besonders schöne Frau ist ein Quell des Schreckens.“
C. G. Jung
I
Als du damals verschwunden bist, sagte deine Mutter, dass es schlimmer wäre, genau zu wissen, was dir zugestoßen ist, als es nie zu erfahren. Wir stritten pausenlos über dieses Thema, denn Streiten war das Einzige, was uns zu dieser Zeit zusammenhielt.
„Die Einzelheiten zu kennen wird es nicht leichter machen“, warnte sie. „Die Einzelheiten werden dich zerreißen.“
Ich war ein Mann der Wissenschaft. Ich brauchte Fakten. Ob ich wollte oder nicht, mein Verstand produzierte unablässig Hypothesen: Entführt. Vergewaltigt. Geschändet.
Rebellisch.
Das nämlich war die Theorie des Sheriffs, oder zumindest war es seine Ausrede, wenn wir Antworten forderten, die er uns nicht geben konnte. Deine Mutter und ich hatten uns insgeheim immer gefreut, weil du deine Anliegen so eigensinnig und leidenschaftlich vertreten hast. Als du dann verschwunden warst, mussten wir feststellen, dass es genau diese Eigenschaften sind, die junge Männer als intelligent und ehrgeizig erscheinen lassen und junge Frauen als schwierig.
„Mädchen laufen ständig weg.“ Der Sheriff hatte mit den Schultern gezuckt, als wärst du ein x-beliebiges Mädchen, als würdest du nach einer Woche, einem Monat, vielleicht einem Jahr in unser Leben zurückkehren, mit einer halbherzigen Entschuldigung wegen eines Jungen, dem du nachgelaufen warst, oder einer Freundin, der du dich für einen Trip nach Europa angeschlossen hattest.
Du warst neunzehn Jahre alt. Rechtlich gesehen, gehörtest du uns nicht mehr. Du gehörtest dir selbst. Du gehörtest der ganzen Welt.
Dennoch organisierten wir Suchmannschaften. Wir telefonierten immer wieder mit Krankenhäusern, Polizeidienststellen und Obdachlosenzentren. Wir hängten überall Suchplakate auf. Wir klopften an Türen. Wir sprachen mit deinen Freunden. Wir sahen in leer stehenden Gebäuden und ausgebrannten Häusern in den üblen Vierteln der Stadt nach. Wir engagierten einen Privatdetektiv, der die Hälfte unserer Ersparnisse einsackte, und einen Hellseher, der den größten Teil vom Rest kassierte. Wir appellierten an die Medien, doch die Medien verloren rasch das Interesse, als die saftigen Einzelheiten ausblieben, über die man sensationslüstern hätte berichten können.
Was wir wussten, war Folgendes: Du warst in einer Kneipe. Du hast nicht mehr als sonst getrunken. Du hast deinen Freunden gesagt, dir sei nicht gut und du wolltest zu Fuß nach Hause gehen. Seitdem hat dich niemand mehr gesehen.
Im Lauf der Jahre gab es viele falsche Geständnisse. Das Rätsel um dein Verschwinden zog scharenweise Trittbrettfahrer und Sadisten an. Sie lieferten Einzelheiten, die sich nicht beweisen, Spuren, die sich nicht verfolgen ließen. Aber wenigstens waren sie ehrlich, wenn man ihnen auf die Schliche kam. Die Hellseher warfen mir immer nur vor, nicht energisch genug zu suchen.
Doch in Wirklichkeit hörte ich nie auf, dich zu suchen.
Ich verstehe, warum deine Mutter aufgegeben hat. Oder zumindest diesen Eindruck erwecken musste. Sie musste ein neues Leben aufbauen, wenn schon nicht für sich selbst, dann für den Rest der Familie. Deine kleine Schwester wohnte noch zu Hause. Sie war still und unauffällig, doch sie trieb sich mit der Sorte Mädchen herum, die sie zu Dingen überredeten, die man lieber nicht tun sollte. Wie zum Beispiel sich in eine Kneipe zu schleichen, um Musik zu hören und dann nie wieder nach Hause zu kommen.
An dem Tag, als wir die Scheidungspapiere unterzeichneten, sagte deine Mutter zu mir, sie hoffe nur, wir würden eines Tages deine Leiche finden. Es war das, woran sie sich klammerte, die Vorstellung, wir würden dich eines Tages doch noch zur letzten Ruhe betten können.
Ich erwiderte, vielleicht würden wir dich ja doch in Chicago, Santa Fe oder Portland finden oder in einer Hippie-Kommune, in der du dich verkrochen hast. Schließlich bist du schon immer ein Freigeist gewesen.
Es überraschte deine Mutter nicht, mich das sagen zu hören. Zu dieser Zeit schwang das Pendel der Hoffnung bei uns noch hin und her, sodass sie an manchen Tagen zutiefst deprimiert im Bett blieb und an anderen mit einer Bluse, einem Pullover oder einer Jeans nach Hause kam, die sie dir schenken wollte, wenn du zu uns zurückkehren würdest.
Ich erinnere mich noch genau an den Tag, an dem ich die Hoffnung verlor. Ich arbeitete gerade in der Tierarztpraxis im Zentrum, als jemand einen herrenlosen Hund bei uns ablieferte. Das Tier war in einem kläglichen Zustand und offenbar misshandelt worden. Es war ein gelb gescheckter Labrador, wenngleich das jetzt mit seinem aschgrauen Fell vom Leben im Freien kaum noch zu erkennen war. An seinem Hinterteil hingen Klumpen von Stacheln und Dornen. Auf den kahlen Stellen im Fell war die Haut entzündet, weil das Tier sich zu heftig gekratzt oder zu oft geleckt hatte – Dinge, die Hunde tun, um sich zu beruhigen, wenn man sie allein lässt.
Ich verbrachte eine Weile mit ihm, um ihm zu vermitteln, dass ich keine Gefahr für ihn darstellte. Er durfte meine Hand lecken, und ich gab ihm Zeit, sich an meinen Geruch zu gewöhnen. Nachdem er sich etwas beruhigt hatte, begann ich mit der Untersuchung. Es war ein älterer Hund, aber noch bis vor Kurzem waren seine Zähne gut gepflegt worden. Eine Operationsnarbe ließ darauf schließen, dass ein verletztes Knie früher einmal sorgfältig und kostspielig wiederhergestellt worden war. Die offensichtlichen Misshandlungen, die das Tier erlitten hatte, waren noch nicht in sein Muskelgedächtnis vorgedrungen. Wenn ich die Hand an sein Gesicht legte, ließ er den Kopf entspannt auf meine Handfläche sinken.
Ich sah in die kummervollen Augen dieses Tieres und malte mir Einzelheiten aus dem Leben dieses armen Geschöpfes aus. Natürlich konnte ich es nicht mit Bestimmtheit wissen, doch mein Herz sagte mir, dass Folgendes geschehen war: Dieser Hund war nicht ausgesetzt worden; er hatte sich einfach verlaufen oder war aus seinem Halsband geschlüpft und weggerannt. Seine Besitzer waren beim Einkaufen gewesen oder in Urlaub gefahren, und irgendwie – ein offen gelassenes Tor, ein Zaun, über den er sprang, eine Tür, die eine Haushälterin nicht richtig geschlossen hatte – hatte sich dieses behütete Wesen plötzlich allein in den Straßen wiedergefunden und nicht gewusst, wie es zurück nach Hause kommen sollte.
Und eine Gruppe Jugendlicher oder ein unbeschreibliches Monster – oder eine Kombination aus beidem – hatte den Hund aufgegriffen und einen zärtlich umsorgten Liebling in ein gehetztes Tier verwandelt.
Wie mein Vater habe auch ich mein Leben der Behandlung von Tieren gewidmet, aber damals stellte ich zum ersten Mal den Zusammenhang zwischen den schrecklichen Dingen her, die Menschen Tieren antun, und den noch schrecklicheren, die sie anderen Menschen zufügen.
So sah es aus, wenn eine Kette die Haut aufriss. So sah der Schaden aus, den Tritte und Schläge verursachten. Und so sah ein Mensch aus, wenn er in eine Welt geriet, in der man sich nicht um ihn sorgte, in der man ihn nicht liebte und aus der man ihn nie nach Hause zurückkehren lassen wollte.
Deine Mutter hatte recht gehabt.
Die Einzelheiten zerrissen mich.
1. KAPITEL
Das Restaurant in der Innenstadt von Atlanta war leer bis auf einen einsamen Geschäftsmann an einem Ecktisch und den Barkeeper, der sich anscheinend für einen Meister in der Kunst des Flirtens hielt. Die Vorbereitungen für das Abendessen kamen langsam auf Touren. In der Küche klapperten Besteck und Porzellan. Ein Koch brüllte. Eine Bedienung stieß ein beleidigtes Lachen aus. Aus dem Fernseher über der Bar drang leise ein steter Strom schlechter Nachrichten.
Claire Scott versuchte, das endlose Trommelfeuer von Geräuschen zu ignorieren, während sie an der Bar saß und an ihrem zweiten Club-Soda nippte. Paul hatte zehn Minuten Verspätung. Er kam sonst nie zu spät, normalerweise war er zehn Minuten zu früh dran. Das gehörte zu den Dingen, mit denen sie ihn neckte, obwohl sie es im Grunde nicht anders haben wollte.
„Noch eins?“
„Sicher.“ Claire lächelte den Barkeeper höflich an. Seit sie Platz genommen hatte, hatte er versucht, ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen. Er war jung und gut aussehend, und sie hätte sich geschmeichelt fühlen müssen, doch sie kam sich einfach nur alt vor – nicht weil sie tatsächlich alt war, sondern weil sie bemerkt hatte, dass ihr Menschen in den Zwanzigern umso mehr Verdruss bereiteten, je weiter sie selbst auf die vierzig zuging. In ihrer Gesellschaft dachte sie ständig Sätze, die mit „Als ich in dem Alter war …“ anfingen.
„Das dritte“, sagte der Barkeeper augenzwinkernd, als er ihr Soda-Glas auffüllte. „Sie ziehen sich das Zeug ja ganz schön rein.“
„Ach ja?“
Er blinzelte ihr zu. „Sagen Sie Bescheid, wenn Sie jemanden brauchen, der Sie nach Hause fährt.“
Claire lachte, weil das einfacher war, als ihm zu sagen, er solle sich die Haare aus den Augen streichen und zurück zu seiner Schulbank gehen. Wieder sah sie auf ihrem Handy nach der Uhrzeit. Paul hatte inzwischen zwölf Minuten Verspätung. Sie begann, sich Katastrophen auszumalen: in seinem Wagen entführt, von einem Bus angefahren, von einem herabfallenden Flugzeugteil erschlagen, von einem Verrückten verschleppt.
Die Eingangstür ging auf, aber es waren andere Leute, nicht Paul. Sie trugen lässige Businesskleidung. Vermutlich waren es Angestellte aus den umliegenden Bürogebäuden, die sich noch einen Feierabend-Drink genehmigten, bevor sie sich auf die Heimfahrt in die Vororte machten, wo sie bei ihren Eltern im Souterrain wohnten.
„Haben Sie das hier verfolgt?“ Der Barkeeper nickte in Richtung Fernseher.
„Nicht wirklich“, sagte Claire, obwohl sie die Story selbstverständlich verfolgt hatte. Man konnte keinen Sender einschalten, ohne von dem vermissten Teenager zu hören. Ein sechzehnjähriges Mädchen. Weiß. Mittelschicht. Sehr hübsch. Irgendwie schien die Empörung immer nicht ganz so groß zu sein, wenn ein hässliches Mädchen verschwand.
„Tragisch“, sagte der Barmann. „Sie ist so schön.“
Claire sah wieder auf ihr Handy. Paul war jetzt dreizehn Minuten zu spät dran. Ausgerechnet heute. Er war Architekt, kein Gehirnchirurg. Es konnte keinen so schlimmen Notfall geben, dass er nicht zwei Sekunden für eine SMS oder einen Anruf übrig gehabt hätte.
Sie begann, ihren Ehering am Finger zu drehen, eine nervöse Angewohnheit, die ihr nicht bewusst gewesen war, bis Paul sie darauf aufmerksam gemacht hatte. Sie hatten sich über irgendetwas gestritten, das Claire zu diesem Zeitpunkt offenbar ungeheuer wichtig gewesen war, aber jetzt erinnerte sie sich weder an das Thema noch daran, wann der Streit überhaupt stattgefunden hatte. Letzte Woche? Letzten Monat? Sie kannte Paul seit achtzehn Jahren und war beinahe ebenso lange mit ihm verheiratet. Es gab nicht mehr viel, worüber sie mit einiger Überzeugung streiten konnten.
„Sind Sie sicher, dass ich Sie nicht doch für was Härteres interessieren kann?“ Der Barkeeper hielt eine Flasche Wodka hoch, aber es war klar, was er meinte.
Claire zwang sich erneut zu einem Lachen. Sie kannte diese Sorte Mann schon ihr ganzes Leben lang. Hochgewachsen, dunkelhaarig und gut aussehend, mit blitzenden Augen und einem geschmeidigen Mundwerk. Mit zwölf hätte sie ihr Matheheft mit seinem Namen vollgekritzelt. Mit sechzehn hätte sie ihm erlaubt, seine Hand unter ihren Pullover zu stecken. Als sie zwanzig war, hätte er mit seiner Hand machen dürfen, was er wollte. Und jetzt, mit achtunddreißig, wollte sie nur, dass er endlich abhaute.
„Nein danke“, sagte sie. „Mein Bewährungshelfer hat mir geraten, nur dann Alkohol zu trinken, wenn ich den ganzen Abend zu Hause bin.“
Sein Lächeln zeigte, dass er den Witz nicht ganz verstanden hatte. „Böses Mädchen, was? Sie gefallen mir.“
„Sie hätten mich mal mit meiner Fußfessel sehen sollen.“ Sie blinzelte ihm zu. „Schwarz ist das neue Orange.“
Die Eingangstür ging auf: Es war Paul. Erleichterung durchflutete Claire, als er auf sie zukam.
„Du hast dich verspätet“, sagte sie.
Paul küsste sie auf die Wange. „Tut mir leid. Ich habe keine Entschuldigung. Ich hätte anrufen sollen. Oder eine SMS schicken.“
„Ja, das hättest du.“
Paul wandte sich an den Barkeeper. „Glenfiddich, einen einfachen, aber anständig eingeschenkt.“
Claire beobachtete, wie der junge Mann Pauls Whisky mit bisher nicht erlebter Professionalität einschenkte. Der Ehering und ihre milderen und deutlicheren Zurückweisungen waren nur unbedeutende Hindernisse gewesen. Kein Vergleich mit dem deutlichen Nein, das die Anwesenheit eines anderen Mannes ausdrückte, der sie auf die Wange küsste.
„Sir.“ Er servierte Paul den Drink und eilte dann ans andere Ende der Theke.
Claire senkte die Stimme. „Er hat angeboten, mich nach Hause zu bringen.“
Zum ersten Mal, seit er die Bar betreten hatte, sah Paul den Barkeeper an. „Soll ich ihm eins auf die Nase geben?“
„Ja.“
„Bringst du mich ins Krankenhaus, wenn er zurückschlägt?“
„Ja.“
Paul lächelte, aber nur, weil sie ebenfalls lächelte. „Und, wie fühlt es sich an ohne Leine?“
Claire sah auf ihren nackten Knöchel hinab und erwartete fast, einen blauen Fleck oder ein Mal an der Stelle zu sehen, wo die klobige schwarze Fußfessel gewesen war. Sechs Monate lang hatte sie in der Öffentlichkeit keinen Rock getragen, solange sie mit dem vom Gericht angeordneten Überwachungsgerät hatte herumlaufen müssen. „Fühlt sich wie Freiheit an.“
Er richtete den Strohhalm neben ihrem Glas parallel zur Serviette aus. „Du wirst übers Handy und über das GPS in deinem Wagen pausenlos überwacht.“
„Aber ich wandere nicht ins Gefängnis, wenn ich mein Handy weglege oder aus dem Auto steige.“
Paul zuckte nur mit den Schultern, obwohl sie ihr Argument ziemlich gut fand. „Und die Ausgangssperre?“
„Aufgehoben. Wenn ich ein Jahr lang keinen Ärger mache, wird mein Eintrag im Strafregister komplett getilgt, so als wäre nie etwas passiert.“
„Reinste Zauberei.“
„Ein sehr teurer Anwalt, besser gesagt.“
Er grinste. „Er war immerhin billiger als dieses Armband von Cartier, das du haben wolltest.“
Eigentlich sollten sie keine Witze über die Geschichte machen, aber die Alternative wäre gewesen, sie sehr ernst zu nehmen. „Es ist komisch“, sagte sie. „Ich weiß, dass das Überwachungsgerät nicht mehr da ist, aber ich spüre es immer noch.“
„Signalentdeckungstheorie.“ Er richtete den Strohhalm wieder gerade. „Deine Wahrnehmung ist voreingestellt, weil sie mit dem Überwachungsgerät rechnet. Man erlebt so etwas manchmal mit dem Handy. Man spürt, wie es vibriert, obwohl das überhaupt nicht der Fall ist.“
Das hatte sie nun davon, dass sie einen Streber geheiratet hatte.
Paul schaute zum Fernseher. „Glaubst du, sie finden sie?“
Claire antwortete nicht, sondern starrte auf den Drink in Pauls Hand. Sie hatte den Geschmack von Scotch nie gemocht, aber nicht trinken zu dürfen weckte in ihr den Wunsch nach einer tagelangen Sauftour.
Aus lauter Verzweiflung, irgendein Gesprächsthema zu finden, hatte Claire am Nachmittag zu ihrer vom Gericht bestellten Psychiaterin gesagt, dass sie es absolut hasse, wenn man ihr vorschrieb, was sie tun sollte. „Gibt es denn jemanden, der das nicht hasst?“, hatte die schmuddelige Frau etwas verwundert gefragt. Claire hatte gespürt, wie sie errötete, aber sie hatte sich die Bemerkung verkniffen, dass sie es eben besonders schlecht vertrug und genau deshalb in einer vom Gericht angeordneten Therapie gelandet war. Sie hatte der Frau nicht die Genugtuung gegönnt, einen Durchbruch erreicht zu haben.
Abgesehen davon, war Claire in dem Moment, als sich die Handschellen um ihre Gelenke schlossen, von allein zu dieser Erkenntnis gelangt.
„Idiotin“, hatte sie gemurmelt und sich selbst damit gemeint, als die Polizeibeamtin sie auf den Rücksitz des Streifenwagens verfrachtete.
Doch die hatte es falsch verstanden. „Das kommt in meinen Bericht“, hatte sie prompt erwidert.
Es waren nur Frauen, die Claire an diesem Tag begegneten, Polizistinnen in allen Größen und Formaten, mit breiten Ledergürteln um die strammen Taillen, an denen alle möglichen tödlichen Gerätschaften hingen. Claire war überzeugt, dass in Anwesenheit eines männlichen Polizisten alles viel besser gelaufen wäre, doch das war leider nicht der Fall gewesen. Dorthin hatte der Feminismus sie also gebracht: in einem hochgerutschten Tennisröckchen auf den klebrigen Rücksitz eines Streifenwagens.
Im Gefängnis nahm eine korpulente Frau mit einem Muttermal zwischen den buschigen Augenbrauchen Claire den Ehering, die Uhr und die Schnürsenkel ihrer Tennisschuhe ab. Deren Aussehen erinnerte sie irgendwie an eine Stinkwanze, und Claire fragte sich, warum die Frau sich die Mühe machte, das Haar aus dem Muttermal auszureißen, sich aber nicht die Augenbrauen zupfte. Dann kam jedoch eine andere Frau, diesmal groß und dürr wie eine Gottesanbeterin, und führte Claire in den nächsten Raum.
Das Abnehmen der Fingerabdrücke lief ganz anders ab als im Fernsehen. Claire musste die Fingerkuppen auf eine schmutzige Glasplatte drücken, damit die Papillarlinien gescannt und digitalisiert werden konnten. Offenbar waren ihre Linien sehr schwach ausgeprägt, denn es waren mehrere Versuche nötig.
„Nur gut, dass ich keine Bank ausgeraubt habe“, sagte Claire und schob schnell ein „Hahaha“ nach, um klarzumachen, dass es sich um einen Scherz handelte.
„Gleichmäßig aufdrücken“, sagte die Gottesanbeterin und kaute auf einer Fliege herum.
Claires Karteifoto wurde vor einem weißen Hintergrund aufgenommen. Das zum Hintergrund gehörige Lineal lag eindeutig um zwei, drei Zentimeter falsch. Claire fragte, warum sie kein Schild mit ihrem Namen und einer Nummer hochhalten musste.
„Photoshop-Schablone“, antwortete die Gottesanbeterin lapidar. Ihr gelangweilter Ton zeigte, dass die Frage nicht neu war.
Es war das einzige Foto, das je von Claire gemacht wurde, bei dem niemand sie zum Lächeln aufforderte.
Dann hatte eine dritte Polizistin, die – sozusagen gegen den Trend – eine Nase wie eine Stockente hatte, Claire in die Arrestzelle geführt, wo sie zu ihrer Verblüffung nicht die einzige Frau im Tennis-Outfit war.
„Weswegen bist du hier?“, hatte die andere gefragt. Sie wirkte hart und zugedröhnt und war offensichtlich auf einem ganz anderen Spielplatz unterwegs gewesen, als sie verhaftet wurde.
„Mord“, hatte Claire geantwortet, da sie beschlossen hatte, das Ganze einfach nicht ernst zu nehmen.
„Hallo.“ Paul gab dem Barkeeper ein Zeichen, ihm nachzuschenken. „Woran denkst du?“, fragte er dann Claire.
Sie stieß einen langen Seufzer aus. „Ich denke, dass dein Tag wahrscheinlich schlimmer war als meiner, wenn du einen zweiten Drink bestellst.“ Paul trank selten. Das hatten sie gemeinsam: Beide bevorzugten sie das Gefühl, alles unter Kontrolle zu haben. Was das Gefängnis zu einem echten Reinfall gemacht hatte, haha.
„Alles in Ordnung?“, fragte sie.
„Im Moment ist alles gut.“ Er strich ihr über den Rücken. „Was hat die Psychiaterin gesagt?“
Claire wartete, bis sich der Barkeeper in seine Ecke zurückgezogen hatte. „Sie meint, dass ich in Bezug auf meine Gefühle nicht sehr mitteilsam bin.“
„Das sieht dir aber überhaupt nicht ähnlich.“
Sie lächelten sich zu. Ein weiterer alter Streitpunkt, zu dem längst alles gesagt war.
„Ich lasse mich nicht gern analysieren“, erwiderte Claire und sah im Geist ihre Therapeutin vor sich, die übertrieben mit den Schultern zuckte und sagte: „Wer tut das schon?“
„Weißt du, was ich heute gedacht habe?“ Paul nahm ihre Hand. Seine Handfläche fühlte sich rau an, denn er hatte das ganze Wochenende in der Garage gearbeitet. „Ich habe gedacht, wie sehr ich dich liebe.“
„Komisch, wenn ein Mann so etwas zu seiner Frau sagt.“
„Es stimmt aber.“ Paul presste ihre Hand an seine Lippen. „Ich kann mir nicht vorstellen, wie mein Leben ohne dich aussähe.“
„Ordentlicher“, erwiderte sie trocken, da Paul immer derjenige war, der herrenlose Schuhe und Kleidungsstücke aufhob, die in den Wäschekorb gehörten, aber irgendwie auf dem Boden vor dem Waschbecken gelandet waren.
„Ich weiß, im Moment ist es schwer“, sagte er. „Vor allem damit …“ Er wies mit einem Kopfnicken auf das Fernsehgerät, wo gerade ein neues Foto der vermissten Sechzehnjährigen gezeigt wurde.
Claire sah zum Bildschirm. Das Mädchen war wirklich schön. Sportlich und schlank, mit dunklem, welligem Haar.
„Du sollst nur wissen, dass ich immer für dich da sein werde“, fuhr Paul fort. „Egal, was geschieht.“
Claire spürte, wie sich ihre Kehle zusammenzog. Sie betrachtete ihn manchmal als selbstverständlich, das war der Luxus einer langen Ehe. Aber sie wusste, dass sie ihn liebte. Sie brauchte ihn. Er war der Anker, der verhinderte, dass sie fortgetrieben wurde.
„Du bist die einzige Frau, die ich je geliebt habe“, sagte Paul.
Sie rief sich ihre Vorgängerin am College in Erinnerung. „Ava Guilford wäre ganz schön schockiert, das zu hören.“
„Keine Witze bitte. Ich meine es ernst.“ Er beugte sich so nah zu ihr, dass ihre Köpfe sich fast berührten. „Du bist die Liebe meines Lebens, Claire Scott. Du bist alles für mich.“
„Trotz meiner Vorstrafe?“
Er küsste sie. Küsste sie richtig. Sie schmeckte Scotch und einen Hauch Pfefferminz, und die Lust überkam sie, als seine Finger über die Innenseite ihrer Schenkel strichen.
„Lass uns nach Hause fahren“, drängte Claire, als sie wieder Luft holten.
Paul trank sein Glas in einem Zug leer und warf etwas Bargeld auf den Tresen. Seine Hand lag immer noch auf Claires Rücken, als sie das Lokal verließen. Ein kalter Windstoß zerrte am Saum ihres Rockes. Paul rieb ihren Arm, um sie warm zu halten. Er ging so dicht neben ihr, dass sie seinen Atem an ihrem Hals spürte. „Wo hast du geparkt?“
„Im Parkhaus“, antwortete sie.
„Mein Wagen steht auf der Straße.“ Er gab ihr die Schlüssel. „Lass uns den nehmen.“
„Wo willst du denn hin?“
„Komm hier rein.“ Er zog sie in eine Gasse und presste sie mit dem Rücken an die Wand.
Claire öffnete den Mund, um zu fragen, was in ihn gefahren sei, aber dann küsste er sie, und seine Hand glitt unter ihren Rock. Claire blieb die Luft weg, aber weniger, weil er ihr den Atem raubte, sondern weil es in der Gasse nicht dunkel und die Straße keineswegs unbelebt war. Sie konnte Männer vorbeigehen sehen, die den Kopf wandten und das, was in der Gasse vor sich ging, bis zum letzten Moment verfolgten. Mit genau solchen Dingen landete man im Internet.
„Paul.“ Sie legte ihm die Hand auf die Brust und fragte sich, was aus ihrem biederen Ehemann geworden war, der es schon für eine gewagte Abwechslung hielt, wenn sie es im Gästezimmer trieben. „Jeder kann uns sehen.“
„Hier hinten.“ Er nahm ihre Hand und zog sie noch tiefer in die Gasse.
Claire stieg über eine Ansammlung von Zigarettenkippen, als sie ihm folgte. Die Gasse verlief T-förmig, weil eine weitere Servicegasse für Restaurants und Läden kreuzte. Was die Umstände nicht wirklich verbesserte. Claire stellte sich Burgerbrater mit Zigaretten im Mund und iPhones in den Händen vor. Aber auch ohne ungebetene Zuschauer gab es gute Gründe, dies hier nicht zu tun.
Andererseits ließ sich niemand gern vorschreiben, was er zu tun hatte.
Paul zog sie um die Ecke. Claire blieben nur wenige Momente, um ihre Umgebung zu checken, ehe sie wieder an eine Wand gepresst wurde. Pauls Mund lag auf ihrem, seine Hände umfassten ihren Hintern. Er wollte sie so sehr, dass sie angesteckt wurde. Sie schloss die Augen und ließ es geschehen. Ihre Küsse wurden tiefer. Er zerrte ihr die Unterwäsche vom Leib. Sie half ihm dabei und zitterte, weil es kalt war und weil es gefährlich war, und sie war so bereit, dass das alles sie nicht mehr interessierte.
„Claire …“, flüsterte er in ihr Ohr, „sag mir, dass du es willst.“
„Ich will es.“
„Sag es noch einmal.“
„Ich will es!“
Ohne Vorwarnung wirbelte er sie herum. Claires Wange schrammte über die Ziegelmauer. Er hielt sie fest an die Wand gepresst. Sie drückte sich an ihn. Er stöhnte, weil er ihre Reaktion für Erregung hielt, dabei bekam sie kaum Luft.
„Paul …“
„Keine Bewegung!“
Claire verstand, aber ihr Gehirn brauchte ein, zwei Sekunden, um die Tatsache zu verarbeiten, dass die Worte nicht aus dem Mund ihres Mannes gekommen waren.
„Dreh dich um.“
Paul wandte sich ganz langsam herum.
„Nicht du, Arschloch.“
Sie. Er meinte sie. Claire war zu keiner Bewegung fähig. Ihre Beine zitterten, und sie konnte sich kaum aufrecht halten.
„Ich sagte, dreh dich um, verdammt noch mal.“
Paul legte die Hände sanft um Claires Arme. Sie schwankte, als er sie langsam umdrehte.
Direkt hinter Paul stand ein Mann. Er trug ein schwarzes Kapuzenshirt, dessen Reißverschluss bis knapp unter den feisten Hals mit der Tätowierung geschlossen war. Eine finster dreinblickende Klapperschlange prangte auf seinem Adamsapfel, sie grinste bösartig und zeigte dabei ihre Giftzähne.
„Hände hoch.“ Das Maul der Schlange hüpfte beim Sprechen.
„Wir wollen keinen Ärger.“ Paul hielt die Hände hocherhoben. Er stand vollkommen reglos. Claire sah ihn an. Er nickte ein Mal, um ihr zu signalisieren, das alles in Ordnung sei, obwohl offensichtlich gar nichts in Ordnung war. „Meine Geldbörse steckt in der Gesäßtasche.“
Der Mann zerrte die Börse mit einer Hand aus Pauls Hosentasche. Claire war überzeugt, dass er in der anderen eine Waffe hielt. Schwarz, glänzend, in Pauls Kreuz gedrückt.
„Hier.“ Paul nahm seinen Ehering ab, seinen Collegering, seine Uhr. Eine Patek Philippe. Sie hatte sie ihm vor fünf Jahren gekauft, ihre Initialen waren eingraviert.
„Claire.“ Pauls Stimme war angespannt. „Gib ihm deine Brieftasche.“
Claire sah ihren Mann an. Sie spürte, wie es in ihrer Halsschlagader heftig pochte. Eine Waffe war auf Pauls Rücken gerichtet, sie wurden soeben ausgeraubt. Das war real, es geschah in genau diesem Augenblick. Sie sah auf ihre Hand hinunter, ihre Bewegungen waren langsam, denn sie stand unter Schock und war in Panik und wusste nicht, was sie tun sollte. Ihre Finger waren noch um Pauls Autoschlüssel gekrallt. Sie hatte ihn die ganze Zeit nicht losgelassen. Hatte sie es etwa so mit ihm treiben wollen – mit dem Schlüssel in der Hand?
„Claire“, drängte Paul noch einmal. „Hol dein Portemonnaie raus.“
Sie ließ den Autoschlüssel in die Handtasche fallen, nahm dafür die Geldbörse heraus und gab sie dem Mann.
Er steckte sie ein und hielt ihr seine Hand wieder hin. „Telefon.“
Claire reichte ihm das Handy. All ihre Kontakte. Ihre Urlaubsfotos der letzten Jahre. St. Martin. London. Paris. München.
„Den Ring auch.“ Der Mann sah sich in der Gasse um, und Claire tat es ihm nach: Da war niemand. Selbst die Quergasse zu den Läden und Restaurants war leer. Sie stand noch mit dem Rücken zur Wand. Die Ecke zur Hauptstraße war nur eine Armlänge entfernt. Und dort waren Leute unterwegs. Viele Leute.
Der Mann erriet ihre Gedanken. „Mach keine Dummheiten. Nimm den Ring ab.“
Claire zog ihren Ehering ab. Es war kein Problem, wenn der weg war, er war versichert. Es waren nicht einmal die Originalringe. Sie hatten sie vor Jahren ausgesucht, als Paul endlich sein Praktikum beendet und seine Zulassung als Architekt bekommen hatte.
„Ohrringe“, kommandierte der Mann. „Komm schon, Schlampe, mach hin.“
Claire griff an ihr Ohrläppchen, und jetzt zitterten ihre Hände. Sie konnte sich gar nicht daran erinnern, die Diamantstecker heute Morgen angelegt zu haben, aber nun sah sie sich plötzlich vor ihrer Schmuckschatulle stehen.
Zog da gerade ihr Leben an ihr vorüber – nichtssagende Erinnerungen an irgendwelche Lappalien?
„Beeilung!“ Der Mann trieb sie mit seiner freien Hand an.
Claire fummelte an den Verschlüssen der Ohrstecker herum. Sie dachte daran, wie sie die Ohrringe anlässlich ihres zweiunddreißigsten Geburtstags bei Tiffany ausgesucht hatten. Paul hatte sie mit einem „Passiert uns das hier wirklich?“-Blick angelächelt, als die Verkäuferin sie in den diskreten Nebenraum des Ladens führte, wo die wirklich kostspieligen Käufe stattfanden.
Claire ließ die Ohrringe in die offene Hand des Straßenräubers fallen. Sie zitterte am ganzen Leib, und ihr Herz schlug wie eine Snare Drum.
„Das war’s.“ Paul drehte sich, stellte sich vor Claire, indem er ihr den Rücken zuwandte, und schirmte sie ab. Er hielt die Hände weiter erhoben. „Sie haben jetzt alles von uns.“
Claire beobachtete den Mann über Pauls Schulter hinweg. Er hielt keine Schusswaffe in der Hand, sondern ein Messer. Ein langes, scharfes Messer mit gezackter Klinge und einem Haken an der Spitze, das aussah wie ein Werkzeug, mit dem Jäger Tiere ausweideten.
„Sonst haben wir nichts mehr“, sagte Paul. „Gehen Sie doch einfach.“
Aber der Mann ging nicht. Er starrte Claire an, als hätte er etwas noch Wertvolleres entdeckt als ihre Sechsunddreißigtausend-Dollar-Ohrringe, und verzog den Mund zu einem Grinsen. Auf einem seiner Vorderzähne trug er eine Goldkrone, und Claire fiel nun auf, dass das Klapperschlangen-Tattoo auf seiner Kehle einen passenden goldenen Giftzahn hatte.
Und dann begriff sie mit einem Schlag, dass dies mehr war als ein Raubüberfall.
Paul begriff es ebenfalls. „Ich habe Geld“, drängte er.
„Wer hätte das gedacht.“ Der Mann hämmerte Paul seine Faust an die Brust, und Claire spürte den Aufprall bis in ihren eigenen Brustkorb. Pauls Schulterblätter schlugen gegen ihre Schlüsselbeine, sein Kopf knallte ihr ins Gesicht, ihr Hinterkopf krachte gegen die Ziegelwand.
Erst mal war Claire völlig benommen, sah Sterne vor den Augen tanzen und schmeckte Blut im Mund. Sie blinzelte und senkte den Blick. Paul krümmte sich auf dem Boden.
„Paul …“ Sie streckte die Hand nach ihm aus, aber da fuhr ihr ein weiß glühender Schmerz durch die Kopfhaut. Der Mann hatte sie an den Haaren gepackt und zerrte sie tiefer in die Gasse hinein. Claire stolperte, ihr Knie schrammte über das Pflaster. Der Mann ging unbeirrt weiter, fiel fast in einen Laufschritt. Sie musste sich vorbeugen, um den Schmerz am Kopf ein wenig abzumildern. Einer ihrer Absätze brach ab. Sie versuchte, zurückzuschauen, und sah, dass Paul einen Arm an die Brust gepresst hielt, als hätte er einen Herzinfarkt.
„Nein“, flüsterte sie und fragte sich noch im selben Moment, warum sie eigentlich nicht schrie. „Nein, nein, nein.“
Der Mann schleifte sie weiter. Claire hörte ihren pfeifenden Atem, ihre Lungen schienen plötzlich wie mit Sand gefüllt. Er führte sie zu einer Seitenstraße, wo ein schwarzer Van stand, den sie zuvor nicht bemerkt hatte. Claire grub ihre Fingernägel in das Handgelenk des Mannes. Er riss ruckartig an ihrem Haar, und sie stolperte. Und wieder ein Ruck. Der Schmerz war höllisch, aber er war nichts gegen ihre Angst. Sie hätte gern geschrien. Sie musste schreien! Aber ihre Kehle war wie zugeschnürt von dem Wissen darum, was nun kam. Er würde sie in diesem Van verschleppen. Irgendwohin, wo er ungestört war. An einen schrecklichen Ort, den sie vielleicht nie wieder verlassen würde.
„Nein“, bettelte sie. „Bitte … nicht … nein …“
Der Mann ließ Claire los, aber nicht etwa, weil sie darum gefleht hatte. Er fuhr herum, das Messer in der ausgestreckten Hand. Paul war wieder auf den Beinen und lief ihnen nach. Mit einem rauen Aufheulen sprang er auf den Mann los.
Es ging alles sehr schnell. Zu schnell. Es gab keine Zeitlupe, damit Claire jeden Sekundenbruchteil des Kampfes hätte verfolgen können.
Paul hätte den Mann vielleicht auf dem Laufband besiegt, und ganz sicher hätte er eine Gleichung gelöst, bevor der Kerl auch nur seinen Bleistift spitzen konnte, doch sein Gegner hatte Paul etwas voraus, was man an der Universität nicht lernte: wie man mit einem Messer kämpfte.
Es gab nur ein pfeifendes Geräusch, als die Klinge durch die Luft fuhr. Claire hätte mehr erwartet: eine Art Schnalzen vielleicht, als die gebogene Messerspitze sich durch Pauls Haut bohrte, oder ein Knirschen, als die gezackte Klinge Sehnen und Knorpel durchtrennte.
Pauls Hand zuckte zum Bauch. Der Perlmuttgriff des Messers ragte zwischen seinen Fingern hervor. Er taumelte rückwärts gegen die Wand, sein Mund stand offen, er hatte die Augen so weit aufgerissen, dass es fast komisch wirkte. Er trug den dunkelblauen Anzug von Tom Ford, der ihm um die Schultern zu eng war. Claire hatte sich vorgenommen, die Nähte zum Auslassen zu bringen, doch dafür war es jetzt zu spät, denn das Jackett war blutgetränkt.
Paul sah auf seine Hände hinab. Die Klinge war bis zum Heft eingedrungen, etwa auf halber Höhe zwischen Bauchnabel und Herz, und auf seinem blauen Hemd breitete sich ein Blutfleck aus. Er schien unter Schock zu stehen. Sie beide standen unter Schock. Eigentlich hatten sie heute zeitig zu Abend essen und feiern wollen, dass Claire erfolgreich dem Strafrechtssystem entronnen war. Würde er nun in einer kalten, dreckigen Gasse verbluten?
Claire hörte eilige Schritte. Der Schlangenmann rannte weg, ihr Schmuck und ihre Uhren klimperten in seiner Tasche.
„Hilfe“, sagte Claire, aber es war nur ein Flüstern, so leise, dass sie ihre Stimme selbst kaum hörte. „Hi-hilfe“, stammelte sie. Aber wer sollte ihnen denn helfen? Es war doch immer Paul gewesen, der für Hilfe gesorgt hatte. Paul war der, der sich um alles kümmerte.
Bis jetzt.
Er glitt langsam an der Ziegelwand hinab und sank zu Boden. Claire kniete neben ihm nieder und rang hilflos die Hände, denn sie wusste nicht, wo sie ihn berühren sollte. Achtzehn Jahre lang hatte sie ihn geliebt, achtzehn Jahre lang das Bett mit ihm geteilt. Sie hatte ihm die Hand auf die Stirn gelegt, um zu sehen, ob er Fieber hatte, sie hatte ihm das Gesicht abgewischt, wenn er krank war, sie hatte seinen Mund, seine Wangen, seine Augenlider geküsst und ihn einmal sogar im Zorn geschlagen, aber jetzt wusste sie nicht, wo sie ihn berühren sollte.
„Claire.“
Pauls Stimme. Sie kannte seine Stimme. Sie schlang die Arme um ihn, zog ihn an ihre Brust, presste die Lippen auf seine Wange. Sie merkte, wie die Wärme seinen Körper verließ. „Paul, bitte, du musst okay sein, du musst einfach.“
„Ich bin okay“, sagte Paul, und es hörte sich an wie die Wahrheit, bis es nicht mehr die Wahrheit war. Das Zittern begann in seinen Beinen und ging dann als heftiges Beben durch seinen ganzen Körper. Seine Zähne schlugen aufeinander. Seine Augenlider flatterten.
„Ich liebe dich“, sagte er.
„Bitte“, flüsterte sie und barg das Gesicht an seinem Hals. Sie roch sein Aftershave. Spürte eine raue Stelle, die er heute Morgen beim Rasieren übersehen hatte. Wo sie ihn auch berührte – seine Haut war sehr, sehr kalt. „Bitte verlass mich nicht, Paul. Bitte!“
„Das werde ich nicht“, versprach er.
Aber dann tat er es doch.
2. KAPITEL
Lydia Delgado blickte auf das Meer von Cheerleadern im Teenageralter und sprach lautlos ein Dankgebet, dass ihre Tochter nicht darunter war. Nicht, dass sie etwas gegen Cheerleader gehabt hätte. Sie war einundvierzig Jahre alt. Die Zeiten, als sie Cheerleader gehasst hatte, waren längst vorbei. Jetzt hasste sie deren Mütter.
„Lydia Delgado!“ Mindy Parker begrüßte immer jeden mit Vor- und Nachnamen und legte zum Ende hin einen triumphierenden Schwung in die Stimme: Seht, wie intelligent ich bin, weil ich mir die vollständigen Namen merke!
„Mindy Parker“, erwiderte Lydia ein paar Oktaven tiefer. Sie konnte nicht anders. Sie war immer schon auf Widerstand gebürstet gewesen.
„Das erste Spiel der Saison! Ich glaube, unsere Mädchen haben dieses Jahr eine echte Chance.“
„Absolut“, pflichtete Lydia bei, obwohl alle wussten, dass es ein Gemetzel geben würde.
„Jedenfalls“, fuhr Mindy fort, streckte das linke Bein und beugte den Rumpf zu den Zehen, „brauche ich die unterschriebene Erlaubnis für Dee.“
Lydia verschluckte gerade noch die Frage, von welcher Erlaubnis sie spreche. „Sie bekommen Sie morgen.“
„Fantastisch!“ Als Mindy ihre Rumpfbeuge beendet hatte, ließ sie zischend den Atem entweichen. Mit den aufgeworfenen Lippen und dem ausgeprägten Unterbiss erinnerte sie Lydia immer an eine frustrierte Französische Bulldogge. „Sie wissen: Wir wollen auf keinen Fall, dass sich Dee ausgeschlossen fühlt. Wir sind so stolz auf unsere Stipendiatinnen.“
„Danke, Mindy.“ Lydia zwang sich zu einem Lächeln. „Es ist schon traurig, dass sie intelligent sein musste, um nach Westerley zu kommen, statt einfach nur Geld mitzubringen.“
Mindy setzte ebenfalls ein bemühtes Lächeln auf. „Okay, prima. Ich rechne dann morgen früh mit dieser schriftlichen Zustimmung.“ Bevor sie die Tribüne hinauf zu den anderen Müttern hüpfte, drückte sie Lydias Schulter. Den Übermüttern, wie Lydia sie nannte, um unflätigere Bezeichnungen zu vermeiden.
Lydia suchte das Basketballfeld vergeblich nach ihrer Tochter ab. Einen Moment blieb ihr vor Schreck fast das Herz stehen, aber dann entdeckte sie Dee schließlich in einer Ecke. Sie unterhielt sich mit Bella Wilson, ihrer besten Freundin; die beiden ließen einen Ball zwischen sich hin und her springen.
War diese junge Frau wirklich ihre Tochter? Es schien, als hätte ihr Lydia eben noch die Windeln gewechselt und nur kurz den Kopf abgewandt, um dann beim nächsten Hinsehen festzustellen, dass Dee plötzlich siebzehn Jahre alt war. In nicht einmal zehn Monaten würde sie ins College aufbrechen. Zu Lydias Entsetzen hatte sie sogar schon begonnen, zu packen. Der Koffer in Dees Schrank war bereits so voll, dass der Reißverschluss nicht mehr ganz zuging.
Lydia verdrückte sich ein paar Tränen, denn schließlich war es nicht normal, dass eine erwachsene Frau wegen eines Koffers weinte. Stattdessen dachte sie über diese schriftliche Genehmigung nach, die Dee ihr nicht zum Unterzeichnen gegeben hatte. Wahrscheinlich wollte das Team bei einem Abendessen ein wenig feiern, und Dee hatte Angst, dass Lydia es sich nicht leisten konnte. Ihre Tochter verstand nicht, dass sie keineswegs arm waren. Ja, am Anfang, als Lydia ihren Hundesalon aufgebaut hatte, hatten sie zu kämpfen gehabt. Doch inzwischen gehörten sie zur soliden Mittelschicht, und das war mehr, als die meisten Leute von sich behaupten konnten.
Über den in Westerley üblichen Wohlstand verfügten sie freilich nicht. Die meisten Schülereltern der Westerley Academy konnten die dreißigtausend Dollar Schulgebühren im Jahr mühelos aufbringen, um ihr Kind auf diese Privatschule zu schicken. Sie konnten über Weihnachten in Lake Tahoe Ski fahren oder Privatflugzeuge in die Karibik chartern. Aber auch wenn Lydia ihrer Tochter solche Dinge niemals würde bieten können, reichte es verdammt noch mal, um ihr ein ordentliches Steak bei Chops zu spendieren.
Allerdings würde sie eine weniger feindselige Formulierung finden, um das ihrem Kind zu verklickern.
Lydia griff in ihre Handtasche und zog eine Tüte Kartoffelchips heraus. Das Salz und das Fett sorgten schlagartig für Wohlbefinden, so als würde man ein paar Tranquilizer auf der Zunge zergehen lassen. Als sie heute Morgen ihre Jogginghose anzog, hatte sie sich vorgenommen, ins Fitnessstudio zu gehen, und sie war dem Studio auch ziemlich nahe gekommen, aber nur weil es auf dem Parkplatz einen Starbucks gab. Thanksgiving stand vor der Tür, und es war eiskalt. Lydia hatte sich einen ihrer seltenen freien Tage genommen; sie hatte es sich verdient, ihn mit einer Kürbis-Latte mit Karamellaroma zu beginnen. Und sie brauchte einfach das Koffein. Sie musste vor Dees Spiel noch so viel Scheißkram erledigen. Supermarkt, Tierfutterladen, Discounter, Apotheke, Bank, zurück nach Hause, um alles auszuladen, dann mittags wieder los zum Friseur, denn Lydia war mittlerweile zu alt, um ihr Haar einfach nur schneiden zu lassen. Nein, sie musste sich der langwierigen Prozedur unterziehen, das Grau in ihrem Haar in blonde Strähnchen zu verwandeln, damit sie nicht aussah wie Cruella de Vils arme Cousine. Ganz zu schweigen von den seit Neuestem sprießenden Haaren im Gesicht, um die sie sich auch noch hatte kümmern müssen.
Lydias Hand flog an die Oberlippe. Das Salz von den Chips brannte auf der gereizten Haut.
„Verdammt“, murmelte sie, weil sie vergessen hatte, dass man ihren Damenbart heute mit Wachs entfernt und dass die Kosmetikerin dann ein neues Gesichtswasser benutzt hatte, was zu dem bösen Ausschlag auf Lydias Oberlippe führte. Jetzt trug sie statt der zwei, drei vereinzelten Barthaare einen dicken roten Streifen unter der Nase.
Sie konnte sich gut vorstellen, wie Mindy Parker das den andern Müttern erzählte. „Lydia Delgado! Mit einem Ausschlag vom Waxing!“
Lydia stopfte sich gleich noch eine Handvoll Chips in den Mund. Sie kaute lautstark und scherte sich nicht um die Krümel auf ihrer Bluse. Sie scherte sich auch nicht um die Übermütter, die zusahen, wie sie Kohlehydrate in sich hineinfraß. Es hatte eine Zeit gegeben, wo sie sich mehr angestrengt hatte: die Zeit, bevor sie vierzig wurde.
Saft-Diät. Saft-Fasten. Null-Saft-Diät. Obst-Diät. Eier-Diät. Curves – Ganzkörpertraining. Bootcamp. Fünf-Minuten-Cardio-Work-Out. Drei-Minuten-Cardio-Work-Out. South-Beach-Diät. Atkins-Diät. Steinzeit-Diät. Jazzgymnastik.
Lydias Kleiderschrank enthielt ein umfangreiches eBay – Sortiment des Versagens. Zumba-Schuhe, Crosstrainer, Trekking-Stiefel, Bauchtanz-Zimbeln, ein Tanga, der es nie in diesen Pole-Dance-Kurs geschafft hatte, auf den eine ihrer Kundinnen schwor.
Lydia wusste, dass sie Übergewicht hatte, aber war sie wirklich fett? Oder war sie es nur nach Westerley-Maßstäben? Das Einzige, was sie sicher wusste, war, dass sie nicht dünn war. Abgesehen von einer kurzen Atempause um ihr zwanzigstes Lebensjahr herum, hatte sie immer mit ihrem Gewicht zu kämpfen gehabt.
Das war die düstere Wahrheit hinter ihrem glühenden Hass auf die Übermütter: Sie konnte sie nicht ausstehen, weil sie nicht so sein konnte wie sie. Sie war scharf auf Kartoffelchips. Sie liebte Brot. Sie gab alles für einen guten Cupcake – oder drei. Sie hatte nicht die Zeit für Übungen mit einem Personal Trainer oder für Pilates-Kurse. Sie hatte ein Geschäft zu führen. Sie war eine alleinerziehende Mutter. Sie hatte einen Freund, um den sie sich gelegentlich kümmern musste. Und nicht nur das: Sie arbeitete mit Tieren. Es war schwer, glamourös auszusehen, wenn man gerade die Analdrüsen eines Dackels ausgedrückt hatte.
Lydias Finger gruben sich in die leere Chipstüte. Sie fühlte sich elend, sie hatte die Chips gar nicht essen wollen. Nach den ersten Bissen hatte sie im Grunde gar nichts mehr geschmeckt.
Hinter ihr brachen die Mütter in Jubel aus. Eines der Mädchen machte gerade eine perfekte Reihe von Flickflacks auf dem Hallenboden. Die Bewegungen waren flüssig und sehr eindrucksvoll, doch als sie am Schluss die Arme in die Höhe riss, erkannte Lydia, dass es gar kein Cheerleader-Mädchen war – sondern eine Cheerleader-Mutter.
Eine Cheerleader-Übermutter.
„Penelope Ward!“, brüllte Mindy Parker. „Weiter so, du Süße!“
Lydia stöhnte und sah nach, ob sie in ihrer Handtasche noch etwas zu essen fand. Penelope kam jetzt direkt auf sie zu. Hektisch wischte sich Lydia die Krümel von der Bluse und versuchte, sich eine Bemerkung zurechtzulegen, die nicht aus einer Reihe von Kraftausdrücken bestand.
Zum Glück wurde Penelope aber von Coach Henley aufgehalten.
Lydia seufzte erleichtert und zog ihr Handy aus der Tasche. Es gab sechzehn E-Mails vom elektronischen Schwarzen Brett der Schule, die größtenteils mit einem kürzlich aufgetretenen Befall mit Kopfläusen zu tun hatten, der in den Grundschulklassen wütete. Während Lydia die Einträge durchlas, sprang eine neue Nachricht auf, diesmal die dringende Bitte des Direktors, der erklärte, es sei wirklich völlig unmöglich, festzustellen, wo die Läuse-Pandemie ihren Anfang genommen habe, und die Eltern sollten bitte aufhören, nachzufragen, welches Kind die Schuld daran trage.
Lydia löschte sie alle. Sie beantwortete einige Nachrichten von Kunden, die Termine vereinbaren wollten. Sie sah in ihrem Spam-Ordner nach, ob Dees Erlaubnisschreiben nicht zufällig darin gelandet war. Fehlanzeige. Sie schrieb dem Mädchen, das sie für Büroarbeiten angestellt hatte, und bat es zum wiederholten Mal, ihren Arbeitszeitnachweis abzuliefern. Man hätte meinen sollen, das sei etwas, was man sich leicht merken konnte, weil es ohne diesen Nachweis kein Geld gab, aber das Kind war von einer dominanten Mutter aufgezogen worden und vergaß sogar, sich die Schuhe zu binden, wenn man ihm nicht ein Post-it mit einem Smiley an die Treter heftete, auf dem stand: BIND DIR DIE SCHUHE. GRUSS MOM. PS: ICH BIN SO STOLZ AUF DICH!
Jetzt war sie aber kleinlich. Bemuttern unter Zuhilfenahme von Post-its war Lydia durchaus nicht fremd. Allerdings sollten ihre überfürsorglichen Anwandlungen tendenziell sicherstellen, dass Dee lernte, allein zurechtzukommen, das immerhin konnte sie zu ihrer Verteidigung anführen. DENK DRAN, DEN MÜLL RAUSZUTRAGEN. ODER ICH BRING DICH UM. LIEB DICH. MOM. Leider hatte niemand sie gewarnt, dass es zu ganz eigenen Problemen führte, wenn man seinem Kind diese Art von Unabhängigkeit beibrachte. Etwa, dass man einen prallvoll gepackten Koffer im Schrank seiner Tochter fand, obwohl es bis zur Abreise ins College noch zehn Monate waren.
Lydia ließ ihr Handy wieder in die Tasche gleiten. Sie sah, wie Dee den Ball zu Rebecca Thistlewaite passte, einem blassen englischen Mädchen, das selbst dann keinen Punkt erzielt hätte, wenn man ihm den Kopf in den Korb gesteckte hätte. Lydia lächelte über den Großmut ihrer Tochter. In Dees Alter war Lydia die Sängerin einer wirklich grässlichen Riot-Girl-Band gewesen und hatte damit gedroht, die Highschool zu schmeißen. Dee war im Debattier-Club. Sie arbeitete ehrenamtlich im YMCA. Sie war gutmütig, großherzig und wahnsinnig intelligent. Ihre Fähigkeit, sich Dinge zu merken, war erstaunlich, allerdings auch höchst ärgerlich, wenn man mit ihr stritt. Schon in jungen Jahren hatte sie alles, was sie hörte, auf fast unheimliche Weise nachahmen können – vor allem, wenn sie es von Lydia hörte. So war sie auch zu dem Namen Dee gekommen, statt mit dem schönen Namen angesprochen zu werden, den Lydia in ihre Geburtsurkunde hatte eintragen lassen.
„Deedus Christus!“, hatte ihre süße kleine Tochter geschrien und dazu in ihrem Hochstühlchen gestrampelt, als sie „Jesus“ noch nicht aussprechen konnte. „Deedus Christus!“
Rückblickend war es natürlich ein Fehler gewesen, sie merken zu lassen, dass Lydia es lustig fand.
„Lydia?“ Penelope Ward reckte einen Finger in die Höhe, als wollte sie Lydia auffordern, zu warten. Lydias Blick schoss sofort zur Tür. Dann hörte sie die Mütter hinter sich kichern und erkannte, dass sie in der Falle saß.
Penelope war eine Art Berühmtheit in Westerley. Ihr Mann war Anwalt, was für einen Westerley-Vater typisch war, aber er war außerdem Senator und hatte vor Kurzem angekündigt, er wolle als Abgeordneter für den Kongress kandidieren. Von allen Vätern an der Schule sah Branch Ward wahrscheinlich am attraktivsten aus, aber das lag größtenteils daran, dass er unter sechzig war und noch freien Blick auf seine Füße hatte.
Penelope war die perfekte Politikergattin. In allen Werbebroschüren ihres Mannes sah man sie mit der kulleräugigen Hingabe eines Border Collies zu Branch aufblicken. Sie war attraktiv, aber nicht so sehr, dass sie von ihm ablenkte. Sie war dünn, aber nicht magersüchtig. Sie hatte ihre Teilhaberschaft an einer erstklassigen Anwaltskanzlei aufgegeben, um fünf hübsche, arisch aussehende Kinder in die Welt zu setzen. Sie war Vorsitzende des Elternbeirats und führte das Gremium mit eiserner Hand. All ihre Memos waren perfekt mit Spiegelstrichen aufbereitet, so präzise und bündig, dass selbst die schlichteren Übermütter mühelos folgen konnten. Sie neigte dazu, auch in Spiegelstrichen zu sprechen. „Okay, meine Damen“, sagte sie etwa und klatschte in die Hände – die Mütter waren große In-die-Hände-Klatscher –, „Erfrischungen! Willkommensgeschenke! Luftballons! Tischdecken! Besteck!“
„Lydia, da sind Sie ja“, rief Penelope. Ihre Knie und Ellbogen arbeiteten wie ein Kolbenmotor, als sie die Tribüne heraufeilte, um sich neben Lydia zu setzen. „Lecker.“ Sie deutete auf die leere Chipstüte. „Ich wollte, ich könnte so etwas essen.“
„Ich wette, ich könnte Sie dazu bringen.“
„Ach, Lydia, wie ich Ihren trockenen Humor liebe.“ Penelope wandte sich Lydia zu und hielt den Augenkontakt wie eine angespannte Perserkatze. „Ich weiß nicht, wie Sie das machen. Sie führen Ihr eigenes Geschäft. Sie halten Ihr Zuhause in Schuss. Sie haben eine fantastische Tochter großgezogen.“ Sie legte eine Hand auf die Brust. „Sie sind meine Heldin.“
Lydia merkte, dass sie begann, mit den Zähnen zu knirschen.
„Und Dee ist so eine kompetente junge Dame.“ Penelope senkte die Stimme. „Sie ist mit diesem verschwundenen Mädchen in die Mittelstufe gegangen, nicht wahr?“
„Ich weiß nicht“, log Lydia. Anna Kilpatrick war eine Klasse unter Dee gewesen. Sie waren zusammen im Sportunterricht, hatten aber sonst nicht viel miteinander zu tun gehabt.
„Was für eine Tragödie“, sagte Penelope.
„Sie finden sie. Es ist ja erst eine Woche her.“
„Aber was kann in einer Woche alles geschehen!“ Penelope zwang sich zu einem Schaudern. „Man darf gar nicht daran denken.“
„Dann tun Sie es nicht.“
„Was für ein wundervoller Ratschlag“, sagte sie und klang zugleich erleichtert und arrogant. „Sagen Sie, wo ist Rick? Wir brauchen ihn hier. Er ist unser kleiner Testosteronschub.“
„Er ist auf dem Parkplatz.“ Lydia hatte keine Ahnung, wo Rick war. Sie hatten sich heute Morgen grässlich gestritten. Bestimmt wollte er sie nie wiedersehen.
Nein, das stimmte nicht. Rick würde kommen, schon wegen Dee. Aber wahrscheinlich würde er sich Lydias wegen auf die andere Seite der Sporthalle setzen.
„Rebound! Rebound!“, schrie Penelope, obwohl die Mädchen noch beim Aufwärmen waren. „Himmel, bisher ist es mir nie aufgefallen, aber Dee sieht ja genauso aus wie Sie.“
Lydia musste lächeln. Es war nicht das erste Mal, dass jemand auf die Ähnlichkeit hinwies. Dee hatte Lydias helle Haut und die veilchenblauen Augen. Sie hatten die gleiche Gesichtsform und das gleiche Lächeln. Beide waren sie von Natur aus blond – was sie definitiv von allen anderen Blondinen in der Halle unterschied. Dees Sanduhrfigur ließ nicht ahnen, was später im Leben passieren konnte, wenn man in Jogginghosen herumsaß und Kartoffelchips in sich hineinschaufelte. In diesem Alter war Lydia genauso schön und genauso schlank gewesen. Leider war eine Menge Kokain nötig gewesen, damit es so blieb.
„Also …“ Penelope schlug sich auf die Oberschenkel, als sie sich wieder Lydia zuwandte. „Ich wollte fragen, ob Sie mir vielleicht helfen können.“
„Okaaay.“ Lydia zog das Wort ängstlich in die Länge. Genau so pflegte Penelope einen einzufangen: Sie befahl einem nicht, etwas zu tun; sie sagte einem, dass sie Hilfe brauchte.
„Es geht um das Internationale Festival nächsten Monat.“
„Das Internationale Festival?“, wiederholte Lydia, als hätte sie noch nie von der eine Woche dauernden Wohltätigkeitsveranstaltung gehört, bei der die weißesten Männer und Frauen von North Atlanta in Dolce & Gabbana-Klamotten herumsaßen und Piroggen und schwedische Hackfleischbällchen kosteten, die die Nannys ihrer Kinder zubereitet hatten.
„Ich schicke Ihnen die E-Mails alle noch einmal zu“, sagte Penelope. „Jedenfalls habe ich mir gedacht, Sie könnten vielleicht ein paar spanische Gerichte mitbringen. Arròs negre. Tortilla de Patatas. Cuchifritos.“ Sie sprach alle Worte mit einem selbstbewussten spanischen Akzent aus, den sie wahrscheinlich von ihrem Poolboy aufgeschnappt hatte. „Mein Mann und ich hatten Escalivada letztes Jahr in Katalonien. Einfach fantastisch.“
Lydia wartete seit vier Jahren darauf, es endlich zu sagen: „Ich bin keine Spanierin.“
„Wirklich?“ Penelope blieb ungerührt. „Dann eben Tacos. Oder Burritos. Oder vielleicht Arroz con Pollo?“
„Ich bin auch nicht aus Meh-i-ko.“
„Ja, gut, natürlich ist Rick nicht Ihr Mann. Aber ich dachte, da Sie Delgado heißen, dass Dees Vater …“
„Penelope, sieht Dee für Sie wie eine Latina aus?“
Penelopes schrilles Lachen hätte Glas zerspringen lassen. „Was heißt das überhaupt: ‚wie eine Latina aussehen‘? Sie sind so komisch, Lydia.“
Lydia lachte ebenfalls, aber aus völlig anderen Gründen.
„Du meine Güte.“ Penelope wischte sich unsichtbare Tränen aus den Augen. „Aber jetzt rücken Sie schon raus mit der Geschichte.“
„Welcher Geschichte?“
„Ach, kommen Sie! Sie tun immer so geheimnisvoll, wenn es um Dees Vater geht. Und um Sie selbst. Wir wissen kaum etwas über Sie.“ Sie rückte näher. „Raus mit der Sprache. Ich erzähl’s niemandem.“
Lydia stellte blitzartig eine Gewinn-und-Verlust-Rechnung an: Auf der Habenseite stand, dass die Mütter wegen Dees ungeklärter Herkunft immer ängstlich zusammenzuckten, wenn ihnen mal eine leicht rassistische Bemerkung herausrutschte. Auf der Kostenseite dagegen, dass sie an einer Spendensammlung des Elternbeirats würde teilnehmen müssen.
Eine schwierige Entscheidung. Die leicht rassistischen Bemerkungen waren legendär.
„Kommen Sie“, drängte Penelope wieder, da sie Schwäche witterte.
„Also gut.“ Lydia holte tief Luft und hob an, das kunterbunte Lied ihrer Lebensgeschichte zu singen, bei dem sie hier eine Wahrheit wegließ, dort eine Lüge einschob, die eine oder andere Ausschmückung hinzufügte und das Ganze gut verrührte.
„Ich bin aus Athens, Georgia. Dees Vater Lloyd stammt aus South Dakota.“ Oder dem südlichen Mississippi, aber Dakota klang weniger heruntergekommen. „Er wurde von seinem Stiefvater adoptiert.“ Der seine Mutter nur heiratete, damit man sie nicht zwingen konnte, gegen ihn auszusagen. „Lloyds Vater starb.“ Im Gefängnis. „Lloyd war auf dem Weg nach Mexiko, um es seinen Großeltern zu erzählen.“ Um zwanzig Kilo Kokain abzuholen. „Sein Auto wurde von einem Lkw erfasst.“ Er wurde tot auf einem Lkw-Parkplatz gefunden, nachdem er versucht hatte, mehrere Gramm Koks auf einmal zu schnupfen. „Es ging schnell.“ Er ist an seinem eigenen Erbrochenen erstickt. „Dee hat ihn nie kennengelernt.“ Was das größte Geschenk war, das ich meiner Tochter machen konnte. „Ende.“
„Lydia.“ Penelope schlug die Hand vor den Mund. „Ich hatte ja keine Ahnung.“
Lydia fragte sich, wie lange es wohl dauern würde, bis die Geschichte die Runde machte. „Lydia Delgado! Die tragische Witwe!“
„Was ist mit Lloyds Mutter?“
„Krebs.“ Ihr Zuhälter hat ihr ins Gesicht geschossen. „Von dieser Seite der Familie ist niemand mehr übrig.“ Der nicht im Gefängnis sitzt.
„Die armen Menschen.“ Penelope legte die Hand aufs Herz. „Dee hat nie etwas davon gesagt.“
„Sie weiß alles.“ Außer den Dingen, von denen sie Albträume bekäme.
Penelope sah auf das Basketballfeld hinunter. „Kein Wunder, dass Sie so fürsorglich sind. Sie ist alles, was Ihnen von ihrem Vater blieb.“
„Stimmt.“ Außer man zählt Herpes mit. „Ich war mit Dee schwanger, als er starb.“ Ich war auf kaltem Entzug, weil ich wusste, sie würden sie mir wegnehmen, wenn sie Drogen in meinem Blut fanden. „Es war ein Glück für mich, dass ich sie bekommen habe.“ Dee hat mir das Leben gerettet.
„Ach, Schätzchen.“ Penelope nahm Lydias Hand, und Lydia sank der Mut, als ihr bewusst wurde, dass alles umsonst gewesen war. Die Geschichte hatte Penelope sichtlich bewegt oder zumindest interessiert, aber sie war mit einer Aufgabe zu Lydia gekommen und musste sie loswerden. „Aber sehen Sie, es ist dennoch ein Teil von Dees Erbe, oder? Ich meine, eine Stieffamilie ist immer noch eine Familie. Einunddreißig Kinder an dieser Schule sind adoptiert, aber sie gehören trotzdem dazu!“
Lydia brauchte einen Moment, um diese Aussage zu verarbeiten. „Einunddreißig? Sagten Sie eben: einunddreißig?“
„Ich weiß.“ Penelope nahm ihre gespielte Schockiertheit für bare Münze. „Die Harris-Zwillinge sind gerade in die Vorschule gekommen. Die hat ihre Mutter mit in die Ehe gebracht, als Altlasten sozusagen.“ Sie senkte die Stimme. „Altlasten, die Läuse verbreiten, wenn man den Gerüchten glauben darf.“
Lydia öffnete den Mund und schloss ihn wieder.
„Wie dem auch sei.“ Penelope setzte wieder ihr strahlendes Lächeln auf. „Geben Sie mir nur die Rezepte vorher kurz durch, okay? Ich weiß, Sie mögen es, wenn sich Dee Fertigkeiten außerhalb des Lehrplans aneignet. Sie haben ja so ein Glück! Mutter und Tochter stehen zusammen in der Küche und kochen. Was für ein Spaß!“
Lydia hielt den Mund. Das Einzige, was sie und Dee zusammen in der Küche taten, war, darüber zu streiten, wann ein Mayonnaise-Glas so leer war, dass man es wegschmeißen musste.
„Danke für Ihre Bereitschaft!“ Penelope trabte über die Tribüne fort und ruderte dazu mit den Armen.
Lydia fragte sich, wie lange Penelope wohl brauchte, um den anderen Müttern vom tragischen Tod Lloyd Delgados zu erzählen. Ihr Vater sagte immer, der Preis dafür, dass man sich Klatsch anhörte, sei, dass über einen selbst ebenfalls geklatscht wurde. Sie wünschte, er würde noch leben, damit sie ihm von den Müttern hier erzählen könnte. Er würde sich vor Lachen in die Hose pinkeln.
Coach Henley blies in seine Trillerpfeife und zeigte damit an, dass die Mädchen langsam mit dem Aufwärmen zum Ende kommen sollten. Penelopes Worte von wegen „Fertigkeiten außerhalb des Lehrplans aneignen“ gingen Lydia nicht aus dem Kopf. Hier hatte sie also die Bestätigung, dass den Übermüttern nichts entging.
Lydia hatte kein schlechtes Gewissen, weil sie ihre Tochter dazu anhielt, einen Autoreparatur-Workshop zu besuchen, damit sie zumindest einen platten Reifen wechseln konnte. Und sie bereute es auch nicht, Dee gezwungen zu haben, sich für einen Selbstverteidigungskurs einzuschreiben, auch wenn sie dafür im Sommer das Basketball-Camp versäumte. Oder darauf bestand, dass Dee Schreien übte, weil Dee dazu neigte, in Paniksituationen vor Angst zu erstarren. Denn stumm zu bleiben war das absolut Blödeste, was man tun konnte, wenn man einen Mann vor sich hatte, der einen attackierte.
Lydia hätte darauf gewettet, dass Anna Kilpatricks Mutter sich in diesem Moment wünschte, ihrer Tochter beigebracht zu haben, wie man einen Reifen wechselte. Der Wagen des Mädchens war auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums gefunden worden, mit einem Nagel im Vorderreifen. Es war nicht unrealistisch, wenn man annahm, dass dieselbe Person, die den Reifen beschädigt hatte, auch Anna entführt hatte.
Coach Henley ließ zweimal kurz seine Trillerpfeife ertönen, damit sein Team sich in Bewegung setzte. Die Westerley-Mädels schlenderten zu ihm und bildeten einen Halbkreis. Die Mütter stampften mit den Füßen und bemühten sich nach Kräften, Begeisterung für ein Spiel aufzubauen, das so viel Dramatik entwickeln würde wie Farbe beim Trocknen. Das gegnerische Team hatte sich nicht einmal die Mühe gemacht, sich aufzuwärmen. Ihre kleinste Spielerin war über eins achtzig und hatte tellergroße Hände.
Die Tür zur Sporthalle flog auf. Lydia sah, wie Ricks Blick über die Menge flog und schließlich an ihr hängen blieb. Dann schaute er zu den leeren Rängen auf der anderen Seite des Spielfelds hinüber. Sie hielt den Atem an, als er offensichtlich überlegte, und stieß die Luft aus, als er sich auf den Weg zu ihr machte. Langsam stieg er die Tribüne herauf. Menschen, die für ihren Lebensunterhalt hart arbeiten mussten, neigten nicht dazu, Tribünen hinaufzusprinten.
Er ließ sich ächzend neben Lydia nieder.
„Hey“, sagte sie.
Rick hob die leere Chipstüte auf, legte den Kopf in den Nacken und ließ sich die Krümel in den Mund rieseln. Die meisten landeten in seinem Hemdkragen.
Lydia lachte, weil es schwer war, jemanden zu hassen, der lachte.
Er sah sie argwöhnisch an. Er kannte ihre Tricks.
Rick Butler war ganz anders als die übrigen Westerley-Väter. Zum einen lebte er von seiner Hände Arbeit. Er war Mechaniker an einer Tankstelle, die den älteren Kunden immer noch den Wagen auftankte. Die Muskeln an seinen Armen und der Brust rührten daher, dass er Reifen auf Felgen wuchtete. Der Pferdeschwanz, der ihm über den Rücken fiel, rührte daher, dass er nicht auf die zwei Frauen in seinem Leben hörte. Er war entweder ein Redneck oder ein Hippie, je nach Laune. Dass sie ihn in beiden Zuständen liebte, war die große Überraschung in Lydia Delgados Leben gewesen.
Er gab ihr die leere Tüte zurück. In seinem Bart hatten sich ein paar Chipskrümel verfangen. „Netter Schnauzer.“
Sie berührte ihre wunde Oberlippe. „Streiten wir noch?“
„Bist du immer noch schlecht gelaunt?“
„Wenn ich auf meinen Instinkt höre, ja“, räumte sie ein. „Aber ich hasse es, wenn wir böse aufeinander sind. Es fühlt sich an, als würde mein ganzes Leben auf dem Kopf stehen.“
Das Startsignal ertönte. Als das Spiel begann, zuckten sie zusammen und beteten, die Demütigung möge kurz ausfallen. Wie durch ein Wunder angelten sich die Westerley-Mädchen den Ball, und noch erstaunlicher war, dass Dee damit das Feld entlangdribbelte.
„Renn, Delgado!“, schrie Rick.
Offenbar nahm Dee die Schatten dreier riesenhafter Mädchen hinter sich wahr. Es gab niemanden, dem sie den Ball zupassen konnte. Sie schleuderte ihn blind in Richtung Korb. Dann sah sie, wie er vom Brett abprallte und in den leeren Rängen auf der anderen Hallenseite landete.
Lydia spürte Ricks kleinen Finger über ihren kleinen Finger streichen.
„Wie ist sie nur so fantastisch geworden?“, fragte er.
„Frühstücksflocken“, antwortete Lydia trocken. Sie brachte das Wort kaum heraus. Ihr ging jedes Mal das Herz auf, wenn sie sah, wie sehr Rick ihre Tochter liebte. Allein dafür verzieh sie ihm den Pferdeschwanz. „Tut mir leid, dass ich in letzter Zeit so eine Zicke war“, sagte sie und ergänzte: „Die letzten zehn Jahre meine ich.“
„Ich wette, du warst schon vorher zickig.“
„Früher war ich viel amüsanter.“
Er zog die Augenbrauen hoch. Sie hatten sich vor dreizehn Jahren auf einem Treffen der Anonymen Alkoholiker kennengelernt. Keiner von beiden war sehr amüsant gewesen.
„Ich war dünner“, versuchte sie es noch einmal.
„Klar, und darauf kommt es ja an.“ Rick nahm den Blick nicht vom Spielfeld. „Was ist los mit dir, Süße? In letzter Zeit brauche ich nur den Mund aufzumachen, schon heulst du los wie ein geprügelter Hund.“
„Jetzt bist du doch froh, dass wir nicht zusammenleben, oder?“
„Wollen wir schon wieder darüber streiten?“
Beinahe hätte sie damit angefangen. Der Satz: „Warum sollten wir zusammenziehen, wenn wir sowieso Tür an Tür wohnen?“, lag ihr schon auf der Zunge.
Ihre Selbstbeherrschung blieb nicht unbemerkt. „Schön, zu sehen, dass du den Mund halten kannst, wenn du es wirklich willst.“ Er pfiff, als Dee einen Dreier versuchte. Der Ball ging daneben, aber er zeigte ihr trotzdem den erhobenen Daumen, als sie in seine Richtung schaute.
Lydia war versucht, anzumerken, dass Dee einen Dreck auf seinen Beifall gäbe, wenn sie zusammenwohnten, aber sie beschloss, sich den Kommentar für das nächste Mal aufzuheben, wenn sie sich anbrüllten.
Rick seufzte, als die gegnerische Mannschaft den Ball bekam. „Oje, das war’s dann wohl.“
Das Mädchen mit den tellergroßen Händen sperrte Dee. Es hatte nicht einmal genügend Anstand, die Arme zu heben.
Rick lehnte sich zurück. Seine Füße hatte er auf dem Vordersitz abgelegt, die rissigen braunen Lederstiefel hatten Ölflecke. Seine Jeans war fettverschmiert, und er roch leicht nach Auspuffgasen. Er hatte freundliche Augen. Er liebte ihre Tochter. Er liebte Tiere. Sogar Eichhörnchen. Er hatte sämtliche Bücher von Danielle Steel gelesen, weil er bei der Entziehungskur süchtig danach geworden war. Es störte ihn nicht, dass Lydias Kleidung meist voller Hundehaare war. Und an ihrem Sexleben bedauerte sie nur eines: dass sie dabei keinen Ganzkörperumhang tragen durfte.
„Was muss ich tun?“, fragte sie.
„Sag mir, was in deinem verrückten Kopf vor sich geht.“
„Ich könnte es dir sagen, aber dann müsste ich dich anschließend töten.“
Er dachte darüber nach. „Also gut. Du darfst nur mein Gesicht nicht entstellen.“
Lydia sah auf die Anzeigetafel. Zehn zu null. Sie blinzelte. Zwölf zu null. „Es ist nur …“ Sie wusste nicht, wie sie es ausdrücken sollte. „Es ist nur so, dass mich die Vergangenheit einholt.“
„Das klingt wie ein Countrysong.“ Er sah ihr in die Augen. „Anna Kilpatrick?“