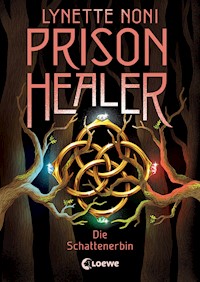
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Loewe Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Prison Healer
- Sprache: Deutsch
Sie hat ihn verraten. Doch was, wenn sie seine einzige Hoffnung ist? Kivas Leben liegt in Schutt und Asche. Nach jener verhängnisvollen Nacht im Palast ist sie zurück in Zalindov. Viel schlimmer jedoch: Jaren weiß nun, wer sie wirklich ist – und dass sie ihn hintergangen hat. Wozu also noch kämpfen? Doch ehe Kiva aufgeben kann, befindet sie sich wieder in einem gefährlichen Strudel aus Intrigen. Und ausgerechnet sie soll Evalons einzige Chance auf Rettung sein … Das fulminante Finale der Fantaystrilogie Im dritten und letzten Band der Prison Healer-Trilogie erschafft Lynette Noni eine spannungsgeladene Handlung rund um eine magische Quest. Dabei muss die Protagonistin nicht nur nach Vergebung suchen, sondern auch sich selbst verzeihen und lernen, ihren Fähigkeiten zu vertrauen. Ein emotionales Finale voller fesselnder Plottwists.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Sammlungen
Ähnliche
Inhalt
Prolog
Heute
Kapitel eins
Kapitel zwei
Kapitel drei
Kapitel vier
Kapitel fünf
Kapitel sechs
Kapitel sieben
Kapitel acht
Kapitel neun
Kapitel zehn
Kapitel elf
Kapitel zwölf
Kapitel dreizehn
Kapitel vierzehn
Kapitel fünfzehn
Kapitel sechzehn
Kapitel siebzehn
Kapitel achtzehn
Kapitel neunzehn
Kapitel zwanzig
Kapitel einundzwanzig
Kapitel zweiundzwanzig
Kapitel dreiundzwanzig
Kapitel vierundzwanzig
Kapitel fünfundzwanzig
Kapitel sechsundzwanzig
Kapitel siebenundzwanzig
Kapitel achtundzwanzig
Kapitel neunundzwanzig
Kapitel dreißig
Kapitel einunddreißig
Kapitel zweiunddreißig
Kapitel dreiunddreißig
Danksagung
Liebe Leser*innen,
in dieser Buchreihe sind bereits von Anfang an sehr ernste Themen zur Sprache gekommen, aber nach den Wendungen am Ende von Prison Healer – Die Schattenrebellin
Für alle, die schon einmal aufgeben wollten,
sich aber dann entschieden haben, weiterzumachen,
es weiter zu versuchen,
weiter zu hoffen,
weiterzuleben.
PROLOG
Die Frau weinte.
Tränen rannen ihr über die Wangen wie kleine Flüsse, tropften ihr vom Kinn und durchtränkten den Stoff ihrer Tunika. Doch sie musste leise sein. Niemand durfte von ihren Sorgen erfahren.
Denn niemand würde sie verstehen.
Sie schlang die Arme um ihre Knie und starrte in die Dunkelheit, betete zu lang vergessenen Göttern. Flehte um Gnade. Obwohl sie wusste, dass sie keine verdient hatte – und niemals wieder welche verdienen würde.
Nicht nach allem, was sie getan hatte.
Nicht nach allem, was sie erschaffen hatte.
Ein Schluchzen erschütterte ihren Körper.
»Ich habe einen Fehler gemacht«, formte sie lautlos mit den Lippen. »Ich will ihn wiedergutmachen. Ich muss ihn wiedergutmachen.«
So fand der Mann sie: tränenüberströmt und vor Qual gebeugt.
Einen Augenblick lang blieb er im Zelteingang stehen, dann jedoch eilte er zu ihr und ergriff ihre zitternden Hände. »Was ist passiert, meine Liebe? Bist du krank? Oder verletzt?«
Ihre feuchten Augen suchten seine. »Es war falsch«, krächzte sie.
Er runzelte die Stirn. »Falsch? Was?«
Neue Tränen benetzten ihre Wangen. »Alles.«
Der Mann konnte seine Verwirrung nicht verbergen. Genauso wenig wie seine Furcht.
»Du brauchst Hilfe«, sagte er. »Ich hole Zuleeka, um dich zu hei–«
»Nein!« Die Frau entriss ihm die Hände. Ihre Anspannung schien das gesamte Zelt zu erfüllen.
Der Mann ging in die Hocke und musterte sie prüfend. Leise wiederholte er seine Frage: »Was ist passiert?«
Eine Weile sagte sie nichts, und als sie schließlich antwortete, klang ihre Stimme schmerzhaft rau. »Zuleeka hat sie getötet. Sie hat ihnen das Genick gebrochen, mit nur einem einzigen Wink.«
Der Mann erbleichte. »Wem?«
»Den Dorfbewohnern – jedem, der ihr über den Weg lief. Jedem, dessen Blick ihr nicht gefiel. Jedem, der sich uns nicht anschließen wollte.« Die Frau schluckte. »Alle denken, ich wäre es gewesen. Dabei –« Sie schüttelte den Kopf und flüsterte: »Ich wusste ja, dass ihre Macht stetig wächst, aber … Ich wollte nicht, dass es so kommt. Niemals. Sie hatte versprochen, sie nicht mehr einzusetzen, nach dem letzten Mal, als sie – als ich –«
»Beim letzten Mal hast du sie aufgehalten«, wandte der Mann mit ruhiger Stimme ein. »Du hast sie davor bewahrt, den Prinzen und seine Leibwächterin zu töten. Allein deinetwegen sind die beiden heute noch am Leben und wohlauf.«
»Die Leibwächterin hat ihre Hand verloren.«
»Sie hätte noch weitaus mehr verloren, wenn du sie nicht von dem magischen Bann befreit hättest. Und der Kronprinz wäre tot.« Leise fügte er hinzu: »Vor nicht allzu langer Zeit hättest du dir genau das gewünscht. Ein Vallentis weniger, mit dem man sich herumschlagen muss.«
»Damals war mir auch noch nicht klar, dass –« Wieder schüttelte die Frau den Kopf. »Er ist doch noch so jung – jünger als Torell. Als ich ihn gesehen habe, da …« Sie schloss die Augen. »Er ist doch noch so jung«, wiederholte sie.
»Trotzdem steht seine Familie deinen Zielen im Weg. Er steht dir im Weg.«
»Es gibt andere Möglichkeiten, den Thron zu erlangen. Möglichkeiten, bei denen nicht noch mehr Menschen zu Schaden kommen, die ich liebe. Ich darf nicht –« Ein heftiger Schluchzer raubte ihr den Atem. »Ich darf nicht noch jemanden verlieren. Nicht so. Sie wird daran sterben, wenn sie ihre Kräfte weiter zum Bösen verwendet. Ihre Magie wird sie von innen heraus zerstören.«
Mit Bedacht wählte der Mann seine Worte. »Du kannst dir nicht die Schuld an Zuleekas Entscheidungen geben. Dafür ist sie selbst verantwortlich.«
»Nein, Galdric, du irrst dich. Alles, was sie tut, tut sie meinetwegen«, entgegnete die Frau und wieder übermannten sie die Erinnerungen an das, was sich vor wenigen Stunden ereignet hatte. An die berstenden Knochen, die gebrochenen Genicke, die zusammensackenden Körper – Männer, Frauen, Kinder, tot, von einer Sekunde auf die andere. »Alles, was sie weiß, habe ich sie gelehrt. Das hier ist meine Schuld.«
Bleiernes Schweigen breitete sich zwischen ihnen aus, ehe der Mann – Galdric – fragte: »Wie lautet dein Befehl, meine Königin?«
Erst da sah Tilda Corentine mit ihren smaragdgrünen Augen auf und ein stummer Austausch vollzog sich zwischen ihr und ihrem engsten Vertrauten, ihrem ergebenen Freund. Schließlich flüsterte sie eine Antwort, flehte um Hilfe.
Und dann steckten die beiden die Köpfe zusammen und schmiedeten einen Plan.
HEUTE
KAPITEL EINS
Kiva Corentine stand in Flammen.
Das Feuer versengte ihren Körper, brachte das Blut in ihren Adern zum Kochen. Sie stöhnte, warf sich hin und her und schlug nach den Händen, die sie festzuhalten versuchten.
»Die glüht ja«, ertönte eine barsche Männerstimme. »Hol ihr mal ’n Schluck Wasser.«
Der Geruch nach Erbrochenem überwältigte Kivas Sinne. Er war so stark, so nah, dass er von ihrem eigenen Mageninhalt herrühren musste – eine Erkenntnis, die sie gleich erneut zum Würgen brachte.
Sie war krank.
Nein. Nicht krank.
Irgendwo in ihrem Hinterkopf regte sich das Wissen, dass dies kein gewöhnliches Leiden war.
Verschwommene Erinnerungen stürzten auf sie ein: blaugoldene Augen und vom Küssen geschwollene Lippen, tödliche Schatten und Glassplitter, goldenes Pulver und eiserne Gitterstäbe. Dann zerstreuten sich ihre Gedanken wieder und eine gnadenlose Hitze brannte ihr die Bilder aus dem Gedächtnis. Bis die Hitze alles war, was Kiva kannte, alles, was sie ausmachte.
»Bei den Göttern, was für ein Häufchen Elend!«, bemerkte eine weibliche Stimme angewidert.
Ein Holzbecher kollidierte unsanft mit Kivas Lippen. Wasser rann ihr die ausgedörrte Kehle hinunter, schwappte ihr übers Kinn.
»Ja«, bestätigte der Mann. »Dein Häufchen Elend. Für Leichen bin ich nich’ zuständig.«
Die Hände, die Kiva zu Boden drückten, ließen von ihr ab. Sie versuchte, sich aufzusetzen, doch die Flammen hielten ihren Oberkörper fest umschlossen. Eine knappe Sekunde lang öffnete sie flatternd ihre Lider, sah aber kein Feuer. Denn es war in ihr – ein tosendes Inferno.
»Sie ist noch am Leben«, protestierte die Frau.
»Aber nich’ mehr lange«, entgegnete der Mann, dessen Stimme jetzt weiter weg klang, als hätte er sich bereits zum Gehen gewandt. »Die hat schon viel zu viel von dem Zeug gekriegt, um ohne durchzukommen. Überlass sie am besten ihrem Schicksal. Oder verpass ihr ’nen Gnadenstoß, wenn dein Magen das mitmacht.« Ein Schnauben. »Ich hab da so ’ne Ahnung, dass du damit keine Probleme hättest.«
»Du bist der Gefängnisheiler«, fauchte die Frau. »Es ist deine Pflicht, ihr zu helfen.«
Wieder ein Schnauben. »Der kann keiner mehr helfen.«
Über dem Dröhnen in ihren Ohren konnte Kiva kaum noch hören, wie seine Schritte sich entfernten. Ihr Herz pochte unnatürlich schnell. Gefährlich schnell.
Ein Teil von ihr wusste, dass sie sich Sorgen hätte machen müssen. Aber dieser Teil konnte nichts ausrichten, konnte ja nicht einmal weiter denken als bis zu dem sengenden Schmerz, der ihren Körper verschlang.
Eine Reihe von Flüchen drang zu ihr durch, gefolgt von einer schwieligen Hand, die Kivas Nacken umfasste und sie grob hochzerrte. Wieder wurde ihr der Becher an die Lippen gedrückt.
»Jetzt trink schon«, kommandierte die Frau und flößte ihr gewaltsam das Wasser ein. »Wenn du am Leben bleiben willst, musst du was trinken.«
Kiva bemühte sich, dem Befehl Folge zu leisten, obwohl sie beinahe an der Flüssigkeit erstickte und sich unablässig fragte, was der Sinn des Ganzen war. Wenn so ihr Leben aussah, dann wäre sie definitiv besser tot. Der Mann hatte einen Gnadenstoß erwähnt. Das war es, was Kiva sich wünschte – ein schnelles Ende für diese brennende Hölle. Dann müsste sie sich auch keine Gedanken mehr um das klaffende Loch in ihrem Herzen machen.
Ein Loch, das mit ihrem derzeitigen Zustand nichts zu tun hatte.
Wieder zuckte ihr das Bild blaugoldener Augen durch den Kopf und fügte ihr eine ganz andere Art von Qualen zu, ehe es wieder verblasste.
»Verdammt noch mal, Kiva, trink endlich«, schimpfte die Frau.
Kiva konnte nicht. Ein Schauder nach dem anderen schüttelte sie. Feuer kämpfte gegen Eis, Schweiß überzog ihre Haut, während sie gleichzeitig vor jäher Kälte zitterte, doch als jemand eine Decke über sie breitete, wimmerte sie, man solle sie wegnehmen.
Zu heiß.
Zu kalt.
Zu viel.
»Bitte«, krächzte sie, ohne zu wissen, worum sie eigentlich bat – oder wen. »Bitte.«
»Du stirbst nicht«, bestimmte die Frau. »Nicht so.«
Aber Kiva glaubte ihr nicht. Sie wünschte sich nichts sehnlicher, als dass es endlich vorbei war – das alles.
Erleichtert ließ sie sich zurück in die Arme der Besinnungslosigkeit sinken.
Als Kiva das nächste Mal die Augen aufschlug, blickte sie in das Gesicht einer Schlange.
Der Raum, schummrig und voller verlassener Pritschen mit fadenscheinigen Decken, schien sich um sie zu drehen. Ein vertrauter beißender Geruch hing in der Luft.
Sie war auf der Krankenstation, flüsterte ihr eine ferne Erinnerung zu. Auf der Krankenstation von Zalindov.
Alarmglocken schrillten in ihrem Kopf, doch sie schaffte es nicht, sich ernsthaft zu sorgen. Nicht mit diesem Karamellgeschmack auf der Zunge, nicht im Angesicht dieser Schlange, die nun das Maul öffnete und zu sprechen begann.
»Wach auf!«, zischte die Schlange und rüttelte an ihrer Schulter. Sie klang wie die Frau, die sie zum Trinken gezwungen hatte.
Kichernd streckte Kiva die Hand nach ihr aus.
Und bekam einen Klaps auf die Finger. »Du musst mitkommen in die Tunnel, sonst bringen sie dich um. Hörst du? Wenn du nicht arbeitest, bist du tot.«
Der Tonfall der Schlange war so eindringlich, dass Kiva sich reflexartig aufsetzte, woraufhin jedoch sofort ihr Kopf zur Seite wegkippte. Verschwommen erkannte sie, dass sie eine graue, schmutzstarrende Uniform aus Hemd und Hose trug. Und von dieser stieg der Gestank von Erbrochenem auf und ließ sie die Nase rümpfen.
»Bei den Göttern, du hast wirklich keine Ahnung, was hier vor sich geht, was?«, raunte die Schlange, wand sich um Kivas Rücken und zog sie auf die Beine. »Sie haben dich während der Reise hierher unter Engelsstaub gesetzt und jetzt bist du süchtig danach.« Die Schlange zerrte sie durch die Krankenstation. »Ich hab ein bisschen Nachschub besorgen können, das sollte dir zumindest durch die nächsten Tage helfen. Wir müssen dich Stück für Stück davon entwöhnen, sonst versagen deine Organe. Verstehst du mich?«
»Sprechende Schlangen«, nuschelte Kiva und ließ sich stolpernd ins Freie ziehen. Im hellen Sonnenschein hob sie die Hand und grinste über all die Regenbogenfarben ringsum. »Schön heute.«
Die Schlange spie ein unanständiges Wort aus und knurrte dann durch zusammengebissene Zähne: »Kiva, ich bin’s, Cresta. Reiß dich zusammen.«
Cresta.
Also doch keine Schlange.
Aber nah dran.
Cresta Voss. Ein Name, der Abneigung und Angst in Kiva weckte, begleitet von Bildern einer muskulösen jungen Frau mit verfilztem rotem Haar, haselnussbraunen Augen und einer über die gesamte linke Gesichtshälfte tätowierten Schlange. Sie arbeitete im Steinbruch von Zalindov und kannte Kiva seit mehr als fünf Jahren – und begegnete ihr schon genauso lange mit unverhohlener Feindseligkeit. Als Anführerin der Gefängnisrebellen war sie Kivas Schwester Zuleeka Corentine, der neuen Königin von Evalon, treu ergeben. Diese saß inzwischen auf einem gestohlenen Thron, nachdem sie Kiva alles genommen hatte. Alles. Und jeden.
»Böse Schlange«, murrte Kiva und versuchte sich von Cresta loszumachen. »Kschhh.«
»Lass das«, herrschte Cresta sie an und packte nur noch fester zu. Sie führte Kiva über Kies, dann vertrocknetes Gras, in Richtung der steinernen Kuppel in der Mitte des Geländes. »Ohne mich hältst du hier keinen Tag mehr durch.«
»Wohl.« Wieder strauchelte Kiva auf dem unebenen Boden. Die strudelnden Farben schienen von den hellen Gefängnismauern in der Ferne abzuprallen. »Und wenn nicht, auch gut.«
»Ist dir eigentlich klar, was du da redest?« Cresta manövrierte sie um einen tiefen Krater herum, den selbst Kiva in ihrer Benommenheit nicht übersehen konnte. Unter großer Anstrengung rief sie sich vor Augen, wie der Wachturm in sich zusammengebrochen war. Heute war nichts als eine Erinnerung davon übrig.
»Mot«, hauchte Kiva in einem kurzen Moment der Klarheit den Namen des Mannes, der den Turm gesprengt hatte. »Wo ist Mot?«
»Tot«, antwortete Cresta emotionslos. »Dafür hat der Vorsteher persönlich gesorgt – gleich nach dem Aufstand, den du für deine Flucht genutzt hast.«
Trauer schnürte Kiva die Brust zu, als sie an den Totengräber dachte, der sich so oft um sie gekümmert und ihr sogar geholfen hatte, die Elementarprüfungen zu überstehen. Im nächsten Moment jedoch war das Gefühl wieder verflogen, so flüchtig wie ein Windhauch. Sie schüttelte den Kopf, um das Farbenchaos daraus zu vertreiben und über das nachzudenken, was die Schlange als Letztes gesagt hatte. »Niemand entkommt aus Zalindov«, widersprach sie und ein Schwall manischen Gelächters brach aus ihr hervor. »Nicht wirklich.«
Eine Gruppe weiterer grau gekleideter Gefangener zog Crestas Aufmerksamkeit auf sich und hielt sie vom Antworten ab. Mit steifen Gliedern schleppten die Häftlinge sich über die abgestorbene Wiese in Richtung der Kuppel, die Gesichter von Erschöpfung gezeichnet.
»Wenn wir an den Tunneln ankommen, musst du absolut zurechnungsfähig wirken, sonst schicken die Wachen dich ins Purgatorium«, warnte Cresta gedämpft. »Falls sie sich überhaupt noch damit die Mühe machen.«
»Na und?«, höhnte Kiva und schlurfte voran.
Der Griff der Steinbrucharbeiterin wurde schmerzhaft fest. »Du hast mir mal eingeschärft, ich sei stark und unabhängig«, zischte sie. »Und es mir selbst schuldig, einen Grund zum Überleben zu finden. Jetzt sage ich dir dasselbe, Kiva Meridan.«
Kiva ließ sich so weit zusammensacken, wie Cresta es zuließ, und erwiderte: »Das ist nicht mein Name.«
»Ist es doch.«
»Ist es nicht.«
»Du entscheidest, wer du sein willst«, verkündete Cresta harsch. »Du entscheidest, was du sein willst. Jetzt musst du dich aber erst mal dafür entscheiden, am Leben zu bleiben. Der Rest kann warten.«
Selbst in diesem Moment, in ihrer mehr als erbärmlichen Verfassung, ließen die Worte Kiva stutzen. Allein die Vorstellung, ihre eigenen Entscheidungen treffen zu können, war lächerlich. Zehn Jahre lang war sie hier in Zalindov den Entscheidungen anderer unterworfen gewesen, hatte jeden Tag aufs Neue ums Überleben kämpfen müssen. Und dann, nachdem sie tatsächlich eine Weile die Luft der Freiheit hatte schnuppern dürfen, hatten ein paar schlechte Entscheidungen sie wieder zurück an den Anfang geführt und ihr mehr gekostet, als sie sich je hätte vorstellen können.
Das Loch in ihrem Herzen pulsierte und nicht einmal der Engelsstaub vermochte, den Schmerz ganz zu betäuben.
»Nur damit es hier keine Missverständnisse gibt: Du bist mir vollkommen egal«, fuhr Cresta eiskalt fort. »Aber du hast mir damals das Leben gerettet und darum stehe ich in deiner Schuld. Und deshalb wirst du heute nicht sterben und morgen auch nicht und immer so weiter, bis du von dieser götterverdammten Droge losgekommen bist. Danach kannst du selbst entscheiden, wie es mit dir weitergeht. Ob du leben willst oder nicht. Doch bis dahin hörst du auf mich. Und ich sage dir, dass du dich jetzt mit aller Kraft zusammenreißen und für den schlimmsten Tag deines Lebens wappnen musst.«
Kiva hatte Cresta so gebannt gelauscht, dass sie kaum bemerkt hatte, wie sie die Kuppel erreichten. Dort hatte sich bereits eine Schlange anderer Gefangener gebildet, die darauf warteten, den Leiterschacht hinab in die Tunnel zu steigen.
»Was machst du hier?«, fragte Kiva, bemüht, einen klaren Gedanken zu fassen.
Frustriert stöhnte Cresta auf. »Hab ich dir doch gerade erklärt.«
Kiva schüttelte den Kopf. Anscheinend hatte sie eine geringere Dosis Engelsstaub verabreicht bekommen als in den letzten Wochen, denn während sie diese größtenteils bewusstlos verbracht hatte, erlebte sie jetzt eine Art lichten Moment. Mühsam präzisierte sie daher: »Nein, ich meine: Warum bist du nicht im Steinbruch?«
Cresta zögerte. »Rooke hat mir nach dem Aufstand einen neuen Posten zugeteilt. Es passt ihm nicht, dass ich schon so lange hier überlebt habe, darum muss ich jetzt in den Tunneln schuften. So kann er sicher sein, dass ich bald vor Erschöpfung krepiere.«
Damit blieben Cresta sechs Monate. Höchstens ein Jahr. Das unvermeidliche Schicksal der Tunnelarbeiter von Zalindov.
Ein Schicksal, das auch Kiva teilte, nachdem sie nun nicht mehr die Gefängnisheilerin war.
Der Gedanke hätte sie mit Todesangst erfüllen müssen, doch dafür konnte sie sich schlicht nicht genug aus ihrer Lethargie reißen.
Und irgendwas sagte ihr, dass diese Tatsache nicht allein dem Engelsstaub zuzuschreiben war.
»Die Nächsten«, erklang eine gelangweilte männliche Stimme und ließ Kiva von dem vertrockneten Gras aufsehen. Sie hatten den Eingang erreicht, wo zwei Wärter die Gefangenen zu den Leitern dirigierten, die aus einem rechteckigen Loch im Boden ragten.
»Ich weiß, du fühlst dich gerade miserabel«, beschwor Cresta sie weiter, während die Gefangenen vor ihnen im Schacht verschwanden. »Aber egal, was passiert, lass bloß nicht die Leiter los.« Nach einem Blick in Kivas ausdrucksloses Gesicht fügte sie eilig hinzu: »Denk an irgendwas, was dir wichtig ist. Diesen Kleinen, der so gestottert hat. Den hattest du doch so gern. Denk an ihn und halt dich fest.«
Tipp.
Das verschwommene Gesicht eines sommersprossigen Jungen mit Zahnlücke schoss Kiva durch den Kopf und brachte ihr Herz abermals schmerzhaft zum Pochen.
»Die Nächsten!«, rief der Wärter wieder und diesmal winkte er Kiva und Cresta heran.
»Einen Fuß nach dem anderen«, mahnte Cresta. »Tu’s für den Kleinen. Ich bin direkt neben dir.«
Träge nickte Kiva. Ihr Kopf war zu schwer für ihre Schultern und fühlte sich zugleich seltsam leicht an. Cresta versetzte ihr einen kleinen Schubs, woraufhin sie beinahe gestolpert wäre. Die Wärter feixten. Sie wussten, wer sie war, wie tief sie gesunken war. Und sie weideten sich an ihrem Leid.
Wut stieg in ihr auf, die jedoch rasch wieder verpuffte. Der Engelsstaub wischte alles fort, ehe sie auch nur nach den Metallholmen greifen konnte.
Zwei Leitern führten nebeneinander in den Schacht hinunter, und als Kiva sich an den Abstieg machte, hielt Cresta Wort und blieb dicht neben ihr. Auf der ersten Plattform angekommen, wechselten sie zum nächsten Leiternpaar. Cresta murmelte ermutigend auf sie ein, während sie gemeinsam Sprosse für Sprosse, Plattform für Plattform in die Tiefe stiegen. Kiva starrte auf ihre Hände, als gehörten sie jemand anderem. Sie spürte nichts, war sich nur vage ihrer Bewegungen bewusst, ihrer brennenden Muskeln und der Luft, die mit der Tiefe stetig schaler und kälter wurde.
Tipp. Für Tipp würde sie durchhalten.
Dabei musste der Junge sie hassen, nach allem, was er über sie herausgefunden hatte, nach allem, was sie getan hatte.
Kiva entfuhr ein gequälter Laut und Cresta drehte sich erschrocken zu ihr um. Kurz darauf jedoch erreichten sie das Ende der letzten Leiter und Erleichterung überzog das Gesicht der rothaarigen Frau.
Sicherheit. Sie waren in Sicherheit.
Und auch wieder nicht.
Denn bevor Kiva auch nur Atem schöpfen konnte, wurde sie einen luminiumerleuchteten Tunnel hinuntergeschleust, durch den sich eine Reihe Arbeiter schob wie emsige Ameisen. Leise Panik stieg in ihr auf, das Gefühl erstickend und vertraut und dennoch gedämpft durch den Engelsstaub.
Bei ihrem letzten Besuch hier unten hatten sich keine anderen Gefangenen mit im Tunnel befunden. Allein war sie allerdings auch nicht gewesen.
Blaugoldene Augen. Eine kleine, in der Luft schwebende Flamme. Eine einzelne, wunderschöne Schneeblüte.
Diesmal war es nicht die Droge, die das Bild beiseiteschob, sondern Kiva selbst.
Sie durfte nicht daran denken.
Sie durfte nicht an ihn denken.
Ein feuchtes Schmatzen brachte sie dazu, den Blick auf den Boden zu senken. Die Erde dort hatte sich in Schlamm verwandelt, der ein Stück weiter in flaches und schließlich kniehohes Wasser überging. Erst als einer der Aufseher den Gefangenen Einhalt gebot, wurde Kiva sich der Spitzhacke bewusst, die ihr unterwegs jemand in die Hand gedrückt haben musste. Sie umfasste den Griff und schwenkte sie wie ein Schwert.
So wie Caldon es ihr während der Trainingsstunden mit der hölzernen Übungswaffe beigebracht hatte.
Kiva schloss die Augen. Auch diese Erinnerung verdrängte sie und gestattete dem Engelsstaub, ihren erneut entfachten Schmerz zu lindern. Sie ließ die Arme sinken und fokussierte sich darauf, wo sie war und warum. Was sie zu tun hatte.
Graben.
Sie war jetzt eine Tunnelarbeiterin, eine von vielen Gefangenen, die nach Wasser suchen und es in Richtung der Zisterne leiten mussten.
Dies war die schlimmste Arbeit, die einem in Zalindov zugeteilt werden konnte. Die härteste, körperlich wie seelisch. Die tödlichste.
»Denk an den Kleinen«, kommandierte Cresta erneut. »Vergiss ihn nicht für eine Sekunde.«
Ihr nachdrücklicher Tonfall ließ Kiva unwillkürlich gehorchen, und als die Wärter ihnen schließlich befahlen, die harten Kalksteinwände des Tunnels auszuschachten, konzentrierte sie sich im Geiste voll und ganz auf Tipps Gesicht.
Wieder und wieder schlug Kiva ihre eiserne Hacke in den unnachgiebigen Fels. Jede Bewegung fuhr ihr wie ein Schock in die Knochen und die Geräusche ließen sie mit den Zähnen knirschen. Mit jedem Schlag hieß Kiva das zunehmende Brennen in ihren Muskeln willkommen, genau wie die durch den aufsteigenden Staub verschleierte Sicht und das Piepen in ihren Ohren, ausgelöst vom Donnern Hunderter Spitzhacken. Vage registrierte sie neben sich Cresta, die ihr immer wieder Tipp ins Gedächtnis rief und sie zum Weitermachen ermahnte. Sie durfte nicht aufhören, denn sobald sie aufhörte, würden die Wärter kommen, die mit gezückten Peitschen und Schlagstöcken durch den Tunnel patrouillierten. »Liefere ihnen keinen Vorwand«, raunte Cresta ihr zu. Nicht aufhören. Nicht aufhören. Nicht aufhören.
Blut aus aufgeplatzten Blasen und aufgescheuerten Schwielen rann den Stiel von Kivas Spitzhacke hinab. Zwar spürte sie den Schmerz, aber er war so dumpf wie alles andere um sie.
Noch.
Denn ganz allmählich, während Sekunden zu Minuten, Minuten zu Stunden wurden, ließ die Wirkung des Engelsstaubs nach.
Es begann mit hartnäckig wummernden Kopfschmerzen, die von der Schädelbasis nach außen strahlten, gefolgt von einem widerlichen Kupfergeschmack auf der Zunge und zitternden Fingern, die es ihr immer schwerer machten, die von Blut glitschige Hacke zu halten. Als die Wärter endlich das Schichtende verkündeten, war Kiva trotz der harten Arbeit durchgefroren. Und klar genug im Kopf, um zu begreifen, dass alles, was sie bis jetzt durchgestanden hatte, nichts war im Vergleich zu dem, was noch vor ihr lag.
»Ich fühle mich hundeelend«, stöhnte Kiva, während sie an den Leitern warteten, um zurück an die Oberfläche zu klettern.
»Kann ich mir vorstellen«, murmelte Cresta. »Hast du nichts auf deiner Krankenstation, was da helfen könnte?«
»Es ist nicht mehr meine Krankenstation«, erwiderte Kiva, die sich vor Erschöpfung kaum mehr auf den Beinen halten konnte. Nach ihrer Flucht aus Zalindov war sie eine Weile in den Genuss von üppigen Mahlzeiten und regelmäßiger Bewegung gekommen, was ihr in Kombination mit dem Engelsstaub die nötige Kraft verliehen hatte, um den Tag zu überstehen. Natürlich schmerzte jede Faser ihres Körpers. Ihr Geist jedoch war so wach wie seit Wochen nicht mehr und Kiva durchforstete angestrengt ihr Gedächtnis nach Heilpflanzen, die gegen Entzugssymptome halfen.
»Tja, wie heißt es so schön? Augen zu und durch«, sinnierte Cresta, nachdem Kiva ihre Liste heruntergerattert hatte, und strich sich die verfilzten roten Locken aus der schweißfeuchten Stirn. »Trotzdem schau ich mal, ob ich was davon besorgen kann.«
Kiva flüsterte eine Antwort, doch sie hätte kaum sagen können, welche Worte tatsächlich ihren Mund verließen, denn sie fror inzwischen so stark, dass ein Schauder nach dem anderen ihren Körper schüttelte. Nur verschwommen bekam sie mit, wie sie aus der Tunnelöffnung stiegen, bevor Cresta sie den ganzen Weg zu ihrem Quartier stützte und sie dort nicht gerade sanft auf ihre Pritsche fallen ließ – staubig und voller Matsch, das Hemd noch immer befleckt von ihrem eigenen Erbrochenen. Kiva hatte keine Ahnung, wie lange sie dalag, zitternd und schwitzend, mit schmerzenden Muskeln und einem gnadenlosen Pochen in den blutigen Händen.
»Zeig mal her.«
Cresta war zurück. Kiva wusste nicht, wie lange sie weg gewesen oder schon wieder da war. Ihr Gesicht war so schmutzig, dass die Schlangentätowierung kaum noch zu erkennen war.
Kiva spürte etwas Nasses, woraufhin ihre Hände zu brennen begannen. Reflexartig wollte Kiva sie wegziehen, aber Cresta hielt sie fest.
»Du musst deine Hände sauber halten, sonst entzündet sich das alles.«
Kiva erstarrte. Diese Worte hatte sie schon einmal gehört. Hatte sie selbst ausgesprochen.
Du musst deine Hände sauber halten, sonst entzündet sich das alles.
Starke Hände, die zu einem starken Körper gehörten, zerzaustes goldbraunes Haar, die schönen Lippen zu einem wissenden Lächeln verzogen, funkelnde blaugoldene Augen.
Das Loch in Kivas Herz riss wieder auf und diesmal traf sie der Schmerz mit solcher Wucht, dass sie einen winzigen Moment lang zu zittern aufhörte. Aber sie war nicht auf der Krankenstation. Und er war nicht bei ihr.
Nicht jetzt.
Und er würde es auch nie wieder sein.
»Hier, iss«, holte Cresta sie zurück in die Gegenwart und hielt ihr eine Faustvoll schlanker grüner Zwiebeln hin, dazu gelbe und orangefarbene Blüten und einen Klumpen schwarz verkohltes Holz.
Weder fragte Kiva, wie es Cresta gelungen war, sich in den Heilkräutergarten zu schleichen, noch wollte sie sich länger mit dem Gedanken befassen, dass die Kohle aus dem Krematorium stammen musste. Erst nachdem sie sich alles in den Mund gestopft und das Gesicht über den Aschegeschmack verzogen hatte, merkte sie an: »Von Kohle hatte ich doch gar nichts gesagt.«
»Du bist nicht die Erste, die ich durch einen Entzug begleite«, erklärte Cresta leise, während sie sich wieder Kivas Händen widmete. »Kohle saugt dir die Giftstoffe aus dem Blut.«
Kiva hätte sich gern erkundigt, wem Cresta noch geholfen hatte, doch genau in diesem Augenblick erfasste sie ein so heftiger Magenkrampf, dass sie sich keuchend zusammenkrümmte.
»Du musst was essen.« In Crestas Stimme lag keine Wärme, keine Sorge um Kivas Wohlbefinden. Sie beschrieb lediglich eine Tatsache.
»Das kommt« – ein weiterer Krampf hielt Kiva gefangen und sie biss die Zähne zusammen – »doch sowieso alles wieder hoch.«
Cresta begann zu widersprechen, doch Kiva verstand nicht, was sie sagte. Die Schmerzen waren so schlimm geworden, dass sie ihre gesamte Aufmerksamkeit beanspruchten. Es würde seine Zeit dauern, bis die Kombination aus den Zwiebeln der Scheinweide, Tilliblüten, Butterkresse und Kohle ihre Wirkung zeigte. Aber selbst das würde Kiva nur begrenzt Linderung verschaffen. Wenn Cresta sie ernsthaft von ihrer Engelsstaubsucht befreien wollte, stand ihr eine harte Nacht bevor.
Ehe Kiva erneut protestieren konnte, wurde ihr ein Stück brühegetränktes Brot zwischen die Lippen geschoben. Schweiß stand ihr auf der Stirn und ihre Haut wechselte von glühend heiß zu kalt und wieder zu heiß.
»Nein«, ächzte sie und versuchte, sich wegzudrehen.
»Du brauchst Energie für morgen«, bestimmte Cresta. »Allein von Engelsstaub kannst du nicht leben.«
»Engelsstaub«, wiederholte Kiva und erstickte beinahe am Brot. Ihre Stimme klang rau, verzweifelt. »Bitte … ich brauche … nur ein bisschen.«
Trotz ihres verschleierten Blicks sah Kiva, wie Crestas Züge sich verhärteten. »Was du brauchst, ist Essen und dann Schlaf. Morgen früh besorge ich dir mehr.«
Abwehrend schüttelte Kiva den Kopf. Die Krämpfe brachten ihre Zähne zum Klappern. »Nein … ich brauche Engelsstaub. Jetzt.«
»Iss.« Cresta stopfte ihr einen weiteren Bissen Brot in den Mund.
Kiva würgte, doch Cresta presste ihr die Hand auf die Lippen, bis ihr nichts anderes übrig blieb, als zu schlucken.
»Die Kohle sollte dafür sorgen, dass du das Essen bei dir behältst«, erklärte Cresta. »Aber der Kampf, der dir bevorsteht, ist nicht nur ein körperlicher, sondern auch ein geistiger. Und den Willen dazu musst du schon selbst aufbringen.«
Kiva stöhnte, als sie erneut zwangsgefüttert wurde, doch sosehr sie auch flehte, Cresta ließ sich nicht dazu erweichen, ihr auch nur die winzigste Dosis Engelsstaub für die Nacht zu besorgen.
Stundenlang rangen sie miteinander. Kiva wimmerte und tobte, während ihr Körper nach Erlösung schrie.
»Kannst du ihr nich’ endlich das Maul stopfen? Andere Leute versuchen, hier zu schlafen!«, beschwerten sich die Gefangenen, die das Drama aus nächster Nähe miterleben mussten.
»Geht doch und heult eurer Mami was vor«, fauchte Cresta und ignorierte die Klagen genauso entschlossen wie Kivas.
Irgendwann im Laufe der Nacht jedoch sank Kiva so tief ins Delirium, dass ihre Schreie das halbe Gefangenenquartier weckten: »GIB IHN MIR! ICH BRAUCHE IHN! DU MUSST IHN MIR –«
Fluchend hielt Cresta ihr abermals den Mund zu und zerrte ihren schweißbedeckten, zitternden Körper im Mondlicht von der Pritsche und dann vorbei an finster dreinblickenden, verschlafenen Gefangenen. Sie blieb erst stehen, als sie gemeinsam in den dunklen Waschraum gestolpert waren, wo sie Kiva unter eine der Duschen bugsierte und das eiskalte Wasser aufdrehte.
Prustend und nach Luft schnappend, versuchte Kiva zu entkommen, doch Cresta hielt sie fest, ohne sich darum zu scheren, dass sie dabei ebenfalls klitschnass wurde.
»LASS MICH LOS!«, brüllte Kiva.
»Nichts da«, knurrte Cresta durch zusammengebissene Zähne, ihr Griff unverändert fest. »Erst wenn du dich beruhigt hast, verdammt noch mal.«
Kiva wand sich, aber es hatte keinen Zweck; sie war zu schwach. Kurz darauf sackte sie japsend und mit ihrem ganzen Gewicht gegen Cresta.
»Bist du fertig?«, herrschte diese sie an.
Kiva konnte bloß stumm nicken. Ihre Kraft war aufgebraucht, ihr Wille gebrochen.
Cresta drehte das Wasser wieder ab und Kiva sank zu Boden. Triefend und bibbernd, saßen sie eine Weile an die Duschwand gelehnt da, während ihrer beider Keuchen durch die Dunkelheit hallte.
»Du bist wirklich eine Nervensäge, weißt du das?«, brummte Cresta.
Die Worte ließen ein Bild von Caldon vor Kivas innerem Auge erscheinen, der sie mehr als einmal so genannt hatte. Und obwohl ihr die Erinnerung einen Stich versetzte, hoben sich kaum merklich ihre Mundwinkel. »D-du bist n-nicht d-die Erste, d-die mich s-so nennt«, sagte sie mit klappernden Zähnen.
»Und mit Sicherheit auch nicht die Letzte.«
»Es t-tut mir l-leid«, flüsterte Kiva. Das eisige Wasser hatte sie genügend ausgenüchtert, dass sie sich für ihr Verhalten schämte, ob nun die Droge daran schuld war oder nicht. »Und d-danke. D-dass d-du mir hilfst.«
»Noch ist es nicht vorbei«, warnte Cresta sie. »Wir haben noch einen langen Weg vor uns.«
Das war Kiva bewusst. Aber sobald sie am Ziel war – falls sie es denn je erreichte –, würde sie eine Möglichkeit finden, sich zu bedanken, selbst wenn Cresta sich nur aus Pflichtgefühl ihrer annahm.
»Du hast g-gesagt, d-du hättest schon m-mal jemand anderem m-mit dem Entzug geholfen.« Kiva genoss den klaren Kopf, zu dem ihr die Kälte verhalf. »W-wer w-war das?«
Cresta schwieg so lange, dass Kiva die Hoffnung auf eine Antwort beinahe aufgab. Dann aber, kaum hörbar in der Dunkelheit des Waschraums, sagte die junge Frau: »Als ich noch klein war, lange bevor ich nach Zalindov gekommen bin, hat meine Schwester einen geheimen Vorrat an Engelsstaub gefunden. Ohne zu ahnen, was es war, hat sie eine Überdosis genommen und ist fast dran gestorben. Ich bin ihr nicht von der Seite gewichen, bis sie wieder gesund war.«
»W-wie alt w-warst du da?«
»Zehn«, antwortete Cresta. »Sie war acht.«
So jung. »U-und eure Eltern?«
»Wir hatten nicht das beste Zuhause«, erwiderte Cresta ganz sachlich. »Meine Schwester war der sanftmütigste Mensch, den man sich vorstellen kann, was mein Vater jedoch als Charakterfehler betrachtet hat. Für ein derart schwaches Kind hatte er nichts übrig. Er meinte sogar, es würde ihn nicht kümmern, wenn sie sterbe. Und meine Mutter … die war zu sehr damit beschäftigt, nicht durch die Hand meines Vaters zu sterben. Meine Schwester hatte niemanden außer mir.«
Der Schmerz darüber war Cresta anzuhören, sosehr sie ihn auch zu verbergen versuchte. »W-wie ging es dann weiter?«, fragte Kiva.
»Na, ich hab erst dafür gesorgt, dass sie die Überdosis übersteht und anschließend den Entzug. Danach hat sie nie wieder Engelsstaub angerührt.«
»Nein.« Kiva rieb sich fröstelnd die Oberarme. »W-was ist aus deiner F-Familie geworden?«
Diesmal schwieg Cresta noch länger. »Ich hab keine Familie. Nicht mehr.«
Kiva schloss die Augen angesichts des Leids, das aus diesen wenigen Worten sprach. Cresta war vor mehr als fünf Jahren nach Zalindov gebracht worden – sie konnte damals nicht älter als sechzehn gewesen sein. Kiva wusste nicht, warum sie hier gelandet war … wie sie ihre Eltern und ihre Schwester verloren hatte … Dafür wusste sie einfach nicht genug über die Vergangenheit der ehemaligen Steinbrucharbeiterin.
»Wie –«
»Die Märchenstunde ist vorbei«, blaffte Cresta und rief Kiva damit in Erinnerung, dass sie alles andere als Freundinnen waren. Im Gegenteil, bis vor Kurzem noch hätte Kiva sie wohl als ihre Feindin bezeichnet und sie war sich nicht sicher, ob sich daran etwas geändert hatte. »Versuch zu schlafen.«
Kiva blinzelte in den dunklen Waschraum. »H-hier?«
»Zurück auf deine Pritsche kannst du jedenfalls nicht. Wenn du dich noch mal so aufführst wie eben, kommen mit Sicherheit die Wärter.« Cresta machte es sich auf dem Boden bequem.
»A-aber mir ist eisk-kalt.« Doch noch ehe Kiva ihren Satz beendet hatte, durchströmte eine altbekannte Wärme ihren Körper. Die Entzugserscheinungen kehrten zurück, nachdem der Kälteschock überwunden war. Zudem war die Spätfrühlingsnacht relativ mild – sobald Kivas Kleider getrocknet wären, würde es wohl nicht allzu unangenehm sein. Sie hatte schon an wesentlich ungemütlicheren Orten geschlafen, auch wenn sie dabei nicht auch noch einen Drogenentzug hatte bewältigen müssen.
»Schlaf«, ordnete Cresta an, ohne auf Kivas Jammern einzugehen. »Solange du noch kannst.«
Kiva wollte protestieren, wollte die Millionen von Fragen stellen, die ihr durch den Kopf geisterten, wollte jede Sekunde auskosten, die sie noch bei klarem Verstand war, bevor sie sich am Morgen erneut dem Engelsstaub hingab. Aber Cresta hatte recht, sie musste schlafen, wann immer ihr Körper es ihr gestattete, und Kraft für all die – geistigen und körperlichen – Strapazen sammeln, die noch vor ihr lagen.
Also biss sie die Zähne zusammen und schloss die Augen, während unter ihrer Haut heiß gegen kalt kämpfte. Bis die Erschöpfung sie in die Tiefe zog.
Die nächsten drei Tage gehörten zu den schlimmsten, die Kiva je erlebt hatte, die vier darauffolgenden wurden nicht viel besser und auch die Woche danach war an Elend kaum zu überbieten.
Cresta hielt ihr Versprechen und blieb die ganze Zeit über an ihrer Seite. Jeden Morgen händigte sie Kiva gerade genug Engelsstaub aus, damit sie den Tag in den Tunneln überstand – wobei Cresta die Dosis stetig verringerte –, jede Nacht schlief sie neben ihr im Waschraum. Allzu oft warf Kiva sich schreiend hin und her und wehrte sich mit aller Macht gegen Cresta, die ihr die Haare aus dem Gesicht halten musste, während sie sich krampfartig übergab. Irgendwann büßte sogar die Kohle ihre Wirkung ein, sodass Kiva nahezu pausenlos von Übelkeit, Magenkrämpfen und einem Wechsel aus Schweißausbrüchen und Schüttelfrost geplagt wurde. Jeder Zentimeter ihres Körpers tat weh, und das nicht nur infolge der Schufterei in den Tunneln – von jenen Stunden voller Schlamm, Staub und Schmerz unter der Erde bekam sie kaum etwas mit. Vielmehr rührten ihre Leiden von dem fortwährenden Kampf, den sie gegen sich selbst führte, Nacht für Nacht und ohne absehbares Ende.
Es war zu viel, zu schlimm, zu viel.
Jeden Tag wünschte sie sich den Tod herbei, so unerträglich waren die Qualen. Und nicht nur die Qualen des Entzugs: Je weiter die Droge sich aus ihrem Körper zurückzog, desto unerbittlicher prasselten die Erinnerungen auf sie ein – alles, was sie erlebt, alles, was sie getan hatte. All die Menschen, denen sie Leid zugefügt hatte.
Dies war eine völlig andere Art von Schmerz. Die schlimmste überhaupt. Eine Art, von der sie sich nie erholen würde. Denn das hätte sie nicht verdient.
Also schob sie die Erinnerungen beiseite und gab sich voll und ganz den Qualen des Entzugs hin, bis zwei Wochen nach ihrer Rückkehr nach Zalindov das Zittern allmählich nachließ, die Übelkeit verebbte, die Verzweiflung abklang.
Sie hatte es geschafft.
Und doch stand ihr das Schlimmste noch bevor.
KAPITEL ZWEI
Kiva betrachtete ihre Handflächen, die blutgefüllten Blasen und aufgeplatzten Schwielen, aber sie spürte nichts. Schon seit Wochen nicht mehr.
Nur Kälte. Nur Taubheit.
Und dennoch gelang es ihr nicht, deswegen auch nur das geringste bisschen Sorge aufzubringen.
Sie hatte es nicht besser verdient.
Dabei wusste sie, dass sie niemals genug Buße tun könnte.
»Iss.«
Ein Stück trockenes Brot wurde Kiva unter die Nase gehalten, von einem Paar Hände, die zwar staubbedeckt waren, aber nicht blutverschmiert. Hände, die seit Jahren harte Arbeit kannten und es gewohnt waren, die Spitzhacke zu schwingen, Stunde um Stunde, Tag um Tag.
Vorsteher Rooke hatte sich in seiner Annahme getäuscht, dass Cresta in den Tunneln schnell zugrunde gehen würde. In dieser Hinsicht war die ehemalige Steinbrucharbeiterin wie eine Kakerlake. Langsam begann Kiva, sich zu fragen, ob Cresta überhaupt durch irgendetwas kleinzukriegen war.
»Noch fünf Minuten!«, rief einer der schwarz uniformierten Aufseher, die mit den Händen an ihren Peitschen den luminiumerleuchteten unterirdischen Gang entlangstolzierten. Eine vollkommen unnötige Ansage, denn die Pause war jeden Tag gleich lang.
»Iss«, wiederholte Cresta und drückte Kiva das Brot in die Hand. Sie saßen in einer Reihe mit den anderen Gefangenen an die Kalksteinwand gelehnt, ihre Werkzeuge neben sich auf dem Boden, und genossen einen kurzen Moment der Rast.
Erst als Cresta ihr den Ellbogen in die Rippen stieß, hob Kiva das Brot wie mechanisch an die Lippen und kaute auf dem zähen Bissen herum.
»Und jetzt trink«, kommandierte die Rothaarige. Gehorsam schöpfte Kiva eine Handvoll brackiges Wasser aus einer Pfütze zu ihren Füßen. Es schmeckte nach Schlamm, aber wenigstens half es ihr, das Brot hinunterzuwürgen und nicht zu verdursten.
Überleben. Zu mehr war Kiva nicht in der Lage, auch wenn sie das Unvermeidliche damit nur herauszögerte.
Ihr war immer klar gewesen, dass nur die Arbeit auf der Krankenstation sie so lange in Zalindov hatte durchhalten lassen. Sie war nicht stark genug für die Schinderei in den Tunneln, nicht wie Cresta. Im Grunde wunderte es sie, dass sie überhaupt noch lebte, nachdem sie nun schon seit über fünf Wochen zurück im Gefängnis war. Das hatte sie einzig und allein Cresta zu verdanken, so viel stand fest. Und ob nun aus Mitleid oder irgendeinem anderen Grund, die ehemalige Steinbrucharbeiterin hatte Kiva auch nach ihrem Drogenentzug nicht im Stich gelassen. Dabei war sie kein bisschen liebevoll oder auch nur freundlich. Meistens redete sie mit Kiva nur, um sie barsch daran zu erinnern, sich um ihre grundlegendsten menschlichen Bedürfnisse zu kümmern. Trotzdem hatte sich im Laufe der letzten Wochen eine Art stillschweigende Partnerschaft zwischen ihnen entwickelt. Wenn eine von ihnen stürzte, half die andere ihr auf – wobei diese Aufgabe meistens Cresta zufiel.
Kiva verstand noch immer nicht ganz, was Cresta zu alldem bewog. Zwischen ihnen hingen so viele unausgesprochene Fragen in der Luft, nicht zuletzt die nach Crestas Rolle als Anführerin der Gefängnisrebellen und ob sie mittlerweile wusste, wer Kiva wirklich war. Bis zu Kivas Flucht hatte sie nichts davon geahnt, aber seither hatte sich vieles verändert. Zum Beispiel, dass es in Zalindov gar keine Rebellen mehr gab, die Cresta hätte anführen können.
Dafür hatte Rooke gesorgt.
Obwohl bei dem Aufstand damals bereits unzählige Gefangene ums Leben gekommen waren – darunter Grendel, Olisha und Nergal –, hatte der Vorsteher anschließend noch eine Massenexekution angeordnet. Niemand aus Crestas engerem Umfeld war dem Galgen entgangen, nur sie allein war in die Tunnel versetzt worden: ein besonders sadistischer Schachzug Rookes, um ihr noch mehr Leid zuzufügen.
Für Kiva war dies der einzig ersichtliche Grund, warum die rothaarige Frau nicht von ihrer Seite wich – weil Kiva ihr auf irgendeine verdrehte Art und Weise Vertrautheit vermittelte, Sicherheit. Vielleicht war es das, was sie suchte, nachdem sie beinahe genauso viel verloren hatte wie Kiva.
Nein, dachte Kiva und starrte abermals auf ihre blutverschmierten Hände. Nicht so viel wie ich.
Es tat weh, auch nur an seinen Namen zu denken, sich sein Gesicht vor Augen zu rufen, doch sie zwang sich dazu, während sie unbewusst nach dem Amulett unter ihrem Hemd griff. Bei ihrer Ankunft im Gefängnis hatten die Aufseher die Anweisung erhalten, ihr das Schmuckstück nicht abzunehmen.
Ich will, dass du es als Andenken behältst, an all das, was ich dank deiner Hilfe erreicht habe, hatte Zuleeka ihr durch die eisernen Gitterstäbe tief unter dem Flusspalast in Vallenia zugezischt.
Doch selbst wenn das königliche Wappen um ihren Hals keine ständige Erinnerung gewesen wäre, hätte Kiva nie vergessen, was passiert war. Das war unmöglich. Sie sah ihn jede Sekunde jedes Tages vor sich, seine blaugoldenen Augen erfüllt von Trauer und Entsetzen, als er begriff, dass sie ihm alles gestohlen hatte: seinen Thron, seine Magie, sein Herz.
Jaren Vallentis.
Der ehemalige Thronfolger des Königreichs Evalon, vertrieben aus seinem eigenen Palast und auf der Flucht. Und das alles durch Kivas Schuld.
Doch Jaren war nicht der Einzige. Weitere Menschen, die ihr wichtig waren, mussten nun ihretwegen leiden: Naari, Caldon, Tipp und sogar ihr Bruder Torell. Kiva hatte keine Ahnung, was ihnen seit jener schicksalhaften Nacht vor ein paar Wochen widerfahren war.
Wann immer sie die Augen schloss, sah sie Naari in einer Blutlache liegen, nachdem Zuleeka ihre Todesmagie gegen sie eingesetzt hatte. Sie sah Caldon, wie er auf den nahezu leblosen Jaren herunterstarrte, bevor er sie anschrie, sie solle fliehen, seine Loyalität gegenüber seiner Familie sichtlich im Widerstreit mit seiner Zuneigung für Kiva. Sie sah die Bestürzung in Tipps Gesicht, als ihm klar wurde, dass sie ihn seit Jahren belogen hatte. Und sie sah, wie Zuleeka den kleinen Jungen kurz darauf bewusstlos schlug – angeblich, weil er ein zu großes Risiko darstellte. Bis heute hatte Kiva keine Gelegenheit mehr gehabt, ihm alles zu erklären. Tipp befand sich in Rhessindas Obhut, die versprochen hatte, sich um ihn zu kümmern. Um ihn und um Torell, der angeblich im Kampf mit ihren mirravenischen Entführern niedergestochen worden war. In Wahrheit jedoch waren es nicht die Mirravener gewesen, die ihn beinahe getötet hatten, sondern Kivas Schwester.
Zuleeka.
Alles, was sich zugetragen hatte, war Zuleekas Schuld. Sie hatte sich mit Mirryn Vallentis verbündet, um die Macht über Evalon an sich zu reißen. Dafür hatte Mirravens König Navok Prinzessin Mirryns Liebe zu seiner Schwester Serafine ausgenutzt und sie so dazu gebracht, sich gegen ihre eigene Familie zu wenden.
Kiva kannte die Hintergründe und doch machte sie sich selbst dafür verantwortlich. Schließlich hatte sie einen wichtigen Beitrag dazu geleistet, dass der Plan der beiden erfolgreich war. Sie hatte ihnen sämtliche Informationen geliefert, die sie brauchten, um sich des Throns zu bemächtigen – und damit hatte sie genau die Menschen verraten, die sie liebte.
Sie hatte Jaren verraten.
Er würde ihr niemals vergeben.
Genau wie sie sich selbst niemals vergeben würde.
Denn das hatten Menschen wie sie nicht verdient.
Menschen wie sie verdienten den Tod.
Da war es wohl nur passend, dass sie wieder in Zalindov saß und genau darauf wartete. Diesmal gab es kein Entkommen, niemand würde sie retten. Sie war allein und genauso sollte es sein.
All das Leid und die Qualen geschahen ihr recht. Dennoch würde keine Strafe der Welt wiedergutmachen, was sie zerstört hatte. Kiva musste mit ihrer Schuld leben – oder sie schon bald mit ins Grab nehmen.
»Ende der Pause!«, rief der Wärter neben ihnen und weiter unten im Tunnel wiederholten seine Kameraden den Befehl. »Zurück an die Arbeit!«
Kiva hievte sich hoch und Cresta tat es ihr gleich. Wie sehr hatte Kiva früher gefürchtet, der rothaarigen Rebellin im Gefängnis zu begegnen. Mit ihrem feindseligen Gebaren und ihrer Neigung zum Unruhestiften hatte Cresta dafür gesorgt, dass Kiva stets einen weiten Bogen um sie gemacht hatte. Und trotz des neuen Friedens zwischen ihnen würde Kiva nie vergessen, dass Cresta einst gedroht hatte, Tipp zu töten, sollte Kiva die Rebellenkönigin nicht am Leben halten. Dabei hatte Kiva dazu keinerlei zusätzlichen Ansporn gebraucht, schließlich war Tilda Corentine ihre Mutter.
Oder besser gesagt: war es gewesen.
Denn Tilda war tot.
Weil Kiva sie nicht hatte retten können.
Genauso wenig wie ihren Vater.
Oder ihren Bruder Kerrin.
Ihre halbe Familie, ausgelöscht.
Zwar trug Kiva in keinem der Fälle die Schuld daran, dennoch plagte sie das Wissen, dass sie ihre Lieben vor dem Übertritt ins Schattenreich hätte bewahren können, wenn sie die Chance gehabt hätte, die Heilmagie in ihrem Blut einzusetzen. Wenn sie den Mut gehabt hätte, sie einzusetzen.
Sie hatte ihre Familie im Stich gelassen.
Und jetzt musste sie dafür bezahlen.
Dafür und für so vieles mehr.
»Was machst du denn?«, flüsterte Cresta. »Fang an zu graben.«
Kiva blinzelte. Während ihre Mitgefangenen längst wieder zu ihren Werkzeugen gegriffen hatten, stand sie bloß da und starrte wie so oft auf ihre Hände.
Hände, an denen Blut klebte.
Hände, die über große Macht verfügten.
Wenn sie wollte, könnte sie einen goldenen Schwall ihrer Magie aus sich hervorbrechen lassen. Oder mit nur einem einzigen falschen Gedanken, einem einzigen falschen Wunsch, die Todesmagie heraufbeschwören, die sie von ihrem Vorfahren Torvin Corentine geerbt hatte. Jene Magie, die ihre Mutter dem Untergang geweiht und ihre Schwester dazu gebracht hatte, sich dem Bösen zuzuwenden. Genau diese Magie strömte auch durch Kivas Adern. Schon immer.
Kiva erschauderte und ballte die Hände zu Fäusten.
»Nimm deine Hacke«, zischte Cresta.
Wie durch einen Dunstschleier sah Kiva hoch und ihr Blick verharrte einen Moment auf Crestas sorgenverzerrter Schlangentätowierung. Erst dann wurde ihr der Grund für den eindringlichen Tonfall der Rebellin bewusst: Ein Wärter war um die Ecke gebogen und marschierte schnurstracks auf sie zu.
Es war der Knochenbrecher.
Irgendein beinahe verschütteter Überlebensinstinkt ließ Kiva hastig nach ihrer Hacke greifen und sie in den Kalkstein rammen.
Der Knochenbrecher war neben dem Metzger einer der Aufseher, die Kiva in ihren zehn Jahren in Zalindov am meisten zu fürchten gelernt hatte, denn der bleiche Mann mit den schwarzen Augen war jähzornig und unberechenbar. Normalerweise patrouillierte er mit seiner Armbrust über die Gefängnismauer oder überwachte von einem der Türme aus das Gelände. Was also machte er jetzt hier unten?
Ein unheilvolles Kribbeln breitete sich in ihr aus, als der Knochenbrecher sich näherte und sie darauf wartete, dass er vorbeiging.
Doch das tat er nicht.
Stattdessen blieb er direkt hinter ihr stehen und seine Hand schnellte nach vorn, entriss ihr die Hacke.
Cresta grub langsamer und beobachtete das Geschehen besorgt von der Seite. Ihre haselnussbraunen Augen funkelten eine Warnung.
Kiva schluckte und drehte sich um.
»Na, sieh einer an, die Heilerin«, schnarrte der Knochenbrecher.
Seine offensichtliche Schadenfreude durchdrang Kivas Benommenheit der letzten Wochen und ließ jähe Angst in ihr aufsteigen. Als Gefängnisheilerin war sie früher wenigstens bis zu einem gewissen Grad vor Gewalttätern wie dem Knochenbrecher geschützt gewesen. Nicht nur, weil er wie alle anderen auf ihr medizinisches Wissen angewiesen war, sondern auch, weil sie in der Gunst des Vorstehers gestanden hatte. Zwar hatte ihr das längst keine absolute Sicherheit garantiert, aber zumindest waren ihr dadurch einige der schlimmsten Torturen erspart geblieben, die manche ihrer Mithäftlinge erleiden mussten.
Jetzt jedoch, als einfache Tunnelarbeiterin, fehlte ihr dieser Schutz. Und in Rookes Gunst stand sie erst recht nicht mehr.
Der Knochenbrecher trat einen Schritt auf sie zu und Kiva wich zurück, bis sie mit dem Rücken an die Kalksteinwand stieß. Der Gefangene links neben ihr zögerte kurz, grub dann jedoch umso eifriger weiter, um nur ja keine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.
Auf der anderen Seite hingegen richtete Cresta sich auf.
»Können wir was für Sie tun?«, fragte sie in frostigem Ton.
Der Knochenbrecher würdigte sie kaum eines Blicks. »Zurück an die Arbeit, Voss.«
Dass er Crestas Namen kannte, war kein gutes Zeichen – normalerweise sprachen die Wärter Häftlinge lediglich mit ihrer Identifikationsnummer an.
Der Knochenbrecher legte die freie Hand auf seine Armbrust und grinste Kiva an. »Wir zwei machen jetzt mal ’nen kleinen Spaziergang.«
Achtlos ließ er Kivas Hacke fallen und griff stattdessen nach ihrem Arm. Kivas Magen krampfte sich zusammen, aber ehe der Wärter sie packen konnte, drängte sich Cresta zwischen sie.
»Da bin ich doch gerne dabei«, verkündete die Rebellin betont unbefangen. »Wo soll’s denn hingehen?«
Der Knochenbrecher betrachtete Cresta mit finsterer Miene. »Letzte Warnung.«
Doch Cresta blieb ungerührt zwischen ihm und Kiva stehen wie ein menschlicher Schutzschild.
»Cresta –«, fing Kiva an, aber ihr Mund war so trocken, dass sie nicht weiterkam.
»Wenn Kiva sich die Beine vertreten darf, sollten wir anderen auch das Recht dazu haben«, fuhr Cresta fort, ohne sich um die drohende Gefahr zu scheren. Vielleicht genoss sie das Gefühl sogar. »Ist ja wohl nur gerecht.«
Der Knochenbrecher musterte sie mit schief gelegtem Kopf. »Normalerweise hab ich ja nichts gegen solche Spielchen, allein um zu sehen, was dabei rauskommt. Aber heute bin ich nicht in Stimmung dafür.« Suchend sah er sich um und winkte zwei andere Wärter heran, die seinem Befehl eilig Folge leisteten. Dann wandte er sich wieder an Cresta. »Entweder, du gräbst jetzt freiwillig weiter oder die beiden hier zwingen dich dazu. Wie du willst.«
Kivas Angst wuchs, da Cresta trotzig stehen blieb, bis den beiden neuen Wärtern nichts anderes übrig blieb, als sie zu ergreifen, einer links, einer rechts.
Hämische Freude breitete sich auf dem Gesicht des Knochenbrechers aus, während Cresta sich im Griff der Männer wand. »Du«, sagte er schließlich wieder zu Kiva. »Mitkommen.«
Kiva warf Cresta einen panischen Blick zu. Als ihr jedoch der Gedanke kam, wie unbesonnen die Rebellin reagieren könnte – womöglich würde sie sogar die Wärter angreifen –, krächzte sie hastig: »Schon gut. Ich bin gleich wieder da.«
Natürlich hatte sie keine Ahnung, ob das der Wahrheit entsprach, immerhin wusste sie nicht, was der Knochenbrecher im Schilde führte. Aber die Vorstellung, dass Cresta ihretwegen bestraft würde, war ihr einfach unerträglich. Wenn sie sich weiter so aufsässig gab, wollte Kiva sich die Konsequenzen lieber nicht ausmalen.
Daher sah sie Cresta flehend an, bis diese endlich aufhörte, sich zu wehren, und widerwillig nickte.
Ein erleichterter Seufzer löste sich aus Kivas Brust. Doch gleich darauf erstarrte sie wieder, als der Knochenbrecher auf dem Absatz herumfuhr und davonmarschierte. »Wenn ich deine Schritte nicht hinter mir höre, kannst du dich auch gleich auf den Weg in die Leichenhalle machen!«, rief er ihr über die Schulter zu.
Cresta schüttelte ihre Wärter kurz ab, um Kiva einen unsanften Stoß vorwärts zu verpassen. »Na los, wenn der Knochenbrecher so was sagt, ist das keine Drohung – sondern ein Versprechen.«
»Aber du –«
»Aber ich bin ganz brav und benehme mich wie eine vorbildliche kleine Tunnelmaus«, gelobte Cresta säuerlich und versetzte Kiva einen weiteren Stoß. »Und jetzt geh.«
Nach einem letzten »Worauf wartest du noch?«-Blick kehrte Cresta zu ihrem Platz an der Kalksteinwand zurück und grub weiter. Die beiden Wärter ließen sie nicht aus den Augen, doch Kiva wusste, dass die Rebellin zu klug war, um weiter Ärger zu machen. Cresta hatte bereits viel riskiert, indem sie dem Knochenbrecher die Stirn geboten hatte. Schließlich trug der seinen Spitznamen nicht ohne Grund, sondern weil er den Insassen gern die Knochen brach – manchmal einfach nur aus Langeweile.
Beim Gedanken daran, was passiert wäre, wenn der Knochenbrecher weniger nachsichtig mit Cresta gewesen wäre, bekam Kiva ein schlechtes Gewissen. Dann jedoch fiel ihr sein Versprechen ihr gegenüber wieder ein und sie eilte ihm hinterher, wenn auch nicht ohne einen letzten Blick über die Schulter, um sich zu vergewissern, dass ihre neue Verbündete wieder sicher bei der Arbeit war. An den Leitern holte sie den Knochenbrecher schließlich ein, der beinahe enttäuscht wirkte, sie zu sehen. Seine Hand lag auf seiner Armbrust, als hätte er sich schon darauf gefreut, sie zu benutzen.
Nervös beäugte Kiva die Waffe, was dem Knochenbrecher ein Grinsen entlockte, bevor er mit dem Kinn auf den Leiterschacht wies. »Na los, rauf da«, kommandierte er und fügte spöttisch hinzu: »Nach Ihnen, die Dame.«
Kiva wusste nur zu gut, dass der Knochenbrecher jede ihrer Bewegungen überwachte, und kletterte folgsam die Leiter hoch. Eine gefühlte Ewigkeit und unzählige Fragen, die sie sich nicht zu stellen traute, später erreichten sie das obere Ende.
Wo ihre Fragen schlagartig beantwortet wurden, als der Knochenbrecher sie hinaus in den nachmittäglichen Sonnenschein führte. Denn endlich wusste sie, warum er sie geholt hatte.
Oder vielmehr: wer ihm den Befehl dazu gegeben hatte.
Am Eingang der Steinkuppel wartete der Gefängnisvorsteher und nahm mit ausdrucksloser Miene Kivas verschwitztes, staubiges Äußeres in Augenschein.
Kiva blieb wie angewurzelt stehen.
Fünf Wochen lang hatte sie ihn kein einziges Mal gesehen, nicht seit ihrer Ankunft, als die Droge sie so fest in ihren Fängen gehabt hatte, dass sie sich kaum noch daran erinnerte. Außer an eine Reihe blitzend weißer Zähne in einem dunklen Gesicht und an ein paar boshafte Willkommensworte. Damals hatte sie derart neben sich gestanden, dass sie rein gar nichts gespürt hatte. Anders als jetzt.
Ein roter Schleier schien sich über ihr Sichtfeld zu legen, als sie dem Mann gegenübertrat, der für den Tod so vieler Menschen verantwortlich war.
Auch für den ihres Vaters vor vielen Jahren.
»Also stimmt es, du lebst noch«, bemerkte Rooke unumwunden.
Kiva schwieg und rief sich ins Gedächtnis, dass der Knochenbrecher sich sofort auf sie stürzen würde, wenn sie auf den Vorsteher losginge. Zwar hatte Caldon ihr während ihrer Zeit im Flusspalast Kampflektionen erteilt, aber sie hatte längst nicht genug Übung, um es mit Rooke oder dem Knochenbrecher aufzunehmen – geschweige denn, mit beiden auf einmal. Dazu hätte sie niemals genug Kraft gehabt, selbst vor den fünf Wochen der Mangelernährung und Schinderei, die nun hinter ihr lagen. Sie musste besonnen bleiben und den richtigen Moment abwarten, sosehr sie auch danach lechzte, den Vorsteher für seine Taten bezahlen zu lassen.
»Dass du so lange durchhältst, hätte ich nicht erwartet«, fuhr Rooke fort. »Erst recht nicht angesichts des jämmerlichen Zustands, in dem du hier eingetroffen bist. So ungern ich es zugebe – ich bin beeindruckt.« Sein Blick bohrte sich in ihren und seine diamantförmige Narbe wirkte furchterregender denn je. »Aber du warst schließlich schon immer eine richtige Überlebenskünstlerin, stimmt’s?«
Kiva reckte das Kinn, blieb jedoch weiterhin stumm.
»Nanu, hast du mir etwa gar nichts zu sagen?« Er hob eine Augenbraue. »Zu schade. Andererseits bin ich auch nicht hier, um mit dir zu plaudern. Immerhin hast du mir seit deiner Flucht nichts als Ärger bereitet, Kiva Meridan – oder soll ich dich Kiva Corentine nennen?«
Noch immer verkniff Kiva sich jegliche Reaktion, konnte allerdings nicht verhindern, dass sie erbleichte. Rookes Nasenflügel blähten sich triumphierend.
»Das war eine ziemliche Überraschung«, räumte er ein. »Doch wenigstens verstehe ich jetzt, warum du dich freiwillig dem Elementarurteil gestellt hast. Die eigene Mutter – nein, wirklich zu tragisch.«
Sein Gestichel ließ Kiva so fest die Fäuste ballen, dass sich die Fingernägel in ihre Haut gruben.
»Aber das allein wäre ja nicht mal von Belang gewesen. Ich hätte dich vollkommen in Ruhe gelassen, wenn dein Prinz nicht gewesen wäre.« Rooke redete sich zunehmend in Rage. »Wusstest du, dass er versucht hat, mich meines Amtes zu entheben? Sogar vor Gericht wollte er mich bringen. Allerdings unterstehe ich nicht der evalonischen Gerichtsbarkeit – zumindest nicht ausschließlich. Ich diene allen acht Königreichen zugleich und die Mehrheit entscheidet. Und im Gegensatz zu deinem Prinz Deverick wissen die anderen Herrscher meine kompetente Führung hier zu schätzen. Sie sind mir dankbar dafür, dass ich das schlimmste Gesindel aus ganz Wenderall vom Rest der Welt fernhalte. Wie genau ich das bewerkstellige, ist ihnen gleich. Oder jedenfalls war es so, bis du und dein Prinz beschlossen habt, mich ins Rampenlicht zu zerren.«
Kiva erstarrte angesichts Rookes finsterer Miene.
»Sie mögen fürs Erste entschieden haben, nicht auf Devericks Anschuldigungen einzugehen, allerdings lassen sie mich neuerdings keine Sekunde mehr aus den Augen«, grollte der Vorsteher. »Und das gefällt mir nicht. Ganz und gar nicht.«
Er beugte sich vor, eine winzige Bewegung und doch unheilvoll genug, dass sie Kiva noch nervöser machte.
»Tja, da der Prinz nicht mehr hier ist und ich ihn mein Missfallen nicht direkt spüren lassen kann, habe ich entschieden, dass du an seiner statt in den Genuss kommen darfst – wo es dir doch jetzt besser geht.«
Kivas Angst wuchs ins Unermessliche, als auf einen Wink hin zwei von Rookes persönlichen Leibwächtern auftauchten.
»Der Metzger erwartet dich schon, N18K442«, sagte der Vorsteher im selben Moment, als die beiden Männer Kivas Arme ergriffen.
Es dauerte eine Sekunde, bis die Bedeutung seiner Worte vollends zu ihr durchsickerte. Doch als sie es schließlich taten, blieb ihr Herz stehen.
Rookes Lippen verzogen sich zu einem Grinsen. »Er hat schon eine hübsche Zelle vorbereitet, ganz für dich allein.«
KAPITEL DREI
Dunkelheit.
Sie umhüllte Kiva – erfüllte sie.
In eine Ecke der stockfinsteren Zelle im Purgatorium gekauert, versuchte sie, den Willen zum Überleben aufzubringen, während ihre inneren Dämonen ihr zuflüsterten, sie solle einfach aufgeben. Alle würden sie hassen und niemand ihr je verzeihen. Es gebe keinen Grund zum Weitermachen.
Derlei Gedanken plagten sie schon seit Wochen, seit die letzten Reste des Engelsstaubs aus ihrem Blut verschwunden waren. Doch die unnatürliche Düsternis des Purgatoriums verstärkte die bösen Stimmen noch um ein Vielfaches, bis Kiva sich nur noch zusammenrollen und die Ohren zuhalten konnte, als könnte sie die Worte auf diese Weise ausblenden.
Sie war in ihrer ganz persönlichen Hölle angekommen – einer Hölle, die sie sich selbst erschaffen hatte.
Schon nachdem Jaren sie bei der Wasserprüfung vor dem Ertrinken gerettet hatte, hatte Kiva die Gräuel der Isolationshaft kennengelernt. Und schon damals hatte sie der vollständige Reizentzug beinahe zugrunde gerichtet. Aber dank Naari hatte Kiva zumindest gewusst, dass sie für den letzten Part des Elementarurteils freigelassen werden würde.
Diesmal wusste sie dagegen nichts. Nur dass das rote Gesicht des Metzgers förmlich aufgeleuchtet hatte, als Rookes Aufseher sie an diesem Nachmittag im Straftrakt abgeliefert hatten. Er hatte so entzückt gewirkt, dass Kiva einen übelkeiterregenden Moment lang gefürchtet hatte, er würde sie direkt in seine Folterkammer zerren. Noch heute sah sie in manchen ihrer Albträume seine blutgetränkte Peitsche, die Jarens Fleisch aufriss. Ein Leid, das der Metzger ihr fürs Erste ersparte. Er wollte sie auf andere Weise quälen.
»Schmerz geht vorbei, doch die Dunkelheit bleibt«, hatte er gehöhnt und sie in die Zelle gesperrt, wo sie nichts mehr von ihren eigenen erbarmungslosen Gedanken ablenkte.
Schuldgefühle, Sorgen und Scham waren ihre treuen Gefährten, während die Sekunden zu Minuten, Minuten zu Stunden wurden. Und die ganze Zeit sah sie immerzu dieselben Gesichter vor sich: Jaren, Naari, Tipp, Caldon, Torell.
Sie hörte die letzten Worte, die Jaren an sie gerichtet hatte: Wie … konntest … du?
Sie hörte Caldons Warnung, die klang, als spräche ein Toter: Du musst hier weg.
Sie hörte Tipps anklagendes, tränenersticktes Krächzen: Du bist eine C-Corentine?
Sie sah das selbstzufriedene Gesicht ihrer Schwester, ihre mondscheinbleiche Haut und die honiggoldenen Augen, und vernahm wieder und wieder ihre hämische Stimme: Gute Arbeit. Was hätte ich bloß ohne dich gemacht?
Rooke hätte sich keine bessere Folter für Kiva ausdenken können. Er hatte sie mit ihren eigenen Dämonen eingesperrt und die Dunkelheit verlieh ihnen nur noch mehr Macht.
»Ich kann das nicht«, flüsterte Kiva und wiegte sich zitternd vor und zurück. »Das überlebe ich nicht.«
In Wahrheit wollte sie auch gar nicht überleben. Wozu, nachdem sie so viel verloren hatte? Sie hatte nichts mehr auf dieser Welt – nichts und niemanden.
Sie wollte mit der Dunkelheit verschmelzen.
Sie wollte, dass es endlich vorbei war.
Sie wollte nicht mehr.
Doch dann: Licht, kurz und blendend grell, gefolgt vom Ächzen eines anderen Menschen, der zu Kiva in die Zelle geworfen wurde. Ein Körper prallte auf den harten Steinboden, während die Tür bereits wieder verriegelt wurde.
»So ’ne Scheiße«, zischte eine Stimme zu Kivas Füßen – eine vertraute Stimme, wenn auch schmerzgeschwächt.
Träumte Kiva? Oder war sie schon tot? »Cresta?«
Ein zustimmendes Grunzen. »Ja verdammt, wer sonst?«
Einen winzigen Moment lang setzte Kivas Hirn aus. Dann aber veranlasste ein weiteres gepeinigtes Stöhnen sie dazu, sich in der Finsternis vorzutasten, bis sie auf etwas stieß. Cresta keuchte auf und zuckte schon bei der geringsten Berührung zurück.
»Was haben sie mit dir gemacht?« Kiva bemühte sich, sanfter zu sein. »Wo tut es weh?«
Cresta stieß ein angespanntes Lachen aus. »Frag lieber, was sie nicht mit mir gemacht haben und wo es nicht wehtut.«
Kiva ließ ihre Hände ruhen, aus Furcht, nur noch mehr Schaden anzurichten. Zögernd fragte sie: »Wegen der Sache in den Tunneln?«
»Es mag dir vielleicht neu sein«, erwiderte Cresta trocken, »aber der Knochenbrecher und seinesgleichen haben für aufsässige Gefangene nicht sonderlich viel übrig.« Ein Rascheln, gefolgt von einer Reihe gedämpfter Flüche. Als sie weiterredete, keuchte sie leicht und ihre Stimme kam von einem Punkt neben Kiva, was bedeutete, dass es ihr offenbar gelungen war, sich aufzurichten. »Aber das war’s wert, allein schon für sein blödes Gesicht.«
»Das ist meine Schuld«, flüsterte Kiva. »Du bist meinetwegen hier.«
»Ich bin meinetwegen hier«, korrigierte Cresta barsch. »Männer, die Schwächere schikanieren, widern mich an. Wenn du mich nicht aufgehalten hättest, wäre ich wahrscheinlich handgreiflich geworden, und zwar mit Freuden. Glaub mir.«
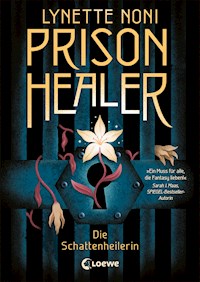
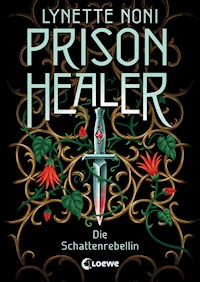













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)













