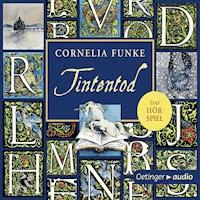11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Dressler Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Reckless
- Sprache: Deutsch
Treten Sie ein in die Welt hinter dem Spiegel! Obwohl Jacob Reckless stets darauf geachtet hat, die Welt hinter dem Spiegel vor seinem Bruder Will geheim zu halten, ist dieser ihm gefolgt und gerät in tödliche Gefahr: Will wird von einem Goyl angegriffen und beginnt, zu Jade zu versteinern. Allein die Feen besitzen die Macht, das Steinerne Fleisch aufzuhalten. Dennoch versucht Jacob verzweifelt, seinen Bruder zu retten. Gemeinsam mit Clara, Wills großer Liebe, und der Gestaltwandlerin Fuchs begibt Jacob sich auf die gefährliche Reise. Den von Grimms Märchen inspirierten Band 1 ihrer Bestseller-Reihe hat Cornelia Funke jetzt umfangreich überarbeitet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Über dieses Buch
Es waren einmal
hinter dem Spiegel
in einer Welt voller Zauber und Gefahren
zwei Brüder,
von denen der eine auszog,
den anderen zu retten.
Die verwunschene Welt, die Jacob Reckless hinter einem Spiegel im Zimmer seines verschwundenen Vaters entdeckt, beschert ihm viele Dinge: Ruhm, Abenteuer und die Freundschaft von Fuchs, einer Gestaltwandlerin, die gemeinsam mit ihm nach verlorenen Zauberdingen sucht. Aber eines Tages folgt Jacob sein jüngerer Bruder Will durch das dunkle Glas. Für ihn hält die Spiegelwelt finstere Dinge bereit: Ein Feenfluch verwandelt Wills Haut in Jade, und Jacob Reckless braucht all sein Wissen über die Schrecken und Zauber der Spiegelwelt, um seinen Bruder zu retten.
Der erste Band der märchenhaften Bestseller-Reihe: von Cornelia Funke vollständig überarbeitet.
Für Lionel, der die Tür zu dieser Geschichte fand
und oft mehr über sie wusste als ich,
Freund und Ideenfinder,
unersetzlich auf beiden Seiten
des Spiegels
Und für Oliver,
der dieser Geschichte immer wieder
englische Kleider schneiderte, damit der Brite und
die Deutsche sie zusammen erzählen konnten
1Es war einmal
Die Nacht atmete in der Wohnung wie ein dunkles Tier. Das Ticken einer Uhr. Das Knarren der Holzdielen, als Jacob sich aus seinem Zimmer schlich – alles ertrank in ihrer Stille. Aber Jacob liebte die Nacht. Sie war wie ein schwarzer Mantel, gewebt aus Freiheit und Gefahr, und ihre Dunkelheit füllte die Wohnung mit dem Flüstern vergessener Geschichten, von Menschen, die in ihr gewohnt hatten, lange bevor er und sein Bruder geboren worden waren. Will nannte die Wohnung »Das Königreich«. Jacob war sicher, dass die Märchenbücher ihres Großvaters den Namen inspiriert hatten, mit all ihren vergilbten Seiten, angefüllt mit fremd klingenden deutschen Wörtern und Bildern von Schlössern und Hütten, die so anders aussahen als die Hochhäuser und Wohnblocks, auf die sie von ihren Zimmern herabblickten. Es war leicht gewesen, Will davon zu überzeugen, dass die Wohnung verzaubert war, weil sie sieben Zimmer hatte und im siebten Stock lag. Bis zu seinem sechsten Geburtstag hatte er Jacob sogar geglaubt, dass das ganze Gebäude von einem Riesen gebaut worden war, der im Keller lebte. Es gab nichts, was Will seinem älteren Bruder nicht glaubte.
Draußen ließen die grellen Lichter der Stadt die Sterne verblassen und die große Wohnung war stickig von der Traurigkeit ihrer Mutter. Für Jacob roch Traurigkeit wie ihr Parfüm, das so selbstverständlich zu den weiten Zimmern gehörte wie die verblassten Fotografien im Flur und die altmodischen Möbel und Tapeten.
Sie wachte wie üblich nicht auf, als Jacob sich in ihr Zimmer stahl. Sie hatten wieder mal Streit gehabt, und für einen Augenblick sehnte er sich danach, ihr über das schlafende Gesicht zu streichen. Manchmal träumte er davon, etwas zu finden, das ihr all die Traurigkeit vom Gesicht wischen würde – ein verzaubertes Taschentuch oder einen Handschuh, mit dem er ihr ein Lächeln auf die Lippen tupfen könnte. Nicht nur Will verbrachte viel zu viele Nachmittage damit, den Märchen ihres Großvaters zu lauschen.
Jacob zog die Nachttischschublade auf. Der Schlüssel lag gleich neben den Pillen, die sie schlafen ließen. Du schon wieder?, schien er ihn zu verspotten, als er ihn herausnahm. Alberner vaterloser Kindskopf. Hoffst du immer noch, dass ich dir eines Nachts mehr als ein leeres Zimmer aufschließe?
Vielleicht. Mit zwölf Jahren konnte man sich solche Wunder noch vorstellen.
In Wills Zimmer brannte noch Licht – sein Bruder hatte Angst im Dunkeln. Will fürchtete sich vor vielen Dingen, im Gegensatz zu seinem älteren Bruder. Jacob überzeugte sich, dass er fest schlief, bevor er die Tür zum Arbeitszimmer ihres Vaters aufschloss. Ihre Mutter hatte es seit seinem Verschwinden nicht betreten, doch Jacob konnte die Nächte nicht zählen, in denen er sich in das leere Zimmer gestohlen hatte, um dort nach den Antworten zu suchen, die sie ihm nicht geben wollte.
Der Raum war so unberührt, als hätte John Reckless noch vor einer Stunde an seinem Schreibtisch gesessen. Über dem Stuhl hing die Strickjacke, die er so oft getragen hatte, und ein benutzter Teebeutel vertrocknete auf einem Teller neben dem Kalender, der immer noch das letzte Jahr zeigte.
Komm zurück! Jacob schrieb es mit dem Finger auf das beschlagene Fenster, auf den staubigen Schreibtisch und die Scheiben des Glasschranks, in dem die alten Pistolen lagen, die sein Vater gesammelt hatte. Aber das Zimmer blieb still – und leer. Er war zwölf Jahre alt und hatte keinen Vater mehr.
Verschwunden.
Als hätte er nie existiert. Als wäre er nichts als eine der kindischen Geschichten, die Jacob und Will sich ausdachten. Jacob trat gegen die Schubladen, die er in so vielen Nächten vergebens durchsucht hatte, erstickend an der hilflosen Wut, die er jedes Mal fühlte, wenn er den leeren Stuhl seines Vaters vor dem Schreibtisch stehen sah. Fort. Er zerrte die Bücher und Zeitschriften aus den staubigen Regalen und riss die Flugzeugmodelle herunter, die über dem Schreibtisch hingen, voll Scham darüber, wie stolz er gewesen war, als sein Vater ihm erlaubt hatte, sie mit rotem und weißem Lack zu bepinseln.
Komm zurück! Er wollte es durch die Straßen schreien, die sieben Stockwerke tiefer Schneisen aus Licht durch die Häuserblocks schnitten, in die tausend Fenster, die leuchtende Quadrate in die Nacht stanzten. Aber stattdessen stand er nur zwischen den Regalen und lauschte seinem eigenen Herzschlag, so laut in dem stillen Raum.
Das Blatt Papier fiel aus einem Buch über Flugzeugtriebwerke. Jacob hob es nur auf, weil er die Handschrift darauf für die seines Vaters hielt. Aber er erkannte seinen Irrtum schnell. Symbole und Gleichungen, die Skizze eines Pfaus, eine Sonne, zwei Monde. Nichts davon machte Sinn. Bis auf einen Satz, den er auf der Rückseite des Blattes fand.
DERSPIEGELÖFFNETSICHNURFÜRDEN, DERSICHSELBSTNICHTSIEHT.
Der Spiegel. Jacob drehte sich um – und sah sich selbst in dem dunklen Glas. Sein Vater und er hatten den Spiegel in den weitläufigen Kellern entdeckt, die sich unter dem Apartmenthaus befanden, verhängt mit einem staubigen Laken, umgeben von alten Möbeln und Koffern voller vergessener Dinge, Besitztümer längst toter Verwandter seiner Mutter. Das ganze Gebäude hatte einst ihrer Familie gehört. Einer ihrer Vorfahren hatte es sogar entworfen und erbaut, »und dabei eine finstere Vorstellungskraft bewiesen«, hätte sein Vater hinzugefügt. Will fürchtete sich immer noch vor den steinernen Gesichtern über dem Hauptportal, die mit goldverkrusteten Augen auf jeden Besucher herabstarrten.
Jacob trat näher an den Spiegel heran. Er war zu schwer für den Aufzug gewesen. Man konnte im Treppenhaus immer noch die Schrammen sehen, die der Rahmen in die Wände gefurcht hatte, als drei Männer ihn fluchend und schwitzend in den siebten Stock hinaufgetragen hatten. Jacob war der Überzeugung gewesen, dass der Spiegel älter als alles war, was er je gesehen hatte, auch wenn sein Vater darüber gelacht und ihm erklärt hatte, dass Spiegel solcher Größe erst im sechzehnten Jahrhundert hergestellt werden konnten.
Das Glas war so dunkel, als wäre die Nacht darin ausgelaufen, und so uneben, dass man sich kaum darin erkannte. Jacob berührte die mit Dornen gespickten Rosenranken, die sich über den Silberrahmen wanden. Sie sahen so echt aus, als könnten die Blüten jeden Moment verwelken.
Im Gegensatz zum Rest des Raumes schien der Spiegel niemals Staub anzusetzen. Er hing wie ein schimmerndes Auge zwischen den Bücherregalen, ein Abgrund aus Glas, der verzerrt all das spiegelte, was John Reckless zurückgelassen hatte: seinen Schreibtisch, die alten Pistolen, seine Bücher – und seinen ältesten Sohn.
DERSPIEGELÖFFNETSICHNURFÜRDEN, DERSICHSELBSTNICHTSIEHT.
Was sollte das bedeuten?
Jacob schloss die Augen. Er kehrte dem Spiegel den Rücken zu und tastete hinter dem Rahmen nach irgendeinem Schloss oder Riegel.
Nichts.
Er blickte immer wieder nur seinem eigenen Spiegelbild in die Augen.
Es dauerte eine ganze Weile, bis er begriff.
Seine Hand war kaum groß genug, um das verzerrte Abbild seines Gesichts zu verdecken. Aber das kühle Glas schmiegte sich an seine Finger, als hätte es auf sie gewartet, und plötzlich war der Raum, den ihm der Spiegel zeigte, nicht mehr das Zimmer seines Vaters.
Jacob wandte sich um.
Mondlicht fiel durch ein schmales, glasloses Fenster auf Mauern aus grauem, grob behauenem Stein. Der Raum, den sie umschlossen, war rund und sehr viel größer als das Zimmer seines Vaters. Die schmutzigen Fußbodendielen waren mit Eichelschalen und abgenagten Vogelknochen bedeckt und Spinnweben hingen wie Schleier von den Balken eines spitz zulaufenden Daches.
Wo war er?
Das Mondlicht malte Jacob Flecken auf die Haut, als er auf das Fenster zutrat. An dem rauen Sims klebten die blutigen Federn eines Vogels, und tief unter sich sah er verbrannte Mauern und schwarze Hügel, in denen ein paar verlorene Lichter glimmten. Verschwunden waren das Häusermeer und die erleuchteten Straßen – alles, was er kannte, war fort. Und hoch über ihm zwischen den Sternen hingen zwei Monde, der kleinere rot wie eine rostige Münze.
Jacob blickte sich zu dem Spiegel um, dem Einzigen, was sich nicht verändert hatte – und sah die Angst auf seinem Gesicht. Aber Angst war ein Gefühl, das Jacob fast genoss. Sie lockte ihn an dunkle Orte, durch verbotene Türen und weit fort von ihm selbst. Sogar die Sehnsucht nach seinem Vater ertrank in ihr.
Es gab keine Tür in den grauen Mauern, nur eine Luke im Boden. Als Jacob sie öffnete, sah er die Reste einer verbrannten Treppe, die sich in der Dunkelheit verlor, und für einen Augenblick glaubte er, einen winzigen Mann daran heraufklettern zu sehen. Aber bevor er sich über die Öffnung lehnen und einen genaueren Blick hinunterwerfen konnte, ließ ihn ein Scharren herumfahren.
Spinnweben fielen auf ihn herab, als etwas ihm auf die Schulter sprang. Sein heiseres Knurren klang nach einem Tier, doch das verzerrte Gesicht, das die Zähne nach seiner Kehle bleckte, war so bleich und faltig wie das eines alten Mannes. Die Kreatur – ein Stilz, wie er später lernte – war sehr viel kleiner als Jacob und mager wie eine Heuschrecke, aber entsetzlich stark. Seine Kleider schienen aus Spinnweben gemacht, das graue Haar hing ihm bis zur Hüfte, und als Jacob seinen dürren Hals packte, gruben sich gelbe Zähne tief in seine Hand. Mit einem Aufschrei stieß er den Angreifer von seiner Schulter und stolperte auf den Spiegel zu. Der Spinnenmann sprang Jacob nach, während er sich das Blut von den Lippen leckte, doch bevor er ihn einholen konnte, fand Jacobs unverletzte Hand das kühle Spiegelglas.
Die dürre Gestalt verschwand ebenso wie die grauen Mauern und hinter ihm stand erneut nur der Schreibtisch seines Vaters.
»Jacob?«
Wills Stimme drang kaum durch das Klopfen seines Herzens. Jacob rang nach Atem und wich von dem Spiegel zurück.
»Jake, bist du da drin?«
Er zog den Ärmel über die zerbissene Hand und öffnete die Tür.
Wills Augen waren weit vor Angst. Er hatte wieder schlecht geträumt. Kleiner Bruder. Will folgte seinem älteren Bruder wie ein junger Hund und Jacob beschützte ihn auf dem Schulhof und im Park. Manchmal verzieh er Will sogar, dass ihre Mutter ihn mehr liebte.
»Mum sagt, wir sollen nicht in das Zimmer.«
»Seit wann tue ich, was Mum sagt? Wenn du mich verrätst, nehme ich dich morgen nicht mit in den Park.«
Jacob glaubte, das Glas des Spiegels wie Eis im Nacken zu spüren. Will lugte an ihm vorbei, aber er senkte hastig den Kopf, als Jacob die Tür hinter sich zuzog. Will war vorsichtig, wo sein Bruder leichtsinnig, sanft, wo er aufbrausend, ruhig, wo er rastlos war. Als Jacob nach seiner Hand griff, bemerkte Will das Blut an seinen Fingern und blickte ihn fragend an, aber Jacob zog ihn nur wortlos zu seinem Zimmer zurück.
Was der Spiegel ihm gezeigt hatte, gehörte ihm.
Ihm allein.
Zwölf Jahre lang würde das die Wahrheit sein. Bis zu dem Tag, an dem Jacob sich wünschte, dass er seinen Bruder in jener Nacht vor dem Spiegel gewarnt hätte und vor all dem, was das dunkle Glas ihm bescheren würde. Aber die Nacht verging und er bewahrte sein Geheimnis.
Es war einmal … so beginnt es immer.
2Zwölf Jahre später
Die Sonne stand schon tief über den Mauern der Ruine, aber Will schlief immer noch, erschöpft von den Schmerzen und der Furcht vor dem, was in seinem Fleisch wuchs. Ein Fehler. Nach zwölf Jahren Vorsicht.
Jacob deckte Will mit seinem Mantel zu und blickte zum Himmel. Die zwei Monde waren bereits sichtbar und die untergehende Sonne färbte die umliegenden Hügel schwarz. Kein Ausblick in der anderen Welt konnte sich damit messen. Nicht in seinen Augen. Zwölf Jahre sind eine lange Zeit und sie hatten diese Welt zu seinem Zuhause gemacht. Schon mit vierzehn hatte er die Monate nicht mehr gezählt, die er hinter dem Spiegel verbracht hatte, trotz der Tränen seiner Mutter, trotz ihrer hilflosen Angst um ihn … »Wo bist du gewesen, Jacob? Bitte! Sag es mir!« Wie? Wie hätte er ihr die Wahrheit verraten können, ohne die kostbare Freiheit zu verlieren, die der Spiegel ihm gewährte, all das Leben, das er dahinter gefunden hatte, das Gefühl, so viel mehr er selbst zu sein hinter dem dunklen Glas.
»Wo bist du gewesen, Jacob?« Sie hatte es niemals herausgefunden.
Er hatte Will von dieser Welt erzählt, überzeugt, dass sein Bruder all die Geschichten für nichts als Märchen halten würde. Er hätte ihn besser kennen müssen. Warum hatte er nicht begriffen, dass seine Geschichten Will mit derselben Sehnsucht erfüllen würden, die ihn durch den Spiegel trieb? Sei ehrlich, Jacob, du wolltest nicht darüber nachdenken. Nein. Er hatte sich nur danach gesehnt, mit jemandem zu teilen, was er gefunden hatte, und da das Arbeitszimmer seines Vaters das Geheimnis des Spiegels so viele Jahre lang sicher verwahrt hatte, war es viel zu leicht gewesen, sich einzureden, dass es dort für alle Zeit sicher sein würde.
Vielleicht wäre es das auch wirklich gewesen, wenn er es nicht so eilig gehabt hätte, zurückzugehen. Er hatte zum ersten Mal vergessen, die Tür abzuschließen, und die Hand bereits gegen das dunkle Glas gepresst, als Will hereingekommen war. Es ist so verführerisch, dem eigenen schlechten Gewissen zu entkommen, indem man die Welt wechselt. Jeder Winkel der Wohnung, in der er aufgewachsen war, hatte Jacob daran erinnert, dass er, während seine Mutter gestorben war, nach einem gläsernen Schuh gesucht hatte. Du hast sie im Stich gelassen, Jacob, hatte ihr leeres Zimmer geflüstert. Genau wie dein Vater.
Im Märchen werden die Helden bestraft, wenn sie vor einer Aufgabe davonlaufen. Die Helden, nicht ihre jüngeren Brüder …
Die Wunden an Wills Hals waren gut verheilt, aber am linken Unterarm zeigte sich bereits der Stein. Jade. Das war ungewöhnlich. Meist war es Karneol, Jaspis, Mondstein …
»Er riecht schon wie ein Goyl.«
Die Füchsin löste sich aus den Schatten, die die zerstörten Mauern warfen. Ihr Fell war so rot, als hätte der Herbst es ihr gefärbt. Am Hinterlauf war es gestreift mit blassen Narben. Es war fast fünf Jahre her, dass Jacob Fuchs aus den Eisenfängen einer Wildererfalle befreit hatte, und seither bewachte sie seinen Schlaf, warnte ihn vor Gefahren, die seine stumpfen Menschensinne nicht bemerkten, und gab Rat, den man besser befolgte.
»Worauf wartest du? Weck ihn auf und bring ihn zurück! Wir sind seit Stunden hier.« Die Ungeduld in ihrer Stimme war nicht zu überhören. »Dafür sind wir hergekommen, oder?«
Jacob blickte auf seinen schlafenden Bruder. Ja, dafür hatte er Will zurück zu dem Turm gebracht: um ihn zurück in die Welt zu bringen, die sie beide geboren hatte. Aber wie sollte er in ihr leben mit einer Haut, die sich in Jade verwandelte?
Jacob trat unter den Torbogen, in dem die verkohlten Reste des Schlossportals hingen. Ein Heinzel huschte davon, als Jacobs Schatten auf ihn fiel. Er war kaum größer als eine Maus, mit roten Augen über der spitzen Nase, Hose und Hemd genäht aus gestohlenen Menschenkleidern. Die Ruine wimmelte von ihnen.
»Ich hab es mir anders überlegt«, sagte Jacob. »Es gibt nichts in der anderen Welt, das ihm helfen könnte.«
Jacob hatte schon vor Jahren versucht, Fuchs von der Welt zu erzählen, aus der er kam, aber sie wollte nichts davon hören. Ihr reichte, was sie wusste: dass es der Ort war, an den er allzu oft verschwand und mit Erinnerungen zurückkam, die ihm wie Schatten folgten.
»Und? Was glaubst du, was hier mit ihm passieren wird?«
Fuchs sprach es nicht aus, doch Jacob wusste, was sie dachte. In ihrer Welt erschlugen Männer ihre eigenen Söhne, sobald sie den Stein in ihrer Haut entdeckten. Aber Jacob war sicher: Falls es eine Medizin gegen das Steinerne Fleisch gab, dann würden sie sie hier finden.
Am Fuß des Hügels, auf dem die Ruine stand, verloren die roten Dächer von Schwanstein sich in der Dämmerung, und in den Häusern flammten die ersten Lichter auf. Während seines ersten Jahres hinter dem Spiegel hatte Jacob dort in einem der Ställe gearbeitet, in dem Reisende ihre Pferde unterbrachten. Die Stadt sah von fern aus wie eins der Bilder, die man auf Lebkuchendosen druckte. Aber die hohen Fabrikschornsteine, die grauen Rauch in den Abendhimmel schickten, passten nicht ins Bild. Die neue Magie … So nannte man Technologie und Wissenschaft in dieser Welt. Aber das Steinerne Fleisch wurde nicht von mechanischen Webstühlen oder anderen modernen Errungenschaften gesät, sondern von dem alten Zauber, der in ihren Hügeln und Tälern zu Hause war, in Flüssen und Meeren, Blumen und Bäumen, in Siebenmeilenstiefeln, Hexennadeln und zahllosen anderen Zauberdingen, die zu finden Jacob zu seinem Handwerk gemacht hatte.
Ein Goldrabe landete auf der Mauer, in deren Schatten Will schlief. Jacob scheuchte ihn fort, bevor er einen seiner finsteren Flüche krächzen konnte.
Sein Bruder stöhnte im Schlaf. Die Menschenhaut machte dem Stein nicht kampflos Platz. Jacob spürte den Schmerz wie seinen eigenen und zum ersten Mal verfluchte er den Spiegel. Seit Jahren hatte ihn nur die Liebe zu seinem Bruder in die andere Welt zurückgebracht, immer bei Nacht, wenn er sicher war, dass seine Mutter schlief. Ihre Tränen hatten es zu schwer gemacht, wieder zu gehen, aber Will hatte ihm nur die Arme um den Hals geschlungen und gefragt, was er ihm mitgebracht hatte. Die Schuhe eines Heinzels, die Mütze eines Däumlings, einen Knopf aus Elfenglas, ein Stück schuppige Wassermannhaut – Will hatte Jacobs Geschenke hinter seinen Büchern versteckt und dann um mehr Geschichten über die Welt gebettelt, in denen sein Bruder solche Schätze fand, bis das erste Morgenlicht auf die verblassten Tapeten gefallen war und Jacob sich, sobald Will fest schlief, durch den Spiegel davongestohlen hatte.
Er griff nach seinem Rucksack. »Ich bin bald zurück. Falls er aufwacht, sag ihm, er soll auf mich warten. Erlaub ihm nicht, in den Turm zurückzugehen.«
»Und wohin gehst du?« Die Füchsin trat ihm in den Weg. »Du kannst ihm nicht helfen, Jacob.«
»Ich weiß. Aber ich muss es versuchen.«
Fuchs folgte ihm mit den Augen, als er auf die verwitterte Treppe zuging, die den Hügel hinabführte. Die einzigen Stiefelabdrücke auf den vermoosten Stufen waren seine eigenen. Die Ruine galt als verflucht. Die Bewohner von Schwanstein erzählten Hunderte von Geschichten über das Feuer, das das Jagdschloss zerstört hatte, das einst auf dem Hügel über der Stadt gestanden hatte, aber nach all den Jahren wusste Jacob immer noch nicht, wer den Spiegel in dem Turm hinterlassen hatte. Oder wohin sein Vater verschwunden war.
3Goyl
Das abgeerntete Feld roch immer noch nach Blut, der Geruch aller Schlachtfelder. Hentzaus Pferd war ebenso an ihn gewöhnt wie seine Soldaten. Der Regen hatte die Gräben mit feuchtem Schlamm gefüllt, und hinter den Wällen, die beide Seiten errichtet hatten, war die Erde bedeckt mit Flinten und zerschossenen Helmen. Kami’en hatte befohlen, die Pferde- und Menschenkadaver zu verbrennen, bevor sie verwesten und die Luft mit ihrem Gestank verpesteten. Seine eigenen Soldaten aber hatte der König, wie es Goylsitte war, dort gelassen, wo sie gefallen waren. Schon in wenigen Tagen würden sie nicht mehr von den Steinen zu unterscheiden sein, die aus der zertretenen Erde ragten, und die Köpfe derer, die besonders heldenhaft gekämpft hatten, waren in die Königsfeste geschickt worden, um dort die unterirdische Ehrenstraße der Toten zu säumen.
Eine weitere Schlacht. Hentzau war ihrer müde, aber er hoffte, dass diese für eine Weile die letzte gewesen war. Die Kaiserin war endlich bereit zu verhandeln und selbst Kami’en wollte Frieden. Hentzau presste sich die Hand vor den Mund, als der Wind die Asche ihrer gefallenen Feinde von der Anhöhe herabwehte. Sechs Jahre an der Oberfläche, sechs Jahre ohne den schützenden Schild der Erde zwischen ihm und der Sonne. Seine Augen schmerzten von all dem Tageslicht und die Luft machte seine Haut so spröde wie Muschelkalk. Hentzaus Haut glich braunem Jaspis. Nicht die edelste Hautfarbe für einen Goyl. Hentzau war der erste Jaspisgoyl, der in die obersten Militärränge aufgestiegen war. Aber die Goyl hatten vor Kami’en auch noch nie einen König gehabt und Hentzau gefiel seine Haut. Jaspis lieferte wesentlich bessere Tarnung als Onyx oder Mondstein.
Kami’en hatte unweit des Schlachtfelds Quartier bezogen, im Jagdschloss eines kaiserlichen Generals, der wie der Großteil seiner Offiziere in der Schlacht gefallen war.
Zwei Goylposten bewachten das Tor. Sie salutierten, als Hentzau an ihnen vorbeiritt. Den Bluthund des Königs nannten sie ihn, seinen Jaspisschatten. Hentzau diente Kami’en, seit der zum ersten Mal die anderen Anführer herausgefordert hatte. Sie hatten zwei Jahre gebraucht, um sie alle zu töten, und danach hatten die Goyl ihren ersten König gekrönt.
Die Straße, die vom Tor zu dem Jagdschloss hinaufführte, war von Statuen gesäumt. Es amüsierte Hentzau stets aufs Neue, dass Menschen ihre Götter und Helden durch Abbilder aus Stein verewigten, während sie seinesgleichen verabscheuten. Selbst die Teighäute mussten zugeben, dass in dieser Welt Stein das Einzige war, was blieb.
Sie hatten die Fenster des Schlosses zugemauert, wie sie es bei allen Gebäuden taten, die sie besetzten, doch Hentzau fühlte sich erst wohl, als er die Treppe zu den Kellern hinabstieg und ihn endlich die wohltuende Dunkelheit umgab, die man bloß unter der Erde fand. Die weitläufigen Gewölbe, die einst mit Vorräten und verstaubten Jagdtrophäen gefüllt gewesen waren, beherbergten nun Kami’ens Generalstab, und Goylaugen brauchten weder Lampen noch Kerzen in der Dunkelheit.
Kami’en. Sein Name bedeutete in ihrer Sprache nichts anderes als Stein. Kami’ens Vater hatte eine der unteren Städte regiert, aber Väter zählten nicht viel bei ihnen. Es waren die Mütter, die sie aufzogen, und vom neunten Geburtstag an galten Goyl als erwachsen und waren auf sich gestellt. In dem Alter erkundeten die meisten von ihnen die Untere Welt, die Kristallhöhlen, schwarzen Seen und versteinerten Wälder unter der Erde, ihren Mut beweisend, indem sie tiefer und tiefer hinabstiegen, zu den Verlorenen Palästen mit ihren Spiegeln und Silbersäulen, bis die Hitze selbst für Goylhaut unerträglich wurde. Doch Kami’en hatten die Tiefen seiner Welt nie interessiert. Ihn faszinierte nur die Obere Welt. Er hatte für eine Weile in einer der Höhlenstädte gelebt, die die Goyl an der Oberfläche gebaut hatten, weil die Kupferpest in den unteren Städten wütete. Als eine seiner Schwestern bei einem Menschenangriff ums Leben gekommen war, hatte er damit begonnen, deren Waffen und Kriegsstrategien zu studieren. Mit neunzehn hatte er eine ihrer Städte erobert. Die erste von vielen …
Als die Wachen Hentzau in den Lagerraum winkten, der als Kommandozentrale diente, stand Kami’en vor dem Tisch, auf dem jeden Morgen die Positionen seiner Gegner nachgestellt wurden. Er hatte die Figuren anfertigen lassen, nachdem er die erste Schlacht gewonnen hatte: Soldaten, Kanoniere, Scharfschützen, Reiterfiguren für die Kavallerie … Die Goyl waren aus Karneol, die Truppen der Kaiserin marschierten in Echsenbein, Lothringen trug Gold, Albions Soldaten waren aus Kupfer. Kami’en blickte auf die Figuren herab, als suchte er nach einem Weg, sie alle auf einen Schlag zu besiegen. Er trug Schwarz, wie immer, wenn er die Uniform ablegte. Es ließ seine mattrote Haut wie versteinertes Feuer aussehen. Nie zuvor war Karneol die Hautfarbe eines Goylanführers gewesen. Jahrhundertelang war Onyx die Farbe ihres Adels gewesen.
Kami’ens Geliebte trug wie immer Grün, Schichten aus smaragdfarbenem Samt, die sie einhüllten wie die Blätter einer Blüte. Selbst die schönste Goylfrau verblasste neben ihr wie ein Kiesel neben geschliffenem Mondstein, aber Hentzau hatte seinen Soldaten befohlen, sie nicht anzusehen. Der alte Goyl glaubte schon lange nicht mehr an Märchen, aber er glaubte all die Geschichten, die man sich über die Feen erzählte und über die liebeskranken Idioten, die sie mit einem Blick in Disteln oder hilflos zappelnde Fische verwandelten. Ihre Schönheit war tödlicher als Spinnengift. Das Wasser hatte sie alle geboren, und Hentzau fürchtete sie ebenso sehr wie die Meere, die an den Felsen seiner Welt nagten. Er hasste sie besonders für diese Furcht.
Die Dunkle Fee lächelte, als hätte sie seine Gedanken gelesen. Viele waren überzeugt, dass die Feen das konnten, aber Hentzau war sicher, dass die Dunkle ihn längst getötet hätte, für das, was er über sie dachte. Sie war die Mächtigste von ihnen – vielleicht war das der Grund, warum ihre eigenen Schwestern sie verstoßen hatten.
Er kehrte ihr den Rücken zu und verbeugte sich vor seinem König. »Mir wurde gesagt, dass Ihr mich braucht, um jemanden zu finden.«
Kami’en griff nach einer der Echsenbeinfiguren und stellte sie zur Seite. Jede stand für hundert Soldaten.
»Ja. Du musst mir einen Menschen bringen, dem das Steinerne Fleisch wächst.«
Hentzau warf der Fee einen raschen Blick zu.
»Und wie soll ich das anstellen? Von denen gibt es inzwischen Tausende.«
Die Dunkle konnte wie all ihre Schwestern keine Kinder gebären, aber nun hatte sie einen Weg gefunden, Kami’en Armeen von Söhnen zu schenken. Menschengoyl … Durch ihre dunkle Zauberei gaben seine Soldaten ihren Feinden eine Haut aus Stein und erschufen so eine neue Spezies, von Goyl und Menschen gleichermaßen gefürchtet.
»Keine Sorge. Dieser Menschengoyl ist leicht von den anderen zu unterscheiden.« Kami’en stellte zwei weitere Echsenbeinfiguren zur Seite. »Die Haut, die ihm wächst, ist aus Jade.«
Die Wachen wechselten einen raschen Blick, aber Hentzau runzelte nur ungläubig die Stirn. Die Lavamänner, die das Blut der Erde kochten, der augenlose Vogel, der alles sah – und der Goyl mit der Jadehaut, der den König, dem er diente, unbesiegbar machte … Geschichten, die man Kindern erzählte, um die Dunkelheit unter der Erde mit Bildern zu füllen.
»Ich werde den Kundschafter erschießen lassen, der Euch das erzählt hat.« Hentzau rieb sich die schmerzende Haut. Die verdammte Kälte würde ihn bald aussehen lassen wie einen zersprungenen Krug. »Der Jadegoyl ist ein Märchen! Seit wann verwechselt Ihr die mit der Wirklichkeit?«
Die Wachen senkten nervös die Köpfe. Jeder andere Goyl hätte solche Worte mit dem Leben bezahlt, aber Hentzau wusste, dass Kami’en seine Ehrlichkeit liebte. Ebenso wie die Tatsache, dass er sich immer noch nicht vor ihm fürchtete.
»Du hast deine Befehle!«, sagte er so beiläufig, als wäre ihm Hentzaus Spott entgangen. »Finde ihn. Sie hat ihn in ihren Träumen gesehen.«
Ah, das war die Quelle.
Die Fee strich über den Samt ihres Kleides. Sechs Finger an jeder Hand, alle für einen anderen Zauber. Hentzau spürte, wie der Zorn in ihm erwachte, der ihnen allen im steinernen Fleisch nistete. Er würde für seinen König sterben, wenn es nötig war, aber es war etwas anderes, nach den Traumgespinsten seiner Geliebten zu suchen.
»Der König der Goyl braucht keinen Jadegoyl, um unbesiegbar zu sein!«
König. Immer noch ein unvertrautes Wort für Goylzungen. Aber selbst Hentzau zögerte inzwischen, Kami’en nur mit seinem Namen anzureden.
»Finde ihn!«, wiederholte er, während er Hentzau wie einen Fremden ansah. »Sie sagt, es ist wichtig, und bisher hatte sie immer recht.«
Die Fee trat an Kami’ens Seite. Hentzau malte sich aus, ihr den blassen Hals zu brechen, aber nicht einmal das brachte Trost. Sie war unsterblich und eines Tages würde sie ihm beim Sterben zusehen. Ihm und dem König. Und Kami’ens Kindern und Kindeskindern. Sie alle waren nur ihr sterbliches Spielzeug. Aber Kami’en liebte sie. Mehr als seine beiden Goylfrauen, die ihm drei Töchter und zwei Söhne geschenkt hatten.
Weil sie ihn verhext hatte!
»Ich habe ihn im Schwarzen Wald gesehen.« Selbst ihre Stimme klang nach Wasser.
»Der Wald ist mehr als sechzig Quadratmeilen groß!«
Die Fee lächelte erneut. Vermutlich stellte sie sich vor, wie er als Fisch nach Atem ringend vor ihren Füßen zappelte. Hentzau erstickte fast an seinem Hass.
»Das klingt, als könntet Ihr etwas Hilfe gebrauchen.« Sie genoss es sichtlich, wie alarmiert er die Schultern straffte, als sie die sechsfingrigen Hände hob und die Perlenspangen öffnete, die ihr Haar zusammenhielten. Es reichte ihr bis zur Hüfte, als es herabfiel. Die meisten verglichen es mit fein gesponnenem Kupfer oder rotem Gold, aber für Hentzau hatte es die Farbe von getrocknetem Blut. Schwarze Motten flatterten ihr zwischen den Fingern hervor, als sie mit den Händen hindurchfuhr. Die blassen Flecken auf ihren Flügeln waren geformt wie Schädel.
Die Wachen öffneten hastig die Türen, als die Motten auf sie zuschwärmten. Hentzaus Soldaten, die draußen auf dem dunklen Korridor warteten, wichen ebenso eilig zurück. Sie alle wussten, dass die Stiche von Feenmotten sogar durch Goylhaut drangen – und dass die Opfer sie selten überlebten.
»Sie werden dir Bescheid geben, sobald sie den Jadegoyl gefunden haben«, sagte die Fee, während sie sich das Haar wieder hochsteckte. »Und du bringst ihn zu mir.«
Seine Männer starrten sie durch die offene Tür an.
Feen.
Verflucht sollten sie alle sein, sie und die Nacht, in der die dunkelste von ihnen plötzlich in ihrem Lager gestanden hatte. Nach der dritten Schlacht, ihrem dritten Sieg. Sie war zwischen den Zelten aufgetaucht, als hätte das Stöhnen der Verwundeten sie herbeigerufen. Hentzau war ihr in den Weg getreten, aber sie war einfach durch ihn hindurchgegangen, wie Wasser durch porösen Stein, und dann hatte sie Kami’en das Herz gestohlen, um sich die eigene herzlose Brust damit zu füllen. Zugegeben, selbst die besten Waffen der Goyl verbreiteten nicht halb so viel Furcht unter ihren Feinden wie der Zauber der Dunklen. Doch Hentzau war sicher, dass sie diesen Krieg auch ohne sie gewonnen hätten und dass der Sieg so viel süßer geschmeckt hätte.
Kami’en beobachtete ihn. Nein, die Fee konnte Hentzaus Gedanken nicht lesen, aber sein König las sie ihm mühelos von der Stirn.
Er presste die Faust aufs Herz, die traditionelle Geste aller Goyl, wenn sie ihren Respekt ausdrücken wollten.
»Ich werde den Menschengoyl finden«, sagte er. »Falls er tatsächlich mehr ist als ein Traum.«
Er spürte den Blick der Fee immer noch, als er hinaus in das grelle Tageslicht trat, das ihm die Augen trübte und die Haut springen ließ.
Er konnte sich nicht erinnern, jemals so sehr gehasst zu haben.
4Clara
Wills Stimme hatte so anders geklungen. Clara hatte sie kaum erkannt. Seit Wochen kein Anruf oder irgendein anderes Lebenszeichen und dann dieser Fremde am Telefon, der nicht wirklich sagte, warum er anrief. Angst. Das war es, was Clara in seiner Stimme gehört hatte. Schlimmer als die Angst, die sie von den Krankenhausfluren kannte, auf denen sie täglich versuchte zu lernen, wie man Krankheit und Tod ins Auge sah.
Sie musste Will sehen. Das war das Einzige, was sie wusste. Herausfinden, was geschehen und warum er seit Wochen verschwunden war.
Das Gedränge auf den Straßen schien noch dichter als gewöhnlich, und sie brauchte eine Ewigkeit, bis sie endlich vor dem alten Apartmenthaus stand, in dem Will aufgewachsen war. Gemeißelte Gesichter starrten von der grauen Fassade, die verzerrten Züge zerfressen von Abgasen. Die Augen waren vergoldet. Clara bemerkte das zum ersten Mal. Der Portier in der Eingangshalle war wie üblich schlecht gelaunt. Tomkins. Ja, das war sein Name. Er erinnerte Clara an einen Kater in seiner grauen Uniform, einen fetten Kater, der sich jedes Mal die Lippen leckte, wenn er sie sah.
»Da oben ist niemand zu Hause, Miss«, sagte er, während er sie ohne Scham von Kopf bis Fuß musterte.
Clara merkte erst unter seinem Blick, dass sie immer noch den blassgrünen Krankenhauskittel unter dem Mantel trug. Sie hatte es so eilig gehabt, dass sie sich nicht die Zeit genommen hatte, sich umzuziehen. Er hatte so verloren geklungen. Wie ein Ertrinkender.
Die Gittertüren des Aufzugs klemmten wie üblich. Will nannte ihn den Hänsel-Käfig. Tomkins kam ihr nicht zu Hilfe, und Clara war erleichtert, als der Aufzug sich endlich in Bewegung setzte. »Du musst ihn nicht ernst nehmen«, hatte Will gesagt, als sie sich über die Dreistigkeit des Portiers beklagt hatte. »Er behandelt jeden so. Wenn er Besucher nicht mag, erzählt er ihnen manchmal sogar, dass wir nicht zu Hause sind. Obwohl er mich und Jacob seit unserer Geburt kennt.« Und dann hatte er sie geküsst.
Will.
Der alte Aufzug brauchte so lange, dass es Clara jedes Mal so vorkam, als hätte sie das Dach der Welt erreicht, wenn sie im siebten Stock ausstieg. Sie versuchte es zuerst mit der Klingel, aber es kam keine Antwort. Das kupferne Namensschild neben der Tür war so angelaufen, dass Clara immer versucht war, mit dem Ärmel darüberzuwischen.
RECKLESS. Will machte sich oft darüber lustig, wie wenig der Name zu ihm passte. Als Clara schließlich den Schlüssel benutzte, den er ihr gegeben hatte, stolperte sie hinter der Wohnungstür in einen Stapel ungeöffneter Post. Hatte Will sie von woanders angerufen?
Sie ging in die Küche. Ein schmutziger Kaffeebecher stand auf dem Tisch. Neben einem Buch, das er gelesen hatte.
»Will?«
Das Zimmer seiner Mutter war unverändert, obwohl sie vor mehr als vier Monaten gestorben war. Clara zögerte, bevor sie die Tür zum Zimmer seines Bruders öffnete. Jacob. Sie hatte ihn immer noch nicht getroffen. »Jacob ist auf Reisen.« Wills älterer Bruder war immer auf Reisen. Manchmal war sie nicht sicher, ob er tatsächlich existierte.
Wills Zimmer war gleich daneben. Es war ebenfalls leer. Nur die übliche Unordnung. Seine Kleider auf dem Boden. Eine Schüssel mit eingetrockneten Müsliresten.
Wo war er?
Sie bemerkte, dass die Tür zum Arbeitszimmer seines Vaters offen stand, erst, als sie wieder auf dem Flur stand. Will betrat das Zimmer nie. Er ignorierte alles, was mit seinem Vater zu tun hatte. »Er ist fort. Hat uns ohne ein Wort verlassen und meiner Mutter das Herz gebrochen.« Das war alles, was er Clara je über ihn erzählt hatte.
Sie trat durch die offene Tür.
Ein Schreibtisch, Bücherregale, ein Vitrinenschrank mit antiken Pistolen. Über dem Schreibtisch hingen ein paar Modellflugzeuge, auf denen der Staub so dick wie schmutziger Schnee lag.
Zwischen den Bücherregalen lehnte ein riesiger Spiegel an der Wand. Der Silberrahmen war bedeckt mit Rosen. Ihre metallenen Dornen zerstachen Clara fast die Finger, als sie sie berührte. Jede Blüte war so vollkommen geformt, dass ihr Duft in der staubigen Luft zu hängen schien. Das Glas, das sie rahmten, war dunkel, als hätte es die Nacht eingefangen. Es war so klar, dass Clara sich fragte, wer es poliert hatte, aber dort, wo ihr Gesicht sich darin spiegelte, war der Abdruck einer Hand zu sehen.
5Schwanstein
Das Laternenlicht füllte die Straßen von Schwanstein wie ausgelaufene Milch. Gaslicht und hölzerne Kutschräder, die über holpriges Kopfsteinpflaster rollten, Frauen in langen Röcken, die Säume nass vom Regen. Jacob konnte sich nicht erinnern, wann er begonnen hatte, all das als normal anzusehen und die Welt, aus der er kam, als die bisweilen befremdendere Wirklichkeit. Mit vierzehn? Sechzehn? Nein, vermutlich sehr viel früher. Der Vater ihrer Mutter hatte nur Deutsch mit ihnen gesprochen, das hatte ihm von Anfang geholfen, zumindest ein paar Brocken Austrisch zu verstehen. In den ersten Jahren war er oft hungrig gewesen und hatte stets mit der Furcht vor dem Armenhaus gelebt. Jacob verdankte es zwei Menschen, dass er diese Jahre überlebt hatte. Einer davon war eine Hexe, keine der Kinderfresserinnen, sondern eine weiße. Alma Spitzweg praktizierte als Heilerin in einem Dorf auf der anderen Seite des Schlosshügels und hatte ihn viele Male gerettet, aber diesmal konnte nicht einmal Almas Zauberei helfen. Falls es irgendjemanden in dieser Welt gab, der wusste, wie sein Bruder noch zu retten war, dann war es sein alter Schatzjagdlehrer Albert Chanute. Der andere Mensch, der Jacob durch die ersten Jahre geholfen hatte.
Die Glocken läuteten zur Abendmesse, als Jacob die Straße hinunterging, die zum Marktplatz von Schwanstein führte. Vor einer Bäckerei verkaufte eine Zwergin geröstete Kastanien. Der süße Duft mischte sich mit dem Geruch der Pferdeäpfel, die überall auf dem Straßenpflaster lagen. Die Idee des Automotors war bislang nicht durch den Spiegel gedrungen. Das Denkmal in der Mitte des Marktplatzes zeigte Karolus, den Goylhetzer, einen Vorfahren der derzeitigen Kaiserin Therese von Austrien, der nicht nur Halsketten für seine Geliebte aus der Haut von Mondsteingoyl anfertigen ließ, sondern auch unermüdlich Jagd auf Riesen in den umliegenden Hügeln gemacht hatte. Jacob bedauerte immer noch zutiefst, dass er erst durch den Spiegel gekommen war, als die Riesen und Drachen dahinter bereits ausgerottet worden waren. Er musste zugeben, dass er dem Stilz nicht nachgetrauert hätte, der ihm bei seinem ersten Besuch fast die Kehle zerbissen hatte. Aber was war mit den Graselfen, Heinzeln, Däumlingen, Nymphen oder Hexen? Würden sie als Nächste verschwinden? Schwanstein hatte sich verändert, seit Jacob zum ersten Mal durch den Spiegel getreten war. Die feuchte Herbstluft roch nach Rauch, und Ruß schwärzte die Wäsche, die zwischen den spitzen Giebeln hing. Es gab inzwischen einen Bahnhof gleich gegenüber der Postkutschstation, ein Telegrafenbüro und einen Fotografen, der steife Hüte und berüschte Röcke auf Platten aus Silber bannte. Fahrräder lehnten an Hauswänden, an denen Plakate vor Wassermännern und Goldraben warnten. Manchmal fragte Jacob sich, ob Schwanstein die modernen Zeiten noch enthusiastischer als der Rest der Spiegelwelt willkommen hieß und wie sehr das mit dem Spiegel im Arbeitszimmer seines Vaters zusammenhing.
Graselfen, Heinzel, Däumlinge, Nymphen oder Hexen … was ist mit den Goyl, Jacob? Jeder Mensch hinter dem Spiegel hätte ihre Ausrottung gefeiert.
Der Zeitungsjunge, der neben dem Denkmal des Goylhetzers die neuesten Nachrichten in den Abend rief, hatte nie mehr als den Fußabdruck eines Riesen oder die verblassten Spuren von Drachenfeuer an der Stadtmauer zu Gesicht bekommen. Aber die Goyl waren ebenso sehr Bestandteil seiner Wirklichkeit wie die Kastanien feilbietende Zwergenfrau oder die Heinzel, die den Bäckern halfen, ihren Teig auszurollen.
Entscheidende Schlacht, schreckliche Verluste … geheime Verhandlungen mit den Goyl …
Es herrschte Krieg in der Spiegelwelt und er wurde nicht von Menschen gewonnen. Vier Tage waren vergangen, seit Will und er einem ihrer Stoßtrupps in die Arme gelaufen waren, aber Jacob sah sie immer noch aus dem Wald kommen: drei Soldaten und einen Offizier, die steinernen Gesichter feucht vom Regen. Augen aus Gold und schwarze Klauen, die den Hals seines Bruders aufrissen … Goyl.
»Pass auf Will auf, Jacob. Er ist so anders als du.«
Er drückte dem Zeitungsjungen drei Kupfergroschen in die schmutzige Hand. Der Heinzel, der auf seiner Schulter hockte, beäugte die Münzen voller Misstrauen. Viele Heinzel schlossen sich Menschen an und ließen sich von ihnen füttern und kleiden, aber das änderte nichts an ihrer ständig schlechten Laune.
»Wie weit entfernt stehen die Goyl?« Jacob nahm sich eine Zeitung.
»Keine fünf Meilen von hier.« Der Junge zeigte nach Südosten. »Wenn der Wind günstig stand, hat man die Kanonen gehört. Aber seit gestern ist es still.«
Er klang fast enttäuscht. In seinem Alter war selbst der Krieg nur ein Abenteuer. Die kaiserlichen Soldaten, die aus dem Wirtshaus von Albert Chanute kamen, wussten es besser. ZUMMENSCHENFRESSER. Jacob war Zeuge bei dem Ereignis gewesen, das dem Wirtshaus seinen Namen gegeben und seinen Besitzer den rechten Arm gekostet hatte.
Albert Chanute stand mit mürrischer Miene hinter dem Tresen, als Jacob in die dunkle Schankstube trat. Chanute war ein solcher Klotz von Mann, dass man ihm nachsagte, Trollblut in den Adern zu haben – nicht gerade ein Kompliment in der Spiegelwelt –, aber bis zu dem Tag, an dem der Menschenfresser ihm den Arm abgehackt hatte, war Albert Chanute der beste Schatzjäger von ganz Austrien gewesen, und Jacob war viele Jahre bei ihm in die Lehre gegangen. Chanute hatte ihm gezeigt, wie man es hinter dem Spiegel zu Ruhm und Reichtum brachte, und Jacob hatte zum Dank verhindert, dass der Menschenfresser dem alten Schatzsucher auch noch den Kopf abschlug.
Die Wände des Schankraums waren bedeckt mit Andenken an Chanutes ruhmreichere Tage: der Kopf eines Braunwolfs, die Ofentür aus einem Lebkuchenhaus, ein Knüppelausdemsack, der von der Wand sprang, wenn ein Gast sich nicht benahm, und, gleich über dem Tresen, aufgehängt an den Ketten, mit denen er seine Opfer gefesselt hatte, der rechte Arm des Menschenfressers, der Chanutes Schatzjägertage beendet hatte. Die bläuliche Haut schimmerte immer noch wie Echsenleder.
»Sieh an, wer da reinspaziert kommt.« Chanutes mürrischer Mund verzog sich tatsächlich zu einem Lächeln. »Jacob Reckless. Ich dachte, du wärst in Lothringen, auf der Suche nach einem Stundenglas.«
Chanute war eine Legende als Schatzjäger gewesen, aber Jacob hatte es inzwischen auf ebensolche Berühmtheit gebracht, und die drei Männer, die an einem der fleckigen Tische saßen, hoben neugierig die Köpfe.
»Werde deine Kundschaft los!«, raunte Jacob Chanute über den Tresen zu. »Ich muss mit dir reden.«
Dann stieg er die ausgetretenen Stufen zu Chanutes Gästezimmern hinauf. Jacob hatte vor Jahren eins gemietet, um seine wenigen Besitztümer in Sicherheit zu wissen, wenn er auf Schatzsuche war. Es gab keinen Ort, den er Zuhause nannte, weder in dieser noch in der anderen Welt. Er sehnte sich stets nach unbekannten Orten, Geheimnissen, die auf Entdeckung warteten, Schätzen, die darauf harrten, gefunden zu werden … Es gab so viel, was er noch nicht gesehen hatte. Mit Fuchs an seiner Seite zu reisen – nur das fühlte sich wie Zuhause an.
Ein Tischleindeckdich, ein Gläserner Schuh, der Goldene Ball einer Prinzessin – die meisten Schätze, die Jacob in dieser Welt fand, verkaufte er an Könige oder Kaiserinnen oder an reiche Männer und Frauen, deren Wünsche nur Zauberei erfüllen konnte. Einige aber hatte er für sich selbst behalten und bewahrte sie in der schlichten Kammer unter Chanutes Dach auf. Die Truhe, die Jacob unter dem Bett hervorzog, hatte ein Troll angefertigt, der für seine Tischlerkünste berühmt war, und die Schätze, die seine meisterlichen Schnitzkünste bewachten, waren das Werkzeug für Jacobs Handwerk. Nun würden sie ihm helfen müssen, seinen Bruder zu retten.
Das Taschentuch, das er als Erstes aus der Truhe nahm, war aus einfachem Leinen, aber wenn man es zwischen den Fingern rieb, brachte es zuverlässig ein bis zwei Goldtaler hervor. Jacob hatte es vor Jahren von einer Hexe bekommen, für einen Kuss, der ihm noch Wochen auf den Lippen gebrannt hatte. Die anderen Dinge, die er in seinem Rucksack verstaute, sahen ebenso unscheinbar aus: eine silberne Schnupftabakdose, ein Schlüssel aus Messing, ein Zinnteller und ein Fläschchen aus grünem Glas. Doch jedes einzelne hatte ihm schon mehr als einmal das Leben gerettet.
Die Schankstube war leer, als Jacob wieder die Treppe hinunterstieg. Chanute saß an einem der Tische. Er schob Jacob einen Becher Wein hin, als er sich zu ihm setzte.
![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)



![Tintenblut [Tintenwelt-Reihe, Band 2 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/52c21247ab9c6ceec994ff4bce1626b8/w200_u90.jpg)

![Tintentod [Tintenwelt-Reihe, Band 3 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/48531063f67bfadcad247f206737472f/w200_u90.jpg)





![Gespensterjäger im Feuerspuk [Band 2] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/961288edbdff425f4f1f3c26568a5f3b/w200_u90.jpg)