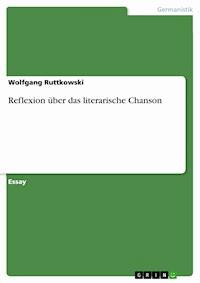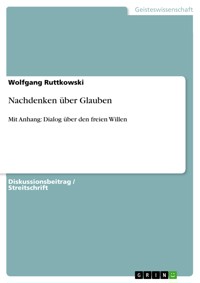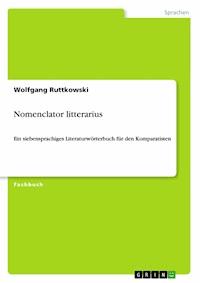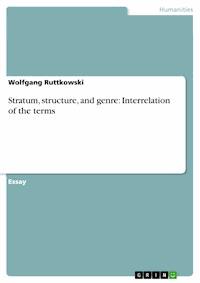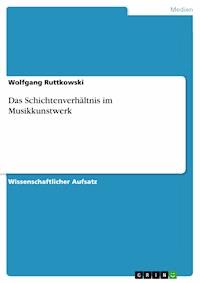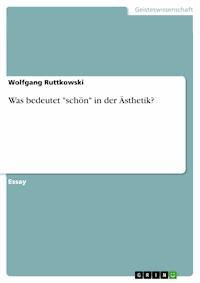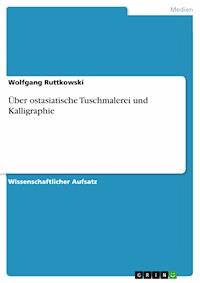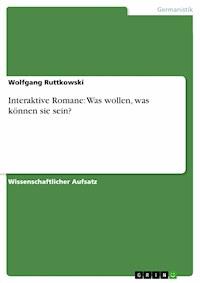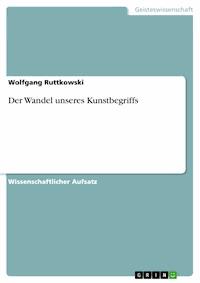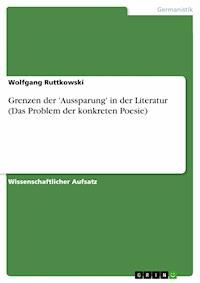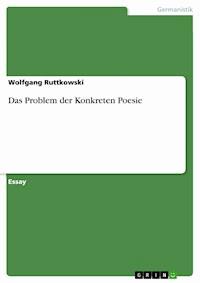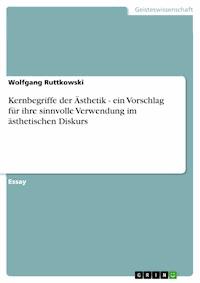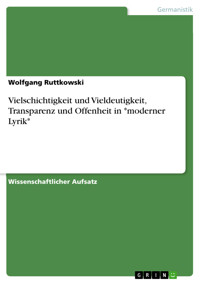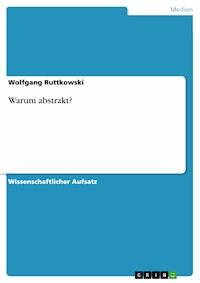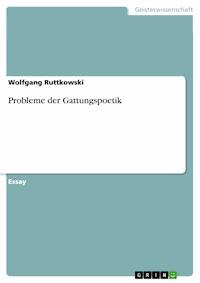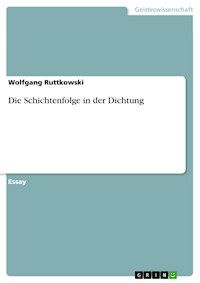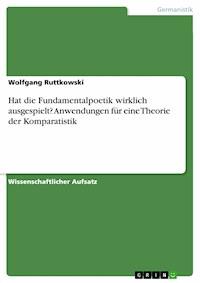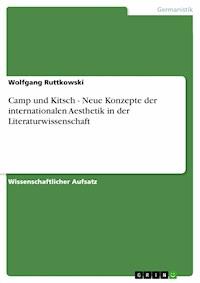13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Essay aus dem Jahr 1975 im Fachbereich Philosophie - Praktische (Ethik, Ästhetik, Kultur, Natur, Recht, ...), Note: keine, , Veranstaltung: Vortrag anlässlich des 3. Jahrestreffens der Canadian Association of University Teachers of German, Sprache: Deutsch, Abstract: Erste grundsätzliche Stellungnahme zu und Erweiterung der Trias von Emil Staiger auf eine vierte "publikumsbezogene" Grundhaltung, in der alle übrigen Gattungen untergebracht werden können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2008
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2013 GRIN Verlag GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhalt
Reflexion über die Grundhaltungen in der Poetik [1]
ANMERKUNGEN
Reflexion über die Grundhaltungen in der Poetik [1]
Die Drei ist uns eine angenehme, fast heilige Zahl. Gern sehen wir sie in der Umwelt bestätigt; unwillkürlich überzeugt sie uns, wo wir ihr begegnen. "Antike–Mittelalter‑Neuzeit", "das Leibliche - das Seelische - das Geistige", "das Lyrische‑das Epische‑das Dramatische", das sind solche Dreiheiten, die keiner mehr anzuzweifeln wagt, obwohl sie höchst fragwürdig sind. Wir selbst haben im vorigen Satz unwillkürlich drei Beispiele gewählt, denn "aller guten Dinge sind drei." Es wohnt der Dreizahl ein eigener, abgerundeter, befriedigender (schon wieder drei Attribute!) Rhythmus inne, der Dreitakt; und wer das nicht glaubt, möge Sätze mit zwei oder vier veranschaulichenden Beispielen bilden und sie sich laut vorlesen. Er wird fast körperlich spüren, dass er entweder nur ein Beispiel geben darf oder drei; zwei aber sind zu wenig, vier zu viel. Häufig aber stimmt es mit diesen unwidersprochenen Dreiheiten doch nicht, man muss sie nur einmal gründlich anzweifeln. Das möchte ich an der Dreiheit "lyrisch‑episch-dramatisch," wie sie uns Emil Staiger in seinem Buch Grundbegriffe der Poetik [2] beschreibt, tun.
Als Gegenthese sei behauptet, dass sich in der Dichtung vier menschliche Grundeinstellungen spiegeln: die lyrische, epische, dramatische und die "artistische," so sei die neue vorläufig genannt. Als Zeugnis für diese Behauptung möchte ich Beobachtungen an den Vortragsgattungen, besonders am literarischen Chanson [3], anführen‑und Staiger selbst.
Die inneren Sprechsituationen des Chansonniers, des Troubadours, des Bänkelsängers ebenso wie die des Akteurs der commedia dell' arte und des Brechtstückes oder der Nestroyposse, die Grundhaltung des witzigen Anakreontikers wie die des empfindsamen Romanciers (Jean Paul) oder des ironischen Schriftstellers (Thomas Mann) haben etwas gemeinsam: die Distanz vorn Stoff und die Bewusstheit der eigenen Wirkung auf den Adressaten. Hermann J. Weigand z.B. stellte uns - allerdings unter anderem Gesichtspunkt‑schon 1933 im V. Kapitel seines Buches über Thomas Manns Roman "Der Zauberberg" (The Ironic Temper, S. 59 ff.) eine Fülle von Beispielen für das Kokettieren des Dichters mit dem Publikum zusammen, von denen wir nur ein kurzes wiedergeben: "Hier steht eine Erscheinung bevor, über die der Erzähler sich selbst zu wundern gut tut, damit nicht der Leser auf eigene Hand sich allzu sehr darüber wundere" (I, 309). Ähnliche Fälle des Verlassens der unreflektierten (d.h. hier: nur auf den Stoff und nicht auf das Publikum konzentrierten) Erzählhaltung zu Gunsten der Wendung an den Leser in Anspielungen oder allgemeinen Reflexionen lassen sich von Wieland über Goethe, Heine bis zu Somerset Maugham oder Henry James immer wieder zeigen.