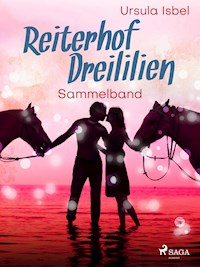
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Spannende Abenteuer rund um Teenager Nell und ihre Freunde auf dem Reiterhof Dreililien. Alle 10 Geschichten gibt es hier im Sammelband! Mit dem Umzug aufs Land ändert sich Nells Leben komplett: Neue Umgebung, neue Freunde, neue Liebe. Auf dem Reiterhof Dreililien entdeckt der Teenager ihre Leidenschaft für Pferde und findet in Jörn, dem Sohn des Reiterhofbesitzers, ihre erste große Liebe. Im Laufe der zehn Bände, die sich über vier Jahre erstrecken, erlebt Nell so manche Abenteuer, Hindernisse und Turbulenzen auf Dreililien. -
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1802
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ursula Isbel
Reiterhof Dreililien Sammelband
Saga
Reiterhof Dreililien SammelbandCopyright © 2019, 2019 Ursula Isbel und SAGA Egmont All rights reserved ISBN: 9788726219685
1. Ebook-Auflage, 2019
Format: EPUB 2.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit Zustimmung von SAGA Egmont gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk
– a part of Egmont www.egmont.com
Reiterhof Dreililien Das Glück dieser Erde
1
Es war ein stürmischer Frühlingsabend, als Kirsty zum erstenmal zu uns kam, und dieser Abend veränderte unser Leben. Heute weiß ich das, doch damals wollte ich es nicht wahrhaben. Ich wehrte mich gegen sie, denn ich dachte, daß sie mir meinen Vater wegnehmen wollte. Und ich hatte doch nur noch ihn, seit Mutter gestorben war.
Und weil ich Angst vor ihr hatte, haßte ich sie. Ich haßte sie, ehe ich sie noch kennengelernt hatte. Der Haß begann, als Vater mir von ihr erzählte – vorsichtig, mit verhaltener Zärtlichkeit, als wollte er mir von einem Schatz berichten, den er gefunden hatte.
„Ich habe eine Frau kennengelernt, Elinor“, sagte er. „Sie ist anders als andere. Ich möchte, daß du sie kennenlernst – daß ihr euch kennenlernt. Du wirst sie gern haben; man muß Kirsty einfach gern haben.“
Ich spürte einen Stich im Herzen. Trotzig dachte ich: Muß man? Und in diesem Augenblick war ich sicher, daß ich sie nicht mögen würde.
Dann, eine Woche nach diesem Gespräch, kam Kirsty in unsere Wohnung. Vater hatte in einem Feinkostladen eingekauft, den Tisch feierlich mit Kerzen und unserem besten Geschirr gedeckt und so getan, als merkte er nicht, daß ich ihm nicht dabei half. Ich saß vor dem Fernseher, sah mir ein albernes Programm an und rauchte, obwohl ich das sonst eigentlich kaum tat.
Ich sah auch nicht auf, als es an der Tür klingelte. Mein Vater fuhr zusammen, warf mir einen hilflosen Blick zu – ich sah es aus den Augenwinkeln – und eilte in den Flur.
In meiner Kehle saß ein Kloß, der sich immer mehr auszudehnen schien. Als ich draußen Stimmen hörte, reichte er schon fast bis in den Magen.
Sie hatte eine helle, etwas brüchige Stimme, die jung und ziemlich atemlos klang. „Es stürmt so draußen“, hörte ich sie sagen, und mein Vater murmelte etwas, was ich nicht verstand. Dann trat einen Augenblick Stille ein. Was taten sie? Küßten sie sich? Ich erstarrte bei dem Gedanken.
Mein Vater kam wieder ins Wohnzimmer. Ich hörte an seinen Schritten, wie nervös er war. Noch immer sah ich nicht auf. Ich starrte auf den Bildschirm, ohne zu sehen, was gezeigt wurde.
„Elinor“, sagte Vater bittend, „ich möchte dir Kirsty vorstellen.“
Ich drehte den Kopf nur leicht zur Seite und nahm die Zigarette aus dem Mund. „Ja?“ erwiderte ich möglichst lässig.
Sie war klein – kleiner als ich – und zierlich. Ihre Haare waren goldbraun und nach hinten gekämmt. Erst später merkte ich, daß sie sie im Nacken zu einem dicken Zopf geflochten hatte.
Als sich unsere Blicke begegneten, sah ich, daß sie angespannt und unsicher war. Und ich dachte triumphierend: Sie hat Angst vor mir.
„Kirsty“, sagte mein Vater, „das ist Elinor.“
„Hallo, Elinor“, sagte Kirsty.
„Hallo“, murmelte ich.
Ich weiß, daß sie mir gefallen hätte, wenn wir uns unter anderen Umständen begegnet wären. Sie trug einen alten Bauernrock mit Rosen darauf, der ihr bis zu den Waden reichte, eine bestickte Bluse mit einer kleinen Schafwollweste, und sie sah durchaus nicht wie eine Durchschnittsfrau um die Dreißig aus. Doch da ich sie von Anfang an zu meiner erklärten Feindin gemacht hatte, nahm ich es ihr zusätzlich übel, daß sie so anziehend wirkte.
Mein Vater stellte den Fernseher ab und bot Kirsty Platz an. Ich blieb im Sessel sitzen, rauchte weiter und wäre am liebsten weggelaufen.
Während Vater den Tee aus der Küche holte, herrschte unbehagliches Schweigen. Der Wind heulte ums Haus, und die Stimmung war scheußlich. Ich hatte sie verdorben, das wußte ich. Doch ich konnte und wollte es nicht ändern.
„Setz dich doch zu uns“, sagte Vater, als er zurückkam.
Ich erwiderte: „Ich habe keinen Hunger.“
Das stimmte auch. Der Kloß, der mir in der Kehle, in der Brust und im Magen saß, hatte sich so ausgeweitet, daß ich sicher war, keinen Bissen hinunterzubringen.
Mein Vater stellte die Teekanne ab und trat vor mich hin. „Elinor“, sagte er. „Bitte!“
Da stand ich auf und setzte mich an den Tisch. Ich merkte selbst, daß meine Bewegungen plötzlich hölzern waren, fast wie die einer Marionette. Ich zerdrückte die Zigarette in einem Teller, zog eine neue Packung aus der Jackentasche und zündete mir wieder eine an.
„Mußt du rauchen?“ fragte Vater.
„Ja“, sagte ich, obwohl es mir überhaupt nicht schmeckte.
So begann dieser Abend, so begann meine Beziehung zu Kirsty. Ich aß fast nichts und sprach kein Wort, und mein Vater redete verzweifelt drauf los. Obwohl ich wütend und verletzt war, tat er mir doch auch leid. Seit drei Jahren lebten wir nun allein, und er hatte nichts als mich und seine Arbeit. Er war gerade vierzig; sicher brauchte er mehr als nur eine kameradschaftliche Tochter und eine leidlich gemütliche Wohnung. Aber ich war gerade fünfzehn, und ich brauchte ihn auch . . .
Liebe . . . Unwillkürlich sah ich Kirsty an. Sie lächelte gerade über etwas, das Vater gesagt hatte, und ich merkte, daß sie ein Grübchen im linken Mundwinkel hatte. Dann drang auch das Gespräch zwischen den beiden in mein Bewußtsein vor.
Vater sagte gerade: „Sie muß dir ziemlich ähnlich gewesen sein“, und Kirsty lachte wieder und antwortete: „Ja, das könnte stimmen. Ich erinnere mich oft an eine Szene, als ich sie einmal am Wochenende besuchte. Sie frühstückte gerade in der Küche, und zwischen der Butter und dem Marmeladentopf saß eines ihrer Perlhühner auf dem Tisch und fraß Kuchenbrösel.“
Mein Vater wollte sich ausschütten vor Lachen. Ich aber hatte an diesem Abend keinen Sinn für Humor. Außerdem wußte ich nicht, um wen es ging.
„Tante Karen ist vor einem Jahr gestorben und hat mir ihr Haus und das Grundstück vererbt“, sagte Kirsty, und ihre Stimme war nun wieder ernst. „Ich hatte nie damit gerechnet, daß sie so etwas tun würde. Ich dachte, sie würde alles dem Tierschutzverein vermachen.“
„Und was ist aus dem Haus geworden?“ fragte mein Vater. „Hast du es verkauft?“
Kirsty schüttelte den Kopf. „Nein, das könnte ich nicht. Ich fahre ab und zu hin. Manchmal denke ich, daß ich gern dort leben würde. Es ist sehr friedlich da, eigentlich so etwas wie ein kleines Paradies. Und ich vermute, daß Tante Karen insgeheim gehofft hat, ich würde nach ihrem Tod in ihr Haus ziehen.“
„Möchtest du denn nicht aufs Land?“ fragte Vater.
„Nicht allein“, sagte Kirsty. „Ich stelle es mir wunderbar vor, mit einer Familie dort zu leben. Manchmal, wenn hier in der Stadt alles so grau und schmutzig und laut ist, würde ich am liebsten meine Sachen packen und zu Tante Karens Haus fahren. Aber ich kenne mich zu gut; ich weiß, daß ich nicht längere Zeit so allein und abgeschieden leben könnte.“
„Ich bin auf dem Land aufgewachsen“, sagte mein Vater nachdenklich. „Und ich träume eigentlich schon lange davon, wieder auf dem Land zu leben. Stimmt’s, Elinor?“
Es stimmte, doch ich tat so, als hätte ich seine Frage nicht gehört. Sollte das heißen, daß er überlegte, ob wir mit in dieses Haus ziehen sollten, das Kirstys Tante gehört hatte – als Kirstys „Familie“?
Ich erschrak und dachte: So weit darf es nicht kommen. Daran darf er nicht einmal denken! Ich möchte in der Stadt bleiben. Hierher gehöre ich. Ich will mich nicht auf dem Land vergraben. Ich würde sterben vor Langeweile. Was soll ich unter Hühnern und Dorftrotteln? Keiner wird mich je dazu bringen, aufs Land zu ziehen . . .
Ich war so sicher, daß nichts und niemand mich dazu bewegen könnte, meine Meinung zu ändern. Zwei Wochen später aber, zu Beginn der Osterferien, fuhren wir doch aufs Land – zu Tante Karens Haus.
2
Vater hatte immer wieder versichert, es wäre ja nur für zwei Wochen, nur für einen kurzen Urlaub. „Du weißt doch, ich hatte das ganze letzte Jahr keine Ferien und habe ein bißchen Erholung dringend nötig“, sagte er.
Schließlich hatte ich nachgegeben. Doch ich nahm mir vor, mich während dieser Ferien von meiner schlechtesten Seite zu zeigen und sowohl Vater als auch Kirsty die Freude am Landleben gründlich zu verderben, damit sie gar nicht erst auf die Idee kamen, einen Dauerzustand daraus zu machen. Ich wollte mich so unmöglich benehmen, daß sie beide froh waren, wenn wir Tante Karens Haus den Rücken kehrten und in die Stadt zurückfuhren. Dann aber kam alles anders, als ich erwartet hatte.
In der Stadt regnete es, als wir losfuhren, und auf dem Land goß es wie aus Kübeln. Die meisten Bäume waren noch kahl, das Gras braun vom Winter. Mein Vater fuhr, und Kirsty saß neben ihm. Sie hatte ihren Hund mitgebracht. Er kauerte neben mir auf dem Rücksitz und tat so, als wäre ich nicht vorhanden.
Ich habe Hunde gern, doch dies war Kirstys Hund; und ich glaube, er spürte meine Abneigung gegen sie. Als wir Kirsty abholten, hatte er mich nur kurz angesehen und mich nicht einmal beschnuppert, während er meinen Vater mit einem gnädigen Schwanzwedeln begrüßte. Er war ein halbhoher Bastard mit wuscheligen, dunkelbraunen Locken, Schlappohren und dicken Pfoten. Um die Schnauze war er schon etwas grau. Kirsty nannte ihn „Herr Alois“.
Herr Alois saß also neben mir und seufzte von Zeit zu Zeit abgrundtief, die Nase auf den Pfoten. Ich versuchte nicht, ihn zu streicheln, weil mir klar war, daß er etwas dagegen hatte. Eigentlich wirkte er ziemlich kummervoll. Bei einer besonders scharfen Kurve drehte sich Kirsty um, streichelte den Hund und sagte: „Ihm wird beim Fahren so leicht schlecht.“
In der Ferne sah man schon die Berge. Wir verließen die Autobahn und bogen auf eine kleine Landstraße ab, die durch ein verschlafenes Nest führte. Natürlich war kein Mensch unterwegs. Alles wirkte wie ausgestorben. Vermutlich saßen die Bauern in ihren Häusern und schliefen auf ihren Ofenbänken oder machten komische Volksmusik, wie man sie manchmal im Radio hört.
Bei dem Gedanken, wie die Leute hier leben mußten, lief mir ein Schauder über den Rücken. Neben einem Haus am Straßenrand standen ein paar triefnasse Schafe und blökten. Herr Alois raffte sich trotz seiner Übelkeit auf und bellte durch die Scheibe, daß es mir in den Ohren gellte.
Wir fuhren über eine Brücke, an einer Mühle vorbei und durch ein Waldstück, wo das Wasser von den Abhängen auf die Straße sprudelte, so daß wir nur noch im Schrittempo fahren konnten. Dann ging es in Schlangenlinien bergauf. Rechts stand ein Wegkreuz ohne Christusfigur, links streckte ein verwitterter Baum seine dürren Äste gegen den Himmel, und mir kam es vor, als würde ich geradewegs in die Verbannung fahren.
Ausgerechnet da sagte mein Vater: „Schön ist es hier!“
Diesmal seufzte ich, doch keiner außer Herrn Alois schien es zu hören. Er spitzte die Ohren, rollte mit den Augen und schloß sie dann voller Überdruß. Vor uns tauchte eine Ortstafel im Regen auf. Jägerhäusl, Mariabrunn, Dreililien, stand darauf.
„Dreililien“, wiederholte Vater. „Ist es das?“
Kirsty nickte. „Ja. Hinter der Biegung geht’s scharf nach links.“
Wir fuhren einen Berg hinauf und wieder hinunter. Hinter Regenschleiern tauchte eine Kirche auf. Sie stand auf einer Anhöhe und sah aus wie eine Dorfkirche im Bilderbuch.
Wie groß der Ort war, der sich um die Kirche scharte, ließ sich im Regen nicht erkennen. Wir bogen auch kurz vor der Ortseinfahrt ab, fuhren über einen holprigen Weg an steil abfallenden Felsen und einem Wildbach vorbei, den die Regenfluten in ein reißendes Gewässer verwandelt hatten. Die Wolken hingen hier so tief, daß der Gipfel der Felswand darin verschwand.
Die Bäume bogen sich im Wind, und kahle Äste scharrten über das Wagendach. Doch mein Vater schien keine Angst um sein Auto zu haben. Er sagte nur mehrmals: „Das ist ja wildromantisch!“, was ich albern fand.
Der Weg führte abwärts und mündete in ein Tal, das wie ein keilförmiger Einschnitt zwischen Wäldern lag. Und inmitten dieser Talsenke stand ein dunkler Viereckshof, größer als alle Bauernhöfe, die ich je gesehen hatte. Eine Anzahl von kleinen Nebengebäuden war in der Talsenke verstreut.
„Ist er das?“ fragte mein Vater, und Kirsty erwiderte: „Ja, das ist Dreililien.“
Ich traute meinen Ohren kaum. Kirsty hatte doch immer vom „Häuschen“ ihrer Tante gesprochen. Ich hatte mir eine Art Hexenhaus wie im Märchen darunter vorgestellt. Doch sie hatte auch gesagt, daß Dreililien unser Ziel sei, und nun fuhren wir auf diesen riesigen Hof zu, der einer Festung glich.
Kirsty streckte die Hand aus und deutete nach links auf einen kleinen, dunklen Umriß am Rand des Tales. Es war ein Haus, das ich für eine Art Nebengebäude des Hofes gehalten hatte. Sie sagte mit einem zärtlichen Untertön in der Stimme: „Dort ist es.“
Ein Seitenweg zweigte von der Auffahrt zum Hof ab. Er war mit Birken und Haselnußsträuchern gesäumt und führte direkt zu Tante Karens Haus. Zwischen den schlanken weißen Stämmen sah man im Hintergrund immer wieder die Umrisse des Viereckshofes.
Ich fragte mich, wer dort wohnen mochte. Ein reiches altes Bauerngeschlecht vielleicht, das seit vielen Generationen hier lebte. Oder ein Millionär, der in diesem Tal wie ein König residierte und Pferde züchtete.
Pferde . . . Seltsam, daß ich plötzlich an Pferde denken mußte. Es kam wohl von den vielen Zäunen, die das Tal in Quadrate und Rechtecke teilten und mich an die Koppeln in einem Film über Pferde erinnerten.
Dann hielten wir vor Tante Karens Haus. Ich verließ den Wagen nur langsam und zögernd, während Kirsty schon zur Haustür lief, ohne zu warten, bis mein Vater den Schirm herausgekramt hatte. Sie breitete ihren Regenmantel wie ein Zelt über den Kopf, und Herr Alois folgte ihr kläffend.
Ich warf nur einen flüchtigen Blick auf das Haus. Es interessierte mich nicht besonders. Für mich sah es wie ein ganz gewöhnliches, gelbes Haus mit tiefgezogenem Dach aus. Das Rosenspalier um die Eingangstür war noch kahl, und die geschlossenen Fensterläden erzeugten einen Eindruck von Verlassenheit.
Ich versteckte mich unter meinem Schirm und ging hinter meinem Vater her. Es war kalt im Freien. Ein Schauder überlief mich. Kirsty schloß die Haustür auf.
3
Gegen Abend ging der Regen in Sturm über, und der Wind heulte ums Haus, rüttelte an den Fensterläden und verursachte eine Menge ekelhafter Geräusche, die mir unheimlich waren. Außerdem war es kalt im Haus, und das Bettzeug fühlte sich klamm an.
Bei flackerndem Kerzenschein zog ich mich aus und dachte mit grimmiger Genugtuung, daß diese Ferien ja schon gut anfingen: Der elektrische Strom funktionierte nicht, es waren keine Sicherungen im Haus, die Öfen in Küche und Wohnzimmer konnten nicht geheizt werden, da im Keller kein Heizmaterial mehr war; und ohne Feuer und Strom gab es auch keine warme Mahlzeit und keinen heißen Tee.
Kirsty hatte sich mehrmals entschuldigt, und mein Vater hatte immer wieder versichert, daß das alles eine interessante Abwechslung vom perfekten Stadtleben sei; ich aber hatte nicht versucht, meine mürrische Miene zu verbergen.
Jetzt lag ich im Mansardenzimmer zwischen schrägen Wänden, und es dauerte lang, bis ich einschlafen konnte. Nicht nur die Kälte und der Wind hielten mich wach; auch der Gedanke an Vater und Kirsty. Es war sinnlos, mir etwas vorzumachen. Die beiden liebten sich, und ich war nun nicht mehr der einzige Mensch in Vaters Leben. Kirsty war ihm wichtiger. Ich wußte auch, daß es mehr als nur eine flüchtige Verliebtheit war. Die beiden waren ein Paar. Ich konnte nur danebenstehen und zusehen.
Ich blies die Kerze aus und schloß die Augen, doch allerlei Bilder quälten mich. In diesem fremden Haus fühlte ich mich einsamer als je zuvor in meinem Leben. Ich sehnte mich nach meinem Zimmer in der Stadt, nach den Lichtreklamen der Straßen, dem täglichen Einerlei, über das ich so oft geklagt hatte.
Und ich dachte: Es wird nie wieder so sein wie früher.
Dann schlief ich ein, endlich. Als ich wieder erwachte, war es Morgen. Der Wind hatte sich gelegt, aber es regnete noch immer.
Barfuß tappte ich ans Fenster und sah hinaus. Der Himmel hing grau und schwer über dem Tal. Wenn ich mich nach links beugte, konnte ich den Viereckshof sehen, der auf den zweiten Blick noch ebenso mächtig wirkte wie am vergangenen Tag. Rauch stieg aus einem der Kamine.
Ich fror so, daß meine Zähne klapperten. Es mußte schon spät sein, denn als ich mich vom Fenster abwenden wollte, sah ich, wie das Auto meines Vaters den Weg entlang fuhr und vor dem Haus hielt. Zitternd beobachtete ich, wie Vater und Kirsty ausstiegen und einen großen Sack aus dem Gepäckraum zerrten, in dem vermutlich Kohlenvorräte waren.
Als ich eine halbe Stunde später in die Küche kam, brannte Feuer im Herd. Jetzt, wo der Raum warm war, wirkte er richtig gemütlich, obwohl man merkte, daß hier lange niemand gewohnt hatte. Die hellen Naturholzmöbel machten einen freundlichen Eindruck, hinter den Sprossenscheiben sah man den Wald, und dem alten Schaukelstuhl mit der Häkeldecke fehlte nur die strikkende Großmutter. Es gab Korbsessel, die knarzten, wenn man sich hineinsetzte, und Flickenteppiche auf dem Holzboden.
Mein Vater deckte den Tisch, während Kirsty Müsli vorbereitete. „Wir haben frische Milch mitgebracht“, sagte sie zu mir. „Hast du bei dem Sturm schlafen können?“
„Ich mag keine Milch“, erwiderte ich. „Und ich habe verdammt schlecht geschlafen.“
„Du mußt spazierengehen“, sagte mein Vater. „Diese Luft! Einfach herrlich!“ Er sah glücklich aus.
Herr Alois thronte auf der Eckbank und schielte mich unter seinen braunen Stirnlocken hervor an. Sein Fell war naß, und er hatte einen Milchschnurrbart.
Nach dem Frühstück ging ich wirklich spazieren – nicht, weil ich es besonders verlockend fand, allein durch den Regen zu stapfen, sondern ganz einfach, weil mir nichts Besseres einfiel. Ich hatte zwar eine Menge Bücher und meinen Kassettenrecorder mitgebracht, doch im Moment war mir weder nach Lesen noch nach Musik zumute.
Die vierzehn Tage lagen wie eine endlose Wüste vor mir. Ich fragte mich, wie ich sie je überstehen sollte. Vater und Kirsty waren natürlich in voller Aktion. Vater stürzte sich sofort mit Feuereifer darauf, einen losen Fensterladen zu reparieren, und Kirsty pusselte mit roten Backen im Haus herum. Später wollten die beiden in den Wald gehen und Holz holen. Ich kam mir ausgeschlossen und überflüssig vor.
In meinen roten Stiefeln und dem gelben Regenumhang sah ich wie eine Ente aus. Doch was machte das schon? Bestenfalls traf ich unterwegs eine Kuh oder ein paar Bauernjungen. Als ich versuchte, Herrn Alois zum Mitkommen zu bewegen, sah er mich düster an und stellte sich taub.
Da es mir im Wald zu naß und zu einsam war, schlug ich den Weg ein, der in die Auffahrt des Viereckshofes mündete. Es regnete jetzt nur noch leicht. Die Luft war mild und roch nach aufgebrochener Erde und Frühling. Widerstrebend gestand ich mir ein, daß das Tal schön war, still und seltsam unberührt wie eine Landschaft aus einer alten Sage.
Als ich an die Wegkreuzung kam, wählte ich den Pfad zur Linken, der zwischen Zäunen und Hecken entlang führte. Knorrige Eichen, Birken und Haselnußsträucher neigten sich über die Einfriedungen. Ich erreichte ein niedriges Gebäude aus rohen Holzstämmen, und da stand plötzlich ein Pferd hinter dem Zaun und sah mir mit großen Augen entgegen.
Ich blieb stehen. Ich mochte Pferde, doch sie waren mir auch ein bißchen unheimlich. Ich hatte bis jetzt noch nie nähere Bekanntschaft mit einem Pferd gemacht. Im Park hatte ich manchmal jemanden vorüberreiten sehen und leichten Neid verspürt. Jetzt stand zum erstenmal ein Pferd dicht vor mir, und ich war froh, daß uns ein Zaun trennte, denn es erschien mir sehr groß und gewaltig.
Das Pferd streckte die Nase über den Querbalken. Ich sah, daß es eine sternförmige Zeichnung auf der Stirn hatte. Es schnaubte und versuchte an meinem Ärmel zu zupfen.
Unwillkürlich trat ich einen Schritt zurück und sagte mit nicht ganz fester Stimme: „Wenn du nach Zucker suchst, tut’s mir leid. Ich hab nichts dabei.“
Es sah mich an, als hätte es mich verstanden. Seine großen, haselnußbraunen Augen hatten einen feuchten Schimmer. Ich merkte plötzlich, daß sie sehr sanft blickten.
Diese Augen waren es, die meine Angst vertrieben. Ich trat nahe an den Zaun heran und streckte behutsam die Hand aus. Das Pferd beschnupperte mich ebenso behutsam. Wie weich seine Lippen und Nüstern waren!
Es war, als würde mich jemand streicheln. Ich schloß die Augen und genoß die Berührung, und das Gefühl von Kälte, das seit Tagen in meiner Brust saß und mir die Kehle zuschnürte, wich.
Ich war so versunken, daß ich zusammenzuckte, als ich eine Stimme hörte. Erschrocken öffnete ich die Augen, als hätte mich jemand bei einer Heimlichkeit ertappt.
Ein Junge stand auf der Koppel. Er mußte hinter dem Heuschober hervorgekommen sein, denn er lehnte dort an der Wand und sah mich an. Er schien auf Antwort zu warten.
Da ich nicht verstanden hatte, was er gesagt hatte, schwieg ich. Das Pferd wandte sich von mir ab und ging zu ihm, und er streichelte seinen Hals.
Nach einer verlegenen Pause sagte der fremde Junge: „Do you speak English?“
Ich mußte lachen. „Ja“, erwiderte ich. „Wenn’s sein muß, schon. Aber vielleicht sollten wir es doch lieber mit Deutsch versuchen.“
Er errötete bis an die Wurzeln seiner blonden Haare. Er war ziemlich groß, mochte aber etwas jünger sein als ich. Stockend sagte er: „Ach so . . . ich . . . ich dachte, du wärst vielleicht Irin oder Schottin, weil . . . wegen deiner roten Haare, und weil du mich vorher nicht verstanden hast.“
Aus irgendeinem Grund fühlte ich mich geschmeichelt. „Ich hab dich nicht kommen hören“, erwiderte ich. „Ist das dein Pferd?“
„Nein“, sagte er. „Sie gehört meinem Vater.“
„Ist es eine Stute?“ fragte ich.
Er nickte. „Ja. Hazel heißt sie.“
„Hazel?“ Er nickte wieder, und wir schwiegen eine Weile. Dann deutete ich mit dem Kinn auf den Viereckshof und fragte: „Ist das euer Hof dort?“
„Ja“, sagte er.
„Er ist sehr groß“, murmelte ich respektvoll. „Der größte Hof, den ich je gesehen habe.“
Er hörte auf, die Stute zu streicheln, und kam langsam näher. Hazel folgte ihm wie ein Hund. „Bist du mit Kirsty hergekommen?“
„Hm. Kennst du sie?“
„Flüchtig. Ihre Tante kannte ich besser. Sie war in Ordnung. Seid ihr verwandt, du und Kirsty?“
Er stand jetzt vor mir am Zaun, und ich sah, daß er sehr blaue Augen und weißblonde Wimpern und Brauen hatte. Die Stute streckte den Kopf über seine rechte Schulter und blies mich an.
„Nein“, sagte ich kurz. „Wir sind nicht verwandt. Mein Vater ist . . . er ist mit ihr befreundet.“
Der blonde Junge sah mich an, als wüßte er, was das für mich bedeutete. Aber natürlich konnte er es nicht wissen. Ich bildete es mir wohl nur ein – vermutlich, weil ich mir so sehr wünschte, daß jemand mich verstand.
„Wird sie jetzt ganz hierherziehen?“ fragte er.
Ich schüttelte heftig den Kopf. „Nein. Wir sind nur zu den Osterferien hergekommen.“
„Lebst du in der Stadt?“ Wieder kam es mir vor, als könnte er erraten, wie es für mich war, diese zwei Wochen hier verbringen zu müssen, ohne einen Menschen, zu dem ich gehen konnte.
Ich sagte: „Ja, ich wohne in München. Ist es nicht furchtbar langweilig und öde, hier draußen leben zu müssen?“
Er sah mich erstaunt an. „Langweilig? Nein, im Gegenteil. Wir haben doch den Hof und die Pferde und jede Menge Arbeit und . . . Glaub mir, es ist wunderbar hier! Vielleicht ist der erste Eindruck nicht gerade überwältigend, wenn alles noch kahl ist und wenn’s noch dazu regnet, aber wart nur ab, wie schön unser Tal sein kann!“
Er sagte das so eindringlich, daß es mir richtig leid tat, so abwertend von seiner Heimat gesprochen zu haben. Weil ich nicht wußte, was ich sagen sollte, schwieg ich, und auch er sagte nichts mehr. Eine Weile standen wir verlegen voreinander, zwischen uns den Zaun, und mir wurde plötzlich bewußt, daß wir uns ja völlig fremd waren.
Da schwang er sich plötzlich über den Zaun, streckte die Hand aus und sagte: „Ich bin Matty.“
Meine Verlegenheit wich. Ich nahm seine Hand, lächelte und erwiderte: „Und ich Elinor. Du kannst aber auch Nora sagen.“
Wieder sah er mich an. Ich merkte, daß er einen seltsam forschenden Blick hatte, als wollte er ergründen, was hinter meiner Stirn vorging. „Wenn’s dir recht ist, sage ich lieber Nell zu dir“, gab er zurück. „Das paßt besser, finde ich.“
Nell – so hatte mich bisher noch niemand genannt. Doch die Abkürzung gefiel mir. Es klang weich und herb zugleich, gerade die richtige Mischung.
Plötzlich wurde ich so froh, ich fühlte mich richtig gut. Ich war nicht allein, die Welt war voller Menschen. Ich hatte Matty kennengelernt und einen neuen Namen bekommen. Es erschien mir wie ein gutes Vorzeichen, eine Art Neubeginn. Ob es Zufall war oder Schicksal, daß sich diese Hoffnung erfüllte, weiß ich bis heute nicht.
4
Matty begleitete mich noch ein Stück den Weg entlang, oder vielmehr begleitete ich ihn, denn es war die Auffahrt zum Hof. Dann ging ich allein weiter in Richtung zum Wald. Matty mußte arbeiten, aber wir hatten uns für den Nachmittag verabredet. Er wollte mir den Stall und die Pferde zeigen.
Ich war in so gelöster Stimmung, daß es mich nicht einmal besonders störte, als ich wieder in die Nähe von Tante Karens Haus kam und Vater und Kirsty sah, wie sie Arm in Arm in den Wald gingen. Vater zog ein komisches altes Leiterwägelchen hinter sich her, und Herr Alois lief geschäftig voraus.
Keiner bemerkte mich, denn ich kam aus einer anderen Richtung. Ich ging ins Haus. In der Küche lag ein Zettel auf dem Tisch: „Sind im Wald, Holz holen. Essen ist im Backrohr.“
Ich sah im Backofen nach. Da war frischer Apfelstrudel mit Rahmkruste in einer Backform. Er sah so gut aus und roch so verführerisch, daß ich Hunger bekam. Ich setzte mich auf die Eckbank, aß und sah dabei aus dem Fenster. Auf dem Ofen summte der Wassertopf, die Wanduhr tickte eintönig, und nun fand ich es friedlich und anheimelnd in dieser Bilderbuchküche mit der Vorfrühlingslandschaft hinter den Fensterscheiben und den bunten Teppichen auf dem abgetretenen Holzboden.
Nach dem Essen ging ich ins Mansardenzimmer und legte mich aufs Bett. In der noch kahlen Eiche vor dem Haus sang ein Vogel. Ich schloß die Augen und lauschte. Dann wurde ich müde und schlief ein.
Als ich wieder aufwachte, bellte Herr Alois im Garten. Ich sah auf die Uhr und merkte, daß es höchste Zeit war, mich auf den Weg zu machen, wenn ich Matty nicht warten lassen wollte.
Diesmal hatte ich keine Lust, wie eine Ente auszusehen. Ich zog meine geliebte Steppjacke aus bunten Stoffresten an und krempelte die Jeans über den Stiefeln hoch. Dann ging ich nach unten.
Im Flur begegnete ich meinem Vater. Er hatte nasse Haare und sah erhitzt und jung aus. „Wohin gehst du?“ fragte er. „Man bekommt dich ja den ganzen Tag kaum zu Gesicht.“
Die alte Abwehr stieg in mir auf. „Ich weiß nicht, wer da wen nicht zu Gesicht bekommt“, sagte ich spitz. „Ich gehe spazieren.“
Er sah verwundert aus, sagte aber nichts mehr, und ich verließ das Haus.
Herr Alois scharrte wild zwischen den Rosensträuchern. Als ich vorüberkam, hob er den Kopf und erwies mir die Ehre eines Schwanzwedelns. Es war das erste Freundschaftszeichen, und ich freute mich darüber. Richtig beschwingt ging ich den Pfad zwischen den Birken und Haselnußsträuchern entlang.
Matty wartete schon auf mich. Ich fand, daß er bedrückt aussah; so, als wäre seit unserer ersten Begegnung am Vormittag etwas geschehen, was ihm zu schaffen machte.
Er hatte einen großen, gefleckten Jagdhund bei sich, der auf dem rechten Auge einen schwarzen und auf dem linken einen weißen Fleck hatte. Er ließ sich ohne weiteres von mir streicheln, und ich sagte: „Er sieht aus, als trüge er eine Augenbinde! Ihr habt wohl viele Tiere auf eurem Hof?“
Die Frage schien eine unangenehme Gedankenverbindung in Matty auszulösen, denn ein Schatten ging über sein Gesicht, und er erwiderte nur kurz: „Ja, eine Menge.“
Langsam schlenderten wir in Richtung zum Dreililienhof. Ich fühlte mich eingeschüchtert durch Mattys düstere Miene, und auch er sagte einige Zeit kein Wort. Als das Schweigen unbehaglich wurde, murmelte ich: „Wenn du mich lieber doch nicht mit in euren Stall nehmen willst – ich meine, wenn es dir ein andermal besser paßt oder so –, dann brauchst du es mir nur zu sagen. Ich verstehe das schon.“
Matty sah rasch auf. Zwischen seinen sandfarbenen Augenbrauen stand eine steile Falte. „Das ist schon in Ordnung“, sagte er. „Es hat nichts mit dir zu tun, weißt du. Ich . . . hatte Schwierigkeiten mit meinem Vater.“
Ich dachte an meine eigenen Probleme und nickte. „Ich verstehe“, sagte ich wieder, obwohl ich ja nicht wußte, worum es in Mattys Fall ging. „Bist du der einzige Sohn?“
Er schüttelte den Kopf. „Ich hab noch einen Bruder.“
Von nahem sah der Dreililienhof noch immer mächtig und eindrucksvoll aus, doch ich bemerkte Zeichen des Verfalls an den Mauern. Ein großer Torbogen verband die Gebäude der viereckigen Wohnanlage, breit genug, um vollbeladene Fuhrwerke durchzulassen. Vor langer Zeit mochten wohl auch Kutschen durch dieses Tor in den Innenhof von Dreililien gefahren sein.
Man sah noch Reste einstigen Reichtums, doch über allem lag ein Hauch von Vernachlässigung: Die Gläser der Laterne, die von der Decke des Torbogens hing, waren zerbrochen, eine Dachtraufe in Form eines wasserspeienden Drachen baumelte lose von der Dachkante, große Stücke des Pflasters der Einfahrt fehlten, und die schmiedeeisernen Fenstergitter rosteten.
Trotzdem strahlte dieser Ort eine eigenartige Schönheit aus, wie man sie nur bei verfallenen und vernachlässigten alten Bauten findet; eine schwermütige Stimmung, die anziehend wirkte.
Matty führte mich nicht durch den Torbogen in den Innenhof, sondern um die Außenseite des Hofes herum. Als wir den Mauervorsprung erreichten, schlug mir unverkennbarer Stallgeruch entgegen. Ich hörte Poltern, leises Gewieher und Schnauben.
Vor einer geschnitzten Doppeltür machte Matty halt und zog einen der Türflügel auf. Der gefleckte Jagdhund lief sofort eifrig voraus, und ich folgte ihm und Matty in den Stall.
Ich habe mich manchmal gefragt, weshalb ich solche Furcht empfand, als ich den Stall von Dreililien zum erstenmal betrat. Es waren wohl die vielen Pferde und die fremden Gerüche und Geräusche, die mich beunruhigten. Später lernte ich, daß Pferde sanft und gutmütig sind, wenn man sie gut behandelt und mit ihnen umzugehen versteht.
Damals aber war alles so neu für mich – das warme Halbdunkel des Stalles nach der Helligkeit des Frühlingsnachmittages, die vielen Pferde, die uns aufmerksam entgegensahen, das Scharren und Stampfen ihrer Hufe.
Als wir zur Stallgasse kamen, stieß eines der Pferde ein durchdringendes Wiehern aus. Ich zuckte zusammen, aber Matty lächelte mir beruhigend zu und sagte: „Das ist nur Hazel. Sie begrüßt mich immer so, wenn ich in den Stall komme.“
„Was macht ihr mit all den Pferden?“ fragte ich.
„Wir züchten sie“, sagte Matty. „Hast du nicht gewußt, daß Dreililien ein Gestüt ist?“
Ich schüttelte den Kopf. Er ging von einer Box zur anderen, streichelte die Pferde und erklärte dabei: „Das dort ist Isabell. Und das Marnie. Das ist unser Deckhengst Ask; er hat schon viele Preise gewonnen. Und die kleine Schimmelstute ist Emily. Bist du eigentlich schon mal geritten, Nell?“
„Nein“, sagte ich. „Bei uns in der Stadt sind Reitstunden ziemlich teuer. Aber du reitest sicher fantastisch, wo du doch praktisch mit Pferden aufgewachsen bist.“
„Reiten kann ich ganz gut“, gab er zu. „Aber ich bin nicht so ein leidenschaftlicher Reiter wie zum Beispiel mein Bruder. Ich mag Pferde unheimlich gern, weißt du, und deshalb widerstrebt es mir immer, ihnen meinen Willen aufzuzwingen – und das muß man nun mal beim Reiten. Mir ist es am liebsten, wenn sie draußen auf der Koppel sind und tun und lassen können, was ihnen gefällt. Wenn ich viel Geld hätte, würde ich meine Pferde ganz wild und frei leben lassen; so, wie es eigentlich ihre Natur ist.“
Er schwieg einen Augenblick und fügte dann hinzu: „Der Reitsport ist ja auch nur eine Art, wie wir Menschen Tiere benutzen, ohne zu überlegen, wie das überhaupt für sie sein mag.“
Ich sah Matty an. Seltsam, darüber hatte ich noch nie nachgedacht. Daß ausgerechnet er so etwas sagte, dessen Familie Pferde züchtete, um sie dann zu verkaufen, damit sie von anderen Menschen benutzt wurden – zum Vergnügen oder um Preise zu gewinnen, also um Geld zu machen!
Ich wollte gerade etwas dazu sagen, als eine Stimme aus dem Hintergrund fragte: „Wen versuchst du da schon wieder mit deinen Hirngespinsten aufzuwiegeln, Matty?“
Ein hochgewachsener Junge kam durch eine Zwischentür geschlendert. Der gefleckte Jagdhund lief ihm entgegen und umsprang ihn voller Freude.
Ich sah sofort, daß der Junge Mattys Bruder sein mußte. Er sah ihm ähnlich, war aber um einen Kopf größer und wohl auch einige Jahre älter. Er bewegte sich mit einer lässigen Anmut, die von Selbstbewußtsein zeugte und deshalb aufreizend auf mich wirkte, einer Anmut, die zugleich aber auch etwas Anziehendes hatte. Seine blonden Haare waren länger als die von Matty und wild gelockt. Seine Jeans, die in Gummistiefeln steckten, waren voller Pferdemist.
Das alles sah ich mit einem Blick, während Matty erwiderte: „Hirngespinste! Alles, was du nicht verstehst, tust du als Verrücktheit ab, wie?“
Sein Bruder lachte. „Sei nicht gleich eingeschnappt“, sagte er. Dabei sah er mich an. „Bist du mit Kirsty gekommen?“ fragte er.
„Sozusagen“, erwiderte ich.
„Das ist Nell“, erklärte Matty. „Ihr Vater ist mit Kirsty befreundet. Sie verbringen die Osterferien im Kavaliershäusl.“
Zum erstenmal hörte ich den Ausdruck Kavaliershäusl für Tante Karens Haus. „Und ich bin der Jörn“, sagte Mattys Bruder. Wir sahen uns prüfend an, gaben uns aber nicht die Hand.
„Warum nennt ihr das Haus Kavaliershäusl?“ fragte ich; nicht so sehr, weil es mich wirklich interessierte, sondern um meine Verlegenheit zu überspielen.
„Weil es mal zum Hof gehört hat“, erklärte Jörn. Er war überhaupt nicht verlegen. „Dreililien war früher mal so was wie ein Rittergut. Das heißt, einer unserer Vorfahren hat es vom Kaiser als Belohnung für treue Dienste während eines Krieges bekommen. Und in dem Haus, das Karen gehörte, lebte vor ewigen Zeiten ein verarmter Adeliger, der bei unserem Ur-Urgroßvater im Dienst stand. Seitdem heißt es Kavaliershäusl.“
„Seid ihr auch adelig?“ fragte ich. „Ich meine, wenn eure Familie ein Rittergut bekommen hat!“
Matty schüttelte den Kopf und erwiderte: „Nein. Unser Ur-Urgroßvater hat damals zwar auch einen Titel verliehen bekommen, aber der wurde nicht weitervererbt. Wir heißen schlicht und einfach Moberg.“ Er machte eine komische Verbeugung.
Jörn bückte sich, um den Jagdhund zu streicheln, der noch immer begeistert an ihm hochsprang.
„Ist ja schon gut, Diana“, sagte er. „Bist ein braves Mädchen.“
Ein Pferd wieherte schrill, ein anderes schlug mit den Hufen gegen die Boxwand, daß es nur so knallte. Matty sagte: „Sie möchten raus aus dem Stall. Morgen dürfen sie wieder auf die Koppel. Das Barometer ist gestiegen, und morgen soll’s einigermaßen warm werden – endlich. So ein verregnetes Frühjahr haben wir schon lange nicht mehr gehabt.“
„Zeit zum Stallausmisten“, sagte Jörn und warf mir einen spöttischen Seitenblick zu. „Bist du gekommen, um uns zu helfen, oder wie sehe ich das?“
Ich merkte, daß ich rot wurde. Bei der Stallarbeit mithelfen – warum eigentlich nicht? Aber dazu brauchte ich eine ältere Hose, und der weiße Pullover, den ich trug, war wohl auch nicht gerade das richtige Kleidungsstück für eine solche Gelegenheit.
Ehe ich eine passende Antwort finden konnte, mischte sich Matty ein. „Ich wollte Nell die Pferde zeigen“, sagte er. „Zum Arbeiten habe ich sie nicht eingeladen.“
Ich lachte. „Mir fällt durchaus keine Perle aus der Krone, wenn ich euch helfe“, erwiderte ich.
Aus den Augenwinkeln beobachtete ich, daß Jörn mich erstaunt musterte. Offenbar hatte er mich nur aufziehen wollen und überhaupt nicht damit gerechnet, daß ich seinen Vorschlag ernst nehmen könnte. „Ich bin nur nicht ganz passend angezogen“, fügte ich hinzu. „Ist es euch recht, wenn ich morgen wiederkomme und mithelfe?“
Matty sah mich fast respektvoll an, und Jörn erwiderte nur: „Warum nicht, wenn du magst? Jede Hilfe wird dankend angenommen. Eine alte Latzhose kannst du von uns bekommen, wenn du keine Arbeitskleidung mitgebracht hast.“
„Hab ich wirklich nicht“, gab ich zu.
Ich hatte ja gedacht, daß dies ein langweiliger Urlaub werden würde, in dem nichts passierte; vierzehn Tage, die ich damit zubringen mußte, die Zeit totzuschlagen! Hier aber gab es offenbar jede Menge zu tun. Ich konnte mich nützlich machen, wie es so schön heißt.
Im Augenblick wußte ich allerdings nicht, ob ich aus Langeweile so bereitwillig meine Hilfe anbot, oder weil es mich reizte, diesem Jörn zu zeigen, daß er sich irrte, wenn er mich für ein zimperliches, verwöhntes Stadtmädchen hielt.
5
Abends erwähnte ich nichts davon, daß ich Jörn und Matty kennengelernt hatte und im Stall von Dreililien gewesen war, obwohl mein Vater mehrmals fragte, wie ich denn den Tag verbracht hätte. Kirsty stellte überhaupt keine Fragen. Sie verhielt sich zurückhaltend, war dabei aber doch freundlich zu mir. Mir wäre es lieber gewesen, sie hätte sich abscheulich benommen und mir damit einen weiteren Grund gegeben, sie nicht zu mögen.
Sie versuchte jedenfalls nicht, sich anzubiedern, und Vater war so glücklich, daß ihm nicht einmal mein mürrisches, abweisendes Verhalten etwas auszumachen schien. Er hatte selbst gekocht – ein indonesisches Gericht mit unaussprechlichem Namen, der Teufel mochte wissen, woher er die Gewürze hatte! – und strahlte, als er sah, daß es Kirsty schmeckte. Im Ofen prasselten die Holzscheite, die sie zusammen aus dem Wald geholt hatten, und hinter den Fenstern schwankten die kahlen Äste der Eiche im Abendwind. Herr Alois lag auf dem Teppich vor dem Ofen, die Schnauze auf den Vorderpfoten, und schnarchte leise.
Nach einer Weile holte Kirsty ihre Gitarre, die sie mitgebracht hatte. Sie setzte sich neben meinen Vater auf die Eckbank und begann eine Melodie zu spielen, die ich nicht kannte.
Vater ließ sie nicht aus den Augen; er sah sie an wie ein Wesen von einem anderen Stern. Da hatte ich genug. Ich stand auf, murmelte etwas und ging ins Mansardenzimmer hinauf.
In dem Räum mit den schrägen Wänden war es kalt. Die Fensterflügel standen noch weit offen. Ich lehnte mich mit den Armen aufs Fensterbrett und sah in die Dunkelheit. Ein paar Lichtpunkte zeigten an, wo Dreililien war. Ein Ast ächzte leise und klagend. Der Mond stand über dem Wald, und der Wind trüg den Geruch von Stall und Pferden zu mir herüber.
Ich dachte, daß ich hier, wo ich es am wenigsten erwartet hatte, zwei Menschen kennengelernt hatte, die mich interessierten und die ich gern zu Freunden gehabt hätte. Dafür habe ich meinen Vater verloren! ging es mir durch den Sinn, und ein bitteres Gefühl stieg in mir auf.
Ich mochte nicht länger am Fenster stehen. Schaudernd zog ich mich aus und kroch unter die Bettdecke. Eine Weile lag ich da und zitterte, doch nicht nur vor Kälte. Ich versuchte einzuschlafen, aber es ging nicht. Ich versuchte an etwas Angenehmes zu denken – daran, daß ich morgen mit Jörn und Matty im Stall arbeiten würde, daß ich hier vielleicht sogar anfangen konnte, reiten zu lernen; doch es nützte nichts. Ich war traurig, und nichts konnte mich darüber hinwegtäuschen, daß ich allein war, und daß mein Vater mit Kirsty dort unten in der Küche saß und vor Glück und Verliebtheit fast platzte.
Zwei Stunden später lag ich noch immer wach. Meine Füße waren wie Eisklötze. Ich dachte sehnsüchtig an meine Mutter, die mir heiße Milch und Honig gebracht hatte, wenn ich als Kind nicht einschlafen konnte.
In der Küche war noch ein Rest Milch vom Frühstück, Honig hatten wir von zu Hause mitgebracht. Ich stand auf, schlüpfte in den Morgenmantel, zündete die Kerze an und nahm sie mit ins Treppenhaus.
Ich nahm fest an, daß Vater und Kirsty längst zu Bett gegangen waren; als ich jedoch in die Nähe der Küche kam, drang Lichtschimmer durch die Türritzen, und ich hörte gedämpfte Stimmen.
Unwillkürlich blieb ich stehen. Ich hatte keine Lust, in die Küche zu gehen, wie ein Kind nach heißer Milch mit Honig zu verlangen und zuzugeben, daß ich nicht schlafen konnte. Schon wollte ich wieder umkehren, da hörte ich ganz deutlich die Stimme meines Vaters: „ . . . daß Elinor dir gegenüber so unfreundlich ist!“
Die erste Hälfte des Satzes hatte ich nicht verstanden, aber ich konnte mir denken, daß er sich für mich entschuldigte.
Ich hielt mitten in der Bewegung inne. Eigentlich wollte ich nicht lauschen; ich verachte neugierige Leute. Diesmal aber mußte ich einfach bleiben und wissen, was sie sagten. Irgend etwas zwang mich, ihre Unterhaltung mit anzuhören.
„Laß nur, ich verstehe sie“, erwiderte Kirstys helle, ein wenig brüchige Stimme.
Sie verstand mich . . . Wenn ich das schon hörte! Ich wollte ihr Verständnis nicht, es konnte mir gestohlen bleiben!
„Ich bin doch ein Eindringling für sie“, fuhr sie fort. „Sie denkt, daß ich dich ihr wegnehme. Und irgendwie ist es ja auch wirklich so.“ Sie stockte. „Es ist sehr schwer, zu teilen, wenn man nur einen Menschen auf der Welt hat, zu dem man gehört.“
Mein Vater erwiderte aufgebracht: „Aber ich kann doch ihretwegen nicht meine besten Jahre wie ein Einsiedler verbringen! In ein paar Jahren wird sie vielleicht schon aus dem Haus gehen und ihr eigenes Leben führen. Ich habe doch auch ein Recht auf ein bißchen Glück und Zärtlichkeit! Warum gönnt sie es mir nicht, daß ich glücklich bin? Sie müßte froh sein, daß ich eine Frau wie dich gefunden habe.“
Ich wagte kaum zu atmen. So also sah er die Sache; das war sein Standpunkt. Ein Teil von mir begriff, daß er recht hatte, aber die Bitterkeit und das Gefühl von Zurücksetzung blieben. Vater brauchte eine Frau, um glücklich zu sein. Er brauchte Kirsty.
Kirsty sagte sanft: „Natürlich hast du ein Recht darauf, Richard. Aber die Sache hat zwei Seiten, und für deine Tochter sieht alles ganz anders aus. Ich habe es doch selbst erlebt, wenn auch umgekehrt. Ich lebte bei meiner Mutter, und als sie Jahre nach ihrer Scheidung wieder eine Beziehung zu einem Mann aufnahm, fühlte ich mich zurüekgestoßen und vernachlässigt. Es war eine bittere Erfahrung, die mir jahrelang schwer zu schaffen gemacht hat. Deshalb verstehe ich Elinor so gut.“
Erst jetzt merkte ich, daß heißes Wachs auf meine Hand tropfte, weil ich die Kerze schief hielt. Leise drehte ich mich um und ging wieder die Treppe hinauf. Ich hatte genug gehört. Mein eigener Vater war gegen mich, und die Frau, die ich für meine Feindin hielt, verteidigte mich noch. So erschien es mir jedenfalls in dieser Nacht.
Kirstys Lebensgeschichte interessierte mich nicht weiter. Ich wollte ihr Verständnis und Mitgefühl nicht. Alles, was ich wollte, war, daß sie meinen Vater in Ruhe ließ, damit wir wieder leben konnten wie zuvor. Doch zugleich wußte ich auch, daß es nie wieder so werden konnte wie früher.
Gegen Mitternacht schlief ich dann doch ein, und als ich in der Morgendämmerung erwachte, sah alles nicht mehr ganz so schlimm aus. Zwar war ich Vater und Kirsty gegenüber keinen Deut versöhnlicher gestimmt, doch ich war fest entschlossen, in Zukunft meine eigenen Wege zu gehen.
Diesen Vorsatz führte ich auch sofort aus, indem ich früher als sonst aufstand, um ins Dorf zu gehen. Im Haus war alles still, und in der Küche waren noch die Vorhänge zugezogen. Ich schrieb auf einen Zettel Bin gegen Mittag zurück, legte ihn auf den Tisch, nahm meine Jacke vom Garderobenhaken und verließ das Haus.
Der Himmel war milchig blau mit einem Schleier von Dunst, doch aus den Wiesen stieg Feuchtigkeit auf, und ich fröstelte in der kalten Morgenluft. Meine Ballerinaschuhe mit den dünnen Sohlen waren nicht gerade die passende Fußbekleidung für einen ländlichen Spaziergang. Ich spürte jeden Stein auf der unbefestigten Straße, und als ich versuchte, im Gras zu gehen, war das dünne Leder im Nu durchnäßt.
Der Weg zum Dorf, der mir mit dem Auto so kurz erschienen war, zog sich endlos lange hin. Als ich nach mehr als einer Dreiviertelstunde den Hügel mit der Dorfkirche in der Ferne auftauchen sah, war ich erleichtert. Kühe starrten mich über einen Weidenzaun hinweg mit friedlicher Neugier an, und ein stattlicher Misthaufen war der erste Vorbote des Dorfes. Eine Schar Hühner kratzte gackernd darauf herum, ein alter Bauer arbeitete in einem Gemüsegarten hinter einem Holzhaus und musterte mich prüfend, und über die Dorfstraße kurvten Kinder mit ihren Fahrrädern.
Ich ging in den Lebensmittelladen, kaufte Milch, Semmeln, ein Stück Käse und zwei Äpfel und setzte mich auf eine Bank am Fuß des Kirchbergs. Dort frühstückte ich in der Morgensonne. Eine Katze saß nicht weit von mir auf einem Zaunpfosten, kniff die Augen zusammen und sonnte sich wie ich, und im Gras unter den Fliederbüschen blühten die ersten Veilchen.
Vom Kirchturm schlug es neun, als ich schließlich aufstand und durchs Dorf ging. Allzu viel gab es da nicht zu sehen – ein großes Haus mit grüngestrichenem Spalier, das offenbar die Schule war, der Pfarrhof am Kirchberg, neben der Dorfstraße ein Wirtshaus mit Kastanien, die gerade erst ausschlugen, den Lebensmittelladen, eine alte Schmiede und ein paar Dutzend Häuser mit Holzbalkons, dazu Gärten, eine Ferienpension, eine Tankstelle und daneben eine Bushaltestelle. Das war alles.
Kein Kino, keine Disco, kein Schallplattenladen und keine Boutique. Nichts. Ich dachte: Wie halten es die Leute hier nur aus?
Die Menschen, die mir begegneten, musterten mich neugierig. Vermutlich waren Fremde um diese Jahreszeit eine Seltenheit. Schließlich hatte ich mir das ganze Dorf angesehen, und es war gerade erst zehn. Ich hatte überhaupt keine Lust, schon wieder zurückzugehen, aber etwas anderes fiel mir nicht ein; und mit Matty und Jörn hatte ich mich erst für fünf Uhr nachmittags verabredet.
Langsam und lustlos schlenderte ich den Weg zurück, den ich gekommen war. Als ich das letzte Bauernhaus des Dorfes hinter mir gelassen hatte und auf die Straße abbog, die am Wildbach entlang nach Dreililien führte, sah ich in der Ferne zwischen den Bäumen einen Reiter kommen.
Es war Matty. Als er mich bemerkte, lenkte er sein Pferd auf mich zu und brachte es kurz vor mir zum Halten. Ich zwang mich, stehenzubleiben und nicht zurückzuweichen, obwohl das haselnußbraune Pferd einfach riesenhaft wirkte.
„Hallo!“ sagte Matty atemlos.
„Hallo“, erwiderte ich. „Reitest du spazieren?“
Er schüttelte den Kopf. „Nein, ich muß ins Dorf und dem Hufschmied Bescheid sagen, daß er heute vorbeikommen soll. Emily hat ein Hufeisen verloren.“
„Hat er denn kein Telefon?“ fragte ich erstaunt.
Matty sah mich ebenso erstaunt an. „Nein, warum denn? Ohne geht’s doch auch! Aber du kommst natürlich aus der Stadt, da denkt man wohl, ohne Telefon geht die Welt unter!“
„Quatsch“, sagte ich etwas gereizt. „Aber praktisch ist es, das wirst du wohl zugeben?“
Er sagte friedlich: „Ja, schon. Hör mal, Nell, ich bin in spätestens zehn Minuten wieder da. Wenn du auf mich wartest, können wir gemeinsam zurückreiten.“
„Reiten?“ wiederholte ich und sah zweifelnd auf das große Pferd. „Ich weiß nicht recht. Wahrscheinlich komme ich gar nicht erst rauf, und überhaupt . . .“
Matty lachte. „Hochstemmen kann ich dich schon“, sagte er. „Aber wir müssen ja nicht unbedingt reiten. Zwei Leute wären sowieso zu viel für Hazel. Sie hat nämlich etwas schwache Fesselgelenke.“
Hazel senkte den Kopf, als hätte sie verstanden, was Matty gesagt hatte, streckte die Nase vor und schnupperte an meinen Haaren. Ich blieb ganz still stehen und ließ es über mich ergehen, doch mein Herz klopfte schneller als sonst.
„Keine Angst“, sagte Matty. „Hazel hat noch keiner Seele was zuleide getan.“
Die Stute blies in mein Haar, und ich atmete den herben, aber angenehmen Pferdegeruch ein. Dann zog sie den Kopf zurück und sah mich mit ihren sanften braunen Augen aufmerksam an.
„Wir können ja zusammen zurückgehen“, schlug Matty vor. „Hazel ist froh, wenn sie niemanden auf ihrem Rücken herumschleppen muß, was, Hazel?“
Die Stute schnaubte leise und schüttelte ungeduldig den Kopf, um ein paar Fliegen zu verscheuchen. Ich trat unwillkürlich einen Schritt zurück und sagte: „Also, dann warte ich auf dich.“
„Prima.“ Matty lenkte Hazel zur Mitte der Straße, und sie trabte in Richtung zum Dorf davon. Während ich den beiden nachsah, dachte ich, daß Matty ein netter Kerl war, netter als alle Jungen in meiner Klasse; auch wenn er noch ziemlich jung war und nicht so gut aussah wie sein Bruder.
Nach etwa zehn Minuten war er wirklich wieder da, schwang sich aus dem Sattel und ließ Hazel auf der Wiese frei. Sie trottete mit schleifenden Zügeln neben uns her, graste ab und zu zufrieden und sah immer wieder zu uns herüber, als wollte sie sich vergewissern, ob Matty noch da war.
„Hazel ist so anhänglich“, erklärte Matty. „Ich habe sie selbst zugeritten. Sie war immer schon lammfromm und hat mich nie abgeworfen.“
„Werdet ihr sie eines Tages verkaufen?“ fragte ich.
Sein Gesicht wirkte plötzlich verschlossen. „Ich weiß nicht“, sagte er. „Das liegt bei meinem Vater. Die Pferde gehören ja alle ihm.“
Ich sah ihn von der Seite an. Eine Weile schwiegen wir. Dann fragte ich vorsichtig: „Verstehst du dich nicht gut mit deinem Vater?“
„Ach, er ist ziemlich schwierig. Aber ich kann’s ihm wohl nicht vorwerfen.“
Ich merkte, daß er im Augenblick nicht mehr darüber sagen wollte, und stellte keine weiteren Fragen. Dann dachte ich, daß ich wirklich einmal gern jemanden kennengelernt hätte, der keine Schwierigkeiten mit seinem Vater oder seiner Mutter oder mit beiden Eltern hatte. Abgesehen von Erwachsenen natürlich, aber selbst die schienen oft noch Probleme mit ihren Eltern zu haben. Ich hatte geglaubt, eine rühmliche Ausnahme zu sein, denn bisher hatte ich mich gut mit meinem Vater verstanden und war stolz darauf gewesen, daß wir so gute Freunde waren. Doch das war jetzt wohl ein für allemal vorbei . . .
„Zum Teufel!“ sagte ich unwillkürlich.
Matty nickte, als wüßte er, in welche Richtung meine Gedanken gingen. „Man müßte erwachsen und unabhängig sein“, sagte er bitter.
„Wenn man erwachsen ist, ist man deswegen noch lange nicht unabhängig“, erwiderte ich.
Matty lachte, aber besonders froh wirkte er nicht dabei. „Das klingt verdammt weise“, sagte er. „Aber du hast schon recht. Um unabhängig zu sein, braucht man Geld.“
Ich murmelte: „Ja, Geld – wenn ich jetzt Geld hätte, würde ich sofort verschwinden. Nach Amsterdam vielleicht, das ist eine wunderbare Stadt.“
„Oh, ich würde schon hierbleiben“, erwiderte Matty. „Ich würde meinem Vater das Gut und die Pferde abkaufen. Dann könnten sie frei leben und hätten es gut bei mir.“
„Haben sie es denn nicht gut bei deinem Vater?“
„Er behandelt sie nicht schlecht, das ist es nicht. Er hängt zwar auch an ihnen, aber ich glaube, er liebt sie nicht so wie Jörn und ich. Für ihn sind sie mehr eine Art Ware, weißt du, die man möglichst gewinnbringend verkauft. Etwas, das man abstoßen muß, wenn es sich nicht mehr rentiert.“
Der Weg führte nun wieder dicht am Wildbach vorbei, und wir warteten, während Hazel an eine seichte Uferstelle ging, sich vorsichtig einen Weg zwischen dem Geröll bahnte und von dem klaren Wasser trank. Es war ein schönes Bild, fast wie ein Gemälde – die haselnußbraune Stute am Bach, die Sonne auf dem Wasser und im Hintergrund die Felsen zwischen den Tannen.
„Rentiert es sich denn?“ fragte ich.
Matty schwieg eine Weile. Dann schüttelte er den Kopf und wandte sich wieder zum Gehen. Ich folgte ihm. Hinter uns erklang das leichte Getrappel von Hazels Hufen auf dem steinigen Pfad.
„Eben nicht“, sagte er nach einiger Zeit. „Es lohnt sich nicht. Deshalb überlegt Vater ja auch immer wieder, ob er die Pferde und vielleicht auch einen Teil unseres Grundstücks verkaufen soll. Er sagt, dann könnten wir bequem und sorgenfrei leben.“
Er schwieg wieder und senkte den Kopf. Die Sache war schlimm für ihn, das spürte ich. „Und deine Mutter? Was sagt sie dazu?“
„Meine Mutter? Die hat keine eigene Meinung“, erwiderte er. „Von ihr kann man keine Unterstützung erwarten. Ich glaube, sie hat Angst vor Vater.“
Matty vergrub die Hände in den Hosentaschen und ging rascher vorwärts. Ich müßte mich beeilen, um ihn einzuholen. Nach einigen Minuten sagte er fast schroff: „Aber was kümmert dich das? Du hast sicher andere Sorgen. Ich will dir nicht die Ohren volljammern.“
„Du jammerst mir nicht die Ohren voll“, sagte ich. „Manchmal tut’s einem gut, wenn man jemandem etwas erzählen kann, den man kaum kennt – einem Außenstehenden, meine ich. Und das bin ich ja auch – eine Außenstehende.“
Und voller Bitterkeit dachte ich, daß das wirklich stimmte. Ich war eine Außenstehende. Das war gegenwärtig genau meine Stellung in der Welt.
Matty nickte und sagte: „Vielleicht hast du recht. Aber dann kannst du mir doch eigentlich auch von dir erzählen. Für dich bin ich schließlich auch ein Außenstehender, wie du das nennst.“
„Ich weiß nicht“, erwiderte ich zögernd. „Immerhin kennst du Kirsty.“
„Und du meinst, deshalb wäre ich voreingenommen?“
„Vielleicht“, sagte ich.
„Kirsty ist in Ordnung“, sagte Matty. „Aber so gut kenne ich sie gar nicht, wie du vielleicht glaubst. Bei ihrer Tante Karen sind wir oft gewesen, als wir noch Kinder waren. Sie hat da ziemlich allein gelebt, aber es war ihr offenbar ganz recht so.“ Er sah mich von der Seite an. „Und Kirsty . . . kommst du nicht gut mit ihr aus?“
„Ich mag sie nicht“, sagte ich heftig.
Matty nickte wieder. „Sind deine Eltern geschieden?“
„Nein“, sagte ich kurz. „Meine Mutter ist vor ein paar Jahren gestorben.“
„Oh!“ Er fragte: „Und jetzt hat dein Vater Kirsty kennengelernt? Glaubst du, daß die beiden heiraten werden?“
„Vielleicht“, sagte ich. „Meinetwegen sollen sie es tun. Sie können machen, was sie wollen. Es kümmert mich nicht.“
Matty murmelte: „Das glaube ich dir nicht.“
Ich wurde plötzlich richtig wütend. „Es ist aber so!“ herrschte ich ihn an. „Was weißt du schon von mir? Ich brauche niemanden, ich komme ganz gut allein zurecht.“ Ich stockte, weil ich merkte, wie meine Stimme zitterte. Meine Kehle verengte sich und schmerzte von der Anstrengung, die Tränen zurückzuhalten. Ich wandte das Gesicht ab, damit Matty meine Augen nicht sah.
Er blieb stehen und sagte sanft: „Unsinn, das stimmt doch gar nicht! Keiner kommt allein zurecht. Warum gibst du nicht einfach zu, daß es dir weh tut? Du hast Angst, deinen Vater zu verlieren, stimmt’s? Du fürchtest, daß Kirsty ihn dir wegnehmen könnte.“
Ich kämpfte um meine Fassung, Matty war nett, aber ich kannte ihn kaum. Er durfte nicht sehen, wie elend und hilflos ich mich fühlte. Ich wollte um keinen Preis vor ihm weinen. Warum hatte ich mich nur auf dieses Gespräch eingelassen?
Verbissen ging ich weiter, die Augen blind vor Tränen, das Gesicht dem Wald zugekehrt. Ich schluckte und schluckte und hielt die Tränen mit aller Macht zurück. Dabei hörte ich Mattys Schritte dicht hinter mir, und dazwischen das gedämpfte Geklapper von Pferdehufen.
Plötzlich hielt ich es nicht länger aus. Ich setzte mich auf einen gefällten Baumstamm, der am Waldrand lag, und sagte mit erstickter Stimme: „Sei nicht böse, aber ich möchte jetzt allein sein. Bitte, geh ohne mich weiter!“
Matty zögerte eine Weile. „Gut“, sagte er dann, „wenn du das wirklich möchtest, reite ich eben nach Hause. Vielleicht reden wir ein andermal darüber. Aber du kommst doch heute noch zu uns in den Stall, wie wir’s ausgemacht haben?“
Ich sah ihn nicht an, nickte nur und fuhr mir mit dem Handrücken über die Nase. Da wandte er sich ab und rief nach Hazel.
Verschwommen sah ich aus den Augenwinkeln, wie die Stute angetrabt kam, und wie Matty sich in den Sattel schwang. Dann hörte ich die beiden davonreiten. Der Kies knirschte unter den Pferdehufen; laut zuerst, dann immer leiser, bis das Geräusch schließlich verklang.
Ich blieb allein zurück. Die Vögel sangen. Jetzt, wo ich hätte weinen können, weil niemand mich sah, konnte ich es nicht mehr. Meine Augen brannten, und ein dumpfes, quälendes Gefühl saß in meiner Brust. Ich war wieder allein, denn ich hatte Matty weggeschickt.
6
Es war Mittagszeit, als ich zum Kavaliershäusl kam. Vater und Kirsty hatten den Gartentisch unter der noch kahlen Eiche gedeckt und sagten kein Wort über meinen vormittäglichen Ausflug. Sie taten, als wäre alles in bester Ordnung; das heißt, mein Vater tat so. Er lachte und versuchte witzig zu sein, doch Kirsty machte ein ernstes Gesicht und ging nicht auf seine erzwungene Fröhlichkeit ein.
Ich sagte überhaupt nichts, saß nur am Tisch und löffelte lustlos einen Yoghurt. Da wurde auch mein Vater mit der Zeit stiller. Ich hatte den beiden die Laune verdorben, doch das schadete nichts. Wenn ich nicht froh war, brauchten sie es auch nicht zu sein.
Herr Alois saß auf der Türschwelle und kaute hingebungsvoll an einem Knochen, und in der Ferne grasten die Pferde des Dreililienhofes auf den Koppeln. Die Sonne sickerte durch die knorrigen Äste und Zweige, und es hätte alles sehr schön und friedlich sein können, wenn die Sache mit Kirsty nicht gewesen wäre.
Plötzlich horchte ich auf. Vater und Kirsty schienen sich gerade über Dreililien zu unterhalten. „ . . . hat wohl kaum noch einen Gewinn erzielt, seit er selbst nicht mehr arbeiten kann“, hörte ich Kirsty sagen.
„Ich glaube sowieso nicht, daß Pferdezucht ein besonders einträgliches Geschäft ist“, erwiderte Vater. „Wenn so ein Pferd krank wird oder stirbt, oder wenn gar eine Seuche ausbricht – das kann einen Pferdezüchter über Nacht ruinieren.“
Kirsty machte ein nachdenkliches Gesicht. „Die meisten Pferde sind wohl versichert“, sagte sie. „Aber Versicherungen kosten natürlich auch eine Menge Geld. Und nach dem Unfall mußte Waldo noch zusätzlich einen Stallknecht einstellen. Damals hat er auch zum erstenmal einen Teil seiner Stuten verkauft.“
Dieser Waldo war vermutlich Jörns und Mattys Vater; doch von welchem Unfall sprach sie? Matty hatte nichts davon erwähnt. Allerdings erinnerte ich mich an seine Bemerkung, man könne es seinem Vater nicht verübeln, daß er schwierig war.
Ich hätte Kirsty danach fragen können, aber ich tat es nicht. Sie und Vater sollten nicht wissen, daß ich Jörn und Matty bereits kannte. Das war meine Privatangelegenheit. Außerdem hatte ich keine Lust, mich auf eine Unterhaltung mit Kirsty einzulassen.
„Aber du hast doch gesagt, daß er zwei Söhne hat“, erwiderte mein Vater. „Sie werden ihm sicher helfen.“
„O ja, natürlich. Aber sie gehen schließlich noch zur Schule. Und ein paar Dutzend Pferde machen eine Unmenge Arbeit.“
Kirsty stand auf und ging ins Haus. Herr Alois nahm seinen Knochen zwischen die Zähne und folgte ihr. Mein Vater sah mich an und sagte: „Schön ist es hier, findest du nicht?“
„Das kommt ganz auf den Standpunkt an“, erwiderte ich.
Er machte ein unbehagliches Gesicht. „Oder auf die Einstellung“, sagte er. „Wenn du entschlossen bist, hier alles unmöglich zu finden, kann es dir allerdings nicht gefallen.“
Ich wandte den Blick von ihm ab. „Unmöglich? Nein, unmöglich finde ich es hier nicht. Ich hab nur einfach keine Lust, fünftes Rad am Wagen zu spielen.“
Mein Vater sagte leise, aber heftig: „Du spielst fünftes Rad am Wagen, ja! Wir drängen dich bestimmt nicht in diese Rolle, Kirsty und ich. Aber du sonderst dich ja dauernd ab und tust, als wäre Kirsty deine Todfeindin und ich ihr Verbündeter, nur weil du schlicht und einfach eifersüchtig auf sie bist! Wenn Mutter wüßte . . .“
Ich sprang auf. „Laß Mutter aus dem Spiel!“ sagte ich ebenso leise und noch heftiger. „Du machst es dir verdammt leicht, wenn du denkst, ich wäre nur eifersüchtig! Dann kann ich ebensogut sagen, daß du egoistisch bist! Hauptsache, du bist glücklich. Wie ich mich dabei fühle, ist dir ja ganz egal – wenn ich mich nur höflich und verträglich benehme!“
Zum zweitenmal an diesem Tag war ich den Tränen sehr nahe, und wieder wollte ich es um keinen Preis zeigen. Ich wandte mich ab und ging; nicht ins Haus, sondern durch den verwilderten Garten und über den Pfad zum Wald.
Dann wanderte ich lange durch den Wald und dachte über alles nach. Eine Stimme in meinem Innern klagte mich an, daß ich Vater Unrecht tat. Zugleich aber war ich auch überzeugt, daß mir Unrecht getan wurde, und daß Vater mich wegen einer fremden Frau verraten hatte.
Als ich zurückkam, waren Vater und Kirsty fort und hatten Herrn Alois mitgenommen. Diesmal hatten sie einen Zettel hinterlassen. Sind spazierengegangen, stand in Vaters Schrift auf einem Blatt Papier in der Küche. Essen ist im Kühlschrank.
Ich hatte keinen Hunger. Langsam ging ich ins Mansardenzimmer, zog das karierte Herrenhemd an, das ich im vergangenen Herbst auf dem Flohmarkt gekauft hatte, schlüpfte in meine alten Lieblingsjeans mit den Flicken auf den Knien, bürstete meine Haare und betrachtete mich gründlich im Spiegel, der über der weißen Waschkommode hing.





























