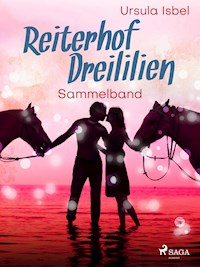Inhaltsverzeichnis
Teil I - Frühlingstage 1830
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Copyright
DIE AUTORIN
Ursula Isbel, 1942 in München geboren, war nach ihrem Modegrafik-Studium und dem Besuch einer Sprachenschule als Lektorin tätig. Mit 27 Jahren hat sie ihren ersten Roman geschrieben, dem viele weitere Erzählungen und Kinder- und Jugendbücher folgten. Heute lebt sie als freie Autorin und Übersetzerin in Staufen bei Freiburg.
Teil I
Frühlingstage 1830
1
Die Dienstboten nannten mich »Sturmkind«, weil ich in einer stürmischen Frühlingsnacht des Jahres 1814 geboren wurde. Ein Schiff geriet in die gefährliche Strömung beim Höllenschlund, der berüchtigten Bucht vor unserer Küste, und zerschellte an den Klippen. Ein Segelschoner lief auf Grund. Viele spanische und portugiesische Seeleute ertranken.
Unsere alte Amme Nanny erzählte oft davon. Sie half bei meiner Geburt und hielt mich als Erste in den Armen.
»Ein ganzes Büschel dunkler Haare hattest du schon auf dem Kopf, während alle anderen Babys, denen ich auf die Welt geholfen habe, fast kahlköpfig waren«, sagte sie. »Hast ausgesehen wie ein Hausgeist, einer von diesen strubbeligen Hobgoblins. Und wolltest einfach nicht schreien, obwohl ich dich ein paarmal mit dem Kopf nach unten durch die Luft geschwenkt habe.«
Mir erschien diese Behandlung grausam. Nanny behauptete, das müsste so sein.
»Babys müssen schreien, sobald sie auf dieser Welt sind, sonst ersticken sie.«
Doch sie wollte nichts darüber sagen, wie so eine Geburt ablief, sooft wir sie auch danach fragten.
»Das werdet ihr noch früh genug erfahren«, sagte sie zu meiner Schwester Chrystobel und mir und verzog ihr breites Gesicht zu einer geheimnisvollen Grimasse, die zugleich komisch und finster wirkte. Ihre graugelben Haare hingen wie Strähnen von Flachs unter der gestärkten Haube hervor.
In der gleichen Sturmnacht wurde auch unsere graue Stute Belle geboren, Iseults und Percivals Tochter. Sie blieb ihr Leben lang unberechenbar wie ein Apriltag. Kein Pferd aus dem Stall meines Vaters hat je so viele Reiter abgeworfen wie sie. Nur bei Papa war sie immer lammfromm und das rettete ihr über Jahre hinweg das Leben.
Wenn einer von uns die Gabe gehabt hätte, in die Zukunft zu sehen, wäre Belle längst nicht mehr im Stall von Windrush Hall gestanden. Doch auch wenn keiner die künftigen Ereignisse voraussehen konnte, machte sich mein Vater wohl bis ans Ende seiner Tage Vorwürfe wegen seiner Sorglosigkeit, was Belle betraf.
Ich selbst ritt Belle nie. Als sie zehn war, brachte sie ein Fohlen zur Welt, das ihr äußerlich aufs Haar glich, ein graues Stutfohlen mit einer weißen Zeichnung auf der Stirn.
Wir nannten sie Melilot. Ich bekam Melilot zum sechzehnten Geburtstag von meinem Vater geschenkt. Nach drei Shetlandponys war sie mein erstes eigenes Reitpferd.
Es war längst klar, dass Melilot und ich zusammengehörten. Schon als Fohlen kam sie an den Weidenzaun, sobald sie mich sah. Und sie wieherte aus ihrer Box, die sie anfangs mit Belle teilte, wenn sie meine Stimme hörte.
Papa hatte es sich nicht nehmen lassen, sie selbst zuzureiten. Er wollte sichergehen, dass ich ein zuverlässiges Pferd bekam, ohne Belles »Grillen«, wie er es nannte. Dabei war seine Sorge unbegründet. Ein sanfteres, gutmütigeres Pferd als meine Melilot konnte es nicht geben und ich habe auch nie ein anderes Pferd so sehr geliebt wie sie.
Helen, meine jüngere Schwester, hatte am Morgen meines Geburtstags einen Kranz aus Gänseblümchen geflochten, der im Frühstückszimmer an meinem Platz lag. Meine fünf Geschwister sangen mir ein Ständchen. Es klang nicht besonders melodisch. Bis auf Chrystobel, die eine schöne, klare Sopranstimme hatte, konnte keiner von uns gut singen. Ich hörte sowieso kaum hin. Ich sah nur das glänzende neue Halfter über meiner Stuhllehne hängen und konnte den Blick nicht davon wenden, während sie mich umringten.
Mama hielt eine feierliche Ansprache. Sie sagte, dass ich jetzt eine junge Dame sei und versuchen müsste, mehr Haltung und Weiblichkeit an den Tag zu legen, das nötige Zartgefühl zu entwickeln, das eine Frau zieren sollte, und mich anmutiger zu bewegen.
»In einem Jahr wirst du in die Gesellschaft eingeführt, Georgina«, sagte sie. Mama war die Einzige in unserer Familie, die mich Georgina nannte. »Ich hoffe sehr, dass du dich bis dahin zu einer würdevollen jungen Dame entwickelt hast, die weiß, was sich schickt. Du musst lernen, dein wildes Temperament zu zügeln.«
Mein Bruder Cedric zwinkerte mir zu. Papa nahm mich in die Arme und drückte mich, dass ich kaum Luft bekam. Ich spähte an seinem Arm vorbei auf das Halfter und hätte am liebsten eine Serie von Luftsprüngen gemacht wie ein Fohlen auf der Frühlingsweide.
»Papa!«, rief ich. »Ich glaube, ich kann es erraten!«
Und er lachte sein polterndes Lachen, gab mich frei, führte mich zu meinem Platz am Tisch und sagte: »Ich will keine langen Reden schwingen, junge Lady. Für mich bist du recht so, wie du bist. Bleib so, werde kein zimperliches Salonpflänzchen, was deine Mutter auch immer sagen mag. Melilot gehört dir. Sie ist von jetzt an dein Pferd, und es gibt keinen, dem ich sie lieber gäbe …«
»… aber versprich, stets im Damensattel zu reiten«, warf Mama ein, während sie sich ans obere Ende des Tisches setzte, sorgsam darauf bedacht, ihr duftiges Batistkleid mit den veilchenblauen Bändern in elegante Falten zu legen.
Zum Glück kamen Crawley und die Mädchen herein, um Tee, Hafergrütze, Fisch, Eier und Schinken zu servieren. So brauchte ich kein Versprechen zu geben, das ich sowieso gebrochen hätte.
Unter dem Tisch kauerten unsere Jagdhunde - die gefleckte Higgelty, Brownie mit den bernsteinfarbenen Augen und Piggelty, der beste aller Hasenjäger. Seit ich denken konnte, beklagte sich Mama darüber, dass die Hunde während der Mahlzeiten im Esszimmer sein durften. Papa aber weigerte sich, sie auszusperren, obwohl er sonst in vielem nachgab, um seine Ruhe zu haben.
Aubrey, der mir gegenübersaß, lächelte mir heimlich zu. Er war mein Lieblingsbruder, fünfzehn Monate älter als ich. Während wir uns zuzwinkerten, fiel mir ein, dass sein Platz bald wieder leer sein würde, denn er musste in einer Woche zurück aufs College nach Oxford.
Der Gedanke war wie eine dunkle Wolke, die für kurze Zeit diesen heiteren, lang ersehnten Tag überschattete. Es gab kaum etwas, was ich nicht getan hätte, um Aubrey hierzubehalten.
»Was machst du für ein finsteres Gesicht, Georgie?«, fragte meine Schwester Chrystobel. »Ich dachte, du freust dich und bist glücklich. Warum packst du nicht endlich deine Geschenke aus?«
Aubreys Päckchen öffnete ich zuerst. Er hatte mir ein Buch mit Gedichten von Wordsworth geschenkt, in feines Leder gebunden, mit Goldbuchstaben, wunderschönen zarten Zeichnungen und bunten Bändern zum Einmerken. Chrystobel hatte Filethandschuhe aus Seidengarn für mich gehäkelt, mit Rüschen an den Handgelenken, hauchzart und perfekt, wie nur sie es konnte. Ich hätte so etwas nie zustande gebracht, auch nicht wenn man mich zehn Jahre lang im Turmzimmer eingesperrt hätte.
Ich umarmte und küsste sie, obwohl ich nicht gern Handschuhe trug, außer im Winter, wenn ich an den Fingern fror. Sie hatte sich solche Mühe gemacht und es war lieb gemeint, das zählte. Mama ließ es sich nicht nehmen, wieder eine kleine Predigt zu halten. Sie ermahnte mich, mir ein Beispiel daran zu nehmen, mit welchem Geschick und welcher Geduld meine Schwester die feinsten Handarbeiten verfertigte.
»Tut mir leid, ich habe eben zwei linke Hände«, sagte ich friedlich.
Ehe Mama richtig in Fahrt kam und sich darüber auslassen konnte, dass das alles eine Frage des Willens und der Bereitschaft sei, weibliche Talente zu entwickeln, mischte sich Aubrey ein.
»Dafür ist Georgie eine ausgezeichnete Reiterin. Ich kenne kein Mädchen, das unerschrockener ist und so gut zu Pferd sitzt wie sie«, sagte er.
Mamas dunkle Augenbrauen hoben sich. »Das sind Fertigkeiten, die bei einem Mann zählen, nicht aber bei einer jungen Frau!«
Papa brummelte begütigend. Ich wusste, er war stolz auf meine Reitkünste und sah die Sache anders als unsere Mutter.
Jetzt begann Emma, unsere Jüngste, die auf ihrem Kinderstühlchen thronte und der Unterhaltung mit großen braunen Augen in dem runden Gesicht aufmerksam gefolgt war, mit dem Löffel Brombeermarmelade auf dem Damasttischtuch zu verteilen. Eines der Dienstmädchen versuchte, ihr den Löffel wegzunehmen, aber was Emma sich in den Kopf gesetzt hatte, gab sie nicht so schnell wieder auf. Sie duckte sich und schwenkte den Löffel durch die Luft. Ein dicker Spritzer Marmelade flog über den Tisch und landete ausgerechnet auf Mamas französischem Batistkleid.
Mama warf dem Dienstmädchen vorwurfsvolle Blicke zu, als wäre es ihre Schuld, dass Emma mit Brombeermarmelade um sich warf. Bridget stammelte eine Entschuldigung. Sie fühlte sich immer für alles verantwortlich, was schiefging, und wurde deshalb auch zum Sündenbock für allerhand Missgeschicke und Fehler.
Ich wünschte, sie hätte sich einmal zur Wehr gesetzt. Sie war klein und dünn und mit ihren fünfzehn Jahren selbst noch ein halbes Kind. Trotzdem musste sie schon täglich mehr als zehn Stunden unter dem strengen Regiment des Butlers und der Hauswirtschafterin schuften.
Im Aufruhr über den Brombeerfleck packte ich meine restlichen Geschenke aus. Zuoberst lag eine Zeichnung meiner Schwester Helen, mit der sie Brownie verewigt hatte. Ich fand, dass der leicht wehmütige Ausdruck in Brownies schnurrbärtigem Gesicht gut getroffen war und versprach, das Bild über meinem Bett aufzuhängen, und Helen wurde vor Freude rot bis an die Haarwurzeln.
Mama hatte mir ein Paar elegante blaue Stiefel aus Ziegenleder geschenkt, die bestimmt der neuesten Mode entsprachen. Ich bedankte mich höflich bei ihr, obwohl ich dachte, dass die engen Stiefel bestimmt verteufelt unbequem waren und nicht für unsere holprigen, steinigen Wege taugten.
Ein Brief von Lance, meinem ältesten Bruder, lag auf dem silbernen Tablett neben meiner Teetasse. Jemand hatte den Umschlag mit Ei bekleckert. Lance war seit fast zwei Monaten bei Freunden in Südengland, die eine bekannte Pferdezucht hatten.
Ich rechnete es ihm hoch an, dass seine Post rechtzeitig zu meinem Geburtstag eingetroffen war. Lance war immer schon der Gewissenhafteste von uns allen gewesen. Er war weder so gut aussehend noch so klug wie Aubrey, und er hatte nicht Cedrics Talent, sich bei allen beliebt zu machen, aber keiner war zuverlässiger als Lance.
»Ich habe kein passendes Geschenk für dich finden können, Schwesterchen«, schrieb er. »Aber ich werde dich zu einer Vorstellung ins Drury-Lane-Theater in London einladen, sobald sich die Gelegenheit dazu ergibt und wenn unsere Eltern einverstanden sind. Du bist ja jetzt sechzehn, also fast erwachsen, und darfst mich bestimmt bald auf einer Reise nach London begleiten. Wir können bei Tante Charlotte wohnen. Sie hat uns doch schon mehrfach eingeladen …«
Ich las seinen Brief vor. Chrystobels Gesicht verdüsterte sich. Sie sagte, wir dürften nicht ohne sie fahren, Tante Charlotte hätte sie ausdrücklich aufgefordert zu kommen. Mama dagegen meinte, so ein Unternehmen wäre unschicklich für zwei junge Damen, die noch nicht in die Gesellschaft eingeführt waren.
»Keinesfalls vor der nächsten Ballsaison!«, verkündete sie. »Dann wird wenigstens Chrystobel in die Gesellschaft eingeführt und ihr beiden Mädchen könnt zusammen mit eurem Bruder nach London reisen.«
Helen schniefte. In ihren Augen standen Tränen.
»Und ich?«, fragte sie mit belegter Stimme. »Von mir redet keiner! Warum vergesst ihr mich immer?«
»Weil man mit dreizehn nicht ins Drury Lane gehen kann«, sagte Cedric. »Außerdem soll es kein Familienausflug werden. Lance hat Georgie eingeladen, es ist sein Geburtstagsgeschenk an sie. Also hör auf zu quaken.«
»Quak, quak, quak!«, echote Emma begeistert und schlug mit ihrem Milchbecher gegen die Kristallschale, in der das Obst lag.
Mama seufzte. »Bridget, bringen Sie das Kind zu Nanny!«, sagte sie. »Ich bekomme Kopfschmerzen. Mein Kleid ist ruiniert. Dabei wollten Lady Trewain und ihre Tochter zu einem Vormittagsbesuch hereinschauen.«
Papa stand hastig auf und wischte sich den Mund mit der Serviette ab. »Du musst mich leider entschuldigen, meine Liebe. Ich habe mit dem Verwalter zu reden, es gibt dringende Geschäfte zu besprechen. Die neuen Weidenzäune müssen aufgestellt werden, die alten verrotten schon an vielen Stellen. Georgie-Kind, treffen wir uns im Stall? Dann können wir Melilot gleich das neue Halfter anlegen.«
Die Hunde kamen unter dem Tisch hervor. Bridget versuchte, Emma aus dem Kinderstuhl zu hieven, aber Emma spreizte ihre dicken krummen Beinchen und drückte den Rücken durch, sodass sie wie ein Widerhaken im Stuhl hing.
»Lass mich, ich mag nicht!«, zeterte sie.
»Ich mag nicht« waren die ersten zusammenhängenden Wörter, die sie gelernt hatte. Mama presste die Fingerspitzen gegen die Schläfen. Chrystobel legte die Arme um Emma und streichelte ihre dunklen Locken.
»Komm, sei lieb! Ich lese dir auch später eine Geschichte vor und wir spielen mit den Murmeln«, sagte sie schmeichelnd.
»Mummeln, o ja, Mummeln!«, jauchzte Emma.
Ich fragte Mama, ob ich aufstehen dürfte. Sie seufzte wieder. »Geh nur, Georgina, aber vergiss deinen Umhang nicht, es weht ein kühler Wind. Und setz eine Haube auf. Für eine junge Frau in deinem Alter schickt es sich nicht mehr, ohne Kopfbedeckung aus dem Haus zu gehen.«
Während ich das Frühstückszimmer verließ, dachte ich, dass ich in jener Sturmnacht vor sechzehn Jahren lieber als Junge zur Welt gekommen wäre, wenn ich die Wahl gehabt hätte.
2
Windrush Hall, das Haus, in dem wir lebten, war ein Herrensitz auf einem Hügel hoch über dem Meer, den mein Urgroßvater Hugh Hamilton erbaut hatte.
Mächtige Bäume, Ziegelsteinmauern und hohe Hecken umgaben das graue Haus zum Schutz vor den rauen Winden und Stürmen, die vom Atlantik über die cornische Küste fegten. Nachts mischte sich das Seufzen der Baumwipfel mit dem Brausen und Klatschen der Brandung zu einer starken, einschläfernden oder wilden, bedrohlichen Melodie.
Neben dem ziemlich düster wirkenden Wohnhaus mit den hohen Fenstern und den gedrehten Kaminen gab es noch die Stallgebäude, die Remise mit den Kutschen, die Glashäuser, das Waschhaus, die Schuppen, in denen die Gärtner arbeiteten und schliefen und ihre Geräte aufbewahrten, und die Gärten und Pferdekoppeln auf der Südseite.
Windrush Hall war eine Welt für sich. Als Kind hatte ich lange geglaubt, dass es außerhalb seiner Gittertore und Mauern nichts sonst gab als das Meer und die felsige, unbewohnte Küste.
Noch waren die Sträucher im Rosengarten kahl und von den Winterstürmen zerzaust. Nur die sorgsam beschnittenen Buchsbäume leuchteten dunkelgrün vor den roten Mauern. Die ersten Narzissen im Rasen unter den Bäumen waren aufgeblüht und schaukelten sacht im Wind. Dunstschwaden schwebten über den Viehweiden, die tiefer lagen als Windrush Hall mit seinen Gärten. Kühe und Schafe bewegten sich langsam wie Geistergestalten darin.
Ich ging am Südflügel des Hauses entlang, durch den steinernen Torbogen mit unserem Familienwappen, einem Schwert und einer Rose, die gekreuzt waren, und über den gepflasterten Pfad zwischen den Eiben.
Tomlins, der Obergärtner, arbeitete mit zwei Gehilfen im Rosengarten. Sie verteilten trockenen Pferdemist in den Beeten. Der junge Stanton mit dem schwarzen Haarschopf band die Ranken einer Kletterrose am Spalier fest. Seine Hände waren zerkratzt und bluteten. Ich wusste, dass Tomlins es nicht duldete, wenn seine Gärtnergehilfen Handschuhe trugen. Er fand, sie hätten dann zu wenig Gefühl in den Fingern, um richtig mit den Pflanzen umzugehen.
Sie grüßten mich ehrerbietig und zogen ihre Mützen vor mir. Jim Stanton verbeugte sich ungeschickt, wobei er fast von der Leiter fiel. Ich wünschte, sie wären nicht so unterwürfig zu mir gewesen, gerade Jim, der im gleichen Alter wie ich war und sehr schüchtern.
Ich blieb kurz stehen und sagte: »Die stechen furchtbar, nicht?«
Jim Stanton wurde rot und kniff die Lippen zusammen.
»Ja nun«, erwiderte Tomlins, »das ist die schöne Albertine, die kratzt und piekst wie eine Horde Wildkatzen. Aber was ein guter Gärtner werden will, der darf nicht zimperlich sein, junge Lady.«
Ich dachte daran, dass vor zwei Jahren ein zwölfjähriger Gärtnerjunge von der Arbeit mit den Rosen und dem Pferdemist Blutvergiftung bekommen hatte und unter großen Schmerzen gestorben war. Rasch ging ich weiter. Der Saum meines Kleides wurde nass vom Gras und wickelte sich um meine Beine und die Schäfte meiner dünnen Lederstiefel.
Drosseln und Rotkehlchen flöteten in den Hecken und Baumwipfeln. Noch waren die Lerchen und Schwalben nicht aus dem Süden zurückgekehrt. In den Duft nach Wasser und Tang und frischem Grün mischte sich der herbe Geruch des Stalles.
Ich liebte diesen würzigen Pferdegeruch, solange ich denken konnte. Jetzt hörte ich sie da drinnen stampfen und prusten, und als ich mich dem Stalltor näherte, begann eine Stute, mit hoher Stimme zu wiehern.
»Melilot!«, rief ich halb laut. »Hallo, meine Schöne! Weißt du, was das heute für ein Tag für uns beide ist?«
Papa hatte das neue Halfter mit in den Stall gebracht. Er stand mit Brewster, dem Stallmeister, vor Melilots Box. Brewster hatte als junger Soldat in der Schlacht gegen Napoleons Truppen ein Bein verloren; er ritt aber trotzdem ausgezeichnet und war ein Zauberkünstler, wenn es um Pferde ging. Von Menschen hielt er sich am liebsten fern.
Als er mich über die Stallgasse kommen sah, tippte er an seine Mütze und murmelte etwas Unverständliches. Dann nahm er seine Mistgabel und verschwand in einer der Boxen, während der jüngste Stallbursche die Tränken säuberte.
Ich streichelte braune, weiße, schwarze und isabellfarbene Stirnen. Jedes unserer Pferde wollte begrüßt und beachtet werden. Bis auf die launische Belle waren sie alle gutmütig und vertrauten uns, denn im Stall von Windrush Hall gab es keine harten Worte und niemals einen Schlag mit der Faust oder der Peitsche. Wenn ein Stallknecht die Pferde grob anfasste, wurde er entlassen, das war ein unumstößlicher Befehl meines Vaters.
In unserem Stall standen drei Ponys und fünfzehn Pferde. Elf davon waren Reitpferde, dazu vier Grauschimmel als Kutschpferde, denn wir hatten eine Reisekutsche, eine Kalesche und zwei leichte, vierrädrige Zweispänner für kurze Fahrten und Ausflüge.
Neben Belle, ihrem Jährling Swan und ihrer Tochter Melilot gab es noch den Wallach Jago und die Stute Juno, Aubreys Wallach Tintin, Cecils braune Bonnie, die zu dick wurde, weil er so selten mit ihr ausritt, Mamas Schimmelstute Fairy und die Jagdpferde meines Vaters, drei an der Zahl.
Als Kinder hatten wir uns gern in der angrenzenden Remise in den Kutschen versteckt, Aubrey und Chrystobel und ich. Am liebsten waren wir in den Ställen zwischen den warmen Körpern der Pferde, ihrem heimeligen Stapfen und Schnauben, dem mahlenden Geräusch ihrer Kiefer, eingehüllt in ihren würzigen Geruch, bis die Erzieherin uns aufspürte und ins Haus holte. Dabei hatte ich es immer ungerecht gefunden, dass Aubrey kaum zurechtgewiesen wurde, wenn er schmutzig und zerzaust war und nach Pferdemist roch. Bei uns Mädchen aber folgten lange Strafpredigten.
»Wie kann man nur so ungepflegt herumlaufen? Ställe und Remisen sind keine Aufenthaltsorte für angehende junge Ladys! Habt ihr euer Klavierstück schon geübt? Und Miss Georgina ist mit ihrer Nadelarbeit noch immer nicht weitergekommen.«
»Pudel« nannten wir unsere Erzieherin, Miss Powdle. Ich musste an sie denken, als ich sah, wie sich der nasse Saum meines Kleides vom Pferdemist braun färbte.
Papa hatte Melilot das neue Halfter angelegt, es glänzte dunkel in ihrer grauen Mähne. Sie hatte den Kopf gereckt und die Ohren gespitzt. Mit ihren sanften, schimmernden Augen sah sie mich an, scharrte mit dem Vorderhuf und blies mir ihren warmen Atem ins Gesicht, als ich die Arme um ihren Hals schlang.
Papa sagte: »Du trägst ja noch keine Reitkleidung! Eigentlich wollte ich zur Feier deines Geburtstags mit dir ausreiten, aber der Verwalter erwartet mich gegen elf, und eben habe ich den Jagdaufseher getroffen. Im Wald ist ein Wilderer unterwegs. Man hat Fallen gefunden. In einer saß eine Füchsin fest.«
»Eine Füchsin?« Erschrocken sah ich ihn an, während Melilot am Samtkragen meines Umhangs knabberte. »Aber die Füchse haben jetzt ihre Jungen! Wenn die Füchsin irgendwo Welpen in einem Bau hatte, müssen sie elend verhungern!«
Papa nickte grimmig. »Wenn wir den Kerl finden, dann gnade ihm Gott!« Und im Weggehen fügte er hinzu: »Reite nicht allein aus, nimm Aubrey oder Cedric mit. Es könnte sein, dass der Wilddieb sich irgendwo auf unserem Grund herumtreibt. Vielleicht hat er eine Schusswaffe. Solchen Leuten ist nicht zu trauen. Wer grausam zu Tieren ist, ist auch grausam zu Menschen.«
Ich gab Melilot zwei von den Haferplätzchen, die ich beim Frühstück eingesteckt hatte. Die Stallburschen stritten leise, aber erbittert im Durchgang zur Sattelkammer. Dann tauchte Aubrey auf, in seiner karierten Reithose, der Jacke aus Samt und mit einem blütenweißen, kunstvoll geschlungenen Halstuch.
Wie gut er aussieht mit seinen grauen Augen, der schmalen Nase und den dunklen Augenbrauen!, dachte ich. Sein Gesicht war eine Spur zu lang, weshalb Cedric ihn manchmal »Pferdegesicht« nannte, wenn er wütend auf ihn war. Aber seine Züge waren fein und edel, fast wie die einer Frau. Seine wilden dunklen Locken zogen stets die Blicke der Mädchen auf sich und erregten den Neid seiner Freunde, die sich abmühten, ihre strähnigen Haare in griechische Locken nach dem Vorbild des bewunderten Dichters Lord Byron zu frisieren.
Aubrey selbst schien nicht zu wissen, wie anziehend er war. Das machte ihn in meinen Augen nur noch liebenswerter.
»Wieso bist du nicht umgezogen?«, fragte er.
»Es dauert nicht lange, wart auf mich. Bis Tintin und Melilot gesattelt und aufgezäumt sind, bin ich fertig.«
Er lächelte. »Ich kenne kein Mädchen, das so schnell umgezogen ist und so wenig Aufhebens um Kleidung macht wie du.«
Ein Labyrinth von Gängen und Stufen, dunklen Seitenfluren und Treppenabsätzen mit zahllosen Türen führte von der östlichen Pforte zum Mittelteil des Hauses. Durch die bleiverglasten Fenster sickerte dämmriges Licht und ließ die Ecken und Winkel im Dunkeln. Es roch nach Staub und Moder, nach Bienenwachs und Lavendel.
Hier hatte ich mich früher so manches Mal verirrt und keinen anderen Ausweg gewusst, als eine der Türen zu öffnen, hinter denen unbewohnte Räume mit verhängten Möbeln und schwarzen Kaminöffnungen waren. Dann blieb mir nichts anderes übrig, als an einem Klingelzug zu ziehen, damit ein Dienstmädchen kam und mich rettete.
»Da hausen die Gespenster!«, hatte Nanny immer geflüstert. »Die Geister der Leute, die früher hier gewohnt haben. Sie stehen hinter den Türen und lauschen und sehen dich mit ihren toten Augen an, wenn du vorbeigehst …«
Mein Umhang blieb an einer Türklinke hängen. Ein Schauder überlief mich, als hätte eine Hand aus dem Halbdunkel nach mir gegriffen. Ich riss mich los, rannte die Wendeltreppe hinauf und ärgerte mich über mich selbst, dass ich mit sechzehn Jahren so ängstlich und abergläubisch war. Doch die alten Spukgeschichten, die Nanny uns vor dem Einschlafen wispernd erzählt hatte, saßen tief.
Hastig zog ich mich um. Während ich in den langen schwarzen Rock schlüpfte, wünschte ich mir wieder einmal, wie meine Brüder Hosen tragen zu dürfen. Sie waren beim Reiten so viel praktischer und erforderten keine schwierigen umständlichen Verrenkungen beim Aufsitzen.
Mit ungeduldigen Fingern schloss ich die Knöpfe an meinem Jackett. Dabei hörte ich, wie sich jemand über den Flur näherte. Es war Jane, Mamas Zofe. Ich erkannte sie am Schnaufen, mit dem sie die Treppe heraufkam, und am eiligen Klappern ihrer Absätze.
Der Vormittagsbesuch!, dachte ich. Sie soll mich holen, damit ich bei Mama bin, wenn die langweiligen, spitznasigen Ladys von Trewain ihre Aufwartung machen!
Blitzschnell schlüpfte ich in den Wandschrank und zog die Tür von innen zu. Sekunden später erklang heftiges Klopfen. Ich lauschte in die Dunkelheit, zwischen die Kleider gepresst, und hielt mir die Nase zu, weil mich der Duft der Lavendelsäckchen zum Niesen reizte.
Janes Stimme war schrill. »Miss Georgina, sind Sie hier? Ihre Ladyschaft hat mich geschickt, Sie in den Blauen Salon zu holen. Der Besuch ist eben gekommen … Miss Georgina!!«
Ich hörte sie husten und etwas murmeln. Dann klappte zu meiner Erleichterung die Zimmertür.
Nach einer Weile, als ich sicher sein konnte, dass die Luft rein war, verließ ich auf Strümpfen mein Zimmer. Ich nahm die schwarzen Schnürstiefel in die Hand und schlich durch das Labyrinth der Gänge und Treppen zur östlichen Pforte zurück.
3
Der Stallmeister hatte Melilot und Tintin ins Freie geführt. Er stand fest auf seinem einen Bein und hielt die unruhig tänzelnden Pferde am Zügel. Mit geblähten Nüstern atmeten sie die prickelnde Frühlingsluft ein. Die Hunde waren bei Aubrey, sprangen mir entgegen und jaulten und hechelten in aufgeregter Erwartung.
Ich ritt nicht im Damensattel, wie sich das für eine junge Dame von Stand gehört hätte. Zum Glück kümmerten Aubrey solche Vorschriften nicht. Und Mama konnte mich nicht sehen, denn der Blaue Salon war auf der Vorderseite des Hauses. Falls uns allerdings Miss Powdle erspähte, bei der Chrystobel und Helen gerade Geschichtsunterricht bekamen, musste ich mich auf eine lange und öde Predigt gefasst machen.
»Teuflisch unpraktisch, diese Röcke«, sagte Aubrey, als er mir beim Aufsitzen half. »Ob es euch Frauen je erlaubt sein wird, Hosen zu tragen - wenigstens beim Reiten?«
Ich seufzte. »Wohl kaum. Kürzlich hab ich im Punch gelesen, dass es einen furchtbaren Aufruhr gab, als eine adelige Dame in Hosen zu einer Reitjagd kam. Eine Zeichnung war auch dabei. Natürlich haben sie sich alle Mühe gegeben, sie lächerlich aussehen zu lassen. Aber ich weiß nicht, warum sich die Leute so aufgeregt haben. Die Hose war ganz weit geschnitten, nicht wie die Beinkleider, die ihr Männer tragt. Man sah eigentlich kaum, dass es kein Rock war.«
Aubrey saß mit einer Anmut auf seinem Wallach, die ihm wohl selbst nicht bewusst war. Wieder einmal dachte ich, dass er Stil und Klasse hatte, ohne es darauf anzulegen. Andere strengten sich an, lässig und elegant zu wirken, und machten dabei doch immer nur einen affigen Eindruck.
Die Dunstschleier hatten sich aufgelöst. Blassblau und klar wölbte sich der Himmel über der Küste. Nur in der Ferne segelten ein paar dicke Wolken im Wind. Wir ritten den Hügelpfad hinunter, der auf einer Seite von hohen, streng beschnittenen Eibenhecken gesäumt war, auf der anderen von Weißdornbüschen und windzerzausten Apfelbäumen.
In das Schmatzen und Murmeln der Wellen tief unten zwischen den felsigen Buchten mischte sich der helle Hufschlag unserer Pferde. Die Hunde sprangen vor uns her, verschwanden im Gebüsch und tauchten wieder auf, die Nasen dicht am Boden, mit wedelnden Schwänzen und fliegenden Ohren.
Aubrey sang leise vor sich hin. Er hatte keine besonders schöne Stimme, aber ich hörte ihm gern zu. Mein Bruder kannte viele der alten Lieder, die die einfachen Leute hier an der Küste sangen. Die meisten handelten vom Meer, seinen Stürmen und Gefahren, von Seeleuten, die nicht wiederkehrten, und Mädchen, die vergebens auf sie warteten. Doch es waren auch Liebeslieder dabei wie das von Aura Lee, dem Mädchen mit den goldenen Haaren.
Wie wunderbar hier die Luft war - klar und rein, prickelnd und voll würziger Gerüche. Hoch über uns zog ein Seeadler seine Kreise und ließ sich von der Strömung tragen. Die wilden Apfelbäume hatten schon dicke Knospen, die Schlehdornbüsche waren von weißen Blütenschleiern überzogen.
Ein schöneres Land als das unsere konnte es nicht geben, auch wenn die Winter rau und stürmisch waren und die Sommer kurz, mit ständigem Wind, häufigem Regen und blauschwarzen Wolkengebirgen, die unversehens aufzogen und die Gärten und Weiden und Klippenpfade in düsteres Licht tauchten.
»Aura Lee, Aura Lee, Maid of golden hair,Sunshine came along with theeand swallows in the air«,
sang Aubrey. Ich summte mit, ganz leise nur, denn ich fand meine Stimme so hässlich, dass ich fürchtete, ich könnte die Pferde erschrecken.
Als wir den Fuß des Hügels erreicht hatten, auf dem Windrush Hall stand, verbreiterte sich der Pfad, und wir konnten nebeneinanderreiten. Melilot und Tintin fielen in leichten Trab. Wie immer freute ich mich über die Bewegungen meines Pferdes. Es war, als fände Melilots Rhythmus ein Echo in meinem Körper, sodass wir für kurze Zeit zu einer Einheit verschmolzen.
Ich hatte nie Schwierigkeiten beim Reiten gehabt. Schon im Alter von vier Jahren, als Papa mich zum ersten Mal auf den Rücken eines Ponys setzte, hatte ich mich zu seiner Freude nicht einen Augenblick lang gefürchtet. Chrystobel dagegen hatte sich schreiend gewehrt, und Cedric war so oft vom Pferd gefallen, dass Papa ihn halb scherzhaft, halb zornig einen »Wechselbalg« nannte. Erst nach langem Forschen und Fragen erfuhr ich, was sich hinter dem geheimnisvollen Wort verbarg: ein fremdes Kind, das seinen Eltern untergeschoben wird.
Der Wind wirbelte mir die Haare ins Gesicht. Auch hier missachtete ich wieder eine Vorschrift, denn Mama und Miss Powdle hatten uns Mädchen eingeschärft, das Haus nie ohne Kopfbedeckung zu verlassen. Einen Reithut zu tragen, war allerdings in unserer Gegend wegen des ständigen Windes schwierig. So sollten wir über dem Hut noch einen dünnen Schal tragen und ihn unter dem Kinn zubinden.
Doch ich kannte nichts Schöneres, als den Wind in meinen Haaren zu spüren. Wenn ich gekonnt hätte, wäre ich auch ohne Sattel geritten, in einer engen Hose, wie Aubrey sie trug.
Mein Bruder erzählte von Oxford, dem ehrwürdigen alten Trinity-College, in dem er lebte und Rechtswissenschaft studierte.
»Du weißt nicht, was für ein Glück du hast, dass du studieren darfst«, sagte ich. »Ich beneide dich so! Wie gern würde ich mit dir nach Oxford gehen. Dann wäre ich in ein paar Jahren unabhängig und könnte frei entscheiden, wie ich leben will. Es ist so ungerecht - dass wir Frauen gezwungen sind zu heiraten, nur weil es keine anderen Möglichkeiten für uns gibt.«
»Du könntest Gouvernante werden, so wie Pudel.« Jetzt stand ein Lachen in Aubreys Augen.
»Du nimmst mich nicht ernst! Du weißt genau, was das für ein armseliges Dasein ist. Bei irgendwelchen hochnäsigen Leuten für einen Hungerlohn freche, aufsässige Gören unterrichten und erziehen zu müssen. Denk bloß an die üblen Streiche, die wir der armen Pudel gespielt haben. Manchmal war sie den Tränen nahe. Ich kriege ein richtig schlechtes Gewissen, weil wir ihr das Leben oft so schwer gemacht haben.«
»Sie hat es herausgefordert, weil sie so steif und sauertöpfisch ist«, behauptete Aubrey. »Und sie mag im Grunde keine Kinder. Das haben wir gespürt und uns dafür gerächt. Aber du hast es doch nicht nötig, Gouvernante zu werden, Georgie. Du wirst heiraten, was ist daran so schlimm? Und wenn nicht, kannst du bei einem von uns leben - bei mir oder bei Chrystobel, falls sie eine eigene Familie hat, oder bei Lance …«
»Herzlichen Dank!«, sagte ich. »Als alte Jungfer in der Familie eines Bruders oder einer Schwester geduldet zu werden, das ist auch nicht meine Vorstellung vom Leben. Und du weißt genau, dass es alles andere als schön ist, einen Mann heiraten zu müssen, den die Eltern für einen aussuchen, den man vielleicht überhaupt nicht mag. Und der dann über einen verfügen kann, als wäre man ein Hund oder ein Pferd … Denn wir Frauen sind doch erst der Besitz unserer Väter und später gehören wir unserem Mann. Wir können und dürfen nicht frei sein!«
»Eines Tages wird sich das vielleicht ändern.« Aubrey war jetzt ernst geworden.
»Ja, eines fernen Tages vielleicht, aber dann bin ich längst alt und grau oder gestorben. Was nützt mir das schon?«
»Möglicherweise werde ich Privatgelehrter und du führst mir den Haushalt. Dann werden wir zwei komische alte Käuze«, sagte er halb im Scherz, streckte die Hand aus und berührte die meine. »Würde dir das nicht gefallen? Und jetzt hör auf mit der Grübelei, du verdirbst dir nur deinen Geburtstag. Keiner kann wissen, was morgen sein wird …«
Wie recht Aubrey mit dieser Bemerkung hatte, wurde mir erst später bewusst. Langsam ritten wir auf dem Klippenpfad zwischen Ginsterbüschen und Brombeerranken dahin. Der Weg war steinig. Er schlängelte sich an Felsbrocken vorbei und führte ständig steil bergab und bergauf. Immer wieder öffnete sich der Blick auf kleine Buchten mit schroffen Klippen, die aus dem Wasser ragten, und auf sandige Uferstellen, die in der Sonne glitzerten.
Auf dem höchsten Punkt der Klippen machten wir Halt, stiegen ab und ließen die Pferde grasen. Die Hunde jagten kläffend hinter einer Schar Möwen her. Der Wind zerrte an meinem Rock und wirbelte Aubreys Locken durcheinander.
Er spähte aufs Meer hinaus und sagte: »Immer wenn ich hier stehe und auf die Höllenschlund-Bucht schaue, muss ich an Nannys düstere Geschichten von den ertrunkenen Seeleuten denken, die auf dem Meeresgrund liegen und nicht zur Ruhe kommen, weil sie nicht in geweihter Erde begraben sind.«
Vor Hell’s Mouth, der Höllenschlund-Bucht, waren im Laufe der Jahrhunderte viele Segelschiffe bei Sturm in tückische Strömungen geraten oder gegen die Riffe geprallt.
»Und sie hat immer behauptet, dass man sie nachts oft rufen hört«, fügte ich hinzu. »Wenn ich im Turmzimmer aufgewacht bin und Geräusche gehört habe, die ich nicht einordnen konnte, dachte ich: Das sind die armen toten Seeleute. Dann hab ich mir die Decke über den Kopf gezogen und die Ohren zugehalten.«
»Wenn Papa gewusst hätte, was Nanny uns für Schauergeschichten erzählt, hätte er sie bestimmt längst vor die Tür gesetzt.«
cbt - C. Bertelsmann Taschenbuch Der Taschenbuchverlag für Jugendliche in der Verlagsgruppe Random House
Verlagsgruppe Random House
1. Auflage
Originalausgabe November 2008
Gesetzt nach den Regeln der Rechtschreibreform
© 2008 cbt/cbj Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Alle Rechte vorbehalten Umschlagfoto: Corbis (Landschaft); Getty Images (Mädchen) Umschlagkonzeption: Zeichenpool, München SE · Herstellung: ReD
eISBN : 978-3-641-02432-1
www.cbt-jugendbuch.de
Leseprobe
www.randomhouse.de