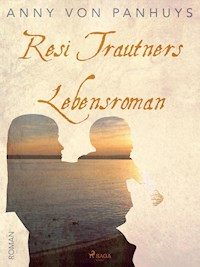
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Frau Doris Faber ist nach dem Tod ihres Kindes unglücklich und verzweifelt. Dr. Ernstmann rät ihrem Mann, zur Erholung mit Doris an den Bodensee zu fahren, und trägt ihm auf, dem Wirtshaus zum Paradies in Konstanz, wo er dereinst mit seiner Frau glücklich berauscht gewesen ist, einen Gruß und Besuch abzustatten. Doch das Wirtshaus ist inzwischen zur üblen Spelunke abgestiegen, und das Paar erlebt mit, wie ein betrunkener Vater seine kleine Tochter misshandelt und hinauswirft. In einer plötzlichen Regung umarmt Doris das Kind aus ärmlichsten Verhältnissen und will es sogleich an Kindes statt annehmen. Die Mutter ist empört, der betrunkene Vater zeigt sich gegen Zahlung von tausend Mark jedoch gerne bereit, und die beiden werden rasch handelseinig. Doch der gesellschaftliche Aufstieg ist für Therese Trautner, genannt Resi, kein glücklicher Traum. Zehn Jahre alt geworden, bemerkt sie, dass ihre vermeintlichen Eltern gar nicht ihre leiblichen Eltern sind, und muss außerdem erfahren, dass ihre Mutter Doris ihr die zweite, leibliche Tochter bei weitem vorzieht – was Stiefschwester Erna die arme Resi auch deutlich merken lässt. Als sie schließlich in eine für ihren Vater höchst vorteilhafte Ehe mit einem ungeliebten Mann gedrängt und ein zweites Mal in ihrem Leben wie eine Ware verhökert werden soll, hat Resi genug. Sie verlässt das Elternhaus und wird Gesellschafterin bei der gütigen Frau Margret von Sluiten. Schwester Erna wiederum schließt eine unglückliche Ehe mit Dr. Ernstmanns Sohn Martin. Als Resi und Martin sich kennenlernen, bemerken sie, dass sie wiederum einander nicht völlig gleichgültig sind ... Bei alledem gibt Resi die Suche nach ihrer verlorenen leiblichen Mutter nicht auf. Doch auch Frau von Sluiten, die in den Niederlanden verheiratete, reich gewordene Deutsche, ist auf der Suche, denn sie umgibt ein tragisch scheinendes Geheimnis ... Resis Lebensroman ist ein gefühlvoller, zu Herzen gehender Lebens-, Liebes- und Schicksalsroman, wie ihn nur eine Anny von Panhuys zu schreiben vermochte!-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 313
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Anny von Panhuys
Resi Trautners Lebensroman
Roman
Saga
Resi Trautners Lebensroman
© 1924 Anny von Panhuys
Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2016 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen
All rights reserved
ISBN: 9788711570319
1. Ebook-Auflage, 2017
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt und Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com – a part of Egmont, www.egmont.com
I.
Frau Doris Faber beweinte ihr totes Kindchen, ihr blondes, süsses, zweijähriges Mädelchen. Ihr feines Gesichtchen hob sich von Tag zu Tag schmaler und blasser aus dem schwarzen Tüllgefältel der Halsrüsche, den stumpfen Kreppschleiern, die schwer und lastend von dem kleinen Hut niederfielen.
Doch reizvoll war die blutjunge Doris Faber auch in ihrer Trauer, unendlich reizvoll. Aber ihrem Manne schnitt der Anblick der immer bleicher werdenden geliebten Frau ins Herz, und er sann auf Mittel und Wege, Doris zu zerstreuen, ihre trüben Gedanken abzulenken, ihren Wangen die Rosenfarbe zurückzugeben.
Er besprach sich mit dem Arzt.
Der schlug eine Reise vor, eine weite Reise in eine Natur die anders, ganz anders war als die der Mark Brandenburg.
„Gehen Sie an den Bodensee, in den Schwarzwald, reisen Sie ein paar Wochen herum, lieber Freund,“ riet er, „Ihr Frauchen ist, wie Sie sagen, aus dem Flachland noch nicht herausgekommen, zeigen Sie ihr ein Stückchen unserer schönsten deutschen Heimat. Am Bodensee grüssen die schimmernden Alpen aus der Schweiz herüber, gewichtig und ernst grüssen dort die Vorarlsberge Oesterreichs, die Schwarzwaldtannen wollen den Himmel stürmen, und von den Bergen jagen Wildbäche in schäumendem, rasenden Lauf zu Tal.“
Die Züge Dr. Ernstmanns strahlten. „Hab’ vor dreissig Jahren meine Hochzeitsreise dorthin gemacht. Herrlich war es, göttlich schön.“ Er seufzte. „Seither hat’s nicht mehr gelangt, das liebe Geld, so weit fortzugehen. Söhne kosten zuviel.“ Sein Gesicht hellte sich auf. „Aber die Erinnerung, die haftet und steigt empor, wenn der graue Alltag in unserem lieben, engen märkischen Städtchen mich wie dichter Nebel einzwängt, dass ich gleich vielen meiner lieben Mitbürger nicht weiter vor mich sehen kann, als meine Nase lang ist. Ja, dann steigt sie empor, die Erinnerung, und zieht in farbenprächtigen Bildern an mir vorüber und“ — er lachte plötzlich — „und ich sehe alles, alles wieder so lebendig vor mir wie damals auf meiner Hochzeitsreise. Ich bin vielleicht zu bescheiden, dass ich mit der Erinnerung im Herzen noch heute glücklich bin, aber ich bin’s.“
Er legte Gustav Faber die Hand auf die Schulter. „Sehen Sie, Verehrtester, wenn ich manchmal des Abends ein ruhiges Stündchen mit meiner Frau zusammensitze, und sie redet mir zuviel von den teuren Fleischpreisen und der Dienstbotennot, dann brauche ich nur ein paar Worte zu sagen, nur den leisen Anschlag bringen: Weisst du noch? Dann wird aus meiner behäbigen, grauhaarigen Frau ein junges, dunkellockiges Weibchen, Reisezauber umspinnt uns beide, und wir wandern über Berg und Tal oder fahren über den gleissenden, tiefen Bodensee, sehen Firnen glühen und vergessen unsre Alltagsnot. Und deshalb, lieber Faber, folgen Sie meinem Rat, ziehen Sie mit Ihrem trauernden Frauchen in die wundervolle Gotteswelt hinaus, gönnen Sie ihr und sich die Reise, ich denke und hoffe, draussen wird die kleine Frau gesund.“
Gustav Faber blickte nachdenklich vor sich hin. „Ich bin durchaus kein reicher Mann, Herr Doktor, wenn wir auch ein paar tausend Mark liegen haben, ein Maschineningenieur —“
Er konnte nicht weitersprechen, denn der Doktor unterbrach ihn ziemlich schroff: „Haben Sie Ihre Frau lieb oder nicht?“
Der andere nickte bestürzt. „Aber gewiss, Herr Doktor, sehr, sehr lieb sogar.“
Dr. Ernstmann putzte seinen Kneifer, setzte ihn energisch auf und blitzte den Ingenieur durch die scharfen Gläser an. „Na also, was wollen Sie weiter? Können Sie dann überhaupt noch zögern, wenn Ihnen die Möglichkeit winkt, Ihre Frau aus dem Schmerz herauszureissen, dem ihre zarte Gesundheit auf die Dauer nicht gewachsen ist?“ Er schnippte mit den Fingern. „Meinetwegen reisen Sie wo anders hin. Thüringen und Harz sind näher, auch die Sächsische Schweiz, ich kann Ihnen keine Vorschriften machen. Ich aber an Ihrer Stelle wäre leichtsinnig, es sollte mir in diesem Falle auf etwas mehr oder weniger Geld nicht ankommen. Ich verspreche mir etwas von der Reise, die ich Ihnen vorgeschlagen, für Ihre Frau. Jedenfalls Medikamente helfen nichts, das Gemüt ist krank, da nützen weder Pillen noch Salben.“
Gustav Faber war plötzlich mit sich im Reinen, der behäbige Doktor hatte recht, er wollte seinem Rat folgen. Herzlich drückte er dem Aelteren die Hand.
Der Doktor hielt die Hand einen Augenblick fest. „Ich werde Ihnen die Reise, wie sie am vorteilhaftesten für Sie ist, aufschreiben, dafür müssen Sie mir aber unterwegs einen Gruss ausrichten.“
Faber verneigte sich. „Gerne, Herr Doktor, wen darf ich von Ihnen grüssen?“
Der Aeltere lächelte versonnen. „Es ist keine Person, der mein Gruss gilt, sondern es ist eine kleine Weinkneipe, tief drinnen im Gewinkel von Konstanz’ alten Gassen. Der Zufall führte mich mit meinem jungen Frauchen damals dorthin, und wir tranken uns einen seligsüssen Rausch an Dürkheimer Feuerberg.“ Sein Lächeln vertiefte sich. „Auch mein Frauchen hatte einen Schwips, und als wir Arm in Arm die kleine Schenke verliessen, da winkten wir zurück: Auf Wiedersehen!“ Er unterdrückte ein tiefes Atemholen. „Aus dem Wiedersehen wird nichts, bestellen Sie deshalb meinen Gruss. Das Wirtshausschild trug die Aufschrift: ‚Weinstube zum Paradiesgarten‘. Grüssen Sie das Häuschen und trinken Sie dort Dürkheimer Feuerberg.“
Faber lächelte. „Ich werde Ihre Grüsse ausrichten, Herr Doktor, ganz bestimmt werde ich es tun.“
Frau Doris wollte anfangs nichts von einer Reise wissen, aber allmählich liess sie sich umstimmen, und nachdem ihr Mann Urlaub erhalten, wurde die Fahrt angetreten. Unterwegs bezeigte Frau Doris wenig Interesse, wohl wurden ihre Augen heller, zeigten Staunen und Bewunderung, als sie neben dem Gatten mit der Höllentalbahn durch den sich eben herbstlich färbenden Schwarzwald fuhr, aber dann versank sie wieder in ihre alte düstere Schwermut.
Faber jedoch genoss bis ins tiefste Herz, was die Gotteswelt hier in verschwenderischer Fülle bot. Er war ein Kind der Mark, wie seine Frau, und die enge Heimat hatte ihm bisher ebenso wie ihr genügen müssen. Als Sohn einfacher Leute wusste er den Wert des Geldes zu schätzen, und Reisen war teuer.
Seine Blicke nahmen innig in sich auf, was da draussen an ihm an Naturschönheit vorüberzog, und er versuchte immer wieder aufs neue, Doris zu begeistern.
Hoch oben fuhr der Zug, und tief drunten lagen die einsamen Gehöfte. Stille, verträumte Schwarzwaldhäuser, niedrig und breit, fast erdrückt von dem weit heruntergehenden Dach. Eine Mühle, um deren Rad weissschäumend die Wasser sprangen, tauchte auf, und noch im leuchtendsten Sommergrün prangende Wiesen, darauf saubere Kühe weideten. Das Läuten ihrer abgestimmten Glocken klang melodisch und traut durch die offenen Fenster des Eisenbahnwagens.
„Ist es nicht schön hier, Liebste?“
Faber nahm sanft die Hand seiner jungen Frau, die durchsichtig weiss auf dem kreppumrandeten Kleiderrock lag.
Sie lächelte traurig. „Ich möchte dir so gern ein frohes Gesicht zeigen, aber ich kann es nicht, unaufhörlich muss ich an Klein-Lisi denken, die in der dunklen Erde liegt. Ich sehne mich nach ihrem Grab.“
Den Mann durchschauerte es. Immer und immer Klein-Lisi, überall drängte sich das tote Mädelchen vor, hemmte ihm jedes freie Aufatmen und machte seine junge, früher so lustige Frau zur Sklavin.
War auch diese Reise umsonst, hatte sich Dr. Ernstmann mit seiner Hoffnung doch getäuscht?
Still und gedrückt reisten beide weiter.
Sie machten öfter Rast und waren doch ruhelos überall. Wohin sie auch kamen, die tote Klein-Lisi war stets in ihrer Mitte. Wenn Doris ein kleines Mädelchen umherspringen sah, dann wurden ihre Augen wehmutsgetrübt.
Sie standen beide Arm in Arm auf dem Hohentwiel, und ihnen zu Füssen lag die Welt des Hegaus. Der Mann beschwor alte Zeiten herauf, erzählte von der jungen Schwabenherzogin Hadwig, die einst hier gelebt, und der Zauber der Vergangenheit, der den Hohentwiel umwehte, ward lebendiger mit jedem Wort.
Aber Doris hörte kaum, was der Mann sprach, ihre Sehnsucht wollte nicht geschichtliche Vergangenheit, ihre Sehnsucht suchte ihr totes Kind, dessen Geist sie überall umschwebte. Ein Gräblein auf einem engen märkischen Friedhof, gekrönt von einem Zypressenbäumchen, war das Ziel ihres ständigen Denkens.
Der Mann drang mit zärtlichen Bitten in sie, das höchste, was ihm dafür ward, war ein verlorenes, müdes Lächeln, das zerquält verflatterte, ein kurzer Satz, der wie wehes Weinen klang und verhauchte wie leiser Geigenton.
Da stöhnte der Mann heimlich und haderte mit dem Geschick. Wie glücklich war er gewesen, ehe Klein-Lisi starb, nun aber trug er schwere Bürde; der Gedanke, seine Doris, sein geliebtes, blutjunges Weib könne dem Kinde vielleicht eines Tages in das Land nachfolgen, daraus es keine Heimkehr mehr gab, lastete immer drückender auf ihm.
So erreichten die beiden Konstanz, die alle Stadt am Bodensee.
Doris sah blasser als je aus, und eines Morgens bat sie bewegt: „Lass uns heimreisen, Liebster, ich finde ja doch nirgends Frieden. In der Nacht habe ich von Lisi geträumt, und sie blickte mich mit gefalteten Händchen an und sagte: Böse Mutti, weshalb gingst du so weit weg von deinem Kind, ich warte immer und immer auf dich in meinem Grabe.“
Gustav Faber umschlang die Frau eng und zärtlich. „Doris, du darfst dich nicht zu weit verlieren, sonst werden wir beide unglücklich, und das würde unser Kindchen sicher nicht wollen. Denke daran, was dir der Pfarrer gesagt.“
Doris lachte gequält. „Ich weiss, ich weiss: Der Herr hat’s gegeben, der Herr hat’s genommen, der Name des Herrn sei gelobt! Es klingt gut, aber mein Herz ist davon nicht leichter geworden.“
Der Mann strich über die weichen, blonden Frauenhaare: „Sei verständig, Doris, füge dich dem Schicksal, tausend Mütter müssen es tragen.“
Sie antwortete nicht, aber in ihren Augen stand die stumme Bitte: „Schweige, ich leide schwerer als tausend Mütter, schweige!“
Er schlug eine Wanderung durch Konstanz vor, die alten Gassen mit ihren krummen Häusern, das Münster und das alte Kaufhaus am See lockten ihn. Und dann ging er mit der schwarzgekleideten Frau durch das Gewirr der Gässchen. Er suchte die Schenke „Zum Paradiesgarten“, um ihr des alten Doktors Gruss zu bringen.
Plötzlich blieb er stehen, ein altes Wirtschaftsbild hatte seine Aufmerksamkeit erregt. „Zum Paradiesgarten“ stand darauf.
Die Buchstaben waren vom Regen verwaschen, von der Sonne gebleicht, kaum noch lesbar, aber Faber hatte sie doch entziffert. Hier also sollte er den Gruss bestellen, dem alten, schmutzigen, windschiefen Häuschen einen Gruss bestellen von einem, der in einem märkischen Städtchen ein braver Bierphilister geworden und sich hier einmal einen seligen, unvergessenen Rausch auf der Hochzeitsreise angetrunken. Ein närrischer Wunsch des alten Doktors.
Er lächelte und erzählte ihn Doris.
Auch ihre Lippen umspielte ein Lächeln. „Wahrlich, ein närrischer Wunsch.“
„Wollen wir ein Glas Wein dadrinnen trinken?“ fragte der Mann.
Doris verneinte hastig. „Es ist eine elende Spelunke, wir passen nicht dahinein.“
Faber musste ihr recht geben.
Vor langen Jahren mochte die Wirtschaft „Zum Paradiesgarten“ sich wohl gefälliger präsentiert haben als heute. Eben wollte er den Schritt wenden, da schrie Doris auf, ein grosser, brutal aussehender Mensch war im Rahmen der Wirtschaftstür erschienen und stiess ein kleines Mädchen roh hinaus.
„Elendes Wurm, such’ dir Brot auf der Gasse und friss mir nicht das beste weg!“
Das Kind stürzte zu Boden, und Doris eilte auf das weinende Geschöpfchen zu, das sich ganz in sich zusammenduckte.
Der rohe Mensch war verschwunden, und Doris nahm das Kind unendlich zart und vorsichtig empor.
„Sieh doch, Liebster, es hat Augen wie Klein-Lisi hatte, und so blonde Löckchen wie sie.“
Wahrhaftig, das Kind sah Klein-Lisi ähnlich, schien es Faber, nur war es schmutzig angezogen, und das tränenüberströmte Gesichtchen zeigte sich nicht gerade vorteilhaft.
Ein junges, ärmlich gekleidetes, sehr schlankes Weib mit schönem, aber verhärmtem Gesicht trat bescheiden heran.
„Ich danke Ihnen, gnädige Frau, dass Sie so gut zu meiner Kleinen sind. Mein Mann ist wieder einmal betrunken, und dann darf sich das Kind nicht vor ihm sehen lassen —“ sie zögerte, „sonst ist er aber seelensgut.“
Faber sah Doris an. Das arme junge Weib log wohl aus Liebe, denn seelensgut war der brutale Mensch von vorhin sicherlich niemals.
Aber das ging sie beide auch nichts an.
Er sagte: „Sie dürfen keinesfalls dulden, dass Ihr Mann so entsetzlich roh zu der Kleinen ist.“
Die Frau zuckte hilflos die Achseln, und langsam zogen ein paar Tränen über früh verblühte Wangen.
Doris lachte mit dem Kind und streichelte es mit sanften mütterlichen Händen. Plötzlich sagte sie kurz: „Geben Sie mir ihr Kind, Frau, mein eigenes ist mir gestorben, und ich würde sehr gut zu Ihrer Kleinen sein, niemand dürfte ihr mehr wehe tun.“
Die Frau hob die etwas schweren Lider über wundervollen Augen.
„Mein Kind soll ich Ihnen geben, mein Kind?“ Sie streckte die Arme aus. „Komm, Resl, komm, du darfst nicht länger belästigen.“
Das Kind schob sich noch enger an Doris heran, und die runde, weiche Wange ruhte dicht an Doris’ Gesicht. „Komm doch, komm!“ lockte die Mutter.
Das Kind rührte sich nicht.
„Gib das Kind der Mutter zurück,“ sagte Gustav Faber und wollte das Kind anrühren.
Da schmiegte sich die Kleine noch enger an und krampfte die Händchen in Doris’ Gewand.
„Du siehst, Resl will bei mir bleiben,“ lächelte Doris, „also lass mir das Kind und sprich mit der Frau, wieviel sie dafür haben will.“
„Ich verkaufe doch mein Fleisch und Blut nicht,“ schrie das vergrämte Weib auf.
„Ihr Kind soll es gut bei mir haben,“ beteuerte Doris eifrig, und zum erstenmal nach langer Zeit sah Faber ihre Wangen sich färben.
Doris fuhr dringlicher fort: „Wenn sich nun das Kind den Kopf eingeschlagen hätte bei dem Sturz? Ihr Mann quält das Würmchen, und wenn Sie Ihr Kind lieben, ist es Ihre Pflicht, es dem Elend zu entreissen, wenn sich Gelegenheit dazu bietet, ehe es zu spät ist.“
Ein paar Leute aus der Nachbarschaft umstanden die Gruppe und starrten neugierig.
„Kommen Sie mit in die Wohnung, schlug die junge Frau vor, „drinnen können wir weiterreden.“
Faber folgte den anderen kopfschüttelnd. Was tat Doris, was wollte sie tun? Ein fremdes Kind wollte sie aufnehmen, ein Kind, das aus Schmutz und Elend kam?
Er flüsterte eifrig auf sie ein, stellte ihr vor, sie könne doch selbst noch Mutter werden; doch alle Einwände wurden von ihr zurückgewiesen. Erkaufe mir meinen Frieden, schenke mir Klein-Lisis Ebenbild.“
Dabei blieb sie, und die vergrämte Wirtin vom Paradiesgarten fand schliesslich den Gedanken, das Kind fortzugeben, gar nicht mehr so wehtuend wie im Anfang, hatte sie doch schon gar so viel Angst um das kleine Geschöpf erlitten.
Ueberaus einfach und armselig war der Raum, in dem man verhandelte, und Gustav Faber konnte den Bitten und Tränen seiner Frau nicht allzu lange widerstehen. Er bat ebenfalls: Ueberlassen Sie uns Ihr Kind als Pflegetöchterchen, es soll bei uns gut behütet werden und eine Heimat finden.“
Plötzlich stand der grosse, brutale Mann im Zimmer. Er begriff schnell und rief dröhnend: „Wenn Sie tausend Mark auf den Tisch legen, ist das Wurm Ihr Eigentum.“
Die Frau schrie auf. „Das wäre Sündengeld. Wenn ich Resl hergebe, will ich keinen Pfennig, dann geschieht es nur, damit das Kind aus dem ewigen Jammer hier herauskommt.“
Er lachte. „Sei froh, wenn du den Balg los wirft und noch Geld dafür siehst.“ Er streckte die Hand aus. „Tausend Mark für den Grasaff, dann können Sie mit ihm glücklich werden.“
„Ich gebe Ihnen zunächst zweihundert Mark, und erst, wenn wir zusammen beim Notar gewesen und Sie beide notariell auf das Kind Verzicht geleistet haben, erhalten Sie die grössere Restsumme.“
Doris lächelte verklärt. Wunderschön, wie eine gnadenspendende Madonna sah sie aus mit dem Kinde im Arm.
Am nächsten Tage schon führte Doris ein hübsches, kleines Mädelchen an der Hand, das in guten neuen Kleidern einem blonden Püppchen glich.
Gustav Faber war sich nicht ganz klar, ob es klug gewesen, dieses fremde Kind dem gewohnten Boden zu entreissen, aber eigentlich war es zu spät, darüber nachzudenken, Resl Trautner war jetzt sein Pflegetöchterchen.
Auf der Heimfahrt befand sich Doris in strahlendster Stimmung, sie liess das Kind nicht aus den Augen, und so war diese Reise, wenn auch in anderem Sinne als gedacht, für sie von Erfolg gewesen, sie ward wieder zu der heiteren jungen Frau von früher, und ihr Mann atmete wieder ruhig und froh, denn Doris legte bald die düsteren Trauergewänder ab.
Die Leute in der Kleinstadt schüttelten die weisen Häupter: Ein so junges Ehepaar darf kein fremdes Kind annehmen, das gibt nur böses Blut, wenn eigene Kinder kommen.
Der alte Doktor aber lächelte, als ihm Faber alles erzählte: „Ein Mädelchen aus dem Paradiesgarten in Konstanz, wo es einstens so guten Dürkheimer Feuerberg gab? Eigen ist’s. Sehen Sie, Verehrtester, wenn ich Ihnen den Gruss nicht aufgetragen hätte, würde Sie Ihr Weg vielleicht niemals dort vorbeigeführt haben. Wollen an eine Vorsehung glauben, an eine Vorherbestimmung.“ —
Ein Jahr später ward Doris Mutter eines gesunden Töchterchens, und von dem Augenblick an musste Resl zurückstehen. Da glaubte Faber nicht mehr an Vorsehung und Vorausbestimmung, wie es der gute, dicke Doktor tat, und wünschte zuweilen, er hätte dem sentimentalen Wunsch des Doktors lieber nicht Folge geleistet und niemals den Paradiesgarten in der schmutzigen engen Gasse von Konstanz gesehen.
II.
Als Therese Trautner zehn Jahre alt war, fragte sie zum ersten Male: „Sage, Mutti, weshalb heisse ich nicht Faber wie du, der Vater und wie Schwester Erna?“
Frau Doris nahm das Köpfchen der Fragerin sanft zwischen beide Hände. „Du bist nicht Vaters Kind, nicht das meine, wenn wir dich auch genau so lieb haben, als wärest du es.“
Thereses Augen wurden starr und dunkel. „Du und Vater, ihr seid nicht meine Eltern, aber weshalb bin ich denn bei euch, weshalb bin ich denn nicht da, wo ich geboren bin?“ Der kleine, schmale Körper zitterte, und das Mündchen stand leicht offen, fieberte der Antwort entgegen.
Doris Faber war längst auf solche Fragen gefasst gewesen und hatte längst die Antwort bereit. „Meine liebe Resi, du bist weit von hier geboren, auf einer Reise führte uns ein Zufall dorthin. Deine Eltern waren eben gestorben, und weil ich kurz zuvor mein Töchterchen verlor, nahm ich dich mit mir, so wurdest du unser Kind, ein Jahr vor Ernas Geburt.“
Resis Gesicht war wie von einer Wolke verhängt. „Ich kann kaum begreifen, dass ihr eigentlich nicht richtig zu mir gehört oder ich nicht zu euch.“
Doris Faber sagt ein bisschen streng: „Was ist dabei zu begreifen, du gehörst doch zu uns.“
Resi wagte an dem Tage keine weitere Frage mehr, so viele ihr plötzlich auch noch im Herzen brannten.
Ein paar Jahre später fragte sie, worüber sie schon Stunden und Tage gegrübelt: „Wer waren meine Eltern, und wie sahen sie aus, habt ihr kein Bild von ihnen?“
Doris kam ihrem Manne, der ausweichend antworten wollte, zuvor. „Deine Eltern waren Bauern im Schwarzwald, arme Bauern, die Haus und Hof verloren und jung starben. Bilder von ihnen fanden sich nicht vor.“
Gustav Faber begriff seine Frau nicht. Weshalb sollte Resi nicht die Wahrheit erfahren? Man konnte doch nie wissen, ob nicht der Zufall eines Tages die Wahrheit enthüllte. Aber vor den warnenden Augen seiner Frau schwieg er.
Er war bequem geworden und scheute jede unnütze Gemütserregung. Schliesslich war die Geschichte auch wohl lediglich Frauensache Er ging lieber in seinen Kegelklub.
Ein anderes Mal sagte Resi: „Seit ich weiss, ich bin nicht euer Kind, möchte ich gern die Gräber der Eltern sehen, dort beten, ihnen Blumen bringen.“
Frau Doris lächelte wie über eine Kinderei. „Sei froh, dass es dir gut geht, du gehörst zu uns, und wenn du uns deinen Dank beweisen willst, dann sprichst du nie mehr von den Toten und denkst auch nicht mehr daran. Da du sie nicht kanntest, müssen sie dir doch Fremde sein.“
Resi presste die Lippen fest aufeinander. Wie einfach und selbstverständlich die Mutter das sagte. Ihr aber war gar nicht so einfach und selbstverständlich zumute, sie hätte wer weiss was dafür gegeben, wenn sie gewusst hätte, wie ihre Eltern ausgesehen.
Sie wuchs zu einem ernsten, stillen Mädchen heran, und wenn die junge Schwester draussen umherflitzte, mit Mädeln und Buben tollte, sass sie über irgendein ernstes Buch gebeugt und las und lernte.
Gustav Faber war Oberingenieur der Maschinenfabrik geworden, und da er Tüchtiges leistete, erhielt er gutes Gehalt. Aber allmählich mit dem Heranwachsen der Töchter wurde der Hausstand immer teurer, denn Frau Doris war eitel wie die Jüngste, und Erna durfte nur das Schönste und Kleidsamste tragen. Sie war ein blondes, süsses Geschöpf, ward der Mutter immer ähnlicher, und wenn Gustav Faber auch zuweilen über die Verschwendung seiner Damen zankte, im Grunde zürnte er ihnen niemals ernstlich. Der kleine Hausstand wurde auf grossem Fusse geführt und Gäste waren stets willkommen.
Der Weltkrieg, der so vielen, so unzähligen Familien das heilige Kreuzeszeichen des Schmerzes in die Herzen gebrannt, bereitete in der kleinen Villa niemandem persönliches Weh. Oberingenieur Faber war unabkömmlich, und nahe Verwandte, die hinausgezogen waren in Not und Tod, besass weder er noch Doris. So floss die grosse Blutwelle, die beinahe ganz Europa überflutete, an ihrem Heim vorbei.
Gustav Faber hatte den alten Doktor einmal gebeten, niemals ein Wort an Resi über ihre Herkunft zu verlieren, und er hatte es gelobt. Resi war viel im Doktorhause. Die wissenschaftlichen ärztlichen Bücher lockten sie, und ihre Sehnsucht war es, Aerztin zu werden.
Frau Doris lachte, als sie davon hörte, laut hinaus. „Bist du verrückt, Therese, wie kommst du nur auf so eine ausgefallene Idee? Junge Mädchen sind zum Heiraten da und nicht zum Quacksalbern. Du wirst an dem neuen Tanzkursus von Fräulein Rettenhof teilnehmen mit Erna zusammen, damit dir schwerblütigen Grillen etwas vergehen. Der Krieg ist aus, die Jugend darf sich wieder ihrer Jugend freuen.“
„Therese schüttelte den Kopf. „Lass das, Mutter, ich mag nicht tanzen, es ist nicht die Zeit dazu.“
Frau Doris erwiderte unmutig: „Du bist bereits neunzehn Jahre, und es ist nötig, dass du ein anderes Wesen annimmst, sonst würdest du ein Altjüngferchen werden. Erna ist nicht so schwerfällig wie du, um die braucht mir nicht bange sein.“
Mutterstolz leuchtete in ihren Augen.
Therese schwieg und dachte, dass Mutterliebe doch fast immer blind ist, sonst hätte es der Mutter nicht verborgen bleiben können, dass Erna tausend kleine Heimlichkeiten trieb und immer neue Ausreden ersann, um von Haus wegzuwitschen. Verstohlene Rendezvous, postlagernde Briefchen gehörten zu Ernas Lebensbedarf. Einmal fand sie so einen Brief bei Erna und sagte ernst: „Auf solche Korrespondenz darfst du dich nicht einlassen, das schadet deiner Ehre!“
Da schalt die Jüngere die Aeltere: „Aufpasserin, Spionin, Scheinheilige,“ und fing an sie zu quälen und bösartig zu necken, denn in Erna war etwas Böses, das manchmal durchdrang und sich Luft machen musste.
Therese aber blieb gleich freundlich und lieb zu der Schwester, mit der sie keine Blutsbande verknüpften, und die sie dennoch liebte und bewunderte, weil sie so feingliedrig und sonnig zart war, während ihr früher blondes Haar längst dunkelbraun geworden war und ihre tiefblauen Augen jetzt fast schwärzlich schienen. Auch besass sie nicht Ernas lichte Haut, ihr schmales, etwas scharfes Gesicht war wie aus nachgedunkeltem Elfenbein.
Frau Doris lachte manchmal, wenn sie nicht immer und immer Resi um sich gehabt hätte, würde sie glauben, das Kind sei ihr vertauscht worden. Wie eine Südländerin sah Resi aus, und ihr Name passte schlecht zu ihr.
„Dolores müsstest du heissen, Kind,“ sagte Dr. Ernstmann, der nun seit langem Witwer war und schon Mitte der Achtzig stand. Seine Söhne waren ausserhalb verheiratet, der jüngste verwitwet wie er. Er lebte ein stilles Einsiedlerleben und kurierte zuweilen noch ein bisschen an den Menschen herum, wenn er gerade gewünscht wurde. Er nannte Resi, wenn er mit ihr allein war, ‚Dolores‘, und sie hörte sich gern so nennen. Es klang sanft und dennoch voll. Dolores, die Schmerzenreiche. Sie musste lächeln. Schmerzen, wirkliche, grosse Schmerzen, nein, die kannte sie nicht, die waren ihr bisher fremd geblieben. Dass sie ihre wahren Eltern nie gekannt, war wohl der einzige Schmerz in ihrem Leben.
Als Kind hatte sie darunter gelitten, heute war sie darüber hinweg, nur zuweilen in stillen Nächten, wenn sie plötzlich erwachte und die Stille wie ein heimliches Raunen und Atmen war, dann sann sie: wie wohl die Mutter gewesen, und ein leises Sehnen zog über ihr Herz, dass es erbebte, und ihr war, als höre sie fernes, verlorenes Weinen.
III.
Nun hatten Resi und Erna tanzen gelernt, und Frau Doris wollte eine kleine, ganz kleine Gesellschaft geben, später sollte getanzt werden.
Ihr Mann widersprach zum erstenmal ganz heftig: „Wir sind keine reichen Leute, in dieser teuren Zeit gibt man keine Gesellschaften.“
„Sollen deine Töchter Vestalinnen werden?“ sagte Frau Doris, die sich noch jung gehalten und mit ihrem Lächeln ihren Mann noch heute wie einst gefügig machte.
„Resi liegt an dem albernen Herumgehüpfe gar nicht,“ wehrte er ab.
Sie zuckte die Achseln. „Sie muss doch heiraten, denn immer kann sie nicht hier herumhocken oder gar drüben beim alten Ernstmann, mit dem sie allerlei ärztlichen Humbug treibt. Erna beschwerte sich, neulich habe sie einen Armknochen zum Präparieren mit ins Haus gebracht, sie hätte sich furchtbar geekelt.“
„Wollen sie doch studieren lassen,“ meinte er nachdenklich.
Sie wehrte heftig ab. „Ausgeschlossen, ich will keine Emanzipierte, und dann kostet das Studium auch viel Geld, und unsere rechte Tochter darf in keiner Weise benachteiligt werden.“ Sie seufzte. „Hätte ich geahnt, dass ich noch ein eigenes Kind haben würde, hätte ich natürlich niemals die Dummheit gemacht —“
„Halt ein!“ unterbrach er schroff, „du gehst zu weit, dergleichen darfst du niemals sagen, auch nicht vor mir, denn ich warnte dich damals. Jetzt ist Resi unser Kind, genau wie Erna, wir müssen unser Gut und unsere Liebe zwischen beide gerecht und ehrlich verteilen.“
Frau Doris lächelte überlegen. „Die Stimme des Blutes fragte nicht nach Gerechtigkeit. Dass ich Erna tausendmal mehr liebe als Resi, wer will mir einen Vorwurf daraus machen?“
Resi stand plötzlich wie dem Boden entstiegen zwischen den Vorhängen, die zwei Zimmer trennten. Ihr Antlitz war fahl, aber die tiefblauen Augen dunkler denn je, als sie sagte: „Frau Direktor Messner ist eben gekommen, Mutter.“
Frau Doris’ rosige Wangen waren auch erblasst. Sie fragte unsicher: „Hast du gehört, was wir hier eben gesprochen haben?“
Resi war zu stolz zum Lügen. So bekannte sie ehrlich: „Ja, ich hörte zufällig den letzten Satz von dir, musste ihn hören. Aber sei ruhig, Mutter, ich wäre die letzte, die dir einen Vorwurf machen würde, weil du Erna tausendmal mehr liebst als mich. Ich bin zufrieden und dankbar für das, was du mir gibst.“ Ihre dichten Wimpern senkten sich, und still huschte sie hinaus.
Frau Doris biss sich zornig auf die Lippen. „Abscheulich ist es, dass sie gerade hören musste, was am wenigsten für sie bestimmt war. Im übrigen klang ihre Antwort seltsam — ich werde manchmal nicht klug aus dem Mädel.“
„Sie empfindet, dass sie gegen Erna zurückgesetzt wird,“ meinte der Mann, „sie tut mir zuweilen leid.“
„Zurückgesetzt?“ fuhr Frau Doris auf. „Aber ich bitte dich, Gustav, davon kann doch gar keine Rede sein, sie erhält alles, was Erna erhält, alles!“
Er lächelte nachgiebig. Wozu Streit? Aendern würde er doch nichts. Also weshalb jetzt antworten, dass Resi zwar genau so viel an Kleidung und anderen Dingen erhielt wie Erna, dass aber alles, was sie bekam, von minderer Güte war. Und Resi besass ausgesprochenen Schönheitssinn, der mochte oft darunter leiden
Frau Doris ging, und ihr Mann blickte ihr sinnend nach. Wie ganz anders hatte sich seine Frau entwickelt, als er früher geglaubt, wie so ganz, ganz anders. Vor dem Tode Klein-Lisis lustig und sanft, gefügig und einfach, nach ihrem Tode abgestumpft, für nichts empfindlich; froh und lieb und einfach wieder, als Resi ins Haus kam, und nach Ernas Geburt eine selbstbewusste, eitle Frau, die es mit der Gerechtigkeit nicht so genau nahm. Sonst hätte sie sich immer und immer sagen müssen, sie hatte Resi ihren Verhältnissen entrissen, ihr Tochterrechte gegeben, sie durfte ihr die eigene Tochter nicht vorziehen.
Gustav Faber brannte sich eine Zigarre an. Gut wäre es, wenn sich für Resi bald ein Mann fand, er fürchtete allerlei Reibereien innerhalb der häuslichen vier Wände, und seine Ruhe und Bequemlichkeit ging ihm über alles. —
Frau Doris begann mit den Vorbereitungen für den Gesellschaftsabend. Neue Kleider sollten die Mädchen haben. Erna sass im behaglichen Wohnzimmer neben der Mutter, und beider Augen ruhten auf einem Modeblatt. Ernas Gesicht lächelte verträumt, während ihr rechter Zeigefinger eine Modefigur nachzeichnete.
„Sieh, Mutti, wie reizend dieses Kleid ist, sieh nur den Faltenwurf und die entzückende Stickerei. Ich denke mir, es müsste für mich in hellgrüner Seide gearbeitet und die kleinen Ranken auf Schultern und Brust in zartestem Rosa oder Weiss hineingestickt werden. Dazu eine matte, ganz matte Rose im Haar.“ Sie blickte mit leuchtenden Augen die Aeltere an. „Mutter, sage ja, ich bitte dich darum. Nicht wahr, das Kleid lässt du mir arbeiten?“
Frau Doris nickte. „Natürlich, Liebling, natürlich. Aber ich weiss nicht, was wir mit Resi machen? Ob ihr mattgrün steht und dann — für euch beide kommen solche Kleider doch vielleicht etwas zu teuer.“
Ernas hellblaue Augen hatten plötzlich einen kalten Glitzerschein. „Ach, Resi,“ sagte sie in leicht wegwerfendem Tone, „wozu muss die denn dasselbe tragen wie ich? Ihr Weisses vom Tanzstundenball ist doch noch tadellos, während meines den hässlichen Riss hat. Sie soll es anziehen, das ist doch ganz einfach.“
Frau Doris zog ein wenig die Brauen hoch und überlegte. Ernas Rat war eigentlich gar nicht schlecht. Auf diese Weise wurde eine hübsche Summe Geld gespart. Resi mochte vielleicht nicht einmal viel an einem neuen Ballkleid liegen, sie tanzte ja nicht besonders gern.
Eben trat Resi ein, und unwillkürlich glitt ein feines Lächeln über ihr Gesicht, als sie Mutter und Schwester über der Modezeitung fand. „Nun, sucht ihr etwas Hübsches für uns zum Anziehen aus? Was meint denn das Schwesterchen, was wir für den grossen Abend wählen sollen?“
Das stumpfe Schweigen der beiden fiel ihr nicht weiter auf. Sie war in froher Jungmädchenstimmung und plauderte unbekümmert weiter.
„Ich alte, pedantische Resi freue mich jetzt doch auf unseren Abend und denke, es wird recht hübsch werden.“ Ihre Augen fielen auf dieselbe Kostümzeichnung, die noch vor Minuten Erna so begeistert hatte. Sie liess sich nieder und wies darauf hin. „Entzückend ist das Kleid, schlicht und doch vornehm, es gefällt mir sehr und — —“ sie blickte von der einen zur anderen, „wenn ich nicht irre, ist es auch euer Geschmack?“ Ihr Blick streichelte Erna beinahe. „Unser Blondchen müsste hinreissend süss in dem Kleide aussehen, ich dächte, hellgrün wäre die rechte Farbe.“
Erna nickte. „Ja, das haben Mutti und ich eben auch besprochen.“
„Fein,“ lächelte Resi, „diese Uebereinstimmung unseres Geschmacks, ich denke, auch meine Zigeunerart darf helles Grün tragen.“
Frau Doris und Erna wechselten einen schnellen, verständnisvollen Blick.
Eine kleine Pause entstand.
Resi lächelte unbefangen weiter. „Meint ihr, dass mich hellgrün auch kleidet? So gut wie Erna allerdings wohl kaum.“
Die Blonde sagte rasch: „Nein, hellgrün steht dir sicher gar nicht, und ich habe auch bereits mit Mutti darüber gesprochen. Es ist am besten, du ziehst das weisse Kleid an, das du zum Tanzstundenball trugst.“
Resis Lächeln löste sich ganz langsam von den schmalen Zügen, und ein seltsames Fragen dämmerte in ihren Augen auf. Erna erklärte mit dem naivsten Gesicht von der Welt: „Sieh, Resi, es ist doch jetzt alles so bodenlos teuer, man muss sparen, es ist klug, wenn du dein weisses Kleid nimmst. Meins hat einen hässlichen Riss — —“
Resi lächelte schon wieder.
„So, meint ihr es! Ja, das sehe ich ein, ihr habt völlig recht, mein weisses Kleid genügt natürlich. Aber dein Riss, Erna, ist auch nicht so schlimm, ich verspreche dir, den Schaden so tadellos auszubessern, dass niemand etwas davon merkt.“ Sie sah Doris an. „Dann kannst du das Geld für zwei neue Kleider sparen, Mutter.“
Frau Doris murmelte etwas vor sich hin. Sie schämte sich ein wenig, hatte das Gefühl, in eine selbstgelegte Schlinge gegangen zu sein.
Erna aber sprang auf, das Modeblatt fiel zu Boden. „Lass doch den blöden Gouvernantenton! Ich trage keine gestopften Kleider, merke dir das, und schliesslich habe ich es nicht so nötig zu sparen wie du.“
Frau Doris erhob sich. „Was fällt dir ein, Erna, in welchem Ton redest du mit deiner Schwester?“
Ernas Augen hatten wieder den alten Glitzerschein. „Lass doch, Mutti, einmal muss man ihr gegenüber doch ein bisschen deutlich werden, denn sie meint immer mit grösster Selbstverständlichkeit, sie hätte genau die Rechte hier wie ich.“
„Erna, ich bitte dich, sei still,“ unterbrach Frau Doris, „gewiss hat Resi dieselben Rechte und deshalb wird sie auch dasselbe Kleid erhalten wie du. Wenn es auch teuer kommt, es muss sich eben machen lassen.
Nun stand auch Resi auf. Gross und schlank stand sie vor den beiden kleineren Frauen. In ihren Zügen zuckte es wie heimliches Wetterleuchten, aber ihre Stimme war ruhig, als sie sagte:
„Liebe Mutter, wenn du auch Erna hindern kannst, allzu deutlich zu werden, so konntest du doch nicht hindern, dass ich längst begriffen habe, was sie meint. Sie sprach wahr, ich habe hier nicht dieselben Rechte wie sie, die dein leibliches Kind ist, während ich nur ein angenommenes bin. Sie ist hier daheim, während du mir nur aus Mitleid hier eine Heimat gegeben hast. Ich habe keine Eltern mehr und muss dem Himmel dankbar sein, der gute Menschen aussandte, die sich meiner erbarmten.“ Sie lächelte wehmütig. „Habe jahrelang nicht so recht daran gedacht, aber in letzter Zeit wurde ich doch öfter erinnert, und es ist gut so, sonst würde ich vielleicht völlig vergessen haben, dass dies hier nicht mein Elternheim ist, sondern Heim der Gnade.“
Frau Doris, die sich schuldig fühlte, es aber nimmermehr eingestanden hätte, ward zornesrot.
„Dein Ton ist nicht der rechte, hinter deiner scheinbaren Demut verbirgt sich Hochmut.“
Resis Augen blickten fast schwarz. „Verzeih, wenn ich den rechten Ton nicht fand, doch glaube mir, nichts liegt mir ferner als Hochmut.“ Ganz traurig setzte sie hinzu: „Ich hätte doch gar keinen Grund dazu.“
„Das meine ich auch,“ sagte Frau Doris scharf. Schärfer, als es in ihrer Absicht lag. Aber sie konnte nichts dafür, Resis Auftreten reizte sie immer wieder.
Ein grosses Schweigen setzte ein, und nach einem Weilchen ging Resi still zum Zimmer hinaus.
Erna machte ein etwas unsicheres Gesicht, dann aber grollte sie: „Es schadet ihr gar nichts, wenn sie einmal etwas geduckt wird.“
Frau Doris streichelte ihr blondes Kind. „Du bist tausenmal schöner als sie, man muss dich ja lieber haben, mein Süsses.“
Erna lächelte taubenhaft. „Mutti, du bist so gut, so gut. Resi hat gar kein Verständnis dafür. Bedenke, sie ist doch nur das Kind armer Schwarzwaldbauern, und wer weiss, was aus ihr geworden wäre, wenn du dich nicht der Elternlosen erbarmt hättest.“
Frau Doris war gerührt über ihre eigene Güte. Sie hatte das Gefühl, sich anzuvertrauen, zu zeigen, dass ihr Herz noch edler gehandelt, als es schien. Wozu brauchte der eigenen Tochter ein Märchen aufgebunden werden? Sie war wohl berechtigt, die volle Wahrheit zu hören.
Sie legte den rechten Arm um Ernas Schultern und ging so mit ihr zum Sofa, wo sich beide dicht nebeneinander niederliessen.
Die Aeltere lächelte: „Du bist nun schon über sechzehn Jahre, mein Liebling, und ich denke, es braucht für dich kein Geheimnis mehr aus der Herkunft Resis gemacht zu werden; denn die Geschichte von den toten Schwarzwaldbauern, die ihr Kind arm und hilflos in der Welt zurückliessen, ist nur ersonnen, um Resi die Wahrheit zu verbergen.“
Ueber Ernas Lippen zitterte ein Laut des Staunens, äusserste Spannung malte sich auf ihrem Gesicht. „Aber woher stammt denn Resi sonst, Mutti?“ und von eigner romantischer Stimmung erfasst, fragte sie hastig: „Resi ist wohl von vornehmer, hoher Herkunft, sie hat manchmal so etwas Stolzes, Unnahbares.“
Frau Doris schüttelte den Kopf. „Im Gegenteil, Liebling, ganz im Gegenteil. Resi stammt aus Niedrigkeit und Armut.“
Ihr tauchten plötzlich Bedenken auf, ob sie nicht doch vielleicht unklug handelte, die allzu junge Erna einzuweihen. Aber nun war es zu spät. Ernas Neugier drängte und drängte.
Da nahm Frau Doris Ernas Rechte. „Versprich mir, mein Kind, gegen jedermann, auch gegen Resi, über das zu schweigen, was ich dir jetzt sagen werde.“
Erna lächelte obenhin. „Natürlich, Mutti, natürlich, ich werde doch ein Geheimnis zu wahren wissen.“ Doppelt gespannt war sie jetzt auf das, was sie erfahren würde.
Und nun erzählte Frau Doris ihrer jungen Tochter von der kleinen, schmutzigen Wirtschaft „Zum Paradiesgarten“ in Konstanz, und Erna lauschte, als würde ihr ein spannender Roman erzählt.
Als die Mutter geendet, richtete sie sich mit tiefem Atemholen auf. Jetzt wusste sie, woher Resi stammte, jetzt wusste sie es anders, als sie es bisher gewusst. Das war eine von der ersten völlig verschiedene Lesart. So sahen in Wirklichkeit Resis Eltern aus, ihre Eltern, die vielleicht noch lebten. Die Mutter war eine arme, müde Frau, der Vater ein Trunkenbold und Rohling, und mit einem Tausendmarkschein liessen sich beide ihr Kind bezahlen.
„Das ist ja Gesindel gewesen,“ sagte sie hart und verächtlich, „stolz kann Resi auf ihre Eltern wahrlich nicht sein.“
Frau Doris nickte. Nein, stolz konnte Resi darauf nicht sein, die bäuerischen Eltern aus dem Schwarzwald, die allzu früh starben, wirkten dagegen gediegen.
„Wenn Resi wüsste, was ich nun weiss, ich glaube, das dämpfte ihren Stolz,“ sagte Erna, und in ihren Augen stand wieder der kalte Glanz.
Frau Doris erhob sich. „Um Gotteswillen, Kind, niemals soll sie davon erfahren, niemals.“
Erna lächelte. „Von mir erfährt sie nichts.“ Leise Verachtung umspielte ihre Lippen. Was doch die Einbildung tut! Sie sah die Pflegeschwester, nun sie über deren Herkunft aufgeklärt war, plötzlich in ganz anderem, schärferen Licht. Bisher war immer noch ein matter Schein sanfter Romantik um sie herum gewesen, jetzt aber schien ihr das, was kurz zuvor noch ein zart abgetöntes Pastellbild, eine groteske Zeichnung aus einem Schundroman. Leichter Widerwillen quoll in ihr auf.
Sie sagte erregt: „Du warst engelhaft gut damals, Mutti, als du das fremde Kind annahmst. Im ganzen Leben kann Resi dir nicht danken, was sie dir schuldet.“
Frau Doris streichelte Erna. „Wir wollen hoffen, dass sie, auch ohne die volle Wahrheit zu wissen, die Dankbarkeit niemals vergisst.“





























