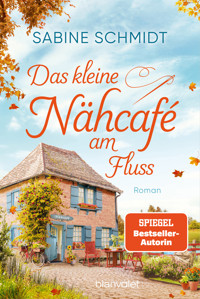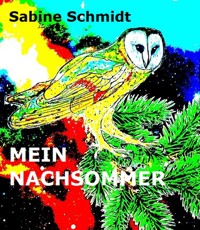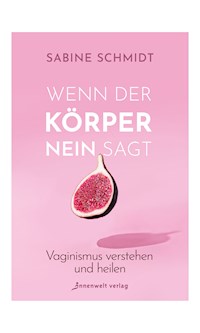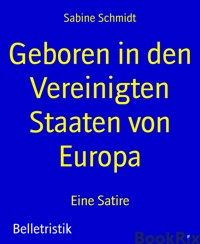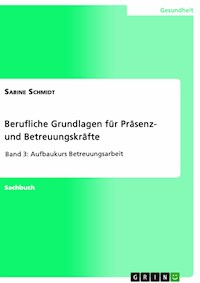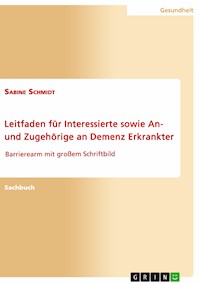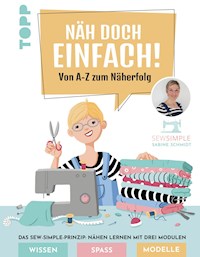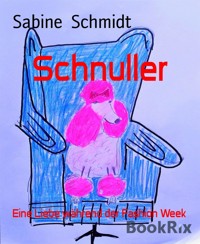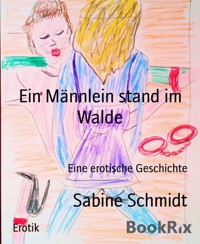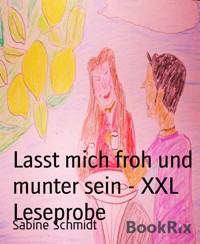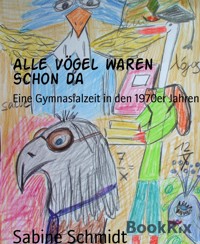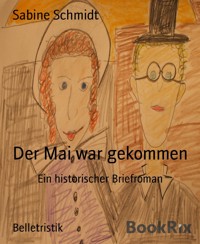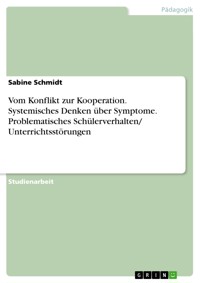Resozialisierung und Strafvollzug. Theoretische Überlegungen und empirische Untersuchung zu Sanktionseinstellungen in der Öffentlichkeit E-Book
Sabine Schmidt
0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Diplomarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich Soziale Arbeit / Sozialarbeit, Note: 1,3, Ernst-Abbe-Hochschule Jena, ehem. Fachhochschule Jena, Sprache: Deutsch, Abstract: Eine Mischung von Nichtwissen und Vorurteilen prägt bis heute die Vorstellung der meisten von uns über das Leben im Strafvollzug. Der Gedanke eines sinnvollen Strafvollzuges, der den Inhaftierten sozialeigenverantwortlich ausgerüstet in die Gesellschaft entlassen kann, hat schon im 16. Jahrhundert revolutionierend gewirkt, so dass die Todesstrafe immer mehr zurückgedrängt wurde, und die Freiheitsstrafe und Zuchthäuser sich immer mehr entwickelten. Die gegenwärtige Freiheitsstrafe wie sie heute existiert, beruht letztendlich auf dem Gedankengut der Zuchthäuser, die im 16. Jahrhundert gegründet wurden. Die Freiheitsstrafe lebt auch heute noch von der Vorstellung, dass durch Freiheitsentzug und Zwang etwas Sinnreiches erreicht werden kann. Dieser Grundwiderspruch wird durch bestimmte Umformungen des Strafvollzuges zu mildern versucht (z. B. offener Vollzug, Weiterbildungseinrichtungen, Hafturlaub usw.). Dennoch liegt die Erkenntnis nahe, dass Strafvollzug uneffektiv ist und für den Haftentlassenen tiefgreifende Konsequenzen hat. Der Gedanke, dass man allein durch Einsperren Menschen „erziehen“ und für die Rückkehr in die Freiheit vorbereiten könne, ist heute nicht mehr tragbar. Aus diesem Grund werden in der modernen Kriminologie zahlreiche Stimmen laut, welche die Abschaffung der Freiheitsstrafe fordern. Die hier zugrunde liegende Diplomarbeit soll sich mit der Effektivität, also der Wirksamkeit und der Effizienz des Strafvollzuges in Deutschland auseinandersetzen. Ziele und Aufgaben des Strafvollzugs sollen diskutiert werden. Zusätzlich wurde von mir eine empirische Untersuchung anhand von qualitativen Daten durchgeführt, welche die Meinung der Bevölkerung zu Strafe und Freiheitsentzug wiedergeben soll. Auch wurden Einstellungen zu Sanktionen als solches untersucht. Die Problematik der Resozialisierung sollte hierbei einen besonderen Stellenwert erhalten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2007
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2015 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1 Einleitung
2 Strafvollzug in Deutschland
2.1 Begriff des Strafvollzugs
2.2 Gesetzliche Grundlagen der Freiheitsstrafe
2.3 Strafvollzug als totale Institution
3 Strafzwecke
3.1 Absolute Strafzwecke - Vergeltungsgedanke und Sühne
3.2 Relative Strafzwecke
3.2.1 Die negative Generalprävention –Abschreckung
3.2.2 Die negative Spezialprävention
3.2.3 Die positive Spezialprävention (Resozialisierung)
3.2.4 Die positive Generalprävention (Normbekräftigung)
4 Vollzugsziele und Vollzugsgrundsätze
4.1 Die Vollzugsgrundsätze
4.2 Sozialisierung und Resozialisierung
5. Wirkungen von Haft
5.1 Akkulturations- und Prisionierungsprozess
5.2 Das Deprivations- und Importationsmodell
5.3 Veränderungen der Persönlichkeit als Folge von Strafhaft
5.3.1 Rollendistanz
5.3.2 Ambiguitätstoleranz
5.3.3 Empathie
5.3.4 Soziale Folgen von Strafhaft
5.3.5 Der Verlust materieller Habe und Hilfe
5.3.6 Entwicklungsstörungen und der Verlust an heterosexuellen Beziehungen
5.3.7 Der Verlust an Selbstbestimmung
5.3.8 Verlust der eigenen Sicherheit
5.4 Die Subkultur im Strafvollzug
5.4.1 Das Deprivationsmodell
5.4.2 Die kulturelle Übertragungstheorie
6 Die „Behandlung“ des Insassen
6.1 Die Behandlung als Form menschlichen Umgangs
6.2 Die Behandlung als medizinischer Vorgang
6.3 Der Behandlungsbegriff in der Sozialtherapie
7. Wirkung von Sanktionen
7.1 Vergeltung und Sühne als Absolute Strafzwecke
7.2 Relative Strafzwecke
7.2.1 Abschreckung als Negative Spezialprävention
7.2.2 Die Positive Spezialprävention
7.2.3 Die Normbekräftigung als positive Generalprävention
8. Legitimationsansätze für den Strafvollzug
8.1 Die Sicherungsfunktion
8.2 Die symbolische Funktion
8.3 Die „backdrop“- Funktion (Die Hintergrundfunktion)
9 Rückfallforschung und Auswertung der Statistiken 2003
9.1 Folge- und Bezugsentscheidungen
9.2 Persönliche Merkmale
9.2.1 Alter
9.2.2 Geschlecht
9.2.3 Nationalität
9.3 Sanktionsgruppen
9.4 Bewährung
9.5 Ausgewählte Deliktsgruppen
9.6 Voreintragungen
9.7 Typen von Sanktionskarrieren
9.8 Zusammenfassung der Ergebnisse:
10 Aktuelle Probleme des Strafvollzuges in Deutschland
10.1 Kosten
10.2 Die Überbelegung der Haftanstalten
10.3 Die Personalstruktur
10.4 Die Sucht und Drogenproblematik in den Haftanstalten
10.5 Die derzeitige Entwicklung der Freiheitsstrafe
11 Öffentlichkeit und Strafvollzug
11.1 Erwartungen der Öffentlichkeit und gesellschaftliche Sichtweise auf den Strafvollzug
11.2 Kriminalitätsfurcht in der Öffentlichkeit
11.3 Sanktionseinstellungen der Öffentlichkeit
11.4 Die meinungsbildende Rolle der Medien
12 Empirische Untersuchung zu Sanktionseinstellungen in der Öffentlichkeit
12.1 Methode der Datenerfassung
12.2 Stichprobenbeschreibung
12.3 Hypothesen
12.4 Auswertung der empirischen Untersuchung anhand der Software MAXqda2
12.4.1 Ist Strafe stets notwendig?
12.4.2 Freiheitsstrafen belasten den Staat, die Gesellschaft, Opfer und die Inhaftierten und deren Familien und fördern Unmenschlichkeit.
12.4.3 Vakuum in der Szene
12.4.4 Die Regelungen für Gewaltverbrecher müssen sich mehr am Schutz der Gesellschaft orientieren.
12.4.5 Stigmatisierung und Sanktionierung sind eng miteinander verbunden.
12.4.6 Freiheitsstrafe ist allein durch den Entzug der Freiheit eine Strafe an sich
12.4.7 Strafrecht als letztes Mittel (Ultima Ratio) und Austauschbarkeitsthese
12.4.8 Der Schutz der Gemeinschaft und Opfern hat Vorrang vor dem Gedanken der Resozialisierung
12.4.9 „gefährliche Straftäter“
12.4.10 Straftäterbehandlung in Politik, Öffentlichkeit und in den Medien
12.4.11 Geeignete Resozialisierungsmaßnahmen:
12.4.12 Der Code-Matrix-Browser
13 Schlusswort
14 Danksagung
15 Literaturverzeichnis
16 Anhang
17 Interviews
17.1 Anhang: A 1
17.2 Anhang: A 2
17.3 Anhang: A 3
17.4 Anhang: A 4
17.5 Anhang: A 5
17.6 Anhang: A 6
17.7 Anhang: A 7
17.8 Anhang: A 8
17.9Anhang: A 9
17.10 Anhang: A 10
17.11 Anhang: A 11
17.12 Anhang: A 12
17.13 Anhang: A 13
17.14 Anhang: A 14
17.15 Anhang: A 15
17.16 Anhang: A 16
17.17 Anhang: A 17
17.18 Anhang: A 18
17.19 Anhang: A 19
17.20 Anhang: A 20
17.21 Anhang: A 21
17.22 Anhang: A 22
17.23 Anhang: A 23
17.24 Anhang: A 24
17.25 Anhang: A 25
17.26 Anhang: A 26
17.27 Anhang: A 27
17.28 Anhang: A 28
17.29 Anhang: A 29
17.30 Anhang: A 30
17.31 Anhang: A 31 Interview ehemaliger Insasse
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Zweck der Strafe
Abbildung 2: Gefangene in Deutschland
Abbildung 3: Einflussbereiche auf Sanktionseinstellungen
Abbildung 4: Aspekte des Rückfall-/Bewährungs-Begriffes
Abbildung 5:Folgeentscheidungen
Abbildung 6: Art der Folgeentscheidung nach Sanktionsart der
Bezugsentscheidung
Abbildung 7: Verteilung der Folgeentscheidungen für alle
Bezugsentscheidungen
Tabelle 6:Schwerste Folgeentscheidung und Altersgruppen bei der
Bezugsentscheidung in Prozent
Abbildung 8: Rückfallrate nach Sanktionsart der
Bezugsentscheidung - Altersgruppe: Erwachsene -
Abbildung 9: Rückfallrate nach Sanktionsart der Bezugsentscheidung
- Männer / Frauen -
Abbildung 10: Rückfallrate nach Sanktionsart der Bezugsentscheidung
nach Nationalität
Abbildung 11: Art der Folgeentscheidung nach Sanktionsart der
Bezugsentscheidung
Abbildung 12: Rückfallrate nach der Dauer unbedingter Freiheits- und
Jugendstrafen der Bezugsentscheidung
Abbildung 13: Art der Folgeentscheidung nach freiheitsentziehenden
Sanktionen - Freiheitsstrafe –
Abbildung 14: Art der Folgeentscheidung nach Art des schwersten Delikts
in der Bezugsentscheidung
Abbildung 15: Art der Folgeentscheidung nach Anzahl der Voreintragungen
(Jugendliche/Heranwachsende)
Abbildung 16: Art der Folgeentscheidung nach Typen von 'Sanktionskarrieren'
(Erwachsene)
Abbildung 17: Art der Folgeentscheidung nach Typen ‚Sanktionskarriere'
(Jugendliche und Heranwachsende)
Abbildung 18: Art der Folgeentscheidung nach Geldstrafe
Abbildung 19: Art der Folgeentscheidung nach Straf(rest)aussetzung von
Freiheitsstrafe mit und ohne Bewährungshelfer
Abbildung 20: Therapiemaßnahmen bei Drogenabhängigkeit und
Alkoholmissbrauch im Jugendstrafvollzug
Abbildung 21: Zustimmung zur Abschreckung von Haft
Abbildung 22: Zustimmung zur Rehabilitationswirkung von Haft
Abbildung 23: Größe der Hafträume (in Quadratmetern)
Abbildung 24: Ist Ausstattung des Personals vs. Erwartete
Personalausstattung
Abbildung 25: durchschnittliche Tageshaftkosten der Bundesländer
2001-2003
Abbildung 26: Jährliche Ausgaben der Vollzugsanstalten pro Inhaftierten
Abbildung 27: Übersicht Codesystem
Abbildung 28: Code-Matrix-Browser
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Missbrauchsquote bei Beurlaubungen 1998-2002
Tabelle 2: Alter
Tabelle 3: Geschlecht
Tabelle 4: Bildungsgrad
Tabelle 5: Branchen/Arbeitsfelder
Tabelle 7: Geplante Neuvorhaben im Justizvollzug und deren Kosten
Tabelle 8: Variablenmatrix
Abkürzungsverzeichnis
1 Einleitung
Die Institution des Strafvollzuges soll den Rechtsfrieden wiederherstellen. Sie ist eines der Instrumente, die die Justiz zu diesem Zweck zur Verfügung hat. Dieses Element steckt jedoch durch den Mangel an Wirksamkeit und seiner Nebenwirkungen in einem tiefen Dilemma, welches in dieser Arbeit wissenschaftlich diskutiert werden soll.[1] Der Anstaltsleiter, Herr Gallmeier äußerte sich zur Problematik des Freiheitsentzuges bereits in den Sechzigerjahren wie folgt:
„Man versucht, an Menschen, die man nicht kennt, unter Verhältnissen, die man nicht beherrscht, Strafen zu vollstrecken, um deren Wirkungen man nicht weiß.“[2]
Eine Mischung von Nichtwissen und Vorurteilen prägt bis heute die Vorstellung der meisten von uns über das Leben im Strafvollzug.[3] Der Gedanke eines sinnvollen Strafvollzuges, der den Inhaftierten sozialeigenverantwortlich ausgerüstet in die Gesellschaft entlassen kann, hat schon im 16. Jahrhundert revolutionierend gewirkt, so dass die Todesstrafe immer mehr zurückgedrängt wurde, und die Freiheitsstrafe und Zuchthäuser sich immer mehr entwickelten. Die gegenwärtige Freiheitsstrafe wie sie heute existiert, beruht letztendlich auf dem Gedankengut der Zuchthäuser, die im 16. Jahrhundert gegründet wurden. Die Freiheitsstrafe lebt auch heute noch von der Vorstellung, dass durch Freiheitsentzug und Zwang etwas Sinnreiches erreicht werden kann. Dieser Grundwiderspruch wird durch bestimmte Umformungen des Strafvollzuges zu mildern versucht (z. B. offener Vollzug, Weiterbildungseinrichtungen, Hafturlaub usw.).
Dennoch liegt die Erkenntnis nahe, dass Strafvollzug uneffektiv ist und für den Haftentlassenen tiefgreifende Konsequenzen hat. Der Gedanke, dass man allein durch Einsperren Menschen „erziehen“ und für die Rückkehr in die Freiheit vorbereiten könne, ist heute nicht mehr tragbar. Aus diesem Grund werden in der modernen Kriminologie zahlreiche Stimmen laut, welche die Abschaffung der Freiheitsstrafe fordern.[4]
Die hier zugrunde liegende Diplomarbeit soll sich mit der Effektivität, also der Wirksamkeit und der Effizienz des Strafvollzuges in Deutschland auseinandersetzen.
Ziele und Aufgaben des Strafvollzugs sollen diskutiert werden. Zusätzlich wurde von mir eine empirische Untersuchung anhand von qualitativen Daten durchgeführt, welche die Meinung der Bevölkerung zu Strafe und Freiheitsentzug wiedergeben soll. Auch wurden Einstellungen zu Sanktionen als solches untersucht. Die Problematik der Resozialisierung sollte hierbei einen besonderen Stellenwert erhalten.
Einleiten möchte ich mit den Gedanken eines Insassen zur Resozialisierung als Vollzugsziel.
Vollzugsziel
Man sperrt mich ein,
um mich auf ein Leben in Freiheit vorzubereiten.
Man nimmt mir alles,
um mich zu lehren, mit Dingen verantwortungsvoll umzugehen.
Man reglementiert mich permanent,
um mir zur Selbstständigkeit zu verhelfen.
Man entfremdet mich den Menschen,
die ich liebe, um mich ihnen näher zu bringen.
Man bricht mir das Rückrat,
um mich zu stärken.
Man programmiert mich auf Anpassung, damit ich lerne, kritisch zu leben.
Man bringt mir Misstrauen entgegen,
Damit ich lerne, zu vertrauen.
Man sagt: „Zeige Dein Gefühl!“,
Damit man mit ihm spielen kann.
Man sagt: „ Du bist resozialisiert!“, wenn ich zu allem nur noch nicke“.[5]
2 Strafvollzug in Deutschland
2.1 Begriff des Strafvollzugs
Unter dem Begriff Strafvollzug versteht man die Art und Weise der Durchführung freiheitsentziehender Kriminalsanktionen in einer Straf- oder Verwahranstalt. Dieses schließt die Freiheitsstrafe (§ 38 StGB), die Jugendstrafe (§ 17 JGG) und die freiheitsentziehenden Maßregeln der Besserung und Sicherung (§§ 63, 64, 66 StGB) mit ein. Die Rechtsgrundlage des Strafvollzuges bildet das am 01.01.1977 in Kraft getretene Strafvollzugsgesetz (StVollzG). Hinsichtlich des Jugendstrafvollzuges greift man auf die Rahmenvorschrift des § 91 JGG und den Verwaltungsvorschriften des Jugendstrafvollzuges (VVJug) zurück.[6]
Der Begriff Vollzug stellt dabei ein komplexes Netz von Handlungen zwischen Einzelnen und Gruppen dar („Inter-Aktionen“), dass durch formelle und informelle Strukturen vermittelt wird. Die gesetzlichen Regelungen stellen dabei die formellen Strukturen dar, die auch die Verwaltungsanordnungen auf Landes- und Anstaltsebene mit einbeziehen. Sie regeln somit das Handeln. Informelle Strukturen sind die tatsächlichen Übungen und Praktiken, die sich in Ausfüllung oder Ergänzung der formellen Strukturen herausbilden und das tägliche Geschehen im Strafvollzug beeinflussen. Inhaltlich werden diese Strukturen durch das Vollzugsziel bestimmt. Sie stellen die Mittel und Wege dar, dieses Ziel zu erreichen. An ihm sollen sich diese Strukturen ausrichten und messen.[7]
Der Strafvollzug stellt ein Instrument staatlicher Verbrechensbekämpfung und Kontrolle dar, welches die Resozialisierung, Rückfallverhinderung und Schutz der Allgemeinheit zum Ziel hat. Somit gehört er neben der Polizei und der Strafrechtspflege zur Verbrechenskontrolle. Diese umfasst sämtliche gesellschaftlichen Einrichtungen, Strategien und Sanktionen, welche die Verhaltenskonformität der Gesellschaft im strafrechtlich geschützten Normbereich bezwecken. Die Verbrechenskontrolle stellt wiederum einen Ausschnitt der allgemeinen Sozialkontrolle dar, die diejenigen Mechanismen umfasst, durch welche die Gesellschaft es möglich macht, dass Menschen bestimmten Normen auch Folge leisten.[8] Das Gefängnis, als verlängerter Arm des Staates stellt eine Organisation dar, die die Wünsche der Gesellschaft hinsichtlich ihrer kriminell gewordenen Mitglieder erfüllen soll.[9]
Die besonderen Formen des Vollzugs, wie Arrest, Maßregelvollzug und U-Haft sollen in dieser Arbeit ausgegrenzt werden.
2.2 Gesetzliche Grundlagen der Freiheitsstrafe
Das Strafvollzugsrecht ist Teil des Strafrechts und der "gesamten Strafrechtswissenschaft". Es regelt die Vollstreckung von Freiheitsstrafen bzw. freiheitsentziehenden Maßregeln und bindet sich an das Strafvollstreckungsrecht an. Nach einem rechtskräftigen Gerichtsurteil geht die Zuständigkeit hinsichtlich Vollstreckung, Dauer und Ort des Vollzug der Freiheitsstrafe in die Kompetenz der Strafvollstreckungsbehörde (Staatsanwaltschaft, § 451 StPO) über. Die hierfür relevanten Rechtsvorschriften sind in der Strafprozessordnung bzw. in der Strafvollstreckungsordnung zu finden (§§ 449ff StPO).[10] Das Strafvollzugsrecht beinhaltet dabei alle Rechtsnormen, welche die stationäre Vollziehung der freiheitsentziehenden Kriminalsanktionen regeln.[11]
Im Bereich der Strafen differenziert das StGB zwischen Haupt- und Nebenstrafen. Hauptstrafen sind die Freiheitsstrafe (§§ 38, 39 StGB) und die Geldstrafe (§§ 40-43 StGB). Als Nebenstrafe gilt das Fahrverbot (§ 44 StGB). Der Strafvollzug ist Ländersache.
Die Freiheitsstrafe wird entweder in eine zeitige oder in eine lebenslange Freiheitsstrafe unterteilt.[12]
Die lebenslange Freiheitsstrafe ist teils als absolute (z. B. bei Mord), teils als wahlweise Sanktion angedroht. Nach Abschaffung der Todesstrafe ist die lebenslange Freiheitsstrafe die schwerwiegendste Sanktion des deutschen Strafrechts.
Die zeitige Freiheitsstrafe beträgt minimal einen Monat, im Höchstmaß beträgt sie 15 Jahre (§ 38 Abs. 2 StGB).
Innerhalb dieses vorgegebenen Rahmens werden durch die Strafrahmen der Straftatbestände Höchst- und Mindeststrafen determiniert. Somit wird dem Rang der strafrechtlich geschützten Rechtsgüter Rechnung getragen.
Die kurze Freiheitsstrafe (unter sechs Monaten) ist im Vergleich zur Geldstrafe ultima ratio[13] (§ 47 StGB).
Sie darf nur angeordnet werden, wenn besondere Umstände (Diese wären z. B. mehrfache Rückfälligkeit, Tatbegehung kurz nach Zustellung der Anklageschrift mit der selben Tat, Freiheitsentzug stellt sich als einziges Mittel dar, dem Täter vom Fortsetzen seines strafbaren Handeln abzubringen), die in der Tat oder der Persönlichkeit des Täters liegen, und die Verhängung einer Freiheitsstrafe zur Einwirkung auf den Täter oder zur Verteidigung der Rechtsordnung unerlässlich machen.[14]
Dies wäre der Fall, wenn aufgrund der Gesamtwürdigung aller die Tat und den Täter kennzeichneten Umstände die notwendige Einwirkung auf den Straftäter oder die Verteidigung der Rechtsordnung eine Freiheitsstrafe für unverzichtbar erscheinen lässt, weil andere Sanktionen nicht mehr ausreichend sind (kann auch bei einer Häufung von Bagatelldelikten der Fall sein). Hier wird die spezialpräventive Funktion der Sanktion angesprochen, d. h. es ist zu entscheiden, ob eine tätergünstige Prognose (Vorhersage weiterer Straftaten) vorliegt und ob eine den Täter weniger belastende und dennoch kriminalpolitischen Erfolg versprechende Alternative zur Freiheitsstrafe existiert. Den frei werdenden Spielraum bei der Entscheidungsfindung füllt die Geldstrafe aus. Ist diese jedoch uneinbringlich, so tritt an ihre Stelle die Ersatzfreiheitsstrafe nach § 43 StGB in Kraft.[15]
Die Bestimmung des § 47 StGB hat den Zweck, die kurzfristige Freiheitsstrafe möglichst zurückzudrängen. Die Vollstreckung einer Freiheitsstrafe, die zwei Jahre nicht überschreitet, kann zur Bewährung ausgesetzt werden; eine teilbedingte Freiheitsstrafe existiert im deutschen Strafrechrecht nicht. Bei Strafen unter sechs Monaten entscheidet gemäß § 56 Abs. 1 i.V.m. Abs. 3 StGB allein die positive Sozialprognose, d. h. die Annahme, dass die Rückfallwahrscheinlichkeit bei Aussetzung der Vollstreckung (gegebenenfalls unter Bewährungsaufsicht) geringer sein wird als bei einer Verbüßung der Freiheitsstrafe (vergleichende Interventionsprognose). Bei Strafen, die sich im Bereich zwischen sechs Monaten und einem Jahr (z. B. Rauschgiftdelikte, Straßenverkehrsdelikte, Wirtschaftsstraftaten, Steuerhinterziehung etc.) bewegen, wird die Vollstreckung auch bei günstiger Prognose nicht ausgesetzt, wenn generalpräventive Erfordernisse ("Verteidigung der Rechtsordnung") entgegenstehen (§ 56 Abs. 3 StGB).
Strafen zwischen einem Jahr und zwei Jahren können dagegen zur Bewährung ausgesetzt werden, "wenn nach der Gesamtwürdigung von Tat und Persönlichkeit des Verurteilten besondere Umstände vorliegen" (§ 56 Abs. 2 StGB).[16] Die besonderen Umstände müssen trotz der Tatschwere eine Strafaussetzung vertretbar erscheinen lassen. Ihr Vorliegen richtet sich nach der Gesamtbewertung der Tat und der Persönlichkeit des Täters, wobei es ausreicht, wenn sie sich nicht ausschließen lassen (Dabei gilt: „in dubio pro reo“, also im Zweifel für den Angeklagten). Sie müssen über die positive Sozialprognose hinaus zusätzlich einen Verzicht auf die in der Strafvollstreckung liegende Reaktion auf ein Fehlverhalten billigen.[17]
Besondere Umstände in der Tat liegen vor, „wenn gewichtige Tatsachen die begangene Tat zugunsten des Täters von durchschnittlichen, gewöhnlich vorkommenden Taten ähnlicher Art abheben.
Dies wäre der Fall, wenn der Täter aus Not oder zur Behebung einer angespannten wirtschaftlichen Lage gehandelt hat, zur Tat gereizt, mittels intensiver Beeeinflussung durch Polizeinformanten bestimmt oder durch eine besondere Gelegenheit verlockt worden ist, aber auch, wenn der Täter selbst Verletzungen mit schweren Dauerfolgen erlitten hat. Eine besondere „Konfliktlage“ ist hierbei nicht erforderlich.“[18]
Bei Strafaussetzung zur Bewährung wird eine Bewährungszeit zwischen zwei und fünf Jahren festgelegt (§ 56a StGB). Die Dauer der Bewährung darf nicht nachträglich verlängert oder verkürzt werden.
Es besteht die Möglichkeit, dem Betroffenen Auflagen und Weisungen zu erteilen. Auflagen, wie z. B. Schadenswiedergutmachung, Geldzahlungen an eine gemeinnützige Einrichtung oder zugunsten der Staatskasse, dienen "der Genugtuung für das begangene Unrecht einer Straftat" (§ 56b StGB). Weisungen verfolgen ausschließlich das Ziel, zukünftige Straftaten des Verurteilten zu verhindern. Eine Weisung z. B. kann sein, sich der Bewährungshilfe (§ 56d StGB) zu unterstellen oder "Anordnungen zu befolgen, die sich auf Aufenthalt, Ausbildung, Arbeit oder Freizeit oder auf die Ordnung der wirtschaftlichen Verhältnisse" beziehen, bestimmte Dinge nicht zu besitzen, die "Gelegenheit oder Anstoß zu weiteren Straftaten bieten können" etc.
Kommt es zu einem Bewährungsverstoß (z. B. durch eine erneute einschlägige Straftat), kommt entweder eine Abänderung der Bedingungen der Aussetzung (§ 56f Abs. 2 StGB), also z. B. die Erteilung weiterer Auflagen oder Weisungen bzw. die Verlängerung der Bewährungszeit in Betracht. Wenn dies nicht aussichtsreich erscheint, kann die Aussetzung widerrufen werden (§ 56f Abs. 1 StGB). Dies hätte zur Folge, dass die verhängte Freiheitsstrafe zu vollstrecken ist. Ansonsten kann die verhängte Freiheitsstrafe erlassen werden (§ 56g StGB).[19]
Bei der zeitigen als auch bei der lebenslangen Freiheitsstrafe besteht die Möglichkeit, die Vollstreckung eines Strafrestes zur Bewährung auszusetzen (§§ 57, 57a StGB). Hat der zu zeitiger Freiheitsstrafe Verurteilte zwei Drittel der verhängten Strafe, mindestens aber zwei Monate abgesessen, ist eine bedingte Entlassung bei günstiger Prognose und wenn verantwortetet werden kann, dass der Verurteilte außerhalb des Strafvollzugs keine Straftaten mehr begehen wird, möglich (§ 57 Abs. 1 StGB).[20]
Hat er die Hälfte der Strafe (mindestens jedoch sechs Monate) verbüßt, ist eine bedingte Entlassung wahlweise möglich, wenn zusätzlich noch "besondere Umstände" vorliegen (§ 57 Abs. 2 StGB).
Strafgefangene, die zu lebenslangem Freiheitsentzug verurteilt wurden, sollen so auch die Chance haben, ein Leben in Freiheit führen zu können. § 57a StGB regelt dementsprechend die Aussetzung des Strafrestes bei lebenslanger Freiheitsstrafe. Voraussetzung hierfür ist die Verbüßung von mindestens 15 Jahren der Strafe.
Die "besondere Schwere der Schuld des Verurteilten“ muss ausgeschlossen werden können, Es muss eine günstige Prognose (§ 57 Abs. 1 StGB) vorliegen.[21]
2.3 Strafvollzug als totale Institution
Haftanstalten lassen sich unter dem Begriff der totalen Institutionen einordnen, welche sich durch folgende Merkmale auszeichnen:
- Diese Einrichtungen isolieren Menschen, meist auf engsten Raum,
- sie kontrollieren das Leben der Insassen.
- Es kommt zu einer sozialen Trennung zwischen der Welt der „Bewacher“ (Angestellten) und jener der „Bewachten“ (Insassen).
- Der Umgang zwischen ihnen ist durch Reserviertheit und Feindseligkeit gekennzeichnet.
Damit führt die totale Institution zu einer Organisationsform, welche ihre Insassen „verwaltet“. Es entsteht eine erzwungene Abhängigkeit von Insasse und „Aufseher“. Der Inhaftierte muss seine vorherige Identität abstreifen, jegliche Art von Privatbesitz aufgeben. Durch Demütigungen und Einschränkungen des Selbstwertgefühls der Inhaftierten entstehen starke Stressbelastungen. Ein weiteres Merkmal totaler Institutionen ist das vorhandene Kontrollsystem. Es arbeitet mit Belohnungen (Begünstigungen, Privilegien), welche sehr bedeutsam sind für den Insassen und Bestrafungen (Besuchsverbot, Einzelhaft etc.), die eine Verhaltenskontrolle ermöglichen sollen. Dem Insassen ist ständig bewusst, dass ihn die Institution zu einem regelkonformen Verhalten zwingt.[22]Alle Begebenheiten des alltäglichen Lebens finden an ein und derselben Stelle, unter ein und derselben Autorität statt. Die Mitglieder der Institution führen alle Phasen ihrer täglichen Arbeit in unmittelbarer Gesellschaft einer großen Gruppe von Schicksalsgenossen aus, wobei allen die gleiche Behandlung zuteil wird und alle die gleiche Tätigkeit gemeinsam verrichten müssen.
Alle Abschnitte des Tages sind gründlich geplant, jede Phase geht zu einem vorher bestimmten Zeitpunkt in die nächste über. Diese Tätigkeiten werden von oben durch ein System kategorischer, formaler Vorschriften und durch einen Stab von Angestellten vorgeschrieben. Die verschiedenen erzwungenen Tätigkeiten werden in einem einzigen rationalen Plan vereinigt, der dazu dient, die gesetzlichen Ziele der Institution zu erreichen. Der Insasse wird einem Prozess der „Diskulturation“ (das Unfähigmachen, mit bestimmten Gegebenheiten der Außenwelt fertig zu werden) unterworfen, der durch „Trimmen“ und „Programmierung“ und durch „Degradierungen, Demütigungen und Entwürdigungen seines Ich“ gekennzeichnet ist. Es besteht eine elementare Trennung zwischen der Gruppe der Insassen und dem zahlenmäßig unterlegenen Aufsichtspersonal.
Anders ausgedrückt: totale Institutionen sind „soziale Zwitter“, einerseits Wohn- und Lebensgemeinschaft, andererseits formale Organisationen.[23]
Nach Goffman ist eines der Hauptmerkmale totaler Institutionen: „dass der Insasse alle Bereiche seines Lebens im Anstaltsgebäude, in unmittelbarer Gesellschaft mit anderen, die ähnlich wie er von der Umwelt abgeschnitten sind, verbringt“.
Im Hinblick auf die Relation zwischen Individuum und Rolle ergibt sich in Strafanstalten die Besonderheit, dass die Gefangenen in eine Rolle hineingedrängt werden, mit der sie ihre Identität nicht oder kaum ausdrücken können.[24]”Der Neuling kommt mit einem bestimmten Bild von sich selbst in die Anstalt, welches durch bestimmte soziale Bedingungen seiner heimischen Umgebung ermöglicht wurde. Beim Eintritt wird er sofort der Hilfe beraubt, die diese Bedingungen ihm boten. ...Sein Ich wird systematisch, wenn auch häufig unbeabsichtigt, gedemütigt.”[25]
Feest erarbeitete zusätzlich folgende „riskante Konstellationen“, die man im Strafvollzug als totale Institution vorfindet:
- Die Gefahr der Eskalation auch der kleinsten Konflikte ist sehr hoch.
- Den Insassen ist es unmöglich, sich Konfliktsituationen durch Ausweichen zu entziehen.
- Die öffentliche Kontrolle ist reduziert. Diese Risiken verschärfen sich bei Überbelegung der Anstalt.[26]
Folglich unterscheidet Goffman verschiedene Möglichkeiten, mit den Bedingungen in einer totalen Institution "fertig zu werden". So wird ein bestimmtes Verhalten erlernt, um Spannungen auszubalancieren, denen sich die Inhaftierten ausgesetzt sehen.
Goffman beschreibt fünf Anpassungsformen an totale Institutionen:
a) Die Strategie des Rückzugs aus der Situation ("situational with drawal"):
Diese Art der Anpassung ist dadurch gekennzeichnet, dass der Gefangene jegliches Interesse an seiner Umgebung verliert und es unterlässt, sich an Interaktionsprozessen zu beteiligen.[27] Dieser Entwicklungsgang wird als irreversibel eingestuft, da es vom Insassen eine große Anstrengung erfordert, seinen Status zu ändern und die Mittel dazu beschränkt sind.
b) Der kompromisslose Standpunkt ("intransigent line"):
Der Strafgefangene bedroht und provoziert die Institution, indem er augenfällig die Zusammenarbeit mit dem Anstaltspersonal ablehnt. Verbunden mit andauernder Kompromisslosigkeit, erfordert diese Form der Anpassung eine laufende Ausrichtung an der formalen Organisation, das heißt, ein stark ausgebildetes Interesse für die Anstalt.[28]
Diese Nicht-Anpassungsform des Gefangenen lässt das Interesse des Anstaltspersonals an dieser Person ebenfalls steigern und führt dazu, den Willen des Insassen brechen zu wollen. Der kompromisslose Standpunkt kann als temporäre, anfängliche Anpassungsform gedeutet werden. In vielen Fällen wählt der Insasse später eine andere Form der Anpassung.
c) Kolonisierung ("colonization"):
Die Spannung zwischen Außenwelt und Haft reduziert sich, indem sich der Insasse aus den maximalen Befriedigungen, die erreichbar sind, ein möglichst stabiles, relativ zufriedenes Dasein innerhalb der Haftanstalt restauriert. Zwischen Innen- und Außenwelt bestehen für den Insassen somit keine Widersprüchlichkeiten mehr, er fühlt sich wohl. Der Insasse hegt keinen Wunsch mehr, die Anstalt zu verlassen und setzt alles daran, seine Entlassung hinauszuzögern.
d) Konversion ("conversion"):
Bei diesem speziellen Anpassungsverhalten macht sich der Gefangene das amtliche Urteil über seine Person zu Eigen und versucht, die Rolle des „perfekten Gefangenen“ darzustellen. Diese Rolle beinhaltet eine disziplinierte, moralistische und monochrome Haltung. Der Insasse biedert sich beim Personal an, hilft und unterstützt gerne.
e) Ruhig-Blut-Bewahren ("playing it cool"):
Am häufigsten findet man diese Strategie vor: Der Strafgefangene weicht allen denkbaren Konflikten aus, um die Wahrscheinlichkeit physischer und psychischer Schäden zu minimieren. Dabei wendet er eine opportunistische Zusammensetzung aller vorher o. g. beschriebenen Anpassungsformen an. Er zeigt sich loyal gegenüber anderen Insassen, um Schwierigkeiten zu vermeiden.[29]
3 Strafzwecke
„Unter strafrechtlichen Sanktionen werden alle staatlichen Maßnahmen im Rahmen eines strafrechtlichen Verfahrens verstanden, welche sich als Schuldausgleichende und/oder kriminalpräventiv ausgerichtete Rechtseinbuße gegen denjenigen richten, der eine rechtswidrige Tat (§ 11 I Nr. 5 StGB) begangen hat.“[30] Demnach sind Strafen, aus dem menschlich- rechtlichen Blickwinkel betrachtet nicht nur Sanktionen, die der Gesetzgeber als Strafe bezeichnet, sondern auch solche, die ihnen gleichkommen.[31] Für Hart ist Strafe konstituiert durch:
- “…pain or other consequences normally considered unpleasant,
- inflicted for an offence against legal rules,
- upon actual or supposed offenders on the ground of the offence committed,
- intentionally administered by human beings (other than the offender),
- Constituted as authorities within that legal system.”[32]
Das sagt aus, dass Strafe durch Schmerz (Übel) und andere unangenehme Konsequenzen gekennzeichnet ist, welche aufgrund einer Handlung gegen Rechtsvorschriften zugefügt wird. Die tatsächlichen oder angenommenen „Übeltäter“ werden somit sanktioniert. Diese Sanktion wird absichtlich durch andere Menschen ausgeübt. Nach Hart gilt Strafe als eine Autorität innerhalb eines zugelassenen Systems (Zwang).[33]
Strafe stellt ein fundamental menschliches Bedürfnis dar.[34] Unser Rechtsempfinden spiegelt sich im heutigen Strafgesetzbuch wieder. Das heißt, unser Recht ist straf- und nicht schutzorientiert. Regelungen zum Umgang mit Opfern finden wir nicht vor. Das Strafrecht widmet sich nicht speziell Sachverhalten, wie Wiedergutmachung, oder „Täter-Opfer- Ausgleich“.[35]
Sanktionen verdeutlichen in der Gesellschaft die verletzte Norm und bestätigen sie. Diese Normen setzen primär und überwachen sekundär die elementaren Bestandteile der sozialen Kontrolle. Ohne diesen mächtigen Schlusspunkt der Sanktion würde nach Rössner jede Verhaltensnorm durch Missachtung von hinten aufgerollt.[36]
Strafzwecke lassen sich klassischerweise in absolute und relative Strafzwecke unterteilen. Diese Unterscheidung beruht auf Protagoras, der bereits 400 v. Chr. schrieb:
„Niemand bestraft einen Rechtsverbrecher aufgrund abstrakter Überlegungen oder einfach deshalb, weil der Täter das Recht gebrochen hat, es sei denn einer nehme unbedacht Rache wie ein wildes Tier. Jener der mit Vernunft straft, rächt sich nicht für das geschehene Unrecht, denn er kann es nicht ungeschehen machen. Vielmehr schaut er in die Zukunft und versucht, den Täter und andere mit der Strafe davon abzuhalten, das Recht wieder zu brechen.“[37]
Dabei werden hinsichtlich der Zeitperspektive Unterschiede gemacht.
Absolute Strafzwecke beziehen sich auf die Vergangenheit („quia peccatur“) relative Strafzwecke dagegen auf die Zukunft („ne peccetur“).[38]
Abbildung 1: Zweck der Strafe[39]
Die absoluten Strafzwecke stellen keine Kriterien für die Gestaltung des Vollzugs dar, haben also keine unmittelbare Gestaltungswirkung. § 2 des StVollzG beinhaltet die ausdrückliche Beschränkung der allgemeinen Strafzwecke für den Vollzugsbereich.[40]
Die über den § 2 StVollzG hinausgehenden Strafzwecke scheiden als handlungs- und entscheidungsleitende Gesichtspunkte für Vollzugsentscheidungen aus.[41] Das Gesetz liefert uns keine ausdrückliche Erklärung zu Strafzwecken, allerdings liegen Festlegungen zu den Strafzumessungserwägungen vor. Dabei greift man auf die Grundlagenformel des § 46 StGB zurück, der die Grundsätze der Strafzumessung, also die Schuld des Täters voraussetzt.[42] Die Wirkungen, die von der Strafe für das künftige Leben des Täters in der Gesellschaft zu erwarten sind, sind dabei zu berücksichtigen.[43]
Hinsichtlich der Einteilung der Strafzwecke können wir auch das Modell der verschiedenen Spuren hinzuziehen. Es differenziert zwischen ein- und zweispurigen Möglichkeiten (z. B. Strafe nach Schuldzumessung, Strafe aus Gründen der Gefährlichkeit oder für Schutz der Gesellschaft) und geht auf die Frage zurück, weswegen wir strafen. Das deutsche Recht verfolgt seit Bestehen des Gewohnheitsverbrechergesetzes von 1933 ein zweispuriges Modell, welches zwischen Strafen und Maßregeln unterscheidet. Dabei handelt es sich um ein festverbundenes Modell von repressiven und präventiven Einzelstücken.
Eine mögliche dritte Spur stellt das Konzept der Wiedergutmachung dar, welche in § 46 StGB als „Strafersatz“ angesprochen wird.[44]
3.1 Absolute Strafzwecke - Vergeltungsgedanke und Sühne
Die Strafrechtstheorie nach Kant basiert auf der Annahme, dass Strafe nie Mittel zum Zweck ist, weder für den Täter noch für andere Mitglieder der Gesellschaft. Strafe soll Vergeltung für begangenes Unrecht darstellen. Art und Schwere der Sanktion hängen von dem Prinzip der Gleichheit von Art und Schwere des Unrechts ab.[45]
Unter den absoluten Strafzwecken lassen sich Rache, Vergeltung und Sühne einordnen. Der Ausdruck „absolut“ wird verwendet, um deutlich zu machen, dass diese Strafzwecke eine Reaktion auf ein Unrecht als Absolutum fordern.
Diese Strafzwecke werden also als von der Wirklichkeit „Losgelöstes“, als in sich Begründetes und Ruhendes beschrieben. Absolute Strafzwecke haben den Anspruch, dass ein Verbrechen gesühnt wird, schlicht weil es stattgefunden hat, und nicht aus dem Grund, weil es dem Opfer dadurch besser gehen würde, oder weil der Täter dadurch etwas lernen würde.
Als absolute Strafzwecke stellen schlussfolgernd keine Verbindungen zur Kriminalprävention oder Kriminalitätsbelastung her. Das heißt, es muss eine Reaktion auf delinquentes Verhalten erfolgen, unabhängig ob und wie diese Reaktion wirkt.[46] Absolute Straftheorien und die zugehörigen Strafzwecke der Vergeltung und Sühne orientieren sich an der zurückliegenden Tat. In dieser Vergangenheit wird der Grund gesucht, also den Beweggrund und das Maß der Strafe. Die Zukunft, die Folgen der Strafe und ihre möglichen general- und spezialpräventiven Wirkungen interessierten dabei nicht.[47]
Mit dem Vergeltungsgedanken assoziieren wir die Ansätze nach Kant (1724-1804) und Hegel (1170-1831). Ihre strafrechtsdogmatische Rückbindung liefern das Schuldprinzip und den Gedanken der Tatproportionalität.
Die Strafe darf also:
„ …niemals bloß als Mittel, ein anderes Gutes zu befördern, für den Verbrecher selbst, oder für die bürgerliche Gesellschaft, sondern muss jederzeit nur darum wider ihn verhängt werden, weil er verbrochen hat; denn der Mensch kann nie bloß als Mittel zu den Absichten eines anderen gehandhabt und unter die Gegenstände des Sachenrechts gemengt werden [...] Er muss vorher strafbar befunden seyn, ehe noch daran gedacht wird, aus dieser Strafe einige Nutzen für ihn selbst oder seine Mitbürger zu ziehen. Das Strafgesetz ist ein kategorischer Imperativ…. „[48]
Wenn es möglich ist, dass das dem Straftäter zugefügte Strafleid als Mittel zur Erreichung irgendeines Nützlichkeitszwecks eingesetzt werden kann, dann bleibt die Möglichkeit bestehen, dass die Strafe gegen den Verbrecher nur darum verhängt wird, „weil er verbrochen hat“. Die Strafe ist absolut, wenn sie allein um der Gerechtigkeit willen verhängt wird und nicht um der Nützlichkeit willen, um bestimmte Ziele zu erreichen, wie z. B. Sicherung, Besserung oder Abschreckung.[49]
Strafe allein aus Vergeltung ist frei von Zweckerwägungen und bildet lediglich ein Übel zum Ausgleich der schuldhaft begangenen Rechtsverletzung. Vergeltung und Sühne gelten als metaphysische, erfahrungswissenschaftlich nicht überprüfbare Strafzwecke.[50]
Die absoluten Theorien haben metaphysischen Charakter, sie sind nicht empirisch überprüfbar. Basisproblem hierbei ist, dass die absoluten Straftheorien einem urmenschlichen Bedürfnis entsprechen, gleichermaßen aber mit dem Ziel der Kriminalitätsreduktion im Widerspruch stehen. In einer Entscheidung des Bundesgerichtes heißt es demnach:
„…dass der Aufschub der Strafe die Wahrscheinlichkeit erneuter krimineller Handlungen zu senken im Stande ist, so ergibt sich daraus ein fundamentales Wertungsproblem: Entweder wir orientieren uns auf die Zukunft hin und versuchen zukünftige Kriminalität zu verhindern. Dann müssen wir unser Strafbedürfnis zurückstellen. Oder aber wir orientieren uns an der Vergangenheit und Gegenwart und lassen entsprechend unser Strafbedürfnis zum Zuge kommen. Dann aber müssen wir akzeptieren, dass wir dadurch möglicherweise die Entstehung zukünftiger Kriminalität zumindest nicht reduzieren, möglicherweise gar fördern. Geht man davon aus, dass unser Gerechtigkeits- und Sicherheitsgefühl durch die Ausfällung von Vergeltungsstrafen gesteigert wird, dann ergibt sich daraus – zugespitzt formuliert – das Problem, dass wir uns entscheiden müssen: Entweder wir fühlen uns sicher und bezahlen dafür mit einer möglichen Reduktion der tatsächlichen Sicherheit, oder aber wir fördern die Sicherheit, müssen dafür aber hinnehmen, dass wir uns unsicherer fühlen. Noch anders ausgedrückt: Unser Wunsch nach umfassender Gerechtigkeit hat seinen Preis.“[51]
Der Vergeltungsgedanke stellt eine allgemeine, weit verbreitete, simple Vorstellung der Gesellschaft dar, der Täter soll nach begangener Straftat leiden. Der Staat ist somit ermächtigt und moralisch verpflichtet, jene Personen zu bestrafen, die Gesetze missachtet haben. Die Straftat stellt einen Verstoß gegen den Staat dar. Gefängnisse sollen also der Bestrafung des Täters dienen. Die Straftat soll in diesem Zusammenhang „zurückgezahlt“ werden, in einem Ausmaß, welches genauso schwer wiegt, wie die Tat. Der Täter soll die „gerechte Strafe“ erhalten. Besonders deutlich zeigt sich der Vergeltungsgedanke in der Gesellschaft, wenn Reformgedanken umgesetzt werden sollen oder es um Budgetangelegenheiten für den Strafvollzug geht.[52]
3.2 Relative Strafzwecke
Relative Strafzwecke nennt man relativ, weil sie sich auf die Wirklichkeit, die Kriminalitätsrate beziehen.[53] Diese Strafzwecke verfolgen Strafe nicht um ihrer selbst willen, sondern aus einem konkreten Zweck- der Prävention. Hier findet sich der Bezug zur Zukunftsorientierung. Relative Strafzwecke haben das Ziel, Kriminalität zu mindern, indem sie Verbrechen verhindern. Sie fordern Strafe, um dadurch die Kriminalität zu senken. Relative Strafzwecke werden unterteilt in General- und Spezialprävention.
Generalprävention spricht die Allgemeinheit der möglichen Straftäter an, folglich uns alle, Spezialprävention dagegen den spezifischen Straftäter als einzelnen Mensch. Beide Präventionsarten werden weiterhin in positive und negative unterschieden.[54]
3.2.1 Die negative Generalprävention –Abschreckung
Begründer dieser Straftheorie ist Johann Anselm Feuerbach (1775-1833). Feuerbach ging davon aus, dass die Rechtfertigung einer Strafe in der vergangenen Handlung selbst liegt und somit absolut begründet ist. Strafe soll somit niemals Mittel sein, einem vom Staat vorgegebenen Zweck zu erreichen. Die Strafe muss einen rechtlichen Zweck verfolgen, um sich von der Rache zu unterscheiden. Diese Theorie dient dementsprechend nicht der Rechtfertigung der Strafe sondern der Rechtfertigung von Gesetzen.[55]
Hier geht man davon aus, dass die primäre Triebfeder für die Vermeidung krimineller Handlungen die Angst vor Strafe ist, nicht ein „moralisches Bewusstsein“. Es wird behauptet, dass durch eine exemplarische Bestrafung einiger weniger Straffälliger (also auch potenzielle Täter) eine Abschreckung der Allgemeinheit möglich sei (Generalprävention).[56]
Die Drohung des Gesetzes muss, wenn sie wirksam sein soll, auch Wirklichkeit werden, die Bestrafung eine notwendige Folge der Rechtsverletzung sein.[57] Strafrechtlich betrachtet heißt das, dass der Preis für einen Regelverstoß so hoch angesetzt wird, dass es sich für zukünftige Täter nicht lohnt, die Regel zu brechen. Man geht davon aus, dass der Einzelne, die Sanktion, die auf seine Straftat erfolgt, ernst nimmt und sich dadurch so beeindrucken lässt, dass er zukünftiges delinquentes Verhalten unterlässt. Die Theorien der Abschreckung behaupten, dass das Verhalten der Menschen durch Berechnungen geprägt ist. Sind die daraus zu erwarteten Nachteile größer als die Vorurteile, verzichtet der Betroffene auf die Handlung.
Aus aktueller Sicht gehören die Abschreckungstheorien zu den beliebtesten Theorien der Kriminalpolitik.[58]
3.2.2 Die negative Spezialprävention
„Adressat aller Spezialprävention ist der einzelne Täter, auf den im Sinne der Rückfallvermeidung eingewirkt werden soll: „positiv“ durch „Resozialisierung“, „negativ“ durch Sicherung (Verwahrung) des einzelnen Täters zum Schutz der Gesellschaft.“[59]. Unter diesem Aspekt wird betont, dass die Hafterfahrung ausreichend unangenehm sein muss, um künftiges Wohlverhalten zu erzielen (Spezialprävention). Dieser Ansatz geht davon aus, dass der Täter durch die Strafe von der Begehung weiterer Straftaten abgehalten wird (Individualabschreckung). Die Gesellschaft soll durch die Inhaftierung des Täters vor neuen Taten des Täters geschützt werden.[60]
Franz von Liszt (1851-1919) ist Begründer der Spezialpräventionstheorie. Für ihn war jede kriminelle Handlung ein „Produkt aus der Eigenart des Verbrechers einerseits und den den Straftäter im Augenblick der Tat umgebenden gesellschaftlichen Verhältnissen anderseits“. Strafe rechtfertigt sich nach ihm durch die Aufrechterhaltung der Rechtsordnung, als Schutzmittel der Gesellschaft (deterministische Sichtweise). Strafe wird ausschließlich aus Zweckgründen vollzogen. Die „gerechte“ Strafe ist so die „notwendige“ Strafe. Liszt kategorisiert Straftäter in drei Gruppen:
- die Unverbesserlichen (Gewohnheitsverbrecher),
- die Besserungsbedürftigen und
- die Gelegenheitsverbrecher.
Vor den Unverbesserlichen muss die Gesellschaft beschützt werden, die Besserungsbedürftigen sollen resozialisiert werden, die Gelegenheitsverbrecher durch Strafe abgeschreckt werden (Die richtige Wahl der Sanktion soll ausschlaggebend sein).[61]
Die Sicherungsverwahrung (SV) soll nun als Beispiel für die negative Spezialprävention näher betrachtet werden.
Die Sicherungsverwahrung als besondere Form des Vollzugs wird als Maßregel der Besserung und Sicherung neben einer Freiheitsstrafe von mindestens 2 Jahren aufgrund einer vorsätzlichen Straftat angeordnet. Meist liegen frühere Verurteilungen bzw. Inhaftierungen vor.[62]
Die Inhaftierung bis zum Tode beruht auf der Annahme, dass alle Ursprünge gefährlichen Verhaltens in der Persönlichkeit des Täters liegen und dort an bestimmten Merkmalen zu erkennen sind.[63] Die Gesamtwürdigung des Straftäters und seiner Taten ergibt, dass er infolge eines Hanges zur erheblichen Straftaten[64] vorhanden ist (§ 66 Abs.1 StGB). Eine SV kann auch angeordnet werden, wenn keine frühere Verurteilung oder Haftaufenthalte vorliegen. Dies kann aufgrund der hervorgetretenen Gefährlichkeit des Täters nach dreier vorsätzlicher Straftaten, durch die er jeweils mindestens ein Jahr Haft verwirkt hat und er nun eine Gesamtstrafe (§ 53 Abs. I StGB) von mindestens drei Jahren Freiheitsentzug erhalten hat, der Fall sein (§ 66 Abs. II StGB). Das Gesetz zur Bekämpfung von Sexualdelikten und anderen gefährlichen Straftaten vom 26.01.1998 erweiterte den Anwendungsbereich der SV in diesen Fällen (§ 66 Abs. III StGB). Im Unterschied zum Resozialisierungsauftrag des § 2 StGB gilt hier entsprechend § 129 StGB, der als vorrangiges Ziel der Unterbringung die sichere Verwahrung zum Schutz der Allgemeinheit vorsieht. Den Sicherungsverwahrten soll dennoch geholfen werden, sich nach Entlassung in das Leben in Freiheit einzugliedern.
Die SV schließt sich an die Vollstreckung einer Freiheitsstrafe an. Vor Ende der Freiheitsstrafe prüft das Vollstreckungsgericht, ob die Unterbringung noch erforderlich ist (§ 67c Abs. I StGB). Gehen vom Straftäter keine erheblichen Gefahren mehr aus, oder erscheint er sozialisiert, kann die Maßregel ausgesetzt werden. An dieser Stelle würde die Führungsaufsicht über den Gefangenen eintreten (§ 67d Abs. II StGB).
Kommt es zu einer SV nach einer Freiheitsstrafe, so wird mindestens aller zwei Jahre von Amts wegen geprüft, ob die weitere Vollstreckung eventuell zur Bewährung ausgesetzt werden kann (§ 67e Abs. I, II StGB). Diese Entscheidung trifft die Strafkammer, welche mit drei Richtern besetzt ist.
Mit einer möglichen Entlassung aus der SV tritt Führungsaufsicht ein, auch wenn die Maßregel rechtlich für erledigt erklärt wurde.
Das bedeutet gleichermaßen, dass eine SV lebenslänglich dauern kann, wenn der Hang, erhebliche Straftaten zu begehen nicht nachweislich widerlegt ist. Dies geschieht vorwiegend aus Gründen der Sicherheit für die Allgemeinheit, die Sicherungskomponente steht im Vordergrund.[65]
3.2.3 Die positive Spezialprävention (Resozialisierung)
Die Resozialisierung als eine Wiedereingliederung in die Gesellschaft betrifft das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft. Der Begriff ist somit weder individuumszentriert noch einer ätiologischen Kriminalitätstheorie verpflichtet.[66]Die positive Spezialprävention beabsichtigt Straftäter über Besserung, Erziehung und Wiedergutmachung von einer erneuten Delinquenz abzuhalten. Es muss betont werden, dass der Begriff der Resozialisierung sehr unscharf und mehrdeutig erscheinen kann. Nehmen wir an, er meint einen Prozess, indem der Straffällige in die ihn umgebende Gesellschaft und Kultur hineinwächst, soziale Normen und Werte, Rollen erlernt und zum eigenständigen handlungsfähigen Individuum wird (Sozialisation), dann muss definierbar sein, welche soziale Normen und Rollen erlernt werden, was es bedeutet, in die Gesellschaft hineinzuwachsen, und was es genau darstellt, ein handlungsfähiger Mensch zu sein. Die Anpassung Straffälliger an ein Idealbild gesellschaftlicher Konformität muss kritisch betrachtet werden, einem Bild, dem die restliche Bevölkerung selbst nicht entspricht. Niggli vertritt den Standpunkt, dass bezüglich des deskriptiven Begriffs der Normalität (Straftaten, die in der Bevölkerung häufig auftreten) Kriminalität als „normal“ gelten müsste.[67]
Ich vertrete die Auffassung, dass eine absolute Konformität an die Gesellschaft vom entlassenen Täter nicht erwartet werden kann, wenn die „Normalbevölkerung“, wenn auch nicht in starken Maße, täglich Straftaten begeht. Nicht registrierte Straftaten der Bevölkerung (z. B. Sachbeschädigungen an Kfz, Unterschlagung, Fahrerflucht, Versicherungsbetrug) fallen so in das Dunkelfeld der Kriminalität und können nicht sachlich polizeilich ausgewertet werden. Man kann aber mit Sicherheit davon ausgehen, dass diese Straftaten existieren. Kury zeigte in einer Untersuchung im Jahr 2001, dass das Dunkelfeld über alle Straftaten hinweg bei ca. 90% (!) liegen dürfte. Lediglich eine von 10 Straftaten wird registriert.[68] Von daher sollte von einer erwarteten völligen Straffreiheit des Insassen nach Entlassung aus der Haft abgesehen werden, wenn man sich an der restlichen Gesellschaft orientiert.
Der Resozialisierungsgedanke stößt in vielerlei Hinsicht an seine Grenzen: Die Resozialisierung soll künftiges strafbares Verhalten verhindern, der Zeitpunkt der Resozialisierung ist aber nicht voraussehbar, der Betroffene müsste also solange in Haft verweilen, bis er vollständig resozialisiert ist.
Die Resozialisierung an sich lässt sich nicht beurteilen, was zur Folge hätte, dass eine Strafe von unbestimmter Dauer sowie die Abkehr vom Verhältnismäßigkeitsprinzip einen Verstoß gegen das Schuldprinzip darstellen würde. Die Spezialprävention lässt offen, was mit nichtresozialisierungsbedürftigen Tätern geschehen soll (z. B. bei Fahrlässigkeit).[69]
Das Sozialisationsziel (Resozialisierung) des StVollzG beinhaltet zwei zentrale Verfassungsgrundsätze:
- dem Gebot der Menschenwürde und
- das Sozialstaatsprinzip.
Die verfassungsrechtlichen Grundlagen gehen aus Art. 2 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 GG hervor, welche beinhalten, dass der Gefangene eine Anspruch auf (Re)- Sozialisierung hat. Art. 20 Abs. 1 und Art. 28 Abs. 1 GG verpflichten den Staat, die notwendigen Mittel zur Realisierung von Resozialisierungsbemühungen zur Verfügung zu stellen.[70]Das Resozialisierungsinteresse wird dementsprechend vom Bundesverfassungsgericht damit untermauert, dass auf dem Hintergrund des Sozialstaatsprinzips das Grundrecht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit (Art. 2 I GG) zu gewähren ist und ferner die staatliche Schutzverpflichtung gegenüber der Unantastbarkeit der Menschenwürde wahrzunehmen ist. Kritisch muss hinterfragt werden, ob eine durch besondere persönliche Verhältnisse bedingte bleibende Gefährlichkeit des Täters für die Allgemeinheit das Resozialisierungsziel außer Kraft setzt. Damit schließt sich, der trotz aller Resozialisierungsbemühungen „gefährlich Bleibende“ selbst, aufgrund seiner persönlichen Verhältnisse, von der Verwirklichung des Resozialisierungsziels aus.[71]
Weber äußerte sich kritisch dazu:
„Der Täter wird durch das Strafurteil in die künstliche soziale Welt des Gefängnisses hineinverpflanzt, dort lokalisiert man das Übel der Kriminalität in der Person des aus seinen alltäglichen sozialen Bezügen herausgelösten Täters und unterwirft ihn sowohl den Alltagszwängen des Vollzuges wie auch spezifischen Behandlungsprozeduren durch Experten/ Fachdiensten, um ihn am Ende als persönlich und sozial ´geheilt´ zu entlassen.“[72]
Der Schritt aus der geschlossenen Institution Strafvollzug in die offene Situation der Entlassung führt letztendlich zu einem äußeren und inneren Strukturverlust beim Häftling. Institutionelle Übergangshürden und individuelle Übergangskonflikte verstärken einander.[73]
3.2.4 Die positive Generalprävention (Normbekräftigung)
Kriminalitätsprävention bezogen auf die Allgemeinheit existiert in zwei Varianten: Positive und negative Generalprävention.
Die positive Generalprävention wendet sich der Allgemeinheit zu, also der Gesellschaft, positive Spezialprävention dagegen dem einzelnen Täter.
Es wird die Ansicht vertreten, dass nicht primär des Rechtsverbrechens wegen gestraft wird, sondern der konformen Mehrheit wegen.
So sollen Sanktionierungen der Stabilisierung des Rechtsstaates dienen, sie ist somit an diejenigen gerichtet, welche an das Gesetz glauben. Es geht um die Etablierung und Aufrechterhaltung eines Plus, nicht lediglich um die Abwendung eines Minus- also um interne Verhaltenskontrolle.[74]
Als klassischer Vertreter der positiven Generalprävention wird Emile Durkheim (1858-1917) benannt. Seine Theorie zur Rechtfertigung von Strafe basiert auf den Begriffen der Kriminalität und des Kollektivbewusstseins. Durkheim ist der Meinung, würden kriminelle Handlungen nicht bestraft, würde dadurch nicht gezeigt werden, dass dieser besondere Fall eine Anomalie ist. Das Kollektivbewusstsein der Gesellschaft würde auf Dauer erschüttert sein. Die Bestrafung oder Verurteilung des Täters würde dagegen das Bewusstsein der Bevölkerung festigen und es verdichten. Strafe wird von Durkheim aus dem Begriff der Kriminalität abgeleitet. Durch Kriminalitätsaufkommen wird nach Durkheim das Gemeinschaftsbewusstsein verletzt, welches durch die Strafe wieder hergestellt werden soll. Auf diese Art und Weise soll der soziale Zusammenhalt repariert werden. Die Verteidigung der Sozialordnung ist somit das essenzielle Ziel der Sanktion. Die Sanktion hat somit nicht nur Ausgleichs- sondern auch Sühnecharakter. Darunter versteht Durkheim eine über die Wiedergutmachung hinausreichende Leistung des Straftäters. Die Theorie der positiven Generalprävention wird postuliert durch eine Bekräftigung der Geltung von Normen durch gerechte Strafen.[75]
4 Vollzugsziele und Vollzugsgrundsätze
Das Gesetz unterscheidet zwischen Vollzugszielen und sekundären Vollzugsaufgaben.[76] Die Aufgabe des Vollzuges finden wir im § 2 StVollzG wieder. Dieser besagt:
„ Im Vollzug der Freiheitsstrafe soll der Gefangene fähig werden, künftig in sozialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu führen (Vollzugsziel). Der Vollzug der Freiheitsstrafe dient auch dem Schutz der Allgemeinheit vor weiteren Straftaten“.[77]