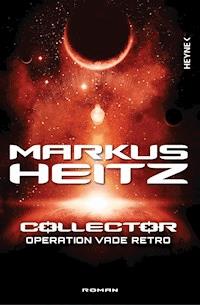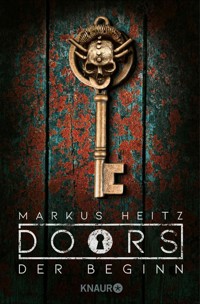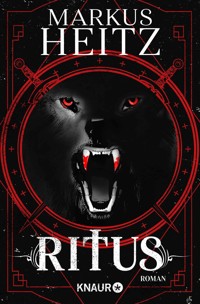
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Pakt der Dunkelheit
- Sprache: Deutsch
Zwei Männer, die nur ein Ziel kennen. Fluch, der die Jahrhunderte überdauert. Der Auftakt zu Markus Heitz' großer Mystery-Bestseller-Serie »Pakt der Dunkelheit« in cooler Neuausstattung. Frankreich im Jahre 1764. Die Menschen des Gévaudan leben in Angst, denn in den umliegenden Wäldern wütet ein Untier, dem Frauen, Kinder und selbst starke Männer zum Opfer fallen. Ist es ein besonders aggressiver Wolf, wie die Obrigkeit behauptet – oder das Werk des Teufels, der eins seiner Geschöpfe entsandt hat, Angst und Schrecken zu verbreiten? Unter den Männern, die sich auf die Jagd nach dem Untier begeben, ist auch der Wildhüter Jean Chastel. Er selbst birgt ein dunkles Geheimnis, das ihn untrennbar an die Bestie kettet – ebenso wie die Äbtissin Gregoria. Eine gefährliche Reise führt die beiden schließlich nach Rom, denn auch in der Ewigen Stadt beginnt ein Dämon zu wüten, dessen Hunger nicht zu stillen ist – und der auch zweihundert Jahre später noch Opfer fordern wird … »Der Roman fesselt seinen Leser von der ersten Seite an, bietet sowohl knallharte Action als auch sorgfältig recherchierte historische Details.« phantastik-news.de Die Neuausgaben der Reihe »Der Pakt der Dunkelheit« von Markus Heitz auf einen Blick: Ritus Sanctum Blutportale
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 662
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Markus Heitz
Ritus
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Inhaltsübersicht
I. Kapitel
II. Kapitel
III. Kapitel
IV. Kapitel
V. Kapitel
VI. Kapitel
VII. Kapitel
VIII. Kapitel
IX. Kapitel
X. Kapitel
XI. Kapitel
XII. Kapitel
XIII. Kapitel
XIV. Kapitel
XV. Kapitel
XVI. Kapitel
XVII. Kapitel
XVIII. Kapitel
XIX. Kapitel
XX. Kapitel
XXI. Kapitel
XXII. Kapitel
XXIII. Kapitel
XXIV. Kapitel
XXV. Kapitel
XXVI. Kapitel
XXVII. Kapitel
XXVIII. Kapitel
XXIX. Kapitel
XXX. Kapitel
XXXI. Kapitel
XXXII. Kapitel
XXXIII. Kapitel
XXXIV. Kapitel
XXXV. Kapitel
XXXVI. Kapitel
Lesen Sie, wie es weiter geht:
Landkarte
Nachbemerkung
Bonusmaterial
Historische Fakten und neue Ideen
Ein Blick hinter die Kulissen
I. Kapitel
Mit einer monotonen Melodie gluckerte der Bach über die runden Steine. Die Abendsonne fiel durch die wenigen lichten Stellen des dichten Blätterwerks der Bäume und erzeugte goldenrote Flecken auf dem schattigen Waldboden. Insekten waren auf der Suche nach Nahrung und summten durch die warme Luft. Der verführerische Duft leitete sie. Es roch nach Frühling, nach neuem Leben. Und nach Verwesung.
Die Fliegen schwirrten aufgeregt zu dem dicken unteren Ast einer mächtigen Buche, an dem ein stinkender Schafskadaver zwei Schritte über der Erde an einer Kette hing. Unmittelbar darunter baumelte eine höchst seltsame, tote Kreatur.
»So etwas … habe ich noch niemals gesehen.« Jean Chastel, ein Mann Mitte fünfzig und von Kindesbeinen an Wildhüter, trat vorsichtig näher und stieß den Fang mit der Mündung seiner doppelläufigen Muskete an. In seinem glatt rasierten, kantigen Gesicht standen Entsetzen, Unglaube und höchste Aufmerksamkeit. Das merkwürdige Tier, das an der Wolfsangel gefangen hing, kannte er nur aus Erzählungen und von den Flugblättern fahrender Schauspielertruppen. Diese Erzählungen und die dazugehörigen Zeichnungen waren alles andere als beruhigend.
Das wolfsartige Tier rührte sich nicht.
Jean meinte, einen schwarzen Streifen auf dem Rücken zu erkennen, der sich vom Kopf bis zum dünnen Schwanz zog. Das Fell selbst war dunkel und ging ins Rötliche über. Die Klauen, doppelt so groß wie eine Frauenhand, beeindruckten ihn fast am meisten. Wenn da nicht die Reißzähne gewesen wären …
Es hatte sich den Köder durch einen beherzten Sprung holen wollen. Der im verrottenden Schaf verborgene Fleischerhaken war ihm zum Verhängnis geworden: Das spitze Metallende ragte aus der blutverkrusteten Schnauze heraus und bog den großen Kopf nach oben. Dadurch hatten sich die gewaltigen Kiefer, die einen Oberschenkelknochen durchbeißen würden, geöffnet und die Fangzähne von der Länge eines Mittelfingers preisgegeben.
Es raschelte, als sein jüngerer Sohn Antoine neben ihn trat. »Ein Männchen«, sagte er, als sähe er eine derartige Kreatur jeden Tag. Trotz seiner zwanzig Jahre wirkte er noch sehr jung, und sein kurzer, dunkler Bart änderte daran nichts. Im Gegensatz zu seinem Vater zeigte er sich von der Entdeckung unbeeindruckt. Er hatte nicht einmal Angst. Sein Geschäftssinn erkannte sogleich die Vorzüge. Er zückte grinsend seinen Jagddolch und deutete auf die Geschlechtsteile des nun sachte hin und her pendelnden Wesens. »Seine Eier werden uns beim Arzneihändler einen Haufen Geld bringen.«
Jean, dem die Sache noch immer nicht geheuer schien, packte ihn am Arm und hielt ihn zurück. Der kurze, weiße Zopf hüpfte auf dem Rücken. »Bleib zurück!« Er wartete auf ein Zucken des Kadavers, das auf Leben hindeutete. Als es ausblieb, öffnete er die Hand und gab Antoine frei. »Lass sie ihm. Das sollen sich Gelehrte anschauen, bevor wir es auseinanderschneiden.«
Das Knistern von trockenem Laub verriet das Nahen eines weiteren Mannes. Die Jäger der Familie Chastel waren vollständig versammelt. »Beim Allmächtigen!«, entfuhr es dem älteren Sohn Pierre. Er glich seinem Vater sehr, nicht nur äußerlich. Verstört betrachtete er das Tier und bekreuzigte sich. »Dieses Vieh … stinkt infernalisch und ist … hässlich.« Er betrachtete die starken Klauen, den großen Kopf, die gewaltigen Kiefer, das buschige Schwanzende und die kleinen, spitzen Ohren eingehend. Sein sonst so freundliches Gesicht verzog sich voller Abscheu. »Was soll das sein? Ein Wolf aus der Hölle?«
Jeans braune Augen glitten über das, was sie seit vier Tagen auf Bitten des befreundeten Wildhüters DeBeaufort im Vivarais gejagt hatten. Eigentlich stammten er und seine Söhne aus dem benachbarten Gévaudan-Gebiet. Nach einundzwanzig getöteten Schafen, zwei gerissenen Kühen und einem toten Hirten hatten die Bauern gedroht, den guten Bekannten aus seinem Amt zu werfen. Die Chastels waren daraufhin ins östliche Südfrankreich gereist, um ihm beizustehen.
Nicht zuletzt verstand Jean es auch als Vorsorge. Fand der gewiss tollwütige Wolf hier nichts mehr, käme er ins Gévaudan. Nur ein toter Wolf war ein guter Wolf. Wenn es sich überhaupt um einen handelte. Was er gerade betrachtete, hatte nichts mit einem der Graupelze gemein, die er kannte.
»Loup-Garou«, gab Antoine leise lachend die Antwort auf Pierres Frage. Er drehte sich grinsend zu seinem Vater um. »Wir haben einen leibhaftigen Werwolf gefangen!«
»Aber ich dachte, es gibt sie nur in Geschichten.« Pierre nahm den Dreispitz vom Kopf, wischte sich den Schweiß von der Stirn und setzte den Hut wieder auf die kurzen schwarzen Haare; dabei fiel sein Blick auf den dicken Ast, über den die Kette lief. Die Rinde und das Holz darunter waren regelrecht abgehobelt worden. »Er hat lange gekämpft«, sagte er und machte die anderen auf die Scheuermale aufmerksam. »Ich danke Gott, dass wir der Bestie nicht bei der Jagd gegenüberstanden. Sie wird mehr als eine Kugel vertragen. Die Zähne …« Er schüttelte sich.
Jean entdeckte tatsächlich vier verheilte Einschusslöcher am Leib der Bestie. »Du hast Recht. Das erklärt, weshalb DeBeauforts Treffer keine Wirkung zeigten. Ein gewöhnlicher Wolf wäre nach einem Schuss schon tot gewesen.« Jean hatte sich bereits gewundert, weshalb ihn sein in der Jagd erfahrener Freund um Beistand bat. »Ich hielt seinen Bericht zuerst für eine Übertreibung.«
Antoine ging zum Stamm der Buche und machte sich daran, die Bolzen zu lösen, mit denen die Fangkette gesichert war, um das Wesen zur Erde zu lassen. »Sie werden uns feiern wie Helden«, freute er sich. »Wir können eine stattliche Belohnung fordern. Wenn wir das Biest in seine Einzelteile zerlegen und verkaufen, machen wir ein kleines Vermögen.«
»Die Mädchen werden dich anhimmeln, das meinst du doch.« Pierre spie aus. »Ich habe gesehen, dass du wieder einmal deine Finger nicht von einer Kleinen lassen konntest. Du hast sie auf deinem Schoß reiten lassen.«
Sein jüngerer Bruder hielt inne und schaute rasch zum Vater, dessen Miene sich verfinsterte. »Nein, ich habe nichts getan!«, wehrte er ab. »Pierre hasst mich, das weißt du, Vater. Er will mich bei dir …«
Jean kam auf ihn zu. »Pierre lügt nicht.« Er baute sich vor ihm auf. »Im Gegensatz zu dir. Was hast du dieses Mal getan? Wie alt war sie?«
»Sechzehn«, erwiderte Antoine und wollte sich der Kette widmen, aber sein Vater packte ihn bei der Schulter und drehte ihn mit Gewalt herum, so dass er ihm ins Gesicht blickte. Die grünen Augen hielten dem wütenden Braun nicht lange stand. »Zwölf«, brach es gequält aus ihm heraus, und er senkte den Kopf. »Vater, ich kann nichts dafür! Es ist …«
»Schwein!« Jean schlug ihm die Faust gegen die Lippen, Antoine verlor den Dreispitz und prallte mit dem Rücken gegen den Kadaver der Bestie, der daraufhin wie eine Marionette grotesk zu zappeln und zu tanzen begann; die Kette klirrte und spielte die Melodie dazu. »Ich habe es dir bereits zu oft gesagt: Lass die Kinder in Ruhe«, warnte er ihn mühsam beherrscht. »Kauf dir so viele Huren wie du möchtest, aber fass die Unschuldigen nicht an! Wenn sie dich festnehmen, werde ich dich nicht schützen.« Abrupt drehte er sich um. »Und jetzt lass das Vieh runter, ehe die Maden es auffressen.«
Antoine fuhr sich mit dem Rockaufschlag über den geschundenen Mund, wischte das Blut von den aufgeplatzten Lippen und stierte seinen Bruder an. Lautlos formte er das Wort Verräter. Er griff nach seinem Hut, stülpte ihn auf die langen, ungepflegten schwarzen Haare und lockerte die Bolzen so weit, bis sich die Kette abwickelte.
Der Körper des seltsamen Tiers prallte unsanft auf den Boden, die Mücken stoben in Schwärmen davon, umkreisten den übel riechenden Schafköder aber bald wieder in kleinen, schwarzen Wolken. Larven krochen über das Fleisch, bohrten sich ihren Weg hinein und verzehrten es langsam, aber beständig.
Die Chastels betrachteten den Loup-Garou schweigend. Der nüchterne Verstand von Jean und Pierre fand sich mehr und mehr damit ab, dass es dieses Wesen wirklich gab. Antoine hatte seine Existenz bereits mit dem ersten Blick hingenommen. Nun hob er den Kopf und lauschte in den Wald. »Surtout!«, rief er nach seinem Jagdhund, einem großen muskulösen Mastiff, der ihn überall hin begleitete. »Wo ist dieser Bastard?«, murmelte er und starrte ins dichte Unterholz. »Surtout!«
Jeans Entsetzen schwand endgültig und wich der Neugier des Wildhüters, der eine neue Spezies entdeckt hatte. Er zog die Augenbrauen zusammen, kniete sich neben den Rücken des Tieres und strich mit den Fingern über das dichte Fell. Sein weißer Haarzopf rutschte nach vorne. »Das Vieh ist dürr. Es muss lange nichts mehr zu fressen bekommen haben.«
Pierre stand einen Schritt weit entfernt und hatte die Muskete locker auf das Tier angelegt. »Gib Acht, Vater.«
»Traust du dem Frieden nicht?« Antoine näherte sich ihm, seine Haltung drückte Verachtung gegenüber dem Bruder aus. »Hasenfuß! Der Loup-Garou ist tot.« Er trat dem Tier in die Flanke. »Verhungert oder erstickt.«
Plötzlich knackte es im Gebüsch. Pierre wirbelte herum, der Lauf zeigte auf das dichte Unterholz.
Antoine griente abfällig. »Hat der Verräter Angst? Keine Sorge, Surtout tut dir nichts. Der frisst nur kleine Kinder.« Er nahm seine Muskete und pirschte auf das Unterholz zu. »Mal sehen, was er aufgestöbert hat. Vielleicht eine junge Magd, die sich am Bach waschen will?«
»Komm zurück«, verlangte Pierre, doch sein Bruder war nach wenigen Schritten mit dem dunklen Grün verschmolzen. Lediglich das leiser werdende Rascheln der Zweige zeigte, wo er sich befand.
»Was sechs Jahre Altersunterschied ausmachen«, murmelte Jean kopfschüttelnd und vermied es, sich einmal mehr Sorgen um seinen Jüngeren zu machen, den er nur mit auf die Jagd nahm, weil er ein begnadeter Schütze war. Antoine hauste ansonsten mit seinen Hunden wie ein Wilder im Wald von Ténazeyre. Was ihm an Ernsthaftigkeit und Aufrichtigkeit fehlte, hatte Pierre zweifach erhalten, der bereits einen guten Ruf als Wildhüter besaß.
Doch nun gab es Wichtigeres als Antoines Tollheiten. Jeans Wissensdurst war noch lange nicht gestillt. Seine Aufgabe als Wildhüter brachte es mit sich, dass er sich mit Tieren auskannte. Nun wollte er dieses unbekannte Exemplar genauer betrachten und seine Geheimnisse enthüllen, ehe es von Gelehrten in Beschlag genommen würde. Er berührte die Pranken des Biestes, drückte eine davon auseinander und rief Pierre voller Erstaunen zu sich. Er wies auf die gespreizte Pfote. »Komm her und lerne. Was fällt dir auf?«
Pierre näherte sich nur widerstrebend. »Die Maden kriechen nicht in sein verfluchtes Fleisch?«
»Das meine ich nicht. Sieh genauer hin.«
Pierre stemmte den Musketenkolben als Stütze auf den Boden und ging neben seinem Vater in die Hocke. Mit ihm an der Seite fühlte er sich sicher. »Mein Gott, es hat Krallen wie eine Katze!«, entfuhr es ihm aufgeregt.
Jean warf den Zopf zurück auf den Rücken und erhob sich, Pierre tat es ihm nach. »Wir müssen DeBeaufort benachrichtigen. Das hier ist ein Fall für die Behörden. Der König muss davon erfahren.« Er holte tief Luft. »Antoine, schaff dich und deinen Köter her! Wir wollen aufbrechen.«
Als sich sein Sohn nicht blicken ließ, rief er noch einmal nach ihm. Und noch einmal.
Sie lauschten aufmerksam, doch hörten nicht das geringste Geräusch. Dann raschelte es; leise Schritte bewegten sich auf sie zu.
»Antoine, hör auf mit deinen Scherzen«, versuchte es Pierre. »Es wird dunkel, und unser Weg nach Langogne ist nicht einfach. Ich …« Er verstummte, weil sein Vater die Hand gehoben hatte.
Wieder horchten sie in den schweigenden Wald hinein, während die Sonne nur noch hier und da durch die Baumkronen schien. Die Schatten wurden düsterer, bedrohlicher. Das Summen der Mücken war das einzige Geräusch.
»Was ist, Vater?«, wisperte Pierre und hielt die Muskete so, dass er sie jederzeit abfeuern konnte.
Jean zog langsam zuerst den rechten, dann den linken Hahn seiner Waffe zurück. Leise klackend arretierten sie. »Es ist still wie auf einem Friedhof«, raunte er zurück. »Keine Vögel, keine anderen Tiere. Ein Räuber ist unterwegs.«
Pierre schluckte, aber die aufsteigende Angst schnürte ihm die Kehle zu. Er wagte nicht, sich zu räuspern; stattdessen hob er die Muskete und zielte dorthin, wo er das Knistern von Laub vernommen hatte.
Ein dicht gewachsener Strauch zitterte, seine Zweige raschelten merkwürdig laut in der Stille des Waldes. Beinahe hätte Pierre abgedrückt, ungeachtet der Tatsache, dass sich Antoine irgendwo in dem Dickicht verbarg, um einen seiner zweifelhaften Späße zu treiben. Die Furcht überlagerte den Verstand.
»Wagt es nicht, auf mich anzulegen«, sagte eine weibliche Stimme gestreng aus dem Unterholz, »Denn ich bin gewiss kein Räuber.« Eine Frau in schwarzem Ordensgewand trat zwischen den Bäumen hervor; in ihrer linken Armbeuge baumelte ein Korb mit Waldbeeren und Kräutern. Die dunkle Kleidung gab nur den Blick auf ihr ansprechendes Gesicht von etwa vierzig Jahren und auf die Hände frei, der Rest war sorgsam verhüllt. Ihre graubraunen Augen waren auf die Gewehre der Männer gerichtet. »Senkt eure Waffen, Messieurs! Es gibt keinen Grund, mir zu drohen.«
Pierre deutete schnell eine Verbeugung an, schwenkte mit einem entschuldigenden Gesichtsausdruck die Mündung seiner Waffe zur Seite und stellte sich vor. Sie nannte daraufhin ihren Namen: »Ich bin Äbtissin Gregoria vom Kloster des heiligen Gregorius von Tours.«
»Kein Räuber, aber ein Seelenfänger.« Jean betrachtete die schlanke Nonne verächtlich. »Seid Ihr nicht ein wenig weit von Eurem Kloster entfernt? Das Vivarais ist derzeit keine Gegend für Unbewaffnete.«
»Ich besitze Beistand, der besser als jede Muskete ist. Der Herr ist mein Hirte, er beschützt mich auf meinen Wegen«, gab sie lächelnd zurück – und erschrak, als sie an dem Jäger vorbei auf die Kreatur am Boden blickte. Die Farbe wich aus ihrem Gesicht, und sie bekreuzigte sich.
»Ja, schaut nur. Der Teufel sendet neue Wölfe, um die Schafe des Herrn zu verschlingen«, sagte Jean. »Meint Ihr, dass Gott Euch vor den Zähnen dieses hungrigen Tiers bewahrt hätte?«
Pierre räusperte sich. »Verzeiht meinem Vater seine Worte und habt keine Furcht, ehrwürdige Äbtissin. Dieser Wolf tut Euch nichts mehr.«
»Weil wir ihn gefangen haben. Nicht Gott«, fügte Jean hinzu.
»Aber mit Gottes Hilfe, guter Mann.« Gregoria trat zur Verwunderung der beiden Männer näher an den Kadaver heran, besah ihn von allen Seiten, bekreuzigte sich erneut und küsste das Kreuz des silbernen, sehr aufwändig gearbeiteten Rosenkranzes, der um ihren Hals über der Ordenstracht hing. »Ein seltsames Tier«, meinte sie dann leise. »Es ist gut, dass Ihr es gefangen habt. Es hat viel Leid über die Menschen in der Umgebung gebracht, wie ich hörte.«
»Wie manche Priester.« Jean kümmerte sich nicht weiter um die Äbtissin, die in ihrem schwarzen Habit wie ein Fremdkörper in dem grünen, lebendigen Wald wirkte. Er fand es zwar merkwürdig, dass sie sich so weit von den Mauern ihres Klosters entfernt hatte, um nach Kräutern und Erdbeeren zu suchen – aber er hatte Wichtigeres zu tun.
»Was auch immer man Euch angetan hat, ich war es nicht. Es gibt keinen Grund, mich feindselig zu behandeln.«
Jean wollte etwas darauf erwidern, aber Gregoria sprach einfach weiter. »Ich werde Euch nicht weiter mit meiner Anwesenheit belästigen. Da Ihr Euch offensichtlich von Gott und seiner heiligen Kirche abgewandt habt, werde ich für Euer Seelenheil beten, auf dass Ihr auf den Pfad des Herrn zurückkehrt.«
»Gut bemerkt! Ich habe nichts mit der Kirche und Gott zu schaffen. Um mein Seelenheil kümmere ich mich selbst und überlasse es keinesfalls scheinheiligen Priestern und gierigen Pfaffen!« Auch wenn das kleine Benediktinerinnen-Kloster bei den einfachen Menschen einen guten Ruf hatte und sich, wie man hörte, um Arme und Verwirrte kümmerte, gab es für ihn keinen Grund, die Äbtissin anders als alle anderen Klerikalen zu behandeln. Ihre überhebliche und selbstgefällige Art verärgerte ihn.
Sie lächelte Pierre freundlich an, der sich wiederum verbeugte. »Der Segen des Herrn sei allezeit mit Euch. Gebt dennoch gut auf Euch Acht, junger Mann, damit die Wölfe Euch nicht holen. Solltet Ihr beten wollen, die Kapelle von Saint Grégoire steht Euch jederzeit offen.« Sie nickte ihm zu und ging. »Guten Tag, Messieurs.«
»Zum Teufel mit den Nonnen«, fluchte Jean leise und wandte sich dem Kadaver zu. »Zum Teufel mit dem ganzen Pfaffenpack.«
»Mutter würde nicht wollen, dass …«, begann Pierre vorsichtig, sah aber an der abweisenden Haltung des Vaters, dass er nicht weitersprechen musste. Seit dem Tod der Mutter gab sein Vater nichts mehr auf die Gnade Gottes, der seiner Ansicht nach nur diejenigen beschützte, die genügend Geld besaßen, um sich das Wohlwollen im Opferstock der Kirche zu erkaufen.
Er wollte gerade zu seinem Vater gehen, als er glaubte, aus den Augenwinkeln einen gedrungenen Schatten zwischen den Stämmen gesehen zu haben.
»Da ist etwas!« Er sandte ein stilles Gebet an Gott, dass er sie, Antoine und die Äbtissin vor dem beschützen möge, was da unter den Buchen umher streifte.
»Es wird Surtout sein«, meinte sein Vater.
Die Angst packte Pierre erneut. »Und wenn diese Bestie, die wir gefangen haben, nicht allein war?«, flüsterte er.
»Töten wir die andere auch noch«, gab Jean zurück und legte die Muskete an. Pierre folgte seinem Beispiel. »Vergiss nicht, dass Antoine irgendwo …«
Ein breiter Schatten flog aus dem Gebüsch zu ihrer Linken. Er brüllte laut und warf sich gegen die beiden Männer, riss sie von den Beinen und schleuderte sie auf den Waldboden. Donnernd entlud sich Pierres Muskete, und sofort stank es nach verbranntem Schwarzpulver. Über die erschrockenen und wütenden Rufe der Männer hinweg –
– ertönte ausgelassenes Gelächter. Antoine wälzte sich im Laub und schüttete sich aus vor Lachen, die Heiterkeitstränen rannen ihm aus den Augenwinkeln und liefen über die Wangen in seinen kurzen Vollbart. »Bonsoir, ihr tapferen Waidmänner«, röhrte er. »Habt ihr euch in die Hosen gepisst?«
Jean sprang in die Höhe und verpasste seinem Jüngeren eine schallende Ohrfeige. »Du bist ein Idiot, Antoine! Wir hätten dich um ein Haar erschossen!«
»Ich wundere mich, dass ihr es nicht getan habt. Dann wärt ihr mich endlich los gewesen«, murmelte er glucksend, stand auf und klopfte sich mit dem Dreispitz die braunen Blätter von seinem Rock. Die Lippe war durch den Hieb wieder aufgeplatzt. »Ihr und die anderen. Die Leute wären doch froh, wenn mich eine Kugel treffen würde. Ich kenne das Gerede. Seit ich von … von meiner Reise zurückgekommen bin, haben sie Angst vor mir. Und manchmal glaube ich, das geht auch meiner Familie so.«
»Hast du deinen Köter gefunden?« Jean ging über Antoines Worte hinweg.
»Nein. Er wird irgendein Wild verfolgen.«
Pierre hielt sich zurück und schwieg. Er lud seine Waffe nach und versuchte trotz der zitternden Hände, die Prozedur so schnell wie immer zu absolvieren. Ihr Vater legte großen Wert darauf, dass sie innerhalb einer Minute dreimal feuern konnten, was angesichts eines heranstürmenden verletzten Keilers überlebenswichtig war. Oder einer angriffslustigen Bestie.
Wie viele Kugeln mochte eine solche Kreatur aushalten, ehe sie ihr Leben verlor? Er gab neues Pulver aus dem Horn auf die Zündpfanne und drückte schnell den Deckel herab, als er etwas Seltsames bemerkte. »Vater, hatte das Vieh die Lider geschlossen oder geöffnet, als wir es vom Baum nahmen?«, fragte er heiser und ließ den breiten Kopf des Biests nicht aus den Augen. Das Schwarz in der blutroten Iris schien ihn direkt anzustarren. Die Pupille war voller Wut, voller Hass – voller Leben!
Dann hörten sie das grollende Knurren.
»Der Loup-Garou lebt noch!« Antoine robbte flink über den Boden und griff nach seiner Muskete, die er bei seinem Sprung aus dem Gebüsch verloren hatte. »Ich brenne ihm eins zwischen die Augen!«
Durch seine Bewegungen verursachte er so viele Geräusche, dass das Laubrascheln beinahe untergegangen wäre. Doch einer der Chastels besaß genügend Aufmerksamkeit.
Pierre schaute zu seinem Vater, der sich plötzlich schreckensbleich nach rechts gewandt und den Kolben der Muskete gegen seine Schulter gepresst hatte. Der Lauf schnellte in die Höhe und zielte scheinbar aufs Geratewohl ins Unterholz.
»Was ist?« Pierre fuhr herum – und erstarrte. Der Schatten zwischen den Bäumen war nicht Surtout gewesen! Er sah eine zweite Bestie, die auf allen vieren und lautlos hinter seinem Rücken auf ihn zugelaufen war. Ohne die Wachsamkeit seines Vaters hätte sie ihn vollends überrumpelt.
Krachend spuckte Jeans Waffe eine Bleikugel nach dem unheimlichen Angreifer, der im gleichen Moment einen riesigen Satz machte und spielend leicht sechs Schritte Distanz überwand. Er sprang gegen einen Baum, stieß sich ab, schnellte gegen den vor Entsetzen schreienden Pierre und riss ihn fauchend zu Boden. Die Krallen schlitzten den Rock in Höhe der Brust auf; Blut quoll aus fünf langen Schnitten hervor.
»Antoine!«, schrie Jean und zwang sich zur Ruhe, damit sein nächster Schuss saß. Angst durfte er sich nicht erlauben. Er sah die Bestie genau vor sich, erkannte die Ähnlichkeit zu dem Wesen, das sie an der Wolfsangel gefunden hatten. Aber dieses Exemplar besaß einen kräftigeren Körperbau und stand gut im Futter. Er dachte an die vier Einschusslöcher, und sein Mut sank. Der Zeigefinger wanderte weiter nach hinten, um den zweiten Abzug zu bedienen.
»Allez, Loup-Garou!« Antoine zog die Aufmerksamkeit auf sich. Er saß vor dem gefangenen Werwolf und drückte ihm die Muskete gegen das linke Auge. »Willst du deinen Freund zurück? Dann lass meinen Bruder gehen, oder ich verteile das Gehirn dieser Bestie im Wald!«
Langsam wandte sich der schauderhafte Kopf in seine Richtung. Das Biest … schien ihn zu verstehen! Die glutroten Augen hefteten sich auf Antoine, die Lefzen zogen sich zurück, und es zeigte den Männern sein einschüchterndes Raubtiergebiss. Eine Klaue umschloss Pierres Kehle, dann erhob es sich zur Bestürzung der Wildhüter auf seine langen Hinterbeine und war plötzlich so groß wie ein Mensch! Es hielt sein Opfer vor sich in die Luft, als wöge es nicht mehr als ein Sack Federn.
»Lass ihn los!«, verlangte Antoine, zog seine Pistole und richtete sie ebenfalls auf den Kopf seiner Geisel. Er grinste dabei unentwegt. Es schien für ihn kaum mehr als ein Spiel zu sein. »Ihr vertragt bestimmt viel Blei in euren hässlichen Leibern, aber ohne Kopf müsst auch ihr sterben. Habe ich Recht?«
Grollend schleuderte der zweite Werwolf Pierre von sich, der sich mehrmals überschlug und vor den Füßen seines Vaters ohnmächtig liegen blieb. Sein Blut sickerte auf den Waldboden. Jean wagte nicht, sich zu bücken und nach dem Verletzten zu sehen. Die Gefahr war noch lange nicht gebannt.
Antoine fühlte sich dagegen sehr sicher. »Braver Loup-Garou«, höhnte er. »Ich werde dich als mein Haustier halten.« Er leckte sich über die Lippen, seine Augen wurden schmal. »Aber das würde meinem Vater nicht gefallen.«
»Nein! Tu es nicht«, raunte Jean vorahnungsvoll. »Reize ihn nicht.«
»Du bist doch der Meinung, dass nur ein toter Wolf ein guter Wolf ist.« Ohne mit der Wimper zu zucken, schoss Antoine dem liegenden Werwolf die Ladungen beider Läufe in den Kopf. Der breite Schädel zerbarst in einer Wolke aus Blut. Allein der Druck der Treibladungen hätte ausgereicht, den Kopf zu zerfetzen, die Kugeln taten ihr Übriges dazu. Es blieb nichts außer Resten des Unterkiefers und der hinteren Schädelpartie zurück. Dennoch tobte der Kadaver wie lebendig, schlug um sich, bäumte sich auf, rollte in seinem Blut umher, die Klauen rissen die Erde auf, schlugen nach dem Feind. Dreck und Blätter stoben herum. Lachend sprang Antoine von dem sterbenden Wesen weg und hob seine Pistole.
Jean verfluchte die unberechenbare Art seines jüngeren Sohns. Er ahnte, wie der betrogene Werwolf handeln würde. Er drückte ab, spürte den Rückstoß gegen seine Schulter und sah die weiße Pulverwolke aufsteigen, die ihm wegen eines ungünstigen Windes die Sicht raubte.
Die aufgellenden Schreie Antoines sagten ihm, dass die Bestie bereits Rache nahm. Ohne zu zögern, hob er Pierres geladene Muskete auf und rannte dorthin, wo sich Mensch und Kreatur auf der Erde wälzten.
Sein Sohn rang mit den Kräften eines Giganten und schaffte es trotzdem nicht, den Angreifer von sich zu stoßen; auch die tiefen Stiche des Dolchs, den Antoine zur Verteidigung benutzte, beeindruckten die Bestie nicht. Ihre Fänge bissen tief ins Fleisch des Unterarms und drängten dann nach der Kehle des jungen Mannes.
Jean handelte instinktiv. Die Angst um seinen Sohn, missraten oder nicht, überwand den Schock und alle lähmenden Gefühle. Er drosch den Kolben der Waffe mehrmals hart in den Nacken des Werwolfs und brachte ihn dazu, von Antoine abzulassen. Die roten Augen wandten sich ihm zu, die weit geöffnete Schnauze flog heran.
Jean lief rückwärts und schoss auf der Bestie. Sie kreischte und stürmte als Schrecken erregende Silhouette weiter auf ihn zu. Als sie den Pulverdampf durchbrach, erkannte Jean deutlich die beiden Einschusslöcher auf Höhe des Herzens. Doch die Wunden schlossen sich bereits!
»Verschwinde!«, schrie er voller Verzweiflung und rammte den Lauf in den zahnbewehrten Schlund. Das Metall traf auf Widerstand und durchstieß etwas, das Wesen gab einen gurgelnden Laut von sich – und wich tatsächlich zurück.
Unschlüssig stand der Werwolf in seiner ganzen Scheußlichkeit auf den langen Hinterbeinen. Er knurrte und fauchte gleichzeitig, die kurzen Ohren waren steil nach oben gerichtet, der Schwanz peitschte.
Da krachte ein Schuss durch den Wald.
Die Kugel fuhr der Bestie seitlich durch die Schnauze, eine rote Fontäne sprühte augenblicklich los, bespritzte den Wolf und Jean. Schrill heulend stieß sich das Wesen vom Boden ab – und sprang sieben Schritte weit in den Schutz der Baumstämme, zwischen denen bereits die Dunkelheit regierte.
»Fahr zur Hölle, Loup-Garou!«
Antoine, die Kleidung in blutigen Fetzen am Körper, hatte sich am Stamm der Buche aufgesetzt, sein linker Arm senkte sich zitternd, die rauchende Pistole sackte nach unten. »Fahr zur Hölle«, wiederholte er leise. Seine Augenlieder flatterten und schlossen sich. Er hatte das Bewusstsein verloren.
Die unheimliche Stille, die vor dem Angriff der Bestie Einzug gehalten hatte, dauerte an. Noch immer waren die Tiere des Waldes wie gelähmt. Das Lärmen, Fauchen und Schießen hatte ihre Stimmen erstickt.
Jean wusste nicht, ob der Werwolf zurückkehren würde, um sein Werk zu beenden. Der Wildhüter lud mit zitternden Fingern alle Waffen nach, wartete einige Momente, die ihm wie qualvolle Stunden erschienen. Als sich nichts rührte, wandte er sich besorgt seinem schwer verletzten Sohn zu. Er vernähte die schweren Blessuren an Antoines Armen mit grobem Garn und wickelte Stofftücher darum, die er hastig aus seinem Rock schnitt. Dann kümmerte er sich um Pierres Wunden. Beide Söhne erwachten nicht aus ihrer Ohnmacht. Vielleicht weigerte sich ihr Verstand so lange es ging, die Bestie noch einmal sehen zu müssen. Liebevoll streichelte Jean die Gesichter seiner Kinder und fragte sich, was er tun konnte außer abzuwarten.
Lange Zeit verharrte er zwischen ihnen, die Waffen griffbereit um sich verteilt, und lauschte in die gespenstische Ruhe.
Es blieb still.
Erst als er den erlösenden Ruf einer Eule hörte, entspannte sich Jean allmählich. Er entzündete ein kleines Lagerfeuer, das die Nacht zwischen den Bäumen vertrieb. Dann wandte er sich zu der Stelle um, wo der Kadaver des ersten Werwolfs darauf wartete, untersucht zu werden.
Jean erstarrte. In einem See aus Blut lag dort –
– der Torso eines Menschen! Der Schein des Feuers beleuchtete die klaffenden, feuchten Wundränder; Chastel sah das Weiß des Schädelrestes schimmern. Die Bestie war nach dem Tod aus ihm gefahren und hatte einen ausgemergelten Mann von gewiss sechzig Jahren zurückgelassen.
Der Wildhüter schauderte. Es widerstrebte ihm, sich dem Leichnam zu nähern. Doch konnte er es wagen, ihn hier liegen zu lassen? Wer würde ihm glauben, dass dieser schwache, alte Mann zu Lebzeiten eine reißende Bestie gewesen war? Er nahm seinen Mut zusammen und schleifte den Toten zum Bach, übergab ihn dem dunklen Wasser und sah zu, wie ihn die Strömung davontrug. Irgendwo würde er angespült werden, weit weg vom Vivarais und noch weiter weg vom Gévaudan. Sollte er dort seinen Frieden finden.
Er kehrte zu seinen bewusstlosen Söhnen zurück, hielt sein Jagdmesser in die Flammen, öffnete die Wundnähte und brannte Pierre und Antoine die Verletzungen mit der glühenden Schneide aus. Der Keim des Wolfs, oder was immer sie angefallen hatte, sollte in der Hitze vergehen.
Niemand durfte von den wahren Geschehnissen dieses Nachmittags erfahren. Die Wunden seiner Söhne stammten von einem großen Wolf, das würde er DeBeaufort und allen anderen erzählen. Ein passendes Tier zu seiner Geschichte konnte er auf der Rückreise ins Gévaudan erlegen. Wichtig war nur eins: So schnell wie möglich diese verfluchte Gegend zu verlassen, in der eine Kreatur ihr Unwesen trieb, die offensichtlich aus der Hölle gesandt worden war. Die Vulkane des Vivarais mussten geradewegs ins Reich des Teufels führen.
II. Kapitel
Er beobachtete die Unbekannte aus dem Schatten einer monströsen, modernen Installation heraus. Wie es sich für alte Ölfässer gehörte, stanken sie. Kunst mit einer unangenehmen Begleiterscheinung.
Sie stand vor dem düsteren Gemälde, den Kopf mit den langen, blonden Haaren etwas nach rechts geneigt. Ein langer, dunkelbrauner Mantel lag um ihre Schultern, der Saum eines schwarzen Rocks und Bikerstiefel schauten darunter hervor.
Er war auf sie aufmerksam geworden, weil sie sich, im Gegensatz zu den hektischen Besuchern in der Galerie, nicht bewegte. Sie nahm sich die Zeit, das Gemälde wirken zu lassen: einsame Versunkenheit.
Die Welt um sie herum befand sich auf Häppchen-Jagd, stieß Gläser aneinander, beglückwünschte den strahlenden Ausstellungsleiter zur gelungenen Vernissage und lud sich die Teller mit Canapés voll. Allenthalben Trunkenheit.
In Zeitlupe richtete sie den Kopf auf, machte einen Schritt zurück und senkte den Schopf nach links. Sie verharrte, er verharrte, und beide betrachteten das Objekt ihres Interesses auf eigene Art.
Schließlich hielt er den Gestank nach Öl nicht mehr aus; außerdem war ihm danach, die Jagd zu eröffnen. Er näherte sich ihr und gab sich Mühe, nicht leise zu sein, damit er sie keinesfalls erschreckte. Erschrockenes Wild flüchtete.
Ihm fiel sofort auf, wie gut sie roch. Der Duft ihres Shampoos war dezent, Parfüm benutzte sie nicht, und so war es ihr eigener Geruch, der pur und unverfälscht in seine empfindliche Nase stieg.
Endlich stand er neben ihr und tat scheinheilig so, als interessiere er sich für das Kunstwerk und nicht für sie.
Die Frau schaute ihn an und zeigte ihm so ihr schlankes Gesicht, in dem eine unmodisch modische Brille ihre kornblumenblauen Augen betonte. Sie trug eine dunkelrote, dünne Seidenbluse und nichts darunter; ihre Brüste zeichneten sich mit allen verlockenden Details unter dem Stoff ab. Sie war nicht mehr als dreiundzwanzig Jahre alt. Ein gutes Alter.
Sie hatte sich schon wieder abgewandt, ihre kurze Musterung war negativ für ihn ausgefallen.
»Schön, dass Sie keine Häppchen in sich hineinstopfen«, sprach er nach vorne, als redete er mit dem Bild. »Wenigstens eine, die sich die Ausstellung anschaut.«
»Ich brauche meine gute Figur«, erwiderte sie offenkundig genervt, »sonst bekomme ich keine Freier mehr. Und fragen Sie mich jetzt bitte nicht, ob ich öfter hier bin. Ich wärme mich bloß auf. Meine Tuberkulose ist noch nicht ganz weg, und da ist das Scheißwetter draußen Gift für meine Lungen.« Sie hustete, nahm ein Tuch aus der Manteltasche, presste es gegen den Mund und hielt es ihm entgegen. Ein großer, roter Fleck.
»Offene TB?« Er grinste. »Wissen Sie, nach dem ersten Satz hätte ich Ihnen die Prostituierte abgenommen. Aber danach haben Sie ein bisschen dick aufgetragen. Und der Fleck war schon vorher drin. Rotwein? Kirschsaft?«
»Lassen Sie es mich etwas einfacher ausdrücken: Ich habe kein Interesse an einer Unterhaltung. Gehen Sie einfach Häppchen essen«, empfahl sie ihm kühl und stopfte das Tuch in die Manteltasche zurück.
»Geht nicht. Ich brauche meine gute Figur, sonst bekomme ich keine Frauen mehr ab.«
Die Blonde lachte, drehte sich nun doch zu ihm und musterte ihn ausführlicher. Seine selbstsichere Bemerkung hatte sie neugierig gemacht. Er wusste, was sie sah: einen Mann Ende zwanzig, groß und durchtrainiert, mit schwarzen Haaren, die bis auf die Schultern reichten. Er trug schwarze Lederhosen, ein schwarzes Feinrippunterhemd und einen langen, weißen Lackledermantel; die Füße steckten in weißen Schnürstiefeln, an den Spitzen saßen Metallkappen. Trotz seiner Rasur vor vier Stunden standen ihm schon wieder erste Stoppeln im Gesicht, sein Kinnbart und die Koteletten lenkten jedoch davon ab und unterstrichen sein markantes, männliches Gesicht. Er rückte seine Brille zurecht, lächelte sie an und fragte: »Kurzsichtig oder weitsichtig?«
»Ich oder Sie?«
»Sie.«
»Kurzsichtig. Eins Komma vier und eins Komma neun Dioptrien, plus Hornhautverkrümmung. Können Sie das toppen?«
»Kurzsichtig, zwei Komma eins und zwei Komma drei Dioptrien. Aber keine Hornhautverkrümmung.« Bedauernd verzog er das Gesicht. »Dafür bin ich leicht farbenblind.«
»Sie Ärmster. Dann haben Sie gar nichts von meiner schreiend gelben Bluse, meinem blauen Mantel und dem grünen Rock.«
»Ich bin leicht farbenblind, nicht total farbenblöd.«
Jetzt lachte sie schallend. »Sie haben mir tatsächlich meine schlechte Laune verdorben. Dabei hat mich das Bild gerade so herrlich depressiv gemacht.« Sie hielt ihm ihre gepflegte, weiche Hand hin. »Ich bin Severina.«
»Ihr Künstlername, nehme ich an?« Er ergriff ihre Hand und schüttelte sie. »Eric.«
»Ich bin keine Künstlerin.«
»Ich meinte als Prostituierte.«
Severina zwinkerte fröhlich. »Wir sind alle Huren, Eric. Jeder, der einen Job macht und Geld dafür bekommt, ist eine Hure.«
»Welchen Beruf haben Sie?«
»Keinen richtigen. Ich studiere Moderne Kunst und habe eine Hiwi-Stelle.« Sie ließ seine Hand los und deutete auf das Bild, das viel Schwarz, einige weiße und einen roten Streifen zeigte, die in wildem Muster vor dem dunklen Hintergrund lagen. »Schon erschütternd, was die modernen Künstler mitunter auf die Leinwand bringen.«
»Wirklich?« Eric nickte und ging dicht an das Bild heran. Prüfend legte er die Hand darauf. »Um genau zu sein, das ist keine Leinwand.« Er pochte dagegen, das Material gab nach und wogte. Die ersten Gäste schauten zu ihm herüber und tuschelten; der Ausstellungsleiter wurde auf den Störenfried aufmerksam gemacht und erbleichte. »Sieht aus wie Plastikplane.«
Severina beobachtete ihn neugierig.
»Wollen Sie sich als Bilderstürmerin der Moderne versuchen?«
Seine hellbraunen, fast schon bernsteinfarbenen Augen mit dem schwarzen Ring fixierten sie. Severina schien es, als habe der dunkle Rand der Iris Mühe, das wilde Gelb in Schach zu halten. Sobald es eine Lücke fand, würde es das Augenweiß fluten.
»Sagen Sie mir, Severina, warum Ihnen das Bild nicht gefällt. Warum Sie es scheiße finden.«
Sie trat näher. »Es sieht nicht echt aus. Es steckt nichts dahinter. Schimpansen malen besser.«
Eric kratzte an der Farbe. Schwarze Bröckchen lösten sich und rieselten auf den geputzten Boden der Halle. »Und wenn es dem Maler nicht um das Bild, sondern um den Akt des Schöpfens ging? Es ist einfach das Resultat der Begegnung von Maler und Plane, schätze ich. So ist er, der abstrakte Expressionismus.« Er tätschelte die Plane. »Aber Sie haben Recht: Das Bild ist scheiße.«
Unvermittelt packte Eric den Rahmen und hievte ihn aus der Verankerung an der Wand, schleuderte ihn zu Boden und sprang mit beiden Füßen mitten auf das Werk. Er streckte die Hand aus. »Kommen Sie, Severina. Wir schaffen neue Kunst.«
Zögernd, aber mit vor Aufregung gerötetem Gesicht nahm sie seine Hand und vollführte mit ihm zusammen einen wilden Tanz. Sie lachten, ramponierten die Plane vor den Augen der fassungslosen Vernissagengäste. Severina malte mit ihrem dunkelroten Lippenstift zusätzliche Linien, Eric spuckte darauf. Dann schob er sie vom Bild hinunter und hängte die zerfetzten Überreste wieder in die Halterung.
»So.«
Eric nahm Severinas Hand und zog sie ein paar Schritte zurück, um das Produkt ihrer spontanen Zerstörungswut aus einem gebührenden Abstand zu betrachten und die Wirkung zu testen. »Es sieht eindeutig besser aus«, lautete sein Urteil. Er schaute zu ihr. Severina strich sich die blonden Haare aus dem Gesicht; sie atmete schnell. Auf ihrer Bluse zeichneten sich unter den Brüsten und am Bauch Schweißflecken ab. Ihr ursprünglicher, unverfälschter Frauenduft erregte ihn.
»Viel besser«, keuchte sie grinsend. »Wie nennen wir es?«
»Sie sind die Fachfrau. Prägen Sie einen neuen Kunststil.« Eric entdeckte den Galeriebesitzer, der seine Häppchen abgestellt hatte und zusammen mit zwei Sicherheitsleuten auf sie zuging. »Machen Sie schnell!«
Sie kniete sich vor das Bild, zückte erneut den Lippenstift und schrieb Abstract axpression by S & E auf die geschundene Plane, dann zog er sie in die Höhe und rannte mit ihr Hand in Hand zum Hinterausgang. Eine Sirene heulte los, als er die gesicherte Tür auftrat. Sie stürmten hinaus in die Seitenstraße und wurden von eiskaltem Novemberregen empfangen. Es machte ihnen nichts aus, sie rannten und rannten, bis er sie in den Schutz eines großen Torbogens zog.
»Gut, wir haben sie abgehängt. Axpression?«, fragte er amüsiert.
»Kommt von Action und Expressionismus«, erklärte sie ihren Einfall und kicherte wie ein übermütiges Kind, das sich etwas Verbotenes getraut hatte. »Meine Güte, Eric! Wie teuer war das Bild wohl?«
»Fragen Sie lieber, was es jetzt wert ist.« Er schaute die menschenleere Straße hoch und runter, dann packte er ihren Kopf und drückte einen wilden, verlangenden Kuss auf ihre Lippen. Warm quoll ihr Geruch unter dem Mantel hervor.
Severina stöhnte auf, schob ihre Zunge in seinen Mund, umfasste ihn und drückte ihn hart an sich. Es war ein surrealer Moment. Sie ließ sich von dem vollkommen Unbekannten verführen, der ihr jetzt den Rock in die Höhe schob und sie zwischen den Beinen berührte. Erregung durchströmte ihren Körper; sie wollte Eric in sich spüren und zeigte es ihm, indem sie seinen Reißverschluss öffnete.
Sie liebten sich unter dem Torbogen. Eric hatte sie angehoben, Severina schwebte auf seinen Oberschenkeln wie auf einer Schaukel, und jeder Stoß seines Beckens katapultierte sie dem Feuerwerk entgegen. Die Art, wie er sich bewegte und wie er sie berührte, zeigte, dass er ein erfahrener Liebhaber war. Als er ihre Bluse öffnete und leicht in ihre harte linke Brustwarze biss, kam sie zum ersten Mal und schrie unterdrückt gegen seine Schulter. Ihre Sinne befanden sich auf einem Freiflug, sie hörte sogar Melodien.
Um genau zu sein, war es die Melodie des A-Teams.
Eric fluchte und glitt aus ihr heraus.
»Hey!«, beschwerte sie sich keuchend und lehnte sich gegen die Mauer.
Er lächelte entschuldigend, wühlte in seiner Hosentasche und zog ein Handy hervor. »Ja?« Lauschend zog er sich mit einer Hand das Kondom ab und schloss den Reißverschluss. Severina hatte in ihrer Erregung gar nicht mitbekommen, dass er sich einen Gummi übergestreift hatte. »Gut. – Aber warte auf mich. – Ja, ich bin gleich da.« Er klappte den Deckel zu und verstaute das Telefon. »Entschuldigen Sie. Es ist wichtig.« Eric lächelte sie an, spielte mit einer feuchten blonden Strähne, die ihr ins Gesicht hing, dann gab er ihr einen Kuss und rannte auf die Straße zurück. »Passen Sie auf sich auf«, rief er und verschwand um die Ecke. Severina lachte ungläubig auf, während sie sich die Bluse zuknöpfte. So etwas war ihr noch nie passiert!
Und sie fürchtete, dass es ihr auch nie wieder passieren würde.
Eric hetzte fluchend durch die regennassen Straßen und suchte sein Auto. Seine Jagd hatte ihn die Pflicht vergessen lassen, und das geschah leider viel zu oft. Aber Frauen zogen ihn einfach magisch an; er mochte es, sie zu jagen, sie zu lieben und sie danach gleich wieder zu verlassen. Er mochte die intimen Momente ohne das Gefühlsgeplänkel danach mit dem »Sehen wir uns wieder?« oder dem »Gibst du mir deine Nummer?«. Deshalb siezte er sie alle, egal was sie vorher zusammen getan hatten.
»Shit! Wo ist …« Er drückte unentwegt auf den Knopf des elektronischen Türöffners, und endlich sah er in zehn Metern Entfernung Blinker aufleuchten. Dort stand der dunkelgrüne Porsche Cayenne in seinem ewig verdreckten Zustand. Eric wusch sein Auto nie. Was der Regen nicht wegspülte, durfte bleiben, wo es war; auch die Dellen und Kratzer im Lack scherten ihn nicht. Das Einzige, was regelmäßig gewartet wurde, waren der Turbomotor und die Bremsen.
Eric sprang auf den Fahrersitz und startete den Porsche. Rücksichtslos setzte er auf die Fahrbahn und schoss mit quietschenden Reifen davon. Wer glaubte, dass Geländewagen in einer Großstadt unnötig waren, kannte ihn nicht. Seine Aufgabe verlangte Schnelligkeit, und die kürzeste Strecke zwischen A und B blieb – sogar in Großstädten – eine gerade Linie. Stadtparks eigneten sich hervorragend als Abkürzung. Eric hatte sein GPS-Verkehrssystem entsprechend modifiziert. München, London, New York, Moskau: Seine Cayennes und er gelangten immer auf der schnellsten Route ans Ziel, seine mörderischen Fahrten durch die Metropolen wären ideale Werbespots für Hersteller von Geländewagen.
Der Anrufer hatte ihm eine Adresse und einen Namen genannt: Upuaut. Ein größenwahnsinniges Wandelwesens, das sich sein eigenes Lykopolis errichten wollte. Vor einigen Wochen war es Eric im ägyptischen Sohag knapp entkommen, ohne sein menschliches Gesicht zu zeigen. Hier in München bot sich nun eine zweite Gelegenheit.
Der Turbolader pfiff, vierhundertfünfzig PS machten das Auto zu einer Rakete, die durch die Münchner Innenstadt zischte, mit einer Neunzig-Grad-Drehung über die Kreuzung schlitterte und mit einhundertsechzig Stundenkilometern auf den Eingang des Englischen Gartens zuhielt.
Wieder klingelte das Handy. Da es im Augenblick tödlich gewesen wäre, die Hände vom Lenkrad zu nehmen, ertrug Eric das A-Team, ehe das Polyphonkonzert nach zehn Sekunden endete. Zu der Zeit befand sich der Cayenne schon neben dem Chinesischen Turm und rauschte über den Fußweg. Die Xenon-Scheinwerfer rissen einen erschrockenen Spaziergänger aus der Dunkelheit, der seinen kackenden Hund gerade noch an der Leine zur Seite reißen konnte.
»Pass auf!«, schrie Eric hinter der Scheibe. »Und mach gefälligst den Scheißhaufen weg!« Wütend trat er das Gaspedal bis zum Boden durch, der Motor röhrte auf, und die Profilräder bissen tief in den Rasen.
Endlich, endlich erreichte er die andere Seite des Parks, schoss auf die asphaltierte Straße, fuhr noch einige Meter weiter und hielt mit einigem Abstand vor dem Haus. Eric streifte die weißen Lackhandschuhe über, stellte das Handy auf Vibrationsruf um, klappte den Beifahrersitz nach vorne und nahm den kleinen schwarzen Koffer hervor. Er öffnete ihn und packte die Sig Sauer P9-Pistole samt Gürtelholster aus, überprüfte das Magazin mit der Glaser-Munition und befestigte sie am Hosenbund. Die Glock-Halbautomatikpistole in seinem Stiefelschaft genügte wahrscheinlich nicht. Sicher war sicher. Eric entschied sich, auch die Bernadelli B4, ein kompaktes, halb automatisches Schrotgewehr, aus ihrem Versteck hinter der Verkleidung der Seitentür zu befreien. Er schob sie unter seinen Mantel und hielt sie mit dem linken Arm an den Körper gepresst, als er ausstieg und sich auf den Eingang zubewegte. Die rechte Hand schwenkte den zur Hälfte aufgeklappten Stadtplan Münchens.
Die beiden Männer in schwarzen Anzügen vor dem Haus musterten ihn. Beide trugen, was man einen »Knopf im Ohr« nannte, und kamen sich offensichtlich richtig wichtig vor. Manchen Security-Leuten sprang die Einfalt aus dem Gesicht.
»’n Abend, Herrschaften. Ich habe mich verfahren«, sagte Eric. »Das dämliche Navigationsprogramm zickt. Wahrscheinlich führen die Amerikaner wieder irgendwo Krieg und stören das GPS.« Er näherte sich ihnen und lächelte. »Sie kennen sich in München aus?«
Der dickere der beiden Security-Männer blieb gelassen, sein Partner aber bekam schmale Lippen und einen starren Blick. Den musste er zuerst ausschalten.
»Wohin wollen Sie denn?« Der Dicke streckte den Arm nach der Karte aus.
»Lerchenfeldstraße zweiundvierzig, glaube ich. Einen Moment. Ich habe eine Notiz eingesteckt …« Eric beugte sich nach vorne, ließ den Mann die Karte allein halten und tastete mit einer Hand seinen Mantel ab, als suche er den Zettel mit der Adresse. »Ich finde ihn nicht.« Dann zog er die Bernadelli und hielt sie dem Dicken hin, dessen Augen vor Unglauben riesig wurden. »Halten Sie die auch noch, bitte? Dann kann ich besser suchen.«
Bevor einer der beiden reagierte, stieß Erics Ellbogen unvermittelt schräg nach hinten. Er traf den längeren Sicherheitsmann präzise auf die Nase; der Überrumpelte prallte gegen die Tür und rutschte benommen zu Boden, während Erics rechter Arm bereits in einer blitzschnellen Vorwärtsbewegung auf die Schläfe des Dicken niederzuckte; der Schlag ließ den Kopf herumschnappen, der Mann knickte zusammen.
Lächelnd schaute Eric auf die Hausnummer neben dem Eingang. »Ach, Sie können mir nicht weiterhelfen? Ich frage wohl besser mal drinnen nach.« Er grinste und durchsuchte die Jackentaschen der Bewusstlosen; in einer fand er die elektronische Schlüsselkarte. »Danke sehr.«
Rasch trat er ein und schlich im Dunkeln die Treppe in den ersten Stock hinauf. Die Bernadelli hielt er mit beiden Händen einsatzbereit.
Irgendwo aus einem der Zimmer vor ihm erklangen laute Trommeln und rhythmisches Klatschen, darunter mischten sich das gelegentliche Lachen von Männern und leises Klimpern. Eric sog die Luft ein. Es roch nach orientalischem Essen – und Wolf. Er würde die Feier abrupt beenden müssen, und es tat ihm nicht einmal Leid.
Sein gutes Gehör lotste ihn den halbdunklen Flur entlang bis zu der Tür, hinter der die Geräusche am leisesten waren. Zufällig fiel sein Blick auf seinen eigenen Schatten, und er erschauderte. Der Anblick erinnerte ihn an Robert Motherwells Gemälde Monster: ein diffuses, Furcht einflößendes Gebilde voller dunkler Bedrohung, dem man entkommen wollte. Aber seinem eigenen Schatten konnte man nicht entkommen.
Erics Hand legte sich auf die Klinke, behutsam drückte er sie herab und öffnete die Tür. Er fand sich im hinteren, dunkleren Teil eines Raumes wieder, unmittelbar neben einem geplünderten Büfett. Sofort duckte er sich und verschwand unter dem Tisch. Er rutschte unter ihm einige Meter vorwärts und schob dann vorsichtig die weiße Tischdecke zur Seite, um sich einen Überblick zu verschaffen.
Eine Männergesellschaft lag auf weichen Kissen um einen runden Tisch, auf dem kleine, dampfende Teetässchen und mehrere Wasserpfeifen standen; über ihnen spannte sich ein Baldachin aus dunkler Seide mit bunten Stickereien. Die Männer verschiedenen Alters trugen allesamt Geschäftsanzüge, sahen orientalisch und aufgrund des Goldschmucks und der schweren Uhren wohlhabend aus. Vor ihnen tanzte eine dunkelhaarige, tiefbraune Schönheit in einem knapp geschnittenen Kostüm mit Schleiern; das Klirren stammte von einem Münzgürtel, den sie um die Hüfte trug. Die bewundernden Blicke der Männer waren ihr sicher.
Erics Handy vibrierte in der Hose. Er ließ das Tischtuch in seine alte Position gleiten und nahm das Telefon heraus. »Ja?«, flüsterte er.
»Komm nicht her, Eric!« Die atemlose Stimme seines Vaters. »Du …« Die Verbindung riss ab.
Erics Puls beschleunigte sich. Er schob das Tischtuch erneut zur Seite und musterte die Männer aufmerksam. Es stank drückend nach Wolf; Eric konnte die Ausdünstungen wegen des starken Geruchs der Umgebung nicht einzeln zuordnen. Aber es musste doch einen Hinweis geben, irgendetwas, an dem er Upuaut erkannte. War er der ältere Mann mit dem dichten Bart? Oder der Nordafrikaner mit der Narbe unter dem Auge? Jeder von dem Dutzend konnte Upuaut sein. Er wusste nichts über dessen menschliches Leben, außer dass er sehr wohlhabend und kriminell war. So wie etwa siebzig Prozent der Lykantrophen, die ihm vor die Mündung gelaufen waren. Ihre durch das Tier veränderte Mentalität sorgte dafür, dass sie kein Mitgefühl kannten, keine Skrupel, kein menschliches Gespür für Gut und Böse. Dass sich Upuaut überlegen fühlte, drückte schon sein Name aus: Es zeugte definitiv von Megalomanie, sich nach einem altägyptischen Toten- und Kriegsgott zu benennen und sein eigenes Reich gründen zu wollen.
Eric wusste, dass er sich beeilen musste, bevor sie ihn witterten. Zeit für radikale Maßnahmen. Er nahm das Magazin der Bernadelli aus dem Lauf, tauschte das erste Vollgeschoss gegen eine Silberschrotpatrone aus und lud durch. Vorsichtig hielt er den Lauf hinaus, achtete darauf, dass er die Tänzerin nach Möglichkeit nicht erwischte – und drückte ab.
Die Silberkügelchen schossen los. Sie zerfetzten die Brokatkissen, pulverisierten etliche Gläser und bohrten sich an den unterschiedlichsten Stellen in die Körper der Männer.
Nach dem Knall kam das Geschrei. Die Verletzten sprangen auf, schrien durcheinander, vier von ihnen zogen Pistolen und schwenkten sie umher, ohne den Angreifer zu sehen. Bei dreien hatte der Beschuss mit der ganz besonderen Munition den gewünschten Effekt: Voller Wut und Schmerz verwandelten sie sich.
Fast so schnell, wie der Cayenne benötigte, um von null auf hundert zu beschleunigen, verformten sich die Körper, wurden sehniger, bekamen einen dichten, gelbbraunen Pelz, ohne aber ihre menschliche Statur zu verlieren. Sie heulten und knurrten dabei, die Verwandlung bereitete ihnen zusätzlich zum Silber Qual. Die Köpfe mit den spitzen Schnauzen ließen sie fuchsähnlich erscheinen, doch Eric wusste, dass er Schakalwesen vor sich hatte. Typisch für das alte ägyptische Lykantrophengeschlecht.
In der neuen Gestalt witterten sie sofort, wo sich der Schütze befand. Sie teilten sich auf und liefen geduckt aus verschiedenen Richtungen auf das Büfett zu, unter dem Eric immer noch kauerte. Es wurde Zeit, die Deckung zu verlassen, die ihn bei einem Nahkampf mehr behinderte als schützte.
Eric sprang in die Höhe und donnerte die zu langsam reagierenden Bewaffneten mit konventionellen Geschossen von den Füßen, ehe er dem ersten Werschakal eine Silberkugel aus der Bernadelli zwischen die Augen setzte. Der Schädel zerstob, dem Edelmetall blieb wegen der zerstörerischen Wirkung des Projektils fast keine Gelegenheit, seine Wirkung zu entfalten. Es zischte leise, als das Blut damit in Berührung kam, und es roch verbrannt. Der Torso flog an Eric vorbei und krachte auf den Tisch, schlitterte darüber und fiel auf der anderen Seite zu Boden. Laut scheppernd folgten ihm die Mehrzahl der restlichen Platten, das Geschirr und die Dekoration. Doch das nahm Eric gar nicht wahr, denn er musste sich bereits um den zweiten Schakal kümmern. Heiser bellend kam er auf Eric zu, stieß sich zum Sprung ab und zeigte ihm so leichtsinnigerweise den verwundbaren Bauch.
Die Bernadelli klemmte und weigerte sich, ihren Dienst zu tun. Geistesgegenwärtig langte Eric neben sich, ging dabei in die Knie, packte den Griff eines Tabletts – und schlug waagerecht nach dem Angreifer. Es entbehrte nicht einer gewissen Ironie, dass dem Wandelwesen jenes silberne Servierbrett, von dem es vorhin die Häppchen gereicht bekommen hatte, nun in den Rippen steckte.
Der Werschakal segelte über Eric hinweg und stieß ein schmerzverzerrtes Kläffen aus. Das Silber zersetzte sein Fleisch, seine Knochen, sein Blut und bereitete ihm unermessliche Qualen. Krachend schlug er gegen die Wand. Eric wirbelte herum, zog dabei die P9 und erschoss ihn, noch während er an der Vertäfelung herabsank.
Das dritte Wandelwesen verharrte. Schakale waren keine besonders mutigen Tiere; die Überzahl hatte sich ausgeglichen, und von den Männern in seinem Rücken erwartete er offenbar keine Hilfe. Die spitzen Ohren legten sich an den Kopf, und er wich zurück.
»Wo ist mein Vater?« Eric zielte mit der Pistole auf die Brust des Wesens. »Ich benutze Glaser-Munition. Eine Patrone besteht aus winzigen Kügelchen, die in einer Metallkapsel mit einer Plastikkappe eingeschlossen sind. Glaub mir, damit willst du keine Bekanntschaft machen!«
»Keine Ahnung«, krächzte der Schakal mit der schrillen, unmodulierten Stimme seiner Art; bei einem Menschen hätte man nicht gewusst, ob sie einem Mann oder einer Frau gehörte. Er sah sich lauernd um. »Ich …«
»Beim Aufprall reißt die Kappe, die Kügelchen schießen wie eine Minischrotladung in dein Fleisch und geben die Aufprallgeschwindigkeit von fünfhundertfünfzig Metern pro Sekunde achtmal schneller an den Körper ab als ein solides Projektil.«
»Ich weiß es nicht!«
»Man sagt, dass siebenundachtzig Prozent der Leute, die von herkömmlichen Kugeln getroffen werden, überleben. Aber über neunzig Prozent von denen, die Glaser-Munition abbekommen, sterben am Schock. Egal, wo sie was abbekommen.« Er zielte jetzt auf den Fuß seines Gegners. »Schauen wir mal.«
Es knallte. Der teure Lederschuh bekam ein Loch, die Sohle wurde nach oben gedrückt, Blut und Gewebe platzten rechts und links heraus. Der Werschakal jaulte auf, machte zwei linkische Hopser rückwärts und fiel auf den Teppich, keuchte, hechelte und krümmte sich. Seine Regenerationsfähigkeit mochte jede Wunde heilen können, doch sie fing die Wirkung der Glaser-Munition nicht ab; das Wandelwesen starb vor den Augen der fünf verbliebenen entsetzten Männer. Mit dem Tod kehrte die menschliche Form zurück.
»Wenn die Kügelchen aus Silber sind, wirkt die Munition noch besser. Habe ich vergessen zu erwähnen.« Eric stand auf. »Welches von den Arschlöchern war Upuaut? Und wo ist mein Vater?« Er zog den Hahn der P9 zurück. »Ich habe noch sechs Schuss und wenig Geduld. Also?«
Das Handy vibrierte los. Mit der freien Hand fischte Eric es aus der Tasche und hielt es sich ans Ohr. »Ja?«
»Sie wurden gewarnt«, raunte eine Frauenstimme. »Warum sind Sie trotzdem hierher gekommen, Herr von Kastell?«
»Wo ist er?«
»Was bieten Sie für sein Leben?«
»Dein Leben.«
Die Stimme lachte. »Machen wir ein Spiel. Ich habe mich nach einem Gott benannt, weil ich tatsächlich über Leben und Tod herrsche. Ich werde Sie noch einmal anrufen, und wenn Sie nicht abheben, wird Ihr Vater sterben. Nehmen Sie das Gespräch an, und ich lasse ihn auf der Stelle frei. Deaktivieren Sie besser Ihre Mailbox.« Das Gespräch wurde mit einem Klicken beendet.
»Was ist das für eine Kacke?« Eric fluchte, stellte den Klingelton wieder an und feuerte dem Mann, der am weitesten von ihm weg stand, in die Brust. Ächzend fiel er rücklings auf die Kissen und starb mit aufgerissenen Augen. »Fünf Schuss, keine Geduld.« Der Lauf ruckte auf den Nächsten.
Er hörte ein leises Klimpern, und aus den Augenwinkeln sah er den Schatten heranhuschen. Dem nur erahnten Angriff gegen seinen Kopf wich er mit einer Körperdrehung zur Seite aus, konnte aber nicht verhindern, dass er einen Schlag auf den rechten Arm erhielt. Die Hand öffnete sich, das Telefon fiel klappernd auf den Boden und schlitterte davon.
Vor ihm stand die Bauchtänzerin. Die Hände hielten zwei Schlagstöcke vor dem trainierten Körper, die braunen Augen blickten ihn geringschätzig an. Ihre Haltung drückte Stolz aus – und eiskalte Überlegenheit. Sie glich einer Pharaonin, die vom Thron gestiegen war, um den anmaßenden Eindringling in ihrem Palast eigenhändig zu töten. Und Eric fand sie in dem knappen Outfit auch noch verdammt attraktiv.
»Sie stören meinen Tanz.« Ihr Stock zuckte wie ein Blitz vorwärts, schnell, elegant und brachial; es gab keine Chance, in irgendeiner Weise auf den explosiven Angriff zu reagieren. Sie schlug ihm die Sig Sauer aus den Fingern, trat ihm synchron dazu gegen die Brust und schleuderte ihn gegen den Beistelltisch. Er krachte, zusammen mit intakten und kaputten Wasserpfeifen sowie den Teetassen, in den Kissenberg; heißer Tabak brannte in seinem Gesicht und versengte seinen Kinnbart.
Eric rollte sich ab, so gut es bei dem weichen Untergrund ging, schnappte sich das Tischchen als improvisierten Schild und erwartete seine Angreiferin.
Sie attackierte mit der Eleganz einer Tänzerin und der Wucht eines Sandsturms. Die harten Hiebe prasselten gegen das Blech, das sich mit jedem Treffer verbog. Das Ägyptische an ihr, der überhebliche Ausdruck, der unerwartete Mut, die Schlagstöcke, die an die Keulen jenes altägyptischen Gottes erinnerten, brachten ihn auf einen unerhörten Gedanken. War sie Upuaut?
Gerade als die Tänzerin zu einem Doppelschlag ausholte, trat Eric unter seinem Schild nach ihrem vorderen Fuß und fegte sie von den Beinen. Er hob das Tischchen hoch und schleuderte es nach ihr. Sie rollte sich blitzschnell zur Seite, wollte aufspringen – und schaute in die Mündung der Glock.
»Bleiben Sie bitte so, Schönheit.« Eric stand über ihr. Er hatte den Augenblick der Ablenkung genutzt, um die Zweitwaffe aus dem Stiefel zu ziehen. Die Tänzerin lag still, eine Hand hinter dem Rücken, die andere hielt einen Schlagstock. Der Tod war ihr nah, und trotzdem zeigte sie keine Anzeichen von Furcht.
Irgendwo im Hintergrund dudelte das A-Team los.
Die Frau grinste gefährlich und zeigte ihm ein Raubtiergebiss; die kräftigen Zähne glichen einer Wand aus spitzen Messern.
Die Sorge um seinen Vater machte ihm Angst, die er niederkämpfen musste, um die Kontrolle zu behalten. »Hey, Schnurrbart!«, schrie Eric einen der zu Statisten degradierten Männer an, die wie gelähmt herumstanden und nur abwarten konnten, wie der Kampf endete. »Geh ran.«
Der Mann wagte nicht, sich zu bewegen.
»Geh an das verfluchte Handy, oder ich schwöre …«
Dann geschahen zwei Dinge gleichzeitig: Einer der Männer bückte sich nach der P9, die zu seinen Füßen lag, und die Tänzerin nutzte seine Ablenkung. Der Schlagstock zuckte derart schnell vorwärts, dass ihm keine Zeit blieb. Er knallte gegen sein Gesicht und küsste ihn schmerzhaft; Eric strauchelte benommen gegen die Baldachinstütze und riss die Konstruktion ein. Die Welt um ihn herum verschwand in schwarzer Seide. Er sah die grünen Stoffblätter einer gestickten Palme vor sich und roch die Düfte von Essen und von Weihrauch, die sich darin gefangen hatten; neben sich hörte er das Keuchen eines Mannes. Er war also nicht allein unter dem Stoff begraben worden.
Immer noch rief das A-Team nach ihm, gleich darauf wurde die Melodie vom Dröhnen seiner eigenen Sig Sauer übertönt, mit der einer der Ägypter auf ihn schoss. Die Glaser-Geschosse sirrten um ihn herum durch den Baldachin, verfehlten ihn aber. Blind wie er war, hechtete Eric ungefähr in die Richtung, in der er den Kissenstapel vermutete; der musste als Deckung dienen, bis er sich aus dem Seidennetz befreit hatte.
Das Schießen endete, das Magazin war leer.
Upuaut hatte einen Mordsspaß, ihn zu quälen, denn das Handy bimmelte ohne Unterlass, lockte ihn, rief ihn zu sich und drohte trotz der heiteren Melodie mit dem Tod seines Vaters.
Aus Erics Angst wurde Panik. Mit roher Gewalt riss er sich aus der Stoffbahn frei – gerade noch rechtzeitig, um den Mann, der noch die leer geschossenen P9 in Händen hielt, mit einem Treffer in die Brust auf den Boden zu zwingen. Von den anderen Männern und der Tänzerin fehlte jede Spur.
»Scheiße, verdammte!« Eric lief geduckt auf die andere Seite des Kissenstapels, wo er das Handy vermutete, hob unterwegs die P9 auf und lud ein neues Magazin nach.
Plötzlich griff ihn die Tänzerin wie aus dem Nichts an. Sie hatte sich verwandelt, war halb Frau, halb Tier geworden, bewegte sich auf zwei Beinen und sah dabei aus wie eine überdimensionale Chimäre mit glänzendem Fell. Nur noch der Gurt aus den dünnen Metallplättchen lag um ihre Hüfte, die restliche Kleidung war abgefallen. Ihre Kurzstöcke zischten nieder.
Eric benutzte seinen weißen Lackmantel zur Abwehr, wirbelte ihn herum und fing so die Schläge ab, nahm ihnen einen Teil ihrer mörderischen Wucht. Gleichzeitig trat er ihr in den Unterleib. Sie kläffte überrascht auf; die Kappen aus gehärtetem Silber verursachten ihr Schmerzen und brachten sie aus dem Angriffsrhythmus. Das nutzte er, um seine Waffe durchzuladen.
»Flieg bis zu den Pyramiden, Dreckvieh!« Eric setzte ihr die Mündung der P9 genau in Herzhöhe aufs Fell und drückte in schneller Folge ab. Der Erfinder der Glaser-Munition hätte seine wahre Freude an dem gehabt, was die Kügelchen mit dem Leib der Tänzerin anrichteten. Nichts, was sich im unmittelbaren Eintrittsbereich befand, blieb zurück. Die Rippen und das Herz wurden zerrissen, das Wandelwesen bäumte sich jaulend auf – und fiel gleich darauf tot auf das Parkett. In wenigen Augenblicken verwandelte sie sich zurück. Vor ihm lag nun wieder eine nackte, schöne Frau von fünfundzwanzig Jahren mit einem Münzgurt um den Bauch und einem klaffenden Loch in der Brust. Nichts deutete darauf hin, dass sie Reißzähne und Klauen besessen hatte. Kein normaler Mensch würde ihm glauben, wenn er von einem Kampf mit einem Wandelwesen berichtete.
Das Handy klingelte noch immer. Eric hechtete in seine Richtung.
Unter den Resten des Baldachins bewegte sich etwas. Eine spitze Schnauze mit hellem Fell zerschnitt den Stoff und erweiterte den vorhandenen Riss, durch den sich ein weiterer Schakal hinauszwängte. Er sprang an Eric vorbei, schnappte sich das Handy und spurtete los.
»Du Wichsding!« Eric kniete sich hin, um mit der Glock ruhiger zielen zu können. Dreimal drückte er rasch hintereinander ab. Das Tier winselte schrill auf, als es in den Leib und den rechten Hinterlauf getroffen wurde. Dummerweise hatte die Glock keine Glaser-Munition geladen. »Gib das Handy her!« Eric nahm die Verfolgung des verletzten Wesens auf, während der Tod seines Vaters immer drohender Gestalt annahm.
Der Schakal hinkte zur Tür hinaus, sein Jäger hetzte hinterher.
Auf dem Flur sah er sich einem Mann gegenüber; er stand zehn Meter vor ihm an einer offenen Tür und gestikulierte. Ohne zu zögern, feuerte Eric im Laufen und traf gut genug, dass der Feind sterbend auf den Boden fiel. Die Tür wurde ruckartig geschlossen, und ein Schloss klackte laut.
Das A-Team säuselte unaufhörlich und unerbittlich.
Eric blieb stehen und schoss die restlichen sechs Projektile nach dem Wandelwesen, ungeachtet des Handys, das er dabei beschädigen könnte.
Der Schakal brach zusammen, lag verkrampfend da und bäumte sich gegen den Tod auf. Das Silber, das in seinem Körper wütete, verbrannte ihn von innen heraus.
Eric steckte die Glock unter den Gürtel, zerrte das zerkratzte Handy aus der Schnauze und drückte atemlos den grünen Knopf. Sein Arm schmerzte vom Treffer des Schlagstocks höllisch.
»Ich habe abgenommen, Upuaut«, keuchte er, wechselte mit einer Hand das Magazin der Sig Sauer und bewegte sich auf die Tür zu, hinter der sich noch jemand befand. »Lass meinen Vater in Ruhe, und ich gebe dir einen Vorsprung.«
»Sie leben noch immer?« Die Stimme klang erstaunt. »Ich dachte, meine Tochter hätte sie erledigt.«
»Die Tänzerin?«
»Ja.« Die Frau schwieg, als fürchtete sie sich vor der Antwort auf die Frage, die sie nun unweigerlich stellen musste. »Was …?«
»Was glaubst du?«
Eric meinte, ein scharfes Einatmen zu hören; für einen quälend langen Moment herrschte unergründliches Schweigen.
»Upuaut? Gib mir meinen Vater …«