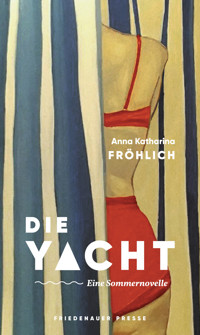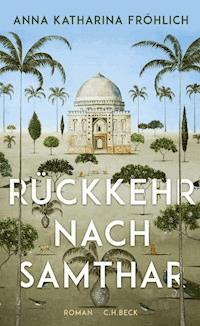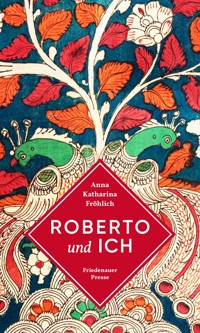
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Er, Roberto Calasso, ist der Mailänder Verleger, der Autoren aus aller Welt im von ihm geführten Adelphi Verlag versammelt, und zudem ein scharfsinnig gelehrter und sprachlich eleganter Autor. Sie, Anna Katharina Fröhlich, zieht von Frankfurt nach Mornaga am Gardasee und befindet sich als junge, abenteuerliche Frau zwischen Büchern und ihrem Garten auf dem Weg zur erfolgreichen Schriftstellerin. Zum ersten Mal begegnen sich die beiden im Oktober 1995 auf der Frankfurter Buchmesse. »Eine Liebesgeschichte unter dem Stern des Reisens« beginnt – und ein Bund mitBüchern. Knapp dreißig Jahre später blickt Anna Katharina Fröhlich zurück und erzählt von der Verbindung zweier Menschen, die gemeinsam den Mut hatten, sich auf ein ganz und gar unkonventionelles Abenteuer einzulassen, das Geist und Leben zu vereinen versprach – und bis 2021 andauerte, dem Todesjahr von Roberto Calasso, der auf der venezianischen Toteninsel San Michele neben seinem besten Freund, dem Dichter Joseph Brodsky, sein Grab fand. Anna Katharina Fröhlichs erinnerndes Erzählen ist frivol und diskret zugleich, humorvoll und intim, vor allem aber gedankenreich. Es zeichnet aufs Lebendigste das Porträt eines Menschen und den Kern im umfangreichen Œuvre eines Schriftstellers nach, der sich die Freiheit nahm, alle Konventionen des Literatur- und Wissenschaftsbetriebes zu ignorieren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 237
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Anna Katharina Fröhlich
Roberto und ich
Ein Bund mit den Büchern
Friedenauer Presse
Aber jeder Tag von früher bleibt in uns deponiert wie in einer unendlich großen Bibliothek, in der auch noch von den ältesten Büchern jeweils ein Exemplar existiert, nach dem wahrscheinlich nie ein Mensch fragen wird.
– Marcel Proust, Auf der Suche nach der verlorenen Zeit
Eswar etwa zwölf Uhr mittags, als ich in einem käfergrünen, bodenlangen, vielleicht aus einem Gardinen- oder Bezugsstoff genähten Wollkleid mit Damastmuster, Puffärmeln und einer Reihe grün glänzender Plastikknöpfe unter einem breitrandigen, ebenfalls grünen Filzhut neben meiner Mutter in Halle 4 der Frankfurter Buchmesse stand.
Ich war dreiundzwanzig Jahre alt. Der Hang zu großen Hüten und bis zum Boden herabfallenden Kleidern war von meiner Mutter auf mich übergegangen, die an jenem Tag in einem schwarzen Rock, der von der Hüfte an in drei ineinander übergehenden Schößchen bis über die Absätze ihrer Schuhe fiel, neben mir stand und ihren Betrachtern die klare Aussage überbrachte, dass sie aus einer anderen Welt stammte, einer Welt, in der Zypressen und Oliven wuchsen, Kaminfeuer brannten, Brunnen rauschten, plötzlich Schlangen auftauchten und Jagdschüsse widerhallten. Es war ihre Gabe, dass sie nicht grotesk wirkte, sondern an eine Schauspielerin erinnerte, die sich vor langer Zeit aus dem Set eines Films von Jean Renoir entfernt hatte und nun die Gänge des Messegeländes entlangschlenderte, um in ihrer Kostümierung Männer zu bezaubern, die, ähnlich wie Calderón de La Barca, im Leben einen Traum sahen.
Sie trug etwas in die großen Hallen hinein, das aus Varieté und der Welt von Gian Domenico Tiepolo gemacht war und den Eindruck von Extravaganz und erotischer Abenteuerlichkeit hinterließ. In Wahrheit entfaltete sie diese marketenderinnenhafte Koketterie vor dem festen Hintergrund ihres Gartens am Gardasee, von dem sie jedem, der sie ansprach, erzählte. Von diesem Garten trug sie immer etwas mit sich herum, einen Hauch von Aschegeruch aus dem Kamin ihrer Küche oder eine winzige, rostrote Hühnerfeder, die sich zwischen einigen Fäden ihres Rocks festgesetzt hatte.
Um uns herum hatten alle einen vollen Zeitplan, nur meine Mutter und ich gingen über die Messe wie über einen Jahrmarkt. Ich kannte das Frankfurter Messegelände seit meiner Kindheit, liebte die Zigarettenverkäuferin mit ihrem rauen Ruf »Zigarren! Zigaretten!«, den Geruch von Kaffee und Papier. Bei allen Witterungen, bei schneidendem Wind oder Nachsommerwärme, hatten wir wartend vor dem Messezaun gestanden, bis ein Freund uns heimlich zwei Eintrittskarten zusteckte. Auf den Gängen trafen wir dann auf romantische Figuren, wie auf den Übersetzer aus dem Ungarischen Paetzke, den Historiker Günther Barudio, den fechtenden Verleger Michael Klett, den Journalisten Andreas Graf Razumovsky oder den Übersetzer Peter Urban. Die italienischen Stände versetzten uns in Reiseerregung, die französischen in ehrfürchtige Neugier. Als ich älter wurde, war die Messe für mich eine vanity fair, wo man sich auf die Suche nach einer Liebe machte.
Jetzt fiel unter der hochgeschlagenen Krempe ihres schwarzen Huts der kurzsichtige, doch deshalb nicht weniger messerscharf wahrnehmende Blick meiner Mutter auf einen Mann, der am Stand des Verlags Matthes & Seitz mit Axel Matthes sprach. Dieser Mann blendete mit einem Schlag alle anderen Menschen aus ihrer Sicht aus.
Selten das Opfer von Irrtümern, wenn es um derart existentielle Dinge wie die Eroberung eines geistvollen Mannes ging, erklärte sie mir: »Da ist Roberto Calasso«, nahm ihre Brille ab und überquerte mit strahlenden Augen den Gang.
Es war Freitag, der 13. Oktober 1995.
Heinrich Heine hat behauptet, dass wahrheitsgetreue Selbstbiographien beinahe unmöglich sind, dass der Mensch bestimmt über sich selbst lügen wird. Ich bin der Ansicht, dass der Mensch, im unausrottbaren Bewusstsein seiner Geringheit, immer über sich selbst lügt, um nicht an sich zu verzweifeln. Traum und Lüge sind die schönen Stoffe, die sich in schillernden Farben schützend über das breiten, was Kafka als »das Unzerstörbare« im Menschen bezeichnet.
Aus höherem Blickwinkel gesehen, ist auch ein Datum Lüge, ein vom Menschen ersonnener Halt im Strom dessen, was er Zeit nennt. Denn was sind Kalendertage und Uhrzeiten anderes als Haken, an denen wir unsere Erinnerungen festmachen?
Schlage ich mein Tagebuch aus dem Jahr 1995 auf, wehen mir aus seinen Seiten Zettel, Zeitungsausschnitte oder Zugfahrkarten entgegen, darunter ein mehrmals zusammengefaltetes, im Lauf der Jahre immer dünner gewordenes, an die Konsistenz eines Libellenflügels erinnerndes Stück Papier, auf dem in der schon beinahe unleserlich gewordenen Handschrift von Roberto das Datum unserer ersten Begegnung steht. Auf diesem kleinen Zettel mit den von Calasso einmal mit frischer, blauer Tinte hingeschriebenen Zahlen, deren Blau dem Papier nach und nach entwichen ist und sie zu Wasserzeichen reduziert hat, verdichtet sich die Macht, mir Zugang zu jenem Oktobertag zu verschaffen, an dem ich ihn kennenlernte.
Natürlich erinnere ich mich nicht an die genaue Reihenfolge der Sätze, die meine Mutter, kaum dass sie vor ihm stand, an ihn richtete, doch was sie sagte, lautete in etwa so: »Ich bin Jane Ross und das ist meine Tochter Katharina. Schon vor langer Zeit habe ich La casa della vita von Mario Praz gelesen und möchte das Buch ins Deutsche übersetzen.«
Wie im Märchen von Ali Baba und die vierzig Räuber war es ja schließlich nur darauf angekommen, die richtige Formel, das Sesam, öffne dich zu finden, den Namen von Mario Praz, damit sich Calassos bereits lebhaftes Interesse in volle Aufmerksamkeit wandelte.
Ich weiß nicht, wie weit es stimmt, wenn meine Mutter später behauptete, sie wäre auf der Suche nach einem Beschützer für mich gewesen, denn weshalb benötigte ich mit meinen dreiundzwanzig Jahren in Mailand, wo ich mich an der Universität in Philosophie eingeschrieben hatte, eine Protektion? Vielmehr nehme ich an, dass sie einfach nur den perfekten Augenblick gekommen sah, mir die Gelegenheit zu verschaffen, mein Glück in der Welt zu versuchen, die für sie in diesem einen Moment Roberto Calasso bildete.
Von ihrem zweiten Ehemann Günther Maschke hatte sie beeindruckende Worte über den Mailänder Verleger gehört, Worte, deren Wirkung ihr den Antrieb gegeben hatten, auf ihn zuzugehen, ohne sich dafür zu schämen, kein einziges Buch von ihm gelesen zu haben. Die Bemerkungen ihres Mannes über Calasso, dessen intellektuelles Renommee ihn in ihren Augen über alle anderen Verleger und Männer der Literatur stellte, hatten bewirkt, dass sie nicht nur wie an eine mythische Persönlichkeit, sondern auch wie an einen Wahlverwandten an ihn herangetreten war, der von dieser Verwandtschaft allerdings nicht die blasseste Ahnung besaß.
In ihren Augen war der italienische Verleger und Schriftsteller so etwas wie eine Madame de Guermantes unter den Verlegern, bei der mich einzuführen sie mir jetzt die Hilfestellung gab. Marcel Proust nicht unähnlich, verstand sie unter Geist »eine mit Worten nicht ausdrückbare, goldene, von Waldesfrische durchströmte Wundergabe«, worin Roberto vielleicht im Geheimen mit ihr übereingestimmt, dennoch diese Äußerung Prousts für misslungen gehalten hätte. Das Wort »Geist« konnte ihn reizen wie kein anderes.
Unabhängig von den Wünschen der Mütter für ihre Töchter hat jede Liebe ihren Ursprung im Anblick. Calassos Augen blieben, nachdem sie in blitzschneller Abwechslung auf meiner Mutter und mir geruht hatten, an meinem Gesicht hängen.
Der Augenblick unserer ersten Begegnung am Stand von Matthes & Seitz war der schicksalhafteste Moment meines Lebens. Unter dem Filzhut spürte ich, dass meine Mutter da etwas Kühnes tat. Keinesfalls zurückhaltend, wie es der gute Ton verlangt, schallten die Worte enthusiastisch aus ihrem Mund, dass es um sie her nur so widerhallte vor Namen von Schriftstellern und Buchtiteln. Sie sagte nichts, was ihre Bewunderung für Calasso ausdrückte, doch ihre blitzenden Blicke, ihre leicht zu ihm hin geneigte Haltung, ihr Lachen übernahmen es für sie.
Auch wenn ich in meinem grünen Kleid mit den Puffärmeln wie eine Komparsin aus einem Goldoni-Stück neben ihr stand, muss ich etwas so Heiteres und Verlockendes verströmt haben, dass Roberto nicht die Flucht ergriff, wie es oft seine Art war. Er war neugierig auf mich, bodenlos neugierig. Später schrieb er mir in einem Brief, dass meine Erscheinung eine Epiphanie für ihn gewesen sei.
In diesen Augenblicken am Stand von Matthes & Seitz lag ein Brio, das uns alle drei in Bann schlug. Mit dem von Axel Matthes in München gegründeten Verlag hatte Adelphi das Privileg gemein, in einer Zeit, als es noch so etwas wie eine Orthodoxie des Marxismus gab, einem unorthodoxen, metaphysischen Denken Raum zu bieten. Jenseits der klassischen Frontstellung zwischen Religion und Aufklärung veröffenlichten Adelphi wie auch Matthes & Seitz Autoren wie Pawel Florenski oder Cristina Campo, Schriftsteller, die jenseits eines strengen Materialismus dachten und dennoch viel zu modern waren, um noch der guten alten Zeit des Priesterbetrugs und des Opiums für das Volk im eigentlichen Sinn anzugehören.
Wenn ich mich richtig erinnere, ließ Roberto seinen Freund Axel Matthes brüsk stehen und wir folgten ihm über die Gänge, bis wir vor dem Stand von Adelphi anlangten. Schon auf diesem ersten Weg an seiner Seite spürte ich, unter dem Eindruck, dass Witz und Schnelligkeit der Reaktion ihn anzogen, den beschwingenden Druck, keine Plattheiten über meine Lippen kommen zu lassen. Es war eindeutig, dass ihn Menschen, die nicht sofort verstehen, nicht interessierten. In seinen Blicken und Worten lag die offensichtliche, etwas kindlich anmutende Hoffnung, dass ich über die »richtigen« Einsichten verfügte, von denen er überzeugt war, dass es sie gab.
Am Freitagmorgen hatte ich Roberto kennengelernt. Am Freitagabend verließ ich in einem schwarzen Rock, einem schwarzen Pullover und einem unter dem Kinn zusammengeknoteten, schwarzen Spitzentuch das Gästehaus der Deutschen Bank, das damals meine Freundin Lis Hauber führte. Ich fühlte mich wie ein weiblicher Gil Blas vor seiner Abreise nach Salamanca, umarmte meine Mutter und meine Freundin Lis, die mir bei der Wahl meiner Garderobe geholfen und mich mit Shalimar besprüht hatten, und setzte mich zwar auf kein Maultier, aber ging zu Fuß durch die Straßen des dunklen, herbstkühlen Westends. Auf den Bürgersteigen lagen vertrocknete, von der abendlichen Feuchtigkeit wieder weichgewordene, nach Pilz und Moder riechende Kastanienblätter, deren Geruch jene Straßen durchzog, die ich als Kind so oft entlanggelaufen war, dabei etwas von mir in ihnen zurücklassend, was ich auf jeder Reise nach Frankfurt wiederfand. An einem schmiedeeisernen Zaun oder in einem von Efeu umwachsenen Vorgarten eines bestimmten Hauses haftete, wie ein Fingerabdruck, noch immer etwas von meinem damaligen Wesen.
Wie eine Schauspielerin vor ihrem Auftritt trug ich meine Schminke wie frische Farbe auf dem Gesicht, das pfirsichrote Rouge, die schwarze Tusche auf den Wimpern und die mit einem Eyeliner gezogenen schwarzen Lidstriche. Schließlich erreichte ich das Hotel Der Hessische Hof, vor dem zu dieser Stunde ein Taxi nach dem anderen vorfuhr. Zu Jimmy's Bar stieg man über eine schmale Seitentreppe hinab.
Es gibt nichts Erregenderes in einer beginnenden Liebesgeschichte als die Schritte, die man in Richtung einer geschlossenen Tür macht, hinter welcher der zu erobernde Mann oder die zu gewinnende Frau wartet. Calasso saß mit einem Gin Tonic an einem kleinen Tisch.
Seit jenem ersten Treffen mit Roberto in Jimmy's Bar bedeutete für mich die Buchmesse das Geräusch von aufklappenden Taxitüren, von eiligen Schritten über die Treppenstufen zum Hessischen oder zum Frankfurter Hof.
Seit Jahren war es für Calasso Brauch gewesen, am Freitagabend der Buchmessetage Vladimir Dimitrijević, den in Serbien geborenen Verleger von L'Âge d'Homme, ins Restaurant Français einzuladen, doch in jenem Jahr sagte er seinem alten Freund ab, um mich, nach dem Gin Tonic in der Bar, dorthin zu führen. Vladimir! Wie viel sollte mir Roberto noch von diesem Mann erzählen.
Während wir uns im gedämpften Licht des Restaurant Français an einem kleinen Tisch gegenübersaßen und Champagner tranken, begannen wir mit dem Erzählen, ein Erzählen, das sich in den folgenden fünfundzwanzig Jahren fortsetzen sollte.
Ich glaube, dass ich damals alle Eigenschaften besaß, um Roberto zu gefallen. Ich war schön, ging nicht zur Wahl, las keine Zeitung, interessierte mich nicht für die Moden und Marotten der Gegenwart, war Tochter eines Schriftstellers und Beute eines Heißhungers nach Büchern. Meine kurze Biographie schien wie gemacht, um einen Mann wie ihn anzuziehen, den »abenteuerliche Frauen« ins Träumen versetzten. »Sie war eine abenteuerliche Frau«, sollte ich ihn noch oft sagen hören, wenn er von bestimmten Frauen sprach, die ihn faszinierten. Auch dass ich Deutsche war, gefiel ihm, da seine erste Liebe, ein Mädchen mit langen, blonden Zöpfen, das in dieselbe Grundschule wie er gegangen war, aus Deutschland stammte. Er liebte die deutsche Literatur, die deutsche Sprache, das deutsche Wort »Faulpelz«.
Ich hatte dem mir gegenübersitzenden Mann viel zu bieten. Wenn auch noch nicht sehr lange auf der Welt, war ich doch schon lange genug hier, um vielleicht mehr erlebt zu haben als eine doppelt so alte Frau. Vor allem erzählte ich ihm von meinem Vater, Hans Jürgen Fröhlich, den ich seit seinem frühen Tod wie eine Heiligenfigur in meiner Erinnerung herumtrug und zu immer neuem Leben erweckte, wenn ich von ihm sprach, mein Gegenüber indirekt auffordernd, meinen Vater in mir zu ehren, der neben seinen Büchern – sechs Romane, ein Erzählband und eine Biographie über Schubert – zahllose Essays, Interpretationen, Vorträge, Kritiken und Artikel für Die Welt der Literatur und die Frankfurter Allgemeine Zeitung schrieb, nachdem ihn Marcel Reich-Ranicki 1976 mit einem Beitrag für die Frankfurter Anthologie als Mitarbeiter für die Zeitung gewonnen hatte. 1932 in Hannover geboren, hatte er eigentlich Musiker werden wollen und bei Wolfgang Fortner studiert, doch stieß er eines Tages während der Suche nach einem geeigneten Opernlibretto auf die Bücher von Franz Kafka. Die Lektüre von Kafkas Romanen und Erzählungen veranlassten ihn, selbst mit dem Schreiben zu beginnen und seine Laufbahn als Komponist aufzugeben.
Natürlich war ich kokett und verstand die Kunst, einen Mann zu faszinieren, doch immer verlangte ich von dem Menschen, der mir gegenübersaß, Respekt vor dem Leben, in das ich durch den Geist meiner Eltern geraten war, ein Leben, das vor allem aus Literatur und einem Garten bestand. Auch von meinen zwei Stiefvätern erzählte ich Roberto. Als Verleger von Carl Schmitt, dessen in Deutschland so umstrittenen Thesen für Calasso, der durch und durch Italiener war, wahrscheinlich als Selbstverständlichkeiten durchgingen, war Roberto dem Carl-Schmitt-Experten Günter Maschke schon einige Male auf der Buchmesse begegnet, während ihm mein zweiter Stiefvater, Thomas Ross, der nach Jahren bei der Wiener Presse im Jahr 1965 Auslandskorrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung geworden war, als Balkankorrespondent aus Belgrad, später aus Tokio über Ostasien und Anfang der achtziger Jahre aus Neu Delhi über Südasien berichtet hatte, unbekannt war.
Meine bizarre familiäre Geschichte klang, wie Roberto mir später gestand, etwas unwahrscheinlich, doch spürte ich an jenem Abend genau, welchen Genuss es ihm bereitete, meinen Erzählungen zuzuhören und sich mit mir zu unterhalten.
Im achtzehnten Jahrhundert hätte man von mir behauptet, eine höchst unregelmäßige Erziehung und Ausbildung genossen zu haben. Ich hatte die Grundschule und zwei Jahre Gymnasium in Frankfurt, zwei weitere Jahre Gymnasium in München und schließlich noch fünf Jahre Liceo linguistico in Saló am Gardasee hinter mir, als ich, zur Belustigung meines Pädagogik lehrenden Onkels, der über mich lachte wie über eine perfekte Null, die Schule mit einundzwanzig Jahren abschloss. Doch waren es nicht die verschiedenen Schulen, die meinen Charakter und meinen Geschmack geprägt hatten, sondern die Zeit, die ich seit meinem vierzehnten Lebensjahr an jenem Ort verbrachte, der mein Angria war: Mornaga.
Wie unter den Kreuzbögen eines mittelalterlichen Klosters fühlte ich mich zwischen den Mauern von Mornaga geschützt wie eine junge Amsel in ihrem Nest. Dieses Grundstück am Gardasee hatte mir mit seinem Olivenhain, seiner ehemaligen Zitronenanlage, seinen Brunnen und Pflanzen seit meiner Kindheit, doch vor allem seit dem Umzug von Deutschland nach Italien immer den reichsten Stoff für meine Phantasie geliefert, ähnlich wie das von den Geschwistern Brontë erfundene Land Angria, in dem Charlotte, Emily, Anneund der Bruder Branwell ihre Geschichten über eine Welt voll orientalischer Pracht, mit gläsernen Städten und brennenden Wüsten, ansiedelten. Mit acht oder neun Jahren hatte ich am Klavier ein Lied über Mornaga erfunden, das ich in mein Tagebuch übertrug. Es hieß »Mornaga, Traumhaus aller Träumer«.
Das anarchische Leben mit seinen am Kamin verbrachten, nächtlichen Lesestunden, mit seiner Arbeit auf dem großen, verwilderten Grundstück, aus dem meine Mutter nach und nach einen ornamentalen Garten geschaffen hatte, die Freundschaften mit den Handwerkern, Bauern und alten Männern der Gegend, die hier entstandenen Liebesgeschichten, das Kommen und Gehen von Freunden aus Frankfurt, Wien, Neu-Delhi, Berlin, Paris oder München, die Erkenntnis, dass die Wirklichkeit nur von der Phantasie abhängt, diese Art von Dasein hatte mich etwas wild und weltfremd gemacht.
Mein Wesen überraschte Roberto. Er spürte, dass mein Leben oft nicht leicht, doch niemals langweilig gewesen war.
Ich wusste, dass alles seinen wirklichen Anfang nehmen würde, wenn Roberto mein Angria sehen würde, und lud ihn ein, mich an meinem Geburtstag in Mornaga zu besuchen, mit der Behauptung, eine Ente für ihn schlachten zu wollen. Ich hatte fest angenommen, er müsse das Bild von einer Enten tötenden Frau ebenso romantisch finden wie ich. Doch wie war ich erstaunt, als er sein Gesicht verzog und mich fast anflehte, das Tier um Himmels willen leben zu lassen! Was in meinen Augen romantisch war, betrachtete er als barbarisch.
Nicht nur die Entdeckung, dass der Wunsch, mit der Zeit zu gehen, mir vollkommen fremd war, nahm Roberto für mich ein. Was den Mann am Tisch des Restaurant Français, wo es leise wie im Saal eines Kurhotels zuging, noch mehr begeisterte, war die Tatsache, dass mein Leben immer um Bücher gekreist war und augenscheinlich immer darum kreisen würde, dass in meinem Kinderzimmer die Werke von Clausewitz und Ernst Kreuder, die Reiseerinnerungen von Charles Darwin und die Erzählungen von Jouhandeau und Gobineau gestanden waren. Ohne ernsthaft gebildet zu sein, hatte ich dennoch so viel von Literatur mitbekommen, um ein scharfes Auge für Bücher entwickelt zu haben.
Roberto war genau der richtige Mann, vor dem ich mit meinem Leben und meinen Lektüren prahlen konnte. Die junge Frau, die vor ihm saß, war, wie eine Flickendecke aus verschiedenen Stoffresten, aus all den Büchern gemacht, die sie bis dahin gelesen hatte. Marcel Proust, Virginia Woolf, Katherine Mansfield, Anton Čechov, Henry Miller, Paul Verlaine, Tolstoj, Molière, Gottfried Benn, in alle diese Schriftsteller und Dichter war ich für die Zeit der Lektüre wie in einen Brunnen hinabgetaucht. Und wie beim Emportauchen aus einem Brunnen eine Alge oder etwas Schlamm an irgendeinem Körperteil hängen bleiben, so war an meinem Wesen etwas von diesen Frauen und Männern hängen geblieben, »ein Wort – ein Glanz, ein Flug, ein Feuer, ein Flammenwurf, ein Sternenstrich – …«. Der Umhang mit der tiepoloroten Fütterung von Madame de Guermantes, er hatte schon unzählige Male auch auf meinen Schultern gelegen, und der Professor aus Katherine Mansfields Erzählung Die moderne Seele hatte auch an mich schon mindestens dreimal die Frage gerichtet: »Oder vielleicht lieben Sie es nicht, Würmer zu essen? Alle Kirschen enthalten Würmer.« Mit welcher inneren Anspannung war ich durch das strahlende und zugleich düstere Haus von Balzacs Alchimisten gegangen, mit seinem Marmorkamin, seinen Spieltischen, vergoldeten Konsolen, bemalten, Fische enthaltenden Glaskugeln, seinen schweren, roten, schwarz geblümten, mit weißer Seide abgefütterten Damastvorhängen! Als ich neunzehn oder zwanzig war, hatte ich mir an einem verregneten Aprilabend, auf der Suche nach einem »kleinen Liebesnest«, in Brooklyn Heights ein Paar lange Handschuhe übergestreift und einen schönen Maulwurfspelz um meinen Hals geschlungen, um als Mona mit Henry Miller eine Vita nuova zu beginnen. Und all die Küsse, die in Prousts Recherche Albertine von Marcel erhielt, hatte ich an den Versicherungsagenten weitergegeben, in den ich einmal verliebt war.
Unser auf Italienisch geführtes Gespräch verband mich mit einer Welt, die mir von klein auf vertraut war. Die Namen, die wir über die kleine Tischplatte hinweg nannten, Joseph Brodsky, Federico Fellini, Karen Blixen oder Georges Simenon, dienten uns als Magnetnadeln.
Die Hochzeit von Kadmos und Harmonia hatte ich vor längerer Zeit einmal gelesen. Robertos andere Bücher kannte ich nicht, erst im Restaurant Français begann ich, mich für sie zu interessieren und ihn danach auszufragen. Auch wenn nichts an ihm auf das Verlangen deutete, gefallen zu wollen, bereitete es ihm sichtbare Freude, mich so empfänglich für seine Bücher zu sehen. Kurz nach unserer Begegnung sollte ich das 1983 erschienene Der Untergang von Kasch lesen, das er in dem posthum veröffentlichten, noch nicht ins Deutsche übersetzten Buch Opera senza nome als Vivarium seines Oeuvres bezeichnet. Das Einzige, deutet Calasso in diesem Buch, was Talleyrand konservierte, sei sein Stil gewesen, da Talleyrand wusste, dass Stil die einzige zuverlässige Waffe ist, wenn man überleben will. »Wer um zu überleben dem jeweiligen Augenblick nachgibt und dessen Stil übernimmt, wird vom nächsten Augenblick umgebracht«, steht in Kasch. Das Credo Ezra Pounds, dass Stil eine Bewährungsprobe für die Aufrichtigkeit eines Menschen sei, war auch das Credo von Calasso. Wie alle Schriftsteller war er bestrebt, eine literarische Form zu erfinden, die es zuvor nicht gegeben hatte. In einem Interview mit Alain Jaubert erklärte Roberto, dass er von jeher des Glaubens gewesen sei, dass Form das Wesentliche sein müsse. Entspricht Form in der Literatur vielleicht dem, was die Liturgie innerhalb der Kirche bedeutet? Ohne Liturgie bewege man sich schon in einem riesigen Schlachthof, heißt es in Der Untergang von Kasch, für das Calasso durch das dichte Verweben von Zitaten, Versen, Theaterszenen, Briefen, Aphorismen, Chroniken, Anekdoten und Manuskriptseiten, die zehn oder auch zwanzig Jahre früher entstanden waren, eine stilistisch bis dahin unbekannte Form gefunden hatte, die von einer »synoptischen und simultanen Vision« der Geschichte zusammengehalten wird, wie Léon Bloy es nennt, für den Geschichte einen Teppich darstellte, auf dem sich mit einem Blick historisch weit zurückliegende, unterschiedliche Vorfälle einander gegenüberstellen und miteinander verknüpfen lassen. Ob es sich um ein vedisches Ritual oder um den Ersten Weltkrieg handelt, durch den synoptischen und simultanen Blick lassen sich diese Dinge gleichzeitig erfassen, als hätten sie im gleichen Zeitraum stattgefunden. In Opera senza nome schreibt Calasso klar und deutlich, dass er sich weigert, die Vergangenheit als eine kontinuierliche Linie zu betrachten, wie es »allen Orthodoxien so lieb ist«.
In Kasch sind die Grundzüge aller seiner Bücher gelegt. Hier taucht schon auf der zweiten Seite, in Beziehung zum Wiener Kongress, das Sanskritwort ṛta, auf, das als »Weltordnung« oder auch als »Wahrheit« übersetzt wird. Wenn dieses seltsam klingende, kurze, schwer auszusprechende Wort einen Grundakkord in seinem Werk bildet, so sind die Seiten über das Opfer der Nerv seiner Bücher. Und natürlich erscheint in Kasch Baudelaire, der Oberpriester der Moderne, die Roberto als bedrückendes und zugleich erregendes, bereits zur Archäologie gehörendes Wesen beschreibt, das der Dichter der Fleurs du mal wie kein anderer als erster erfasst und geschildert habe. Wie Kafka wird auch Baudelaire alle Bücher von Calasso durchziehen, bis er als Hauptfigur in Der Traum Baudelaires erscheint.
Sein Äonen und Kontinente übergreifendes Werk ließe sich auch als metaphysischer Zyklus bezeichnen, in dem immer wieder die gleichen Motive – das ṛta, das Opfer, das Göttliche, die Moderne, Analogie und Substitution, das Bewusstsein und der Eros – auftauchen. Wie Balzac erst nachträglich in seinen Romanen die Comédie Humaine entdeckte, so erkannte Calasso erst spät, dass seine Bücher ein zusammengehörendes Ganzes, ein opus bilden, das durch seine Suche nach dem hinter allem waltenden, Opfer fordernden Unbekannten verbunden wird. Wie jener »Fromme alten Schlags« in Kasch, der nur mit dem Finger auf die Welt der Sterne deutet und dazu auffordert, die Augen für die Zeichen einer sich darin äußernden göttlichen Ordnung zu öffnen, so deutet Roberto mit seinen Büchern, die für jeden Leser zu einem Handbuch der Selbstinitiation werden können, auf die göttliche Ordnung.
Als ich Roberto mitteilte, dass ich in Mailand Philosophie studierte, riet er: »Hör so schnell wie möglich mit dem Studium auf! Du bist zu intelligent für die akademische Welt!«
Wir teilten auch eine andere Leidenschaft: Indien. Er war Mitte der achtziger Jahre mit seiner Frau, Marella Agnelli und einigen anderen Freunden nach Indien gereist. Vor allem Madurai mit seinen Tempeln und den davorsitzenden Schneidern, die mit fliegender Schnelligkeit Hemden und Hosen nähten, war ihm in der Erinnerung haften geblieben. Ich erzählte ihm von meinen Aufenthalten in Neu-Delhi und im kleinen Königreich von Samthar im Staat Uttar Pradesh. Es war eine lange Erzählung, die schon an diesem Abend meinen Wunsch zum Ausdruck brachte, eines Tages mit ihm in das Land zu reisen, das ich liebte, wie man einen Menschen liebt.
Während unserer Unterhaltung schenkte ich seiner Stimme und seiner Art zu reden, die etwas Ungewöhnliches hatte verglichen mit der von Gesten begleiteten Sprechmanier der Italiener, die größte Aufmerksamkeit.
Er glich in nichts den anderen Männern, die mir bisher über den Weg gelaufen waren, auch wenn ich in ihm fast alle Eigenschaften vereint fand, die mir einzeln an dem einen oder anderen meiner Verehrer gefallen hatten. In Roberto stieß ich auf Eleganz, Belesenheit, Weltläufigkeit, Ernsthaftigkeit, Kindlichkeit und Großzügigkeit. Kein Schatten von Bitterkeit, kein Abdruck von erlebten Enttäuschungen oder unerfüllten Ambitionen hing an ihm, vor allem keine Spur von Kleinlichkeit oder Kleinbürgerlichkeit. Es war ihm anzusehen, dass ihn seit seiner Jugend der weltliche Erfolg begleitet hatte und dass er sein Leben liebte.
Robertos Blick war durchdringend und von großer Eloquenz. Wie die zart gezeichnete Ader in einem Bernstein, zogen sich Sensibilität und Leidenschaft durch ihn hindurch. Zuweilen blitzte ein scharfer Strahl aus ihm hervor. Oft sollte ich auch noch beobachten, wie sich seine Pupillen plötzlich bedrohlich zusammenziehen und alle Konzentration darin sammeln konnten. Später einmal erzählte er mir, dass er auf die blaue, manchmal mehr, manchmal weniger geschwollene Ader über seinem linken Auge stolz war. Wie in seinem Blick sammelte sich auch in seinen schmalen und dennoch sinnlichen Lippen eine Anspannung, als dächte der Mund seine Gedanken mit. Roberto war männlich, hatte jedoch nichts betont Maskulines an sich, und dann besaß er Sprezzatura, jene von Baldassare Castiglione von einem Hofmann geforderte Haltung aus Ungekünsteltheit, Beiläufigkeit und vor allem Leichtigkeit im Umgang auch mit den schwereren Lagen des Lebens.
Wie der Dampf aus einer Tasse Kaffee ging von ihm das ganz bestimmte Aroma eines belesenen Mannes aus, doch spürte ich, dass sein Wissen tiefer war als das der Männer, die ich bis dahin kennengelernt hatte. Die Luft um ihn war die eines Menschen, der Schätze zu bieten hatte, der in lebendiger Verbindung mit Dichtern wie Ovid und Mallarmé, mit Schriftstellern wie Céline oder Musil stand.
Viele Jahre später offenbarte er mir einmal, dass für ihn die Physiognomie alles bedeute. Seiner Physiognomie war auf den ersten Blick anzusehen, dass er ein Mann war, der Frauen verehrte, und was diese anging, war klar, dass für ihn das einzig Entscheidende die Schönheit war. Vor allem bewunderte er Schönheiten mit einem Hauch, doch nur einem Hauch, von Maskulinität oder zumindest mit einem Hauch von männlicher Provokationskunst. Er hatte mir vom ersten Augenblick an gefallen, weil er Frauen liebte. In Casanova schreibt der ungarische Schriftsteller Szentkuthy: »Das ist nun einmal so, ein Naturgesetz, doch nur wenige Frauen können sich damit abfinden: Wer sie auf die Art liebt, wie sie es sich erträumt haben, aus dessen Wesen ergibt sich, dass er viele andere Frauen lieben wird, denn wer mit einem solchen Talent zur Liebe geboren ist, ist stets auch ein Don Juan.« Und Calasso war mit einem Talent zur Liebe geboren. So wie die Frauen ihn anzogen, zog er die Frauen an. War es schwer, einen Mann faszinierend zu finden, hinter dessen Gestalt sich Bibliotheken und Verlagsräume auftaten?
Ich ahnte, dass ich vielleicht mit ihm jene Art Liebe erfahren würde, wie sie in meiner Vorstellung in den langen Lesestunden herangewachsen war. Erfüllt von der Sehnsucht, auf eine ähnliche Weise zu lieben wie die weiblichen Figuren von Proust oder Balzac, stellte ich mir vor, dass die Frauen, die Roberto geliebt hatte, umwerfend elegante Erscheinungen gewesen sein mussten. Wahrscheinlich war ich schon an diesem Abend auf alle weiblichen Gestalten eifersüchtig, die in seinem Leben aufgetaucht waren, auf seine Frau, auf seine Geliebten, auf die Prostituierten, von denen ich überzeugt war, dass er sie aufsuchte, und auf die Damen der Gesellschaft, die ihn zu sich riefen. Schon im Restaurant Français musste es sich in mir auch entschieden haben, meine wirklichen und meine imaginierten Konkurrentinnen aus dem Feld zu schlagen. Wie Leni in Kafkas Prozess wollte ich so schnell wie möglich seine Geliebte werden, wie Leni konzentrierte ich mich sogleich nicht auf die Mängel einer Frau, sondern auf die Mängel aller Frauen, denen Roberto im Lauf seines Lebens begegnet sein musste. Ich erinnere mich nicht mehr genau, doch mit Sicherheit brachte ich irgendwann mit der dem Skorpion eigenen Manie, sich selbst zu verletzen, das Gespräch auf seine Frau. Ich wusste ja, dass er verheiratet war, und verzog mein Gesicht nicht, als er es mir wiederholte.
Nehmen oder lassen? Es stand außer Frage für mich: nehmen! Auf was ich mich da einließ, war nicht ungefährlich. Doch was ist nicht gefährlich im Leben? »Wenn wir genießen, dann stört uns niemals der Gedanke, dass auf unsere Freude Leid folgen werde«, heißt es bei Casanova.
Was auch immer geschehen mochte, ich würde diesem Mann folgen, denn ich ahnte, dass er mich lie