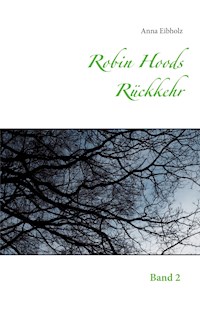Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Robert of Huntingdon lebt auf der Burg von Nottingham, doch es fällt ihm schwer, sich der Ordnung der normannischen Eroberer anzupassen. Als er eines Tages erfährt, wer er wirklich ist, kann nichts mehr so bleiben, wie es war. Für Robert gibt es keinen anderen Weg als sich gegen den Sheriff zu erheben. Er flieht in den Sherwood Forest und wird bald zu Robin Hood, dem mutigen und waghalsigen Anführer der Gesetzlosen. Sein Kampf gegen den Sheriff und Guy of Gisborne verlangt ihm alles ab - und macht ihn schließlich zur Legende.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 578
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Teil I: Sherwood Forest
Teil II: Nottingham
Teil III: Legenden
Teil I Sherwood Forest
Langsam senkte sich die Dämmerung auf die mächtigen Kronen der alten Eichen. Die Vögel piepsten ihre letzten Abendgesänge, dann wurde es still im Sherwood Forest.
Nur auf einer Lichtung, tief im dunkelsten Teil des Waldes, war noch etwas zu hören. Dort prasselten unter den breit gefächerten Ästen einer besonders großen und starken Eiche Lagerfeuer, um die sich an die zwanzig Männer scharten. Es waren raue Männer, denen Trauer und Verzweiflung, aber auch Mut und Entschlossenheit ins Gesicht geschrieben standen.
Unter ihnen war auch Alan a’Dale, ein Spielmann, der eifrig an seiner Laute zupfte und sie zu stimmen versuchte. Nach einer Weile schaute ein missmutig dreinblickender junger Mann den Spielmann mit seinen tiefliegenden, blauen Augen böse an und sagte: „Verdammt, Ruhe, Alan. Ich schmeiß das Ding sonst ins Feuer!“ Man glaubte ihm jedes Wort.
Doch der blonde Sänger legte nur sorgsam sein Instrument zur Seite, setzte sich gemächlich zurecht und meinte friedlich: „Du hattest gar keinen Grund so ausfallend zu werden, Will, ich bin gerade fertig.“
„Endlich!“, knurrte Will wütend.
„Versteh’ ich nicht. Wieso regt der sich so auf? Ist doch überhaupt nicht wichtig!“, meldete sich jetzt ein riesiger, bärtiger Kerl zu Wort. „Es gibt Schlimmeres. Ich zum Beispiel hab‘ jetzt Hunger!“
Er stand auf und ging zu einer Hütte neben der Eiche. Lachend rief ihm Alan nach: „Ein Wunder, Little John! Du bist hungrig? Wann hat es das denn das letzte Mal gegeben?“ John brummte etwas Unverständliches und verschwand in der Hütte.
Nach einer Weile kam er wieder heraus, eine große Hirschkeule in der Hand, die er auf einen Spieß steckte und anfing, sie über dem Feuer zu drehen.
„Das... isst du aber nicht... alleine, oder?“, fragte Much, der Müllerssohn, der mit seinen 14 Jahren der Jüngste unter den Männern war.
Doch sie bekamen alle etwas ab, und in diesem Augenblick waren sie froh darüber, so frei im Wald leben zu können. Bis hierher in den tiefen Sherwood drang die grausame Herrschaft der Normannen nicht vor. Doch sie war der Grund dafür, dass sie dieses Leben als Geächtete, Gesetzlose führen mussten. Jeder von ihnen hatte eine böse Erfahrung mit den Normannen gemacht: Den einen hatten die Forstleute erwischt, als er einen Hasen schoss, um seine Familie durch den Winter zu bringen; der andere hatte die viel zu hohen Steuern nicht mehr zahlen können; wieder ein anderer hatte sich zur Wehr gesetzt, als man ihm seine Frau für einen der Adligen nahm. So hatte jeder seine Geschichte, und von Tag zu Tag wurden es mehr, die sich auf der Lichtung unter der großen Eiche versammelten.
Allesamt waren es einfache Leute, Bauern und Handwerker, die Schutz suchten im tiefen Wald, fernab von den großen Straßen und Städten. Und sie führten ein freies und wildes Leben, ernährten sich vom Wild des Königs und schliefen im Sommer unter freiem Himmel, im Winter in Hütten und Erdhöhlen im Wald. Die Furcht vor der Blutherrschaft der Normannen hielt sie zusammen.
Als das Mahl zu Ende war, wurden die Männer still, starrten ins Feuer und hingen ihren traurigen Gedanken nach. Alan a’Dale, der fahrende Sänger, versuchte, sie mit ein paar lustigen Liedern wieder aufzuheitern, aber als auch das nichts half, legte er seufzend seine Laute weg und sagte: „Aye, Männer, was ist los mit euch? Ihr seid doch sonst nicht so trübselig! Warum macht ihr so lange Gesichter? Singt und seid fröhlich, so wie ich es bin!“
„Halts Maul“, fuhr ihm der missmutige Will grob ins Wort. „Gibt nichts zu Lachen. Das verstehst du nicht. Bist frei. Kannst überall deine Lieder singen.“
Alan grinste darauf nur spöttisch. „Ist es dir wieder einmal geglückt, alle mit deiner schlechten Laune anzustecken, Will! Darin schlägt dich keiner!“ Etwas ernster geworden fügte er hinzu: „Und was die Freiheit anbelangt, könnt ihr euch doch wirklich nicht beklagen! Ihr könnt schließlich auch tun und lassen, was ihr wollt! Ihr seid keinem Herrn verpflichtet, müsst Euch nicht um Haus und Hof kümmern, ihr seid völlig ungebunden hier im grünen Wald!“
„Aber das... fehlt uns doch...“, entgegnete Much, dem Tränen in den Augen standen. „Die Eltern... ein... Zuhause...“ Einige der Männer kicherten. Doch John legte Much beruhigend den Arm um die Schultern und sagte tröstend: „Aber wenn morgen in unserem Wald die Sonne scheint und die Vögel singen, geht es uns schon wieder besser, was?“
Und als ob das ein Stichwort gewesen wäre, begannen die Männer, die Feuer zu löschen und es sich mit Decken und Fellen unter den Bäumen bequem zu machen.
So wurde es endgültig still im großen Sherwood Forest, und das Wild zog auf die mondbeschienenen Waldwiesen um zu äsen. Plötzlich hob einer der Hirsche den Kopf und lauschte. Seine feinen Ohren hatten ein ungewöhnliches Geräusch wahr-genommen. Misstrauisch sog er die frische Nachtluft ein, stieß dann einen warnenden Laut aus und verschwand mit seiner Herde fast lautlos von der Lichtung.
Einige Zeit später stolperte ein junger Mann aus dem Gebüsch. Im Mondlicht sah er so bleich aus, dass man ihn fast für ein Gespenst halten konnte. Aus den großen blauen Augen - fast zu groß für das abgemagerte Gesicht - sprachen Müdigkeit, Hunger und Erschöpfung. Seine Kleidung führte das Bild des Elends weiter. Jedoch nicht ganz: Obwohl Umhang und Hose recht schmutzig und zerschlissen aussahen, konnte man doch erkennen, dass sie aus teurem Stoff gefertigt waren, und die Stiefel an seinen Füßen waren aus festem, gut gegerbtem Leder.
Er blieb einen Augenblick am Rand der Lichtung stehen und schaute sich um. Ihm wurde klar, dass er schon wieder zu unvorsichtig die Deckung des Dickichts verlassen hatte.
„Du darfst nicht vergessen, dass du verfolgt wirst“, dachte er bei sich. Doch eigentlich war er zum Denken schon viel zu müde. Er gähnte und sah sich nach einem geeigneten Platz zum Schlafen um. Viel Auswahl gab es nicht, und so legte er sich auf ein Moospolster zu Füßen einer großen Buche, wickelte sich in seinen Umhang und war bald eingeschlafen.
Vor Kälte zitternd erwachte er in den frühen Morgenstunden, obwohl es noch dunkel im Wald war. Feuchte Nebelschwaden lagen auf der Lichtung. Er setzte sich auf und zog seinen Umhang enger um sich. Doch das schützte ihn auch nicht mehr vor der nasskalten Luft. Er hatte Hunger und Durst. In der Hoffnung, irgendwo auf eine Quelle zu stoßen, stand er auf und lief los.
Nachdem er eine Weile gegangen war, fand er einen Tümpel, auf dem sich der erste Sonnenstrahl des neuen Tages spiegelte. Er kniete nieder und trank, doch das Wasser schmeckte bitter nach dem Laub vom letzten Herbst. „Besser als verdursten“, seufzte er und trank mit verzogenem Gesicht ein paar Schlucke. Dann wanderte er weiter. Zwei Tage lang war er jetzt schon im Sherwood unterwegs. Und er fragte sich, wie weit er wohl noch gehen musste, bis er endlich ins tiefste Herz des Waldes vorgedrungen war. „Ich hätte nie gedacht, dass der Sherwood so riesig ist. Aber vielleicht laufe ich ja auch genau an der Mitte vorbei. Dann finde ich die Gesetzlosen nie!“
Ein leises Geräusch hinter ihm ließ ihn aus seinen Gedanken aufschrecken. Er sprang mit einem Satz hinter den dicken Stamm einer Buche und spähte vorsichtig in die Richtung, aus der er das Geräusch gehört hatte. Doch er konnte nichts Außergewöhnliches entdecken. Nach einer Weile ging er weiter, lauschte aber misstrauisch auf die Laute im Wald. Noch oft meinte er, hinter sich Rascheln von Laub oder das Knacken kleiner Zweige am Boden zu hören. Aber sobald er in Deckung ging und sich umschaute, war es totenstill. Nur die Vögel, die immer munterer wurden, zwitscherten lustig.
Während er so durch den Wald wanderte, änderte sich langsam die Landschaft um ihn. Die Bäume rückten näher zusammen, und die mächtigen, ineinander verschlungenen Eichen sahen aus, als hätten sie da schon gestanden, bevor der erste Mensch auf der Erde lief. Zwischen ihnen wuchsen Farne und Gestrüpp wie eine Wand, und die ausgetretenen Wege im lichteren Wald wichen schmalen Pfaden, die nur noch vom Wild begangen wurden, wie es schien. Der Gesang der Vögel wurde seltener, und die üblichen Geräusche des Waldes verstummten. Er hatte die Grenze zum ‘Geisterwald’ überschritten, wie er vom abergläubischen Volk genannt wurde. Niemand wagte sich sonst so tief in den Wald, denn es gab schlimme Geschichten über ein Geisterpferd, das jeden unbefugten Wanderer zu Tode hetzte. An all dies dachte er jetzt jedoch nicht. Er war nur froh, nun doch zur Mitte des Sherwood Forest gekommen zu sein, und er hoffte, nicht mehr allzu weit laufen zu müssen, denn er war nun so erschöpft, dass er nur noch vorwärts stolperte.
Mittlerweile war es ganz hell geworden, und das Sonnenlicht fiel gedämpft durch das grüne Blätterdach und malte Kringel auf den braunen Waldboden. Da traten plötzlich die Bäume auseinander und er stand am Rand einer Lichtung, in deren Mitte eine große Eiche stand. Vor ihm plätscherte ein kleiner Bach, und der Pfad führte über einen mannsbreiten Baumstamm weiter.
Gerade als der junge Mann seinen Fuß auf den Stamm setzte und hinübergehen wollte, tauchte plötzlich wie aus dem Nichts ein riesiger, bärtiger Kerl auf der anderen Seite auf und versperrte ihm den Weg. Er wirbelte einen beeindruckenden Fechtstock herum, setzte ihn dann auf dem Stamm ab und stützte sich darauf. Er musterte den Fremden genau, und schließlich sagte er: „Hier geht’s nicht weiter!“
„Lass mich durch, Freund. Ich bin schon seit zwei Tagen auf der Suche nach den Gesetzlosen, die hier irgendwo hausen sollen, und...“
„Ich bin nicht dein Freund“, unterbrach ihn der Riese, der niemand anderes war als Little John, grob. „Wer durch den Sherwood läuft, muss Wegzoll zahlen. Das hast du nicht“,
„Nein“, antwortete der Fremde. „Ich habe keinen Wegzoll gezahlt. Aber es hat mich auch niemand darum gebeten, und jetzt...“
„Oho, du möchtest erst artig gebeten werden, was?“, schnitt ihm Little John wieder das Wort ab. „Na gut, dann bitte ich Euch jetzt ehrerbietigst darum, gnädiger Herr.“
John machte eine spöttische Verbeugung und streckte abwartend seine Hand vor, um den Wegzoll entgegenzunehmen.
Hinter dem Fremden ertönte Gelächter. Erschrocken drehte er sich um. Er war so auf den bärtigen Kerl mit dem Stock konzentriert gewesen, dass er gar nicht bemerkt hatte, wie sich hinter ihm auf dem Pfad um die zehn weitere wild aussehende Männer aufgebaut hatten und ihm den Rückzug abschnitten. Sie standen breitbeinig und bis an die Zähne bewaffnet da und lachten schallend über den Witz ihres Anführers.
„Ich warte, gnädiger Herr!“, rief der Riese mit höhnischem Lachen.
Der Fremde drehte sich wieder zu ihm um. Auch hinter dem Riesen waren jetzt einige Männer aus den Büschen getreten und standen breit grinsend da. Alle musterten den Fremden erwartungsvoll. Der spürte, wie Wut in ihm aufstieg. Sie hatten ihn in einen Hinterhalt gelockt und ließen ihn nicht erklären, was er eigentlich wollte!
„Ich bin kein Herr! Und ich habe nichts bei mir, mit dem ich zahlen könnte“, entgegnete er laut.
Da griff jemand hart sein linkes Handgelenk und riss die Hand hoch: „So?“, fragte ein missmutig aussehender Kerl. „Und das?“
„Nicht auch das noch“, dachte der junge Mann. „Nicht diesen Ring!“
Wütend riss er seine Hand los und sagte laut: „Dieser Ring ist mir teuer. Den gebe ich nicht her!“
Die Männer, die sich denken konnten, um was für einen Ring es sich handelte, brachen wieder in unmäßiges Gelächter aus.
„Teuer, soso! Das wär‘ er uns auch, glaub‘ mir“, sagte Little John hämisch. „Her damit!“
Der junge Mann schüttelte stur den Kopf.
„Wenn ich dir aber drohe, dich ein bisschen zu verprügeln?“ Er wirbelte wieder seinen Stock durch die Luft, bei dessen Anblick es dem Fremden ziemlich mulmig wurde. Aber er sagte fest: „Auch dann gebe ich den Ring nicht her.“
„Na, das wollen wir doch mal sehen!“ John packte den Stock fester und machte einen Schritt auf ihn zu. Der Fremde war fest entschlossen, sich den Ring um keinen Preis abnehmen zu lassen. Also schrie er: „Halt an, Bursche! Findest du es nicht feige, mich zu verprügeln, ohne dass ich mich wehren kann?“ Und zu den anderen gewandt rief er: „Gebt mir einen von euren Stöcken!“
Die Männer schauten Little John erwartungsvoll an. Der war ganz baff ob der Dreistigkeit seines jungen Gegners. Der Kleine wagte es, ihn feige zu nennen, obwohl er hoffnungslos einer Überzahl ausgeliefert war! Schneid hatte er, das musste John ihm lassen.
„Gut, gut, gebt ihm nur einen Stock. Mit so einem Normannensprössling werd‘ ich allemal fertig“, antwortete er.
Ein rothaariger Junge warf dem Fremden seinen Stock zu. Er fing ihn auf und wog ihn in den Händen, um sich mit dem Gewicht vertraut zu machen.
Und schon sprang John auf ihn zu und ließ einen mächtigen Schlag auf ihn herniedersausen. Er konnte ihn gerade noch mit dem über den Kopf gehaltenen Stock abfangen. Es war sofort klar, dass er der Stärke dieses Kerls nichts entgegensetzen konnte, zumal er nach den Anstrengungen der letzten Tage längst nicht bei ganzer Kraft war. Aber da sie auf dem Stamm über dem Bach kämpften, hatte er immerhin einen Vorteil durch seine Wendigkeit und Trittsicherheit. Also verlegte er sich aufs Ausweichen. Als John seinen Stab seitlich auf ihn zu sausen ließ, duckte er sich blitzschnell, und bevor John nach dem Schlag das Gleichgewicht wiederfand, schlug er ihn so fest er konnte in die Rippen. Der Riese wankte und wäre um ein Haar in den Bach gestürzt.
Als John wieder sicher stand, grinste er breit und sagte: „Eins zu Null für dich, Kleiner!“; und bevor der Fremde, der sich keuchend auf seinen Stab stützte, richtig reagieren konnte, bekam er Johns Stock mit voller Wucht in die Seite. Er biss die Zähne zusammen um nicht laut aufzuschreien, schwankte, trat beinahe ins Leere, fing sich im letzten Moment und stellte sich mit verzerrtem Gesicht wieder seinem Gegner.
Die Geächteten johlten und klatschten John Beifall. Man sah, dass der Fremde nicht mehr lange durchhalten würde.
Von jetzt an konnte er nur noch versuchen, Johns Schläge abzuwehren. So ging es eine Weile, und John und seine Gefährten hatten ihren Spaß an dem Kampf. Einmal schaffte der Fremde es sogar, dass Little John bei einem Ausweichmanöver mit einem Fuß in den Bach trat. John wurde daraufhin ziemlich wütend und drosch mit verdoppelter Kraft auf den Fremden ein. Plötzlich zerbrach der Stock des Fremden unter einem mörderischen Hieb, und er war waffenlos. Auch John warf seinen Stab weg und stürzte sich auf ihn. Er packte ihn an den Schultern, drängte ihn von der schmalen Brücke hinunter und stieß ihn mit dem Rücken gegen einen Baumstamm. Der Fremde musste sich zusammenreißen, um nicht vor Schmerzen laut aufzuschreien. Er versuchte, sich aus Johns Griff zu befreien, der ihn jetzt am Hemd festhielt.
„Na, siehst du jetzt endlich ein, dass du keine Chance hast? Gib mir den Ring, oder willst du noch mehr abkriegen?“ fragte John schnaufend.
Statt einer Antwort packte der andere John an den Handgelenken und versuchte mit letzter Kraft sich zu befreien. Dabei zerriss sein Hemd, und John starrte ihn erschrocken an und ließ langsam die Hände sinken; der ganze Oberkörper des Fremden war mit kaum verheilten Striemen und Schnitten bedeckt, die zum Teil unter Johns Schlägen wieder aufgebrochen waren und zu bluten begonnen hatten. John wich fast schuldbewusst vor ihm zurück und stammelte entschuldigend: „Warum hast du das denn nicht gleich gesagt, Kleiner?“
Statt einer Antwort richtete sich der Fremde trotzig auf und versuchte, so gut es ging sein Hemd wieder zurechtzurücken. Inzwischen waren mehrere der Männer nähergekommen und sie betrachteten ihn jetzt mit freundlicheren Mienen. Wie es schien hatte dieser Junge, der auf den ersten Blick wie ein Normanne wirkte, ebenso viel durchgemacht wie jeder von ihnen. Dann trat Alan a’Dale, der Spielmann, vor und nahm ihn freundschaftlich am Arm: „Komm mit, du siehst so aus, als könntest du etwas zu essen vertragen.“ Er führte ihn zu einem Feuer und gab ihm ein Stück Brot, kaltes Fleisch und einen Krug voll Bier. Dankbar nahm der Fremde es an.
Während er aß, waren auch die anderen Männer ans Feuer gekommen. Sie waren neugierig geworden und wollten die Geschichte des Fremden hören.
Alan a’Dale blickte ihn freundlich und auffordernd an. „Also, jetzt erzähl mal! Wer bist du, wo kommst du her, wer sind deine Eltern?“, fragte er.
Der Fremde räusperte sich und sagte: „Ich heiße Robin und ich komme aus Nottingham. Meine Eltern sind schon lange tot. Hergekommen bin ich, weil ich vom Sheriff von Nottingham verfolgt werde. Und weil ich dem König der Normannen nicht die Treue schwören wollte, hat man mich geächtet.“ Robin sah sich um, als sei alles gesagt. Doch die Männer um ihn herum schauten ihn mit verständnislosen Blicken an.
„Das musst du schon genauer erklären, Kleiner“, meinte Little John. „Du kommst aus Nottingham. Gut. Was hast du da gemacht und wo hast du gewohnt, wenn deine Eltern tot sind?“
„Ich...“ Robin zögerte. Er fürchtete, dass sie sich alle wieder gegen ihn wenden würden, wenn sie die Wahrheit kannten. Aber es führte kein Weg daran vorbei, also sagte er mit fester Stimme: „Ich habe in der Burg gewohnt, beim Sheriff von Nottingham. Ich dachte, ich sei sein Sohn.“
Die Männer starrten ihn fassungslos an, und einige blickten schon wieder feindselig drein. Nur Alan, Much und Little John blieben weiterhin freundlich. Robin wusste, dass er jetzt erzählen musste, wie alles gekommen war, und das fiel ihm schwer; er hatte selbst noch sehr daran zu kauen.
„Ach, Eure Familie war so arm, Herr“, begann die alte Magd zu reden. „Sie hatten ja alles verloren. Und als ihr noch sehr klein wart, vielleicht drei oder vier Jahre, konnten sie einmal die Steuern nicht zahlen. Pah, keiner konnte zahlen, die verfluchten Normannen haben das schon so gemacht, damit sie uns Engländer unterdrücken können! Sie wohnten in Edwinstowe, Eure Eltern, einem kleinen Dorf im Sherwood. Ich hab‘ früher auch dort gelebt.“ Ich hatte Mühe, die Alte zu verstehen. Sie hatte nur noch einen Zahnstummel im Mund und redete zudem sehr schnell. „Und da kamen nun eines Tages die Steuereintreiber ins Dorf. Wir hatten immer solche Angst, und in diesem Jahr war es besonders schlimm, weil ein Sturm die Ernte vernichtet hatte und keiner mehr so viel besaß, dass er etwas hätte abgeben können. Es war furchtbar! In einem anderen Dorf hatte es schon einen Aufstand gegeben, die Männer wurden ausgepeitscht und geschlagen um uns alle einzuschüchtern und zu bestrafen. Aber in unserem Dorf wurde es noch viel schlimmer… Der Herr war so grausam, er ließ viele Männer von den Soldaten einfach umbringen. Mein Mann und mein Sohn waren auch dabei... Ach, heilige Jungfrau, das war ein Elend!“
Sie schwieg und sah mich an. Ich konnte in ihren Augen die Trauer und die Verzweiflung sehen, die an jenem Tag das ganze Dorf erfasst hatte. Sie nickte langsam mit dem Kopf und sagte dann: „Auch Eure Eltern starben.“
„Warum haben sie auch meine Mutter getötet?“, fragte ich.
Wieder sah sie mich sehr ernst an. „Wollt Ihr das wirklich wissen?“
Ich nickte.
„Als sie zu Eurer Hütte kamen, ließ sich der Herr die Namen eurer Eltern sagen. Zuerst solltet Ihr mit eurem Vater getötet werden, und der Herr wollte es selbst tun. Aber Eure Mutter schrie und tobte so, dass der Herr ihr anbot, für ihren Sohn das Leben zu lassen. O, sie war so eine tapfere Frau, Herr! Sie hat sich für Euch töten lassen, und ihr und euer Vater mussten dabei zusehen!“
Es dauerte eine Weile, bis ich begriff, was sie eben gesagt hatte. Meine Mutter – sie hatte sich geopfert um mir das Leben zu retten... Ich spürte einen unfassbaren Hass gegen die Normannen in mir hochkommen. Sie hatten kleine Kinder und Frauen getötet, nur um in ihrem Reichtum zu prassen. Und ich hatte all die Jahre hier gelebt und war einer von ihnen gewesen - auch dafür, dass ich immer mehr als genug zu essen hatte, waren Menschen gestorben! In diesem Augenblick hasste ich auch mich.
„Was dann mit Euch geschah, Herr, weiß ich nicht. Denn nun zündeten sie unsere Hütten an und wir versuchten, noch etwas vor den Flammen zu retten. Aber Jahre später kam ich selbst hier auf die Burg als Küchenmagd, und ich habe Euch sofort erkannt. Ihr seht genauso aus wie Euer Vater! Er war ja noch so jung, viel zu jung um zu sterben. Und Eure Mutter - sie war die Schönste im Dorf und überall in den Dörfern im Sherwood war sie berühmt, weil sie so schön war. Wie froh war da Euer Vater, dass er sie bekam. O, das war auch kein Wunder, schließlich wussten alle, wer er war, auch wenn seine Familie nichts mehr besaß...“ Sie hielt inne und zog etwas aus ihrer Tasche, das sie mir in die Hand drückte. Es war ein kleines Holzpferdchen, an einer Seite etwas angekohlt. „Das gehört Euch. Euer Vater hat es für Euch geschnitzt, glaube ich. Es lag vor der Tür der Hütte - Ihr habt wohl gerade damit gespielt, als die Steuereintreiber kamen. Warum ich es aufgehoben habe, weiß ich nicht. Vielleicht, weil es mich an meinen eigenen Sohn erinnert hat, von ihm habe ich nichts mehr...“
Ich hörte der alten Frau nicht mehr zu. Ich stand auf und ging durch das Zimmer zum Fenster. Das Pferdchen hielt ich fest in den Händen. Zum ersten Mal fielen mir die kostbaren Wandbehänge auf, und unwillkürlich überlegte ich, wie viele Menschen dafür hart gearbeitet hatten oder sogar gestorben waren. Mein ganzes Leben kam mir so sinnlos vor. Warum war ausgerechnet ich hier gelandet, wo ich überhaupt nicht hingehörte?
Wie in einem furchtbar schnellen Traum stürmte all das auf mich ein, was ich nie verstanden hatte. Ich hörte die Kinder schreien: „Sachsenhund! Sachsenhund!“ und sah mich hilflos heulend dastehen, mit dem Fuß stampfen, beteuern: „Ich bin doch kein Sachse! Ich bin kein Sachse!“ Ich rannte mit der ganzen Horde über den Burghof, warf Steine nach einem englischen Jungen. Ich spürte noch den schalen Geschmack auf der Zunge. Aber ich war mitten unter den Kindern, keiner beschimpfte mich mehr... Ich sah das Burgvolk, wie sie heimlich über mich tuschelten, mit dem Finger auf mich zeigten, beim Bankett, bei der Jagd. Doch plötzlich stand ich zwischen ihnen, brüllte Schmähworte auf die Verurteilten vor dem Galgen. Und dann sah ich Marian. Traurig sah sie aus. Mit Tränen in der Stimme sagte sie: „Was haben sie dir denn getan? Es ist nicht gerecht! Ich dachte, du wärest anders!“ Anders? Es war doch nicht gut, anders zu sein? Der Sheriff tauchte auf. Ich stritt mit ihm, weigerte mich, die Soldaten zum Plündern in die Dörfer zu führen. Er brüllte vor Wut. Ich blieb stur. Schoss immer noch mit Pfeil und Bogen, statt mit dem Schwert zu üben. Verteidigte die Gefangenen. Und wusste nicht warum. Wieder Marian: „Vielleicht können wir etwas ändern? Es ist doch nicht gerecht.“
Und da wusste ich, warum. Ich war hier in der Burg gelandet, damit ich kämpfen konnte. Kämpfen gegen die große Ungerechtigkeit in diesem Land. Gegen die Unterdrückung der einfachen Menschen. Zwar wusste ich noch nicht wie, aber ich war sicher, dass sich das schon ergeben würde. Und ich durfte mich auf keinen Fall in die Pläne ergeben, die der Sheriff mit mir hatte. Ich durfte das Lehen nicht annehmen, das mir gegeben werden sollte - um mich aus dem Weg zu schaffen, das begriff ich jetzt. Denn dort auf dem Landsitz würde ich irgendein Mädchen heiraten müssen, das ich gar nicht kannte, eine Menge Kinder bekommen und mein Leben mit Jagen verbringen. Ich müsste dem König die Treue schwören, die ich ihm keineswegs halten wollte, denn er war nicht mein König - er war König der Normannen. Plötzlich fühlte ich mich sehr frei - es gab niemanden, dem ich verpflichtet war, außer dem unterdrückten Volk der Engländer. Ich drehte mich um, dankte der alten Magd und ging aus dem Zimmer.
Draußen fragte ich einen der Diener: „Wo ist mein-“ ‘mein Vater’ hatte ich sagen wollen. Doch das war vorbei. „Wo ist der Sheriff?“
„In seinem Gemach, Herr.“ antwortete der Diener und fügte unterwürfig hinzu: „Aber er möchte nicht gestört werden, das hat er ausdrücklich befohlen. Von niemandem, Herr.“
Ich ging an ihm vorbei und durch die Burg, geradewegs zum Gemach des Sheriffs. Zwei Wachen standen vor der Tür und wollten mich nicht hereinlassen, doch ich schob sie einfach zur Seite und ging ins Zimmer.
„Diable! Robert!“, rief der Sheriff überrascht und sprang auf. „Robin.“ verbesserte ich ihn. Er war nicht allein. Er hatte mit einer der jungen Edeldamen, die sonst seiner Frau aufwarteten, auf der Fensterbank gesessen.
„Ich werde das Lehen nicht annehmen, Herr“, sagte ich mit Nachdruck und tat, als hätte ich das Mädchen gar nicht bemerkt.
„Du weißt nicht, was du redest.“ Der überraschte Ausdruck auf seinem Gesicht wich der Wut, die er mir gegenüber immer empfand. „Und nenne mich gefälligst ‘Vater’, verstanden?“, herrschte er mich an.
„Ihr seid nicht mein Vater, sondern der Mörder meines Vaters.“ Der Hass in meiner Stimme schien ihn etwas aus der Ruhe zu bringen. Er wich meinem Blick aus und sah, dass das Mädchen noch da war. Als hätte er vorübergehend meine Anwesenheit vergessen, ging er zu ihr und flüsterte ihr etwas ins Ohr. Als sie daraufhin aufstand, küsste er sie und brachte sie galant zur hinteren Tür. Dann drehte er sich wieder zu mir und sagte in gelangweiltem Ton: „C’est ça. Ich kann wirklich nicht behaupten, dass mich deine Dummheit überrascht. Hast du dir das gut überlegt? Hucknall ist ein schönes Stück Land und du könntest ein ruhiges Leben führen, ohne...“
„Ohne Euch in die Quere zu kommen“, unterbrach ich ihn. „Was ich gerade gesagt habe, ist mein letztes Wort. Ich werde Eurem Normannenkönig nicht die Treue schwören, und vor allem werde ich der Ungerechtigkeit in diesem Land nicht länger zusehen.“
Er sah mich lange mit unbeweglicher Miene an. Dann sagte er: „Du wirst es noch lernen, mon cher. Du wirst es ganz sicher noch lernen, dafür werde ich sorgen.“
Ich verstand nicht ganz, was er meinte. Seine Stimme klang gefährlich und ich wusste nicht, was er als nächstes tun würde.
Er rief die beiden Wachen herein.
„Nehmt ihn fest und werft ihn in den Kerker!“, befahl der Sheriff kalt.
Ich war völlig überrascht. Mit fast allem hatte ich gerechnet, nur nicht damit.
Auch die Wachen waren ganz verdattert.
„Na los, macht schon! Oder muss ich es selber tun?“
„Aber... aber Herr, das könnt Ihr doch nicht tun, er ist Euer Sohn...“, stotterte einer der Soldaten mutig.
„Diable! Habe ich mit irgendeinem Wort erwähnt, dass du mir sagen sollst, was ich tun kann oder nicht?“, zischte der Sheriff. „Wenn ihr nicht sofort meinen Befehl ausführt, dann...“ Er zog sein Schwert.
Da packten mich die beiden Soldaten und zerrten mich aus dem Zimmer. Sie schleppten mich durch die ganze Burg, brachten mich schließlich in eine kleine Zelle und verriegelten die Tür hinter mir.
Es war völlig dunkel in dem engen Raum. Am Boden lag Stroh, das ziemlich stank, und die Wände waren feucht. Ich setzte mich in eine Ecke und wartete. Bald verlor ich jedes Zeitgefühl. Manchmal schlief ich und schreckte auf, wenn ein Wächter mir etwas zu essen und zu trinken brachte. Dies geschah wohl jeden Tag einmal, und so rechnete ich mir aus, dass ich vier Tage in dem Kerker saß, als ein Soldat den Sheriff hereinführte.
„Alors, wie gefällt dir dein neues Zimmer? Du möchtest sicher noch länger hierbleiben und bist deshalb fest entschlossen, das Lehen nicht anzunehmen, nicht wahr?“
Nein, so leicht bekam er mich nicht klein! Ich war noch nicht bereit, aufzugeben, und so sagte ich fest: „Ganz richtig, ich werde das Lehen nicht annehmen.“
„So so, der Widerstand ist also noch nicht gebrochen. Tapfer, wirklich sehr tapfer“, meinte er mit einem bösen Lächeln. Ich erwiderte seinen Blick, der außer Hass nichts von dem verriet, was in ihm vorging. Plötzlich schlug er mir mit der Faust ins Gesicht, dass ich zu Boden ging.
„Wir werden sehen, wie lange du das noch durchhältst, mon cher. Ich kann warten.“
Wieder war es völlig dunkel und ich war allein. Ich befühlte mein Gesicht. Die ganze rechte Hälfte schmerzte, und aus Mund und Nase rann Blut. Ich blieb einfach liegen, wo ich war.
Die Zeit schlich dahin. Ich bekam nichts mehr zu essen, nur noch Wasser, und ich glaubte verrückt zu werden, wenn ich nicht endlich wieder Licht sah. Ich war schon fast bereit, alles zu tun, was sie von mir wollten, nur um hier herauszukommen, als meine Hand plötzlich auf etwas Kleines, Hartes im Stroh stieß. Es war das Holzpferdchen. Ich konnte die Kanten fühlen und auch die Stelle, wo es angekohlt war, denn da war es besonders glatt. Ich stellte mir vor, wie mein Vater es geschnitzt hatte, wie ich als kleines Kind damit gespielt hatte, bis die Soldaten kamen. Ich dachte daran, wie meine Mutter für mich gestorben war und so viele Menschen mit ihr. Wenn ich jetzt aufgab, wären ihre Opfer umsonst gewesen.
Mein Widerstand war wieder geweckt, und ich war entschlossen durchzuhalten.
Es waren wohl noch einmal vier Tage vergangen, als die Tür wieder geöffnet wurde. Der Fackelschein blendete mich, und ich musste die Augen schließen. Noch bevor ich sie wieder öffnen konnte, wurde ich von zwei Soldaten gepackt und aus der Zelle geführt. Sie brachten mich durch schmale Gänge mit vielen Eisentüren in einen niedrigen Raum, in dem noch zahlreiche andere Gefangene an die Wände gekettet saßen. Die Soldaten ketteten mich ebenfalls an und verschwanden wieder.
Einige Fackeln erhellten den Kerker, und ich musterte die Menschen um mich herum. Manche schienen sich schon in ihr Schicksal gefügt zu haben und lehnten mit geschlossenen Augen an der Mauer. Doch andere hielt ein ungebrochener Lebensmut hoch, den auch die zahlreichen Misshandlungen nicht hatten brechen können, deren Spuren ich an allen sah.
Der Raum war von einer völligen Hoffnungslosigkeit erfüllt, das spürte ich. Als meine Augen den Blick eines Mannes mir gegenüber trafen, wollte ich irgendetwas sagen, ihn ansprechen, ihm und mir selbst Mut machen. Doch die beklemmende Stille hinderte mich daran. Ich fürchtete mich fast davor, meine eigene Stimme zu hören.
Neben mir stöhnte jemand auf. Es war ein alter Mann, dem die zerfetzten Kleider vom Leib hingen. Er hatte Peitschenstriemen am Körper, und die rechte Hand fehlte ihm; der Stumpf war mit schmutzigen Lappen umwickelt. Doch in seinen Augen war noch ein verstecktes Fünkchen Leben zu sehen. Er schaute mich eindringlich an, als wollte er sagen: „Du bist jung, du hast noch dein ganzes Leben vor dir, du kannst noch tun, was ich nicht mehr kann.“ Dann schloss er die Augen und schlief ein.
Ich war wohl wieder vier Tage in diesem Gefängnis, und es waren die Schlimmsten. Der alte Mann neben mir starb bald, und auch zwei andere Männer erlagen ihren Verletzungen. Keiner bekam etwas zu essen, und bald lernte ich die Soldaten fürchten, die ab und zu hereinkamen und jemanden mitnahmen, der dann lange Zeit später, völlig zerschunden von der Folter, am Ende seiner Kräfte wieder hereingeführt wurde.
Am dritten Tag geschah etwas, das mir Hoffnung gab. Die Tür wurde geöffnet und zwei Soldaten kamen herein. Doch sie gingen nicht schnurstracks auf einen Gefangenen los, sondern stellten sich als Wachen neben die Tür. Und dann betrat Marian den Raum. Ihr langes Kleid schleifte auf dem schmutzigen Boden, doch darauf achtete sie nicht. Sie trug einen Korb, ging zu jedem Gefangenen, gab ihm etwas zu essen und zu trinken und hatte für jeden ein freundliches Wort. Als sie zu mir kam, sagte sie mit flüchtigem Lächeln: „Ich habe die Soldaten bestochen, damit sie mich hereinlassen!“ Dann flüsterte sie: „Ich versuche, dich irgendwie hier herauszuholen. Halte durch!“, und war schon wieder verschwunden.
Am selben Tag kamen die Soldaten noch einmal, und wieder betete jeder bei sich, dass sie nicht ihn holen würden.
Diesmal kamen sie zu mir, ketteten mich los, zogen mich grob auf die Füße, die mich nach dem langen Sitzen kaum mehr tragen wollten, und führten mich in eine Kammer, aus der mir unerträgliche Hitze entgegenschlug. In einer Ecke stand ein glühender Ofen, in dessen Öffnung ein Knecht gerade ein langes Messer steckte. In einer anderen Ecke befand sich eine Streckbank, von der Decke hingen einige Vorrichtungen, von denen ich mir lieber nicht vorstellen wollte, was man damit machen konnte; und in der Mitte stand ein Holzpflock, vor dem mich die Soldaten nun in die Knie drückten und daran festbanden. In dieser unbequemen Stellung musste ich eine Weile warten, bis ich Schritte hinter mir hörte. Obwohl ich ihn nicht sehen konnte, wusste ich sofort, dass es der Sheriff war, der da kam.
Er stellte sich vor mich hin, doch da ich festgebunden war, konnte ich nur seine Füße in den schwarzen Stiefeln sehen. Trotzdem wusste ich sehr genau, was für ein Ausdruck auf seinem Gesicht lag, als er sagte: „An allem, was bisher geschehen ist und was geschehen wird, bist du selbst schuld, Robert! Du brauchst jetzt nur zu sagen, dass du alles vergisst, was du über deine Herkunft erfahren hast und dass du das Lehen in Hucknall annehmen wirst. C’est tout. Dann lasse ich dich gehen und vergesse alles, was passiert ist. Im Übrigen wirst du bald sowieso nachgeben, und wenn du es jetzt schon tust, ersparst du dir einiges.“
Statt einer Antwort schüttelte ich nur verachtungsvoll den Kopf. Da sagte er mit seiner leisen, gefährlichen Stimme, die mich Schlimmes erahnen ließ: „Wenn ich nur wüsste, warum ich dich nicht einfach umbringe...!“ Dann bewegten sich seine Beine aus meinem Sichtfeld, und er befahl den Soldaten: „In den nächsten Tagen das Übliche für ihn! Er will ein Sachse sein, alors, dann wollen wir ihn auch so behandeln.“
Als mich die Soldaten eine Ewigkeit später wieder in das Gefängnis zurückführten - sie mussten mich mehr tragen als dass ich noch laufen konnte - war ich sicher, dass ich das nicht überleben würde. Aber um nichts in der Welt hätte ich dem Sheriff die Genugtuung gegönnt, mich um Gnade bitten zu sehen.
Sie ließen mir nicht die Zeit, mich ein wenig zu erholen. Mitten in der Nacht kamen sie wieder.
So ging es auch noch den folgenden Tag, und ich wusste nicht, wie lange ich das noch aushalten könnte.
Sie hatten mich gerade wieder angekettet, und ich versuchte, eine Stellung zu finden, in der der Schmerz leichter zu ertragen war und ich vielleicht sogar eine Weile schlafen konnte, als schon wieder die Tür aufging.
Ich machte mir gar nicht mehr die Mühe, die Augen zu öffnen, da ich sowieso schon zu wissen glaubte, wer hereinkommen würde. Doch es geschah etwas ganz anderes.
Statt der schweren Stiefeltritte der Soldaten hörte ich leise, schleichende Schritte und das Rascheln von Stoff. Verwirrt schlug ich nun doch die Augen auf und sah - Marian vor mir kauern!
„Mein Gott, was haben sie mit dir gemacht!?“, flüsterte sie erschrocken, wartete aber keine Antwort ab, sondern suchte nervös an dem großen Schlüsselbund nach dem Richtigen für meine Ketten. „Geoffrey steht draußen und passt auf, dass keiner kommt“, erklärte sie und hatte schon die Ketten aufgeschlossen.
„Geoffrey?“, fragte ich, nun völlig durcheinander.
„Ja, Geoffrey. Komm jetzt“, sagte sie eilig und wollte mich an einem Arm hochziehen. Ich stöhnte auf vor Schmerz, und sie ließ mich sofort wieder los.
„Entschuldige... kannst du aufstehen?“
Ich nickte und versuchte mich an der Wand hochzustemmen. Endlich stand ich schwankend auf den Beinen, und Marian führte mich nach draußen, wo tatsächlich Geoffrey als Soldat verkleidet auf uns wartete. Er gab mir ein anderes Hemd - das alte war völlig verdreckt und zerfetzt - und einen Umhang und stützte mich auf der anderen Seite. So konnten wir zu dritt recht schnell durch die dunklen Gänge schleichen und kamen bald zu der Tür, die einen Weg durch die vielen Höhlen und Gänge im Burgfelsen hinunter in die Stadt öffnete. Die Tür war unbewacht, da niemand wusste, was dahinter lag. Marian und ich hatten es als Kinder einmal herausgefunden und seit-dem als unser Geheimnis bewahrt.
„Du musst Nottingham verlassen haben, ehe sie merken, dass du geflohen bist“, sagte Marian, bevor sie mich durch die Geheimtür schob.
„Marian, ich...“
„Sag’ nichts mehr, Rob! Du musst dich beeilen! Leb wohl!“ Damit schloss sie die Tür hinter mir. Ich hörte, wie ihre und Geoffreys Schritte schnell verklangen. Dann machte ich mich auf den Weg.
Ich weiß nicht mehr, wie ich es geschafft habe, durch den endlos langen Gang zu kommen. Das erste, an das ich mich erinnern kann, ist der Augenblick, als ich irgendwo in einem Gebüsch aufwachte und plötzlich erkannte, dass ich ein ganz neues Leben anfangen musste.
Zuerst wusste ich nicht, was ich tun sollte. Ich erwog, in das Dorf zu gehen, wo ich geboren war, doch dann fiel mir ein, dass man mich suchen würde – dort vermutlich zuerst - und ich mich verstecken musste. Und da musste ich plötzlich an die Gefangenen denken, die Marian und ich einmal befreit hatten. Wir hatten sie gefragt, wo sie jetzt hingingen, und einer hatte geantwortet: „Dahin, wo alle Zuflucht finden, die verfolgt werden: Ins tiefste Herz des Sherwood Forest. Dort sammeln sich die Gesetzlosen, denn dort gelten nur noch die Gesetze des Waldes.“
„Tragische Geschichte! Wirklich! Tust mir ehrlich leid“, sagte Will Scarlet in die Stille hinein, die Robins Erzählung folgte. Seine Stimme klang höhnisch und in seinem Gesicht stand der blanke Hass. „Verdammt, hast du gelitten unter den bösen Normannen! Haben dir zu essen gegeben, dich in ihrer Burg wohnen lassen. Und dann ein Lehen annehmen müssen, eine Zumutung! Bist ein verdammter Held!“
„Halt den Mund, Will“, sagte Alan a’Dale ruhig. „Und du, Robin, nimm Will nicht so ernst. Er meint zwar immer alles so wie er es sagt, aber manchmal tut es ihm hinterher doch leid.“
„Nie!“, antwortete Will immer noch hasserfüllt. „Der hat das alles erfunden! Will uns ausspionieren!“
Viele der Männer nickten zustimmend und murmelten sich ihr Einverständnis zu. Sie glaubten auch nicht so recht an Robins Geschichte.
Jetzt schaltete sich auch Little John ein. Er hatte zwar Robins Erzählung etwas ungläubig gelauscht. Aber ihm gefiel der „Kleine“, weil er trotz seiner Wunden so tapfer mit ihm um den Ring gekämpft hatte. Deshalb sagte John: „Ob Robins Geschichte wahr ist oder nicht, das wird sich schon noch herausstellen. Aber er bleibt erstmal hier, das ist überhaupt keine Frage. Er ist erschöpft, verletzt und müde und er wird wenigstens so lange hierbleiben, bis er sich erholt hat. Und bis dahin ist er unser Gast. Verstanden? Will!“ John sah Will Scarlet scharf an. Aber der schaute nur böse zurück. „Und ihr auch?“ Er musterte die anderen. Und obwohl sie nicht alle einer Meinung mit ihm waren, hielten sie lieber den Mund. Das taten sie immer, wenn Little John etwas bestimmte. Schließlich war er der Stärkste, und keiner wollte sich Prügel einhandeln.
Robin saß nur da und war froh, dass er bleiben durfte. Irgendwie würde er sie überzeugen können...
* * *
Die Waldmänner gingen ihren täglichen Verrichtungen nach, und alle Gespräche drehten sich um Robin. Die meisten wollten Robins Geschichte nicht so recht glauben und waren misstrauisch. Doch es gab auch einige, die Partei für Robin ergriffen: „Ich hab‘ auch schon gehört, dass der Sheriff einen ungewöhnlichen Sohn haben soll! Und der heißt Robert, glaub ich“, erzählte Tom Bell, ein Handwerker aus Nottingham, dessen Familie noch dort lebte. „Meine Frau sagt, dass der immer gut zu den Dienern gewesen ist. Vor dem brauchte sich in der Burg keiner fürchten!“
Und Randal fügte hinzu: „Es gibt auch Gerüchte, dass dieser Robert seine Hand im Spiel hatte, als ein paar Gefangene aus dem Kerker abgehauen sind.“
„Stimmt, das hab‘ ich auch gehört“, sagte George-a-Green. „Meine Schwester - ihr wisst ja, dass sie in Nottingham mit dem Koch vom Sheriff verheiratet ist - hat einmal erzählt, dass ein riesiger Aufruhr um den jungen Herrn war, weil er sich geweigert hat, einen Steuereintreiber-Trupp anzuführen. Ich hab‘ aber meine Schwester schon lang nicht mehr gesehen, drum weiß ich nicht, was aus dem Jungen geworden ist...“
Währenddessen besprachen sich Alan a’Dale und Little John, wie sie herauszufinden sollten, ob man Robin trauen könne.
„Schon eine ziemlich komische Geschichte, die der Kleine da erzählt“, meinte John. „Am besten gehst du mal nach Nottingham und hörst dich um, Alan. Ihr fahrenden Sänger kriegt doch immer alle Neuigkeiten mit.“
Alan nickte dazu, sagte aber: „Warum sollten wir ihm eigentlich nicht glauben? Was gibt es denn für einen Grund, sich derart misshandeln zu lassen, nur um eine Bande Waldmänner auszuspionieren? Da kommt mir ja Robins Geschichte noch wahrscheinlicher vor. Aber trotzdem, ich gehe nach Nottingham und sehe, was ich erfahren kann.“ Und dann grinste Alan plötzlich und fügte schelmisch hinzu: „Soll ich vielleicht jemanden in Nottingham besuchen und von dir grüßen, John?“
John tat so als wüsste er nicht, was Alan meinte. Doch der ließ nicht locker: „Eine gewisse Aelfrith vielleicht?“
„Hmm“, knurrte John unwillig. „Wenn du zufällig vorbeikommst, kannst du sie von mir aus grüßen... wenn du unbedingt willst.“
Alan lachte. „Gut, ich werde der reizenden Aelfrith also einen schönen, nein, sogar einen sehr schönen Gruß von dir sagen, und dass du es kaum mehr erwarten kannst, ihr süßes Lächeln wieder zu sehen...“ Mit ein paar Sprüngen zog sich Alan rasch aus Johns Reichweite zurück.
„Wart nur, Bürschchen“, schrie ihm John wütend nach. Doch dann musste er selber lachen.
Am frühen Nachmittag brach Alan auf seinem alten, weißen Pferd nach Nottingham auf. Sobald er die große Straße erreichte, die sich durch den Sherwood zog, achtete er sehr darauf, auch wirklich wie ein fahrender Sänger zu wirken. Während sein braver Schimmel müde dahintrottete, sang Alan lauthals fröhliche Lieder, seine Laute auf dem Rücken. Immer wenn ihm jemand entgegenkam, grüßte er freundlich. So näherte er sich gemächlich den Stadtmauern von Nottingham. Am Carter-Gate fragte ihn der Wächter nach dem Woher und Wohin.
„Ich bin der fahrende Sänger Alan a’Dale, und die letzte Nacht habe ich in Mansfield verbracht. Jetzt will ich hier in Nottingham den edlen Sheriff auf seiner Burg mit meinen Liedern unterhalten.“
„Du bist Alan a’Dale? Ich glaub, ich hab‘ schon von dir reden hören. Du sollst eine ganz annehmbare Stimme haben, sagt man. Trotzdem glaub ich, dass du heute beim Sheriff kein Glück haben wirst, auch wenn du noch so gut bist“, meinte der Wächter.
„Warum denn nicht?“, fragte Alan. „Ist dem Sheriff die Freude am Minnesang vergangen? Das könnte ich mir gar nicht vorstellen! Oder etwa gar an den Trinkliedern? Das wäre ja noch unglaublicher!“
Der Wächter lachte schallend. „Nein, beim heiligen Dunstan, du bist ein lustiger Kerl, guter Freund, und weil ich lustige Burschen mag, sag‘ ich dir, dass dem Sheriff tatsächlich die Lust auf derlei Dinge vergangen ist. Er läuft nämlich seit einigen Tagen nur noch wutschnaubend in seiner Burg herum und schreit jeden an, der das Pech hat, ihm unter die Augen zu treten. Und dir würd‘ es auch nicht anders ergehen, guter Freund!“
„Oje, das sind ja schlechte Aussichten für mich!“, meinte Alan betrübt. Doch innerlich war er froh, an einen so geschwätzigen Kerl geraten zu sein, und er nahm sich vor, ihn gleich noch mehr auszufragen: „Weshalb ist der edle Sheriff denn so schlecht gelaunt? Hat ihn ein Händler übers Ohr gehauen, oder hat man ihm nur sauren Wein verkauft?“
Wieder lachte der Wachmann laut: „Du bist wirklich witzig, beim heiligen Strohsack! Aber das ist das erste Mal, dass mich ein fahrender Sänger nach Neuigkeiten fragt!“ Und jetzt lachte er über seinen eigenen Scherz noch lauter als vorher. Alan grinste höflich, aber er wurde langsam etwas ungeduldig, schließlich musste er noch einen Besuch in Nottingham erledigen. „Mir scheint wirklich etwas entgangen zu sein! Du wirst sicher verstehen, dass mir so etwas nicht passieren darf! Also wäre ich dir sehr dankbar, wenn du es mir erzählen würdest. Vielleicht kann ich dann gleich ein lustiges Liedchen darüber dichten...“
„Wenn du mir versprichst, dass ich das Lied dann auch zu hören kriege! Es kann nie genug Lieder über den Sheriff geben! Ich bin schlechter bezahlt als eine Kuh in ihrem Stall, und es passiert selten, dass hier mal ein so lustiger Kerl vorbeikommt, wie du einer bist, mit dem man sich ein bisschen unterhalten kann. Nun, der Sheriff hat ja vier Kinder, also, ich meine, vier eheliche Kinder...“ Er unterbrach sich und lachte erst mal eine Weile über seinen gelungenen Scherz. Alan merkte, dass der Soldat wohl nicht ganz nüchtern war.
„Ja, der Älteste ist sein Stiefsohn, Guy heißt er“, fuhr der Wächter fort. „Das ist einer ganz nach dem Geschmack des Sheriffs. Dann sind da noch seine Stieftochter Gisella und die Kinder aus seiner ersten Ehe, die schöne Marian und Robert. Der war immer schon etwas seltsam und nicht gerade das, was man sich unter einem Normannen vorstellt. Er sieht ja auch keinem in der Familie ähnlich, weil alle dunkle Haare und Augen haben und eher kleingewachsen sind. Aber Robert ist ziemlich groß, hat blonde Haare und blaue Augen. Der ist ständig mit seinem Vater aneinandergeraten, mal, weil er sehr gut Bogenschießen kann aber im Schwertkampf gegen den geringsten Soldaten verliert, dann wieder, weil er für verhaftete Engländer Partei ergriff und sie verteidigte. Und jetzt sollte er ein Lehen bei Hucknall bekommen und dem König die Treue schwören. Ich denke er hat sich geweigert, obwohl man nicht so recht weiß warum, aber eins ist sicher: Man hat ihn trotz seiner adligen Abstammung in den Kerker geworfen, und vor drei Tagen ist er daraus entwischt. Man sagt, seine Schwester Marian, die immer zu ihm gehalten hat, habe ihn befreit! Ach ja, das ist übrigens auch noch so eine Geschichte, aus der du vielleicht ein Lied machen könntest: Es gibt Leute, die sagen, dass der junge Robert in seine schöne Schwester verliebt sein soll, aber sie liebt einen anderen, einen jungen Adeligen aus einer angesehenen Familie...“
„Ja, vielleicht mache ich ein Lied daraus“, unterbrach Alan ihn ungeduldig. „Aber wie geht die andere Geschichte weiter?“
„Ach so, ja, also, der junge Robert ist aus dem Gefängnis geflohen, und der Sheriff und die Truppen konnten ihn nicht finden, aber sie verfolgen ihn immer noch, und inzwischen ist ein Kopfpreis von dreißig Pfund in Gold auf ihn ausgesetzt! Dreißig Pfund! Guter Freund, du kommst ja viel herum, wenn du also zufällig etwas hörst, sag es mir, ich will mir gern das Gold verdienen, dann könnte ich die Arbeit hier an den Nagel hängen, ich würde den Sheriff mit seinem Stadttor alleine lassen. Soll er es doch selber bewachen!“
„Wenn der wüsste, was ich weiß!“, dachte Alan und lachte in sich hinein. Dann sagte er: „Danke für die Auskunft, guter Freund! Schade, dass nicht in jeder Stadt so erzählfreudige Wächter am Tor stehen, dann wüsste ich Bescheid wie kein anderer! Aber darf ich jetzt trotzdem in die Stadt? Denn auch wenn der Sheriff meine Lieder nicht hören will, brauche ich doch ein Quartier für die Nacht, und die wird bald da sein.“ „Aber natürlich darfst du hier durch! Beim heiligen Dunstan, man soll mich in einen heiligen Strohsack stecken, wenn ich so lustige Kumpane wie dich nicht in die Stadt lassen würde! Lass es dir gutgehen, mein Freund, und vergiss nicht, mir deine Lieder vorzusingen!“
Alan trieb sein Pferd an: „Nein, das werde ich nicht vergessen!“, rief er und ritt durchs Tor.
Also hatte Robin wirklich die Wahrheit gesagt! Alan war sehr zufrieden. Er hatte es gleich gewusst, nur Will mit seinem ewigen Misstrauen hatte wieder alle Pferde scheu gemacht. Aber Alan wusste jetzt auch mehr als alle anderen, denn wenn es stimmte, dass Robin in diese Marian verliebt war, dann erklärte das die Sache mit dem Ring. Und natürlich war sie nicht seine Schwester, Robin war ja auch nicht der Sohn des Sheriffs; aber das schien keiner zu wissen. „Gut, gut“, dachte Alan, „Das ist etwas, das ich für mich behalten werde. Aber jetzt muss ich zu Aelfrith!“
Irgendwie schien die schlechte Laune des Sheriffs die ganze Stadt angesteckt zu haben: Der Marktplatz, auf dem sonst ein reges Treiben herrschte, war fast menschenleer. Nur ein kleiner Trupp Soldaten marschierte darauf herum. Überhaupt standen fast an jeder Straßenecke Soldaten. Alan musste grinsen. Dachten die wirklich, einer, der aus dem Kerker flieht, ist drei Tage später noch in der Stadt? Schön dumm müsste man da sein!
Mittlerweile war Alan an dem kleinen Haus angelangt, in dem Aelfrith mit ihrer Mutter und Schwester wohnte. Er band sein Pferd ein paar Häuser weiter an einem Baum fest - es sollte niemand merken, zu wem er ging. Dann klopfte er dreimal an die Tür, doch niemand öffnete. Er klopfte noch einmal, und von drinnen fragte eine Stimme: „Wer da?“
„Ich bin es, Alan a’Dale.“
Da öffnete sich die Tür einen Spalt, und die Stimme flüsterte: „Komm rein, schnell!“ Alan schlüpfte hinein, und Aelfrith schloss die Tür hinter ihm und schob den Riegel vor.
„Warum seid ihr denn so misstrauisch geworden?“, fragte Alan.
„Ihr? Ich bin allein, deshalb bin ich vorsichtig, wenn jemand kommt. Sarlinna war das nicht“, antwortete Aelfrith bitter.
Alan spürte einen kleinen Stich im Herzen, und er fragte ängstlich: „Ist deiner Schwester etwas passiert?“
„Die Leute des Sheriffs haben sie mitgenommen. Als Belustigung für unseren edlen Lord“, sagte Aelfrith hart, ohne darauf zu achten, was das für Alan bedeuten mochte. Natürlich wusste sie, dass Alan und Sarlinna einander liebten, aber er hätte es sowieso erfahren müssen, und Aelfrith war kein Mensch, der lang um den heißen Brei herumredete.
Alan war wie vom Blitz getroffen. Er konnte es nicht fassen - seine Sarlinna als Mätresse des widerlichen Sheriffs! Und er war so machtlos, nichts konnte er für sie tun, nie würde sie ihm gehören... Wie er den Sheriff hasste! Der sonst so friedfertige Alan wünschte ihm alles erdenklich Schlechte an den Hals.
„Vor vier Wochen ist es passiert“, erzählte Aelfrith jetzt weiter. „Ich war gerade beim Einkaufen - wenn man das Einkaufen nennen kann, mit den paar Groschen, die wir zum Leben haben. Großmutter und Sarlinna waren allein, und zu unvorsichtig. Großmutter ist an der Aufregung gestorben.“
Alan fasste sich langsam wieder. „Gestorben? Das... das tut mir leid.“
Aelfrith wandte den Kopf ab: „Du weißt ja, dass sie schon nicht mehr so gesund war.“
Alan nickte. „Und du bist jetzt ganz allein hier?“
„Nein, nicht ganz. Ich habe noch das Ferkel und die Ziege. Aber die sind ein schlechter Ersatz für Großmutter und Schwester.“
„Ich kann dich hier nicht allein lassen! John würde es mir nie verzeihen, wenn dir etwas geschieht!“
„Was willst du denn sonst tun? Vielleicht hier wohnen?“ fragte Aelfrith spöttisch. „Nein, nein. Ich komme schon zurecht. Oder sehe ich so schwach aus, dass ich mich nicht wehren könnte?“
So sah sie wirklich nicht aus, das musste Alan zugeben. Sie war hübsch, mit blauen Augen und roten lockigen Haaren, aber sie war ziemlich groß und kräftig. Trotzdem widersprach ihr Alan: „Das kommt gar nicht in Frage!“, denn er hatte schon eine Idee. „Du kommst mit mir in den Sherwood! Warum sollen immer nur Männer dort Zuflucht finden? Wir können auch jemanden gebrauchen, der kochen kann und der wäscht und die Kleider flickt...“ Und nach einer Weile hatte er Aelfrith, die sich zunächst gesträubt hatte, doch überredet: „John wird sich bestimmt sehr freuen!“
* * *
Little John schien jedoch überhaupt nicht glücklich, als Alan am nächsten Tag mit Aelfrith, der Ziege und dem Ferkel in den Sherwood kam. Bevor Aelfrith oder Alan den erstaunten Männern irgendetwas erklären konnten, packte John Alan am Kragen, zog ihn vom Pferd und ein Stück abseits von Aelfrith und den anderen Waldleuten fuhr er ihn an: „Wie kommst du dazu, du hirnloser Sängerknabe, Aelfrith hierher zu bringen? Der Sherwood ist viel zu gefährlich für eine Frau, das weißt du genau, und in Nottingham wäre sie sicher gewesen...“
„Sicher?“, unterbrach ihn Alan. „Nennst du das sicher, wenn der Sheriff sich ein Mädchen einfach in die Burg holt? Oder wenn alte Frauen sterben, weil sie den Verlust ihrer Enkelin nicht ertragen?“
John erschrak, als er den Hass und den Schmerz in Alans Gesicht sah und in seiner Stimme hörte.
„Wenn du das sicher nennst, dann bring Aelfrith doch wieder zurück! Ansonsten solltest du froh sein, dass sie bei dir ist...“
Alan versagte die Stimme. Er riss sich los und rannte in den Wald.
Verdutzt stand John da. So kannte er den immer fröhlichen und friedlichen Alan gar nicht. Und er wurde auch nicht recht schlau aus dem, was Alan gesagt hatte und warum er deshalb so traurig war. Das war auch nicht weiter verwunderlich, denn Alan hatte niemandem von Sarlinna erzählt.
Aber John war keiner, der lang grübelte, wenn er etwas nicht verstand. Er fragte lieber die anderen, und das tat er jetzt auch. Als Aelfrith ihm alles erzählt hatte, war er wirklich froh, dass Alan sie mitgebracht hatte.
Doch über all der Aufregung hatte John nicht vergessen, warum er Alan eigentlich in die Stadt geschickt hatte, und er ärgerte sich, dass der verschwunden war, ohne davon zu erzählen.
Geduld war noch nie eine von Johns Stärken gewesen, und je länger er warten musste, desto ärgerlicher wurde er. Unruhig lief er hin und her und knurrte ab und zu wie ein Bär. Schließlich setzte er sich mit einem Fluch unter einen Baum und schnitzte an einem neuen Stock, dass die Späne flogen.
Auf einmal entstand Unruhe unter einigen Männern, und Will Scarlet kam mit triumphierendem Gesichtsausdruck zu John gelaufen und pflanzte sich vor ihm auf: „Er ist weg!“
John knurrte: „Das weiß ich doch längst.“
„Was?“ Will war erstaunt. „Und du tust nichts? Der rennt zum Sheriff, verpfeift uns! Und du?“
Jetzt war es an der Reihe für John, verwundert zu sein: „Sag mal, von wem redest du eigentlich?“
„Robin, verdammt!“
„Was?“, brüllte John.
Er sprang auf, als hätte er sich in einen Ameisenhaufen gesetzt. Mit einem Wink sammelte er die Männer um sich und teilte sie in Zweiergruppen auf, um den Wald nach Robin zu durchkämmen.
* * *
Robin war noch da gewesen, als Alan zurückgekommen war, er hatte auch den Wortwechsel zwischen John und Alan mitgehört und danach Aelfriths Erklärung. Dann war er Alan in den Wald nachgegangen.
Er fand Alan am Ufer des kleinen Baches, ein ganzes Stück weg vom Lager. Er saß an den Stamm einer Buche gelehnt und brach einen Zweig in kleine Stücke, die er mit heftigen Bewegungen ins Wasser warf. Robin sah, dass er geweint hatte. Alan blickte Robin nicht an, als er sich neben ihn setzte.
„Du liebst Sarlinna?“ Es war mehr eine Feststellung als eine Frage.
Zuerst wollte Alan trotzig „Was geht dich das an?“ erwidern, aber er merkte, dass er mit jemanden reden wollte und so sagte er: „Ja. Und ich kann die Vorstellung einfach nicht ertragen, dass der Sheriff sie... dass er ihr etwas antut!“
Robin verstand. „Du brauchst keine Angst zu haben. Sie ist keine Mätresse des Sheriffs geworden.“
Jetzt sah Alan ihn ungläubig an: „Woher weißt du das?“
Robin grinste. „Du vergisst, dass ich bis vor ein paar Wochen selbst dort in der Burg gelebt habe! Aber du musst dir wirklich keine Sorgen machen. Sarlinna ist bei Marian eine der Kammerfrauen. Und Marian ist gut zu ihr!“, setzte er mit Nachdruck hinzu.
„Aber Aelfrith hat gesagt, man habe sie zur ‘Belustgung’ des Sheriffs geholt“, beharrte Alan, der noch nicht wagte, Robin zu glauben.
„Das war zuerst auch so gedacht. Aber Marian hat es verhindert.“
„Und du bist ganz sicher, dass es meine Sarlinna war?“, fragte Alan noch einmal nach.
„Ja, das bin ich! Schließlich ist das kein ganz gewöhnlicher Name, und außerdem sieht sie Aelfrith ein wenig ähnlich“, versicherte Robin.
Plötzlich hörten sie hinter sich das Geräusch herannahender Schritte. Sie sprangen auf, und Alan zog sein Schwert. Robin wollte instinktiv dasselbe tun, aber da merkte er, dass er gar keine Waffe hatte. Er konnte also nur hoffen, dass Alan mit dem Gegner allein fertig wurde. Robin verschwand gerade hinter dem Baum, als Will Scarlet und Much aus dem Unterholz kamen. Alan lachte erleichtert und steckte sein Schwert wieder in die Scheide.
„Was macht ihr denn hier? Seid ihr auf der Jagd?“, fragte Alan mit einem Blick auf die gespannten Bögen in ihren Händen.
„Nein... wir...“, setzte Much an, doch Will unterbrach ihn: „Ja! Wir suchen den Dreckskerl. Robin. Der rennt grad zum Sheriff, verpfeift uns.“
Robin, der immer noch hinter dem Baum stand, wurde rot vor Zorn und wollte schon hervorkommen, doch Alan gab ihm einen versteckten Wink, und so blieb er wo er war.
„Warum bist du nur immer so misstrauisch, Will? Es könnte doch auch sein, dass er nur so ein Stück in den Wald gegangen ist, um sich ein bisschen umzusehen.
Und was den Sheriff angeht, so muss ich dich leider enttäuschen: Robins Geschichte ist wahr! Ich war in Nottingham, und dort pfeifen es die Spatzen von den Dächern! Nur du willst es nicht glauben.“ Alan sah Will fest an, und der wich kurz seinem Blick aus.
„Warum haut er dann ab?“, fragte Will störrisch.
„Er ist nicht abgehauen.“ Robin kam aus seinem Versteck, und Much und Will sahen ihn erstaunt an. „Ich habe euch mein Wort gegeben, dass ich nicht weggehe, bevor sich meine Geschichte als wahr er-wiesen hat, und ich halte mein Wort!“
* * *
An diesem Abend ging alles wieder seinen gewohnten Gang. Aelfrith half den Männern beim Kochen. Und Little John war wieder bester Laune - nicht nur weil das Essen besser schmeckte als sonst und er endlich nicht mehr von seiner Aelfrith getrennt war. Nein, er war auch sehr zufrieden, dass ihn sein Gefühl doch nicht getrogen hatte und der ‘Kleine’ kein Lügner war.
Robin saß bei Alan und Much am Feuer, und sie unterhielten sich. Nach einer Weile fragte Robin: „Warum ist eigentlich John hier im Sherwood?“
Much sah schweigend auf den Boden, und Alan sagte nach kurzem Zögern: „Das muss er dir selber erzählen. Hier erzählt jeder die eigene Geschichte, und das auch nur, wenn er will.“
Er sah den ärgerlichen Ausdruck in Robins Gesicht und fügte schnell hinzu: „Bei dir war das anders, das musst du verstehen, du sahst zu sehr wie ein Adliger aus, wir hätten dich nicht hier dulden können, wenn wir deine Geschichte nicht gehört hätten.“
Robin nickte, doch er sah nicht gerade besänftigt aus, und schließlich sagte er herausfordernd: „Erzählst du mir dann deine Geschichte?“
Da schaute auch Much auf, und seine Augen leuchteten neugierig. Robin begriff, dass auch er Alans Geschichte noch nicht gehört hatte.
„Meine Geschichte? Meine Geschichte ist langweilig, nicht tragisch, nicht mutig, nicht tapfer. Es lohnt sich nicht einmal, sie zu dichten. Wollt ihr sie wirklich hören?“
Much und Robin nickten ernst.
Da erzählte Alan.
Meine Eltern waren kleine englische Landadlige in Shropshire, und mein Vater hatte beschlossen, dass es besser sei, sich auf die Seite der Eroberer zu schlagen. So kam ich auch zu dem wenig englisch klingenden Namen Alan, den nicht einmal meine Amme richtig aussprechen konnte! Ich habe noch zwei ältere Brüder, Roger und Jean, und da war mein Los natürlich von vornherein klar: ich sollte in ein Kloster. Nun, es gab kaum etwas, das weniger zu mir gepasst hätte! Aber danach hat natürlich niemand gefragt, und so wurde ich im zarten Alter von 11 Jahren ins Benediktinerkloster von Shrewsbury gesteckt. Es dauerte nicht lange bis mich die endlosen Gebete zu allen unmöglichen Zeiten schier verrückt machten, und der Unterricht in Latein war so lahm, dass ich mich langweilte und anfing, eigene kleine Gedichte in meine Wachstafel zu kratzen. Diese Gedichte waren alles andere als gut, aber einmal machte ich einen wirklich sehr treffenden Vers auf den Novizenmeister, der so spindeldürr war wie eine Vogelscheuche. Natürlich hat er mich erwischt und den Vers gelesen, und ich machte meine erste Bekanntschaft mit einer Rute und später der Gefängniszelle des Klosters, in die man eingesperrt wurde, wenn man sich nicht den Regeln unterwarf. Diese Zelle wurde zu meiner zweiten Heimat, es verging keine Woche, in der ich nicht ein paar Tage darin verbrachte! Besonders als ich ein wenig älter wurde und entdeckte, welche Verlockungen es außerhalb der Klostermauern zu entdecken gab!