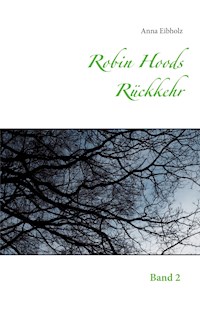
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Robin Hood
- Sprache: Deutsch
Nottinghamshire ist ein friedlicher Ort geworden, die Wälder werden nicht mehr von Gesetzlosen heimgesucht, denn Robin of Edwinstowe ist inzwischen Sheriff von Nottingham und regiert gerecht und gütig. Doch die Ruhe ist trügerisch: im Verborgenen haben Robin Hoods Feinde einen teuflischen Plan ausgeheckt, der Robin auslöschen und Marian in ihre Gewalt bringen soll. Wird es ihnen gelingen, oder kehrt Robin Hood, die Legende vom Sherwood Forest, wieder zurück?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 887
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
„Unglücklich das Land, das Helden nötig hat.“
(Bertold Brecht: „Leben des Galilei“)
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Teil I
Teil II
Teil III
Nachwort
Prolog
Nebelschwaden wehten um die weißen Kreidefelsen von Dover. Während er am Bug der kleinen Kogge stand und sich an diesem Anblick erfreute, lächelte Haimon still vor sich hin. Er dachte daran, wie ihn die anderen Ritter in der Normandie oft aufgezogen hatten damit, dass es in seiner Heimat England selbst im Sommer nur dann keinen Nebel hatte, wenn es regnete. Sie hatten Recht damit, doch er freute sich trotzdem sehr darauf, wieder nach Nottingham zurückkehren zu können.
Die anderen Handelsschiffe, die in Sichtweite waren, bogen in den Hafen von Dover ein. Die Kogge, die Haimon ausgewählt hatte, segelte dagegen weiter an der Küste entlang. Im Gegensatz zu den meisten seiner Landsleute machte Haimon das Reisen mit dem Schiff nichts aus, er fand es sogar bequemer als mit dem Pferd durch unwegsame Gegenden zu reiten. Bestimmt ging es auch schneller. Deshalb hatte er sich entschieden, die Themse hinauf bis nach London zu fahren. Schließlich duldeten die traurigen Neuigkeiten, die er Lady Marian of Huntingdon überbringen musste, keinen Aufschub. Und diskreter war eine solche Reise auch. Die geheimen Briefe, die er, in sein Wams genäht, auf Geheiß seines Herrn Richard of Huntingdon – möge Gott seiner Seele gnädig sein – niemandem außer Lady Marian und ihrem Mann zeigen durfte und die er unter Einsatz seines Lebens zu schützen geschworen hatte, waren so viel sicherer, da er nicht jeden Abend in einer anderen Wirtsstube sitzen und mit anderen Reisenden in einer Kammer nächtigen musste. Er konnte nicht beurteilen, ob Sir Richard mit seinen Verdächtigungen Recht gehabt hatte, denn in den Tagen vor seinem Tod hatte er überall Verrat lauern sehen. Aber er hatte seinem Herrn ein Leben lang treu gedient und würde nun auch diese letzte Aufgabe mit größter Sorgfalt erfüllen.
Einen Tag später erreichte die Kogge die Docks von London und Haimon machte sich auf den Weg zu der Gaststube am Rande der Stadt, die ihm Sir Richard genannt hatte. Leider konnte er nicht verhindern, dass sich der ziemlich aufdringliche Ritter Fulke de Grière, der seine Nähe suchte, seit sie aus Dover ausgelaufen waren, an seine Fersen heftete. „Ein Glück, dass du eine vertrauenswürdige Unterkunft weißt, Haimon. Hier in London muss man aufpassen, wo man hintritt. Überall lauern zwielichtige Gestalten darauf, einem für ein paar Pennies den Hals abzuschneiden“, hatte er mit einem unangenehmen Grinsen gesagt. Und Haimon, der zuvor schon zweimal abgelehnt hatte, den Hof des Königs aufzusuchen wie Fulke das vorgeschlagen hatte, konnte nicht verhindern, dass er ihn begleitete.
Auch am nächsten Morgen gelang es Haimon nicht, den Ritter abzuschütteln, obwohl er sehr früh aufstand und noch vor dem Morgengrauen die Schenke verließ. Fulke de Grière wartete bereits bei den Pferden auf ihn.
„Ihr werdet noch froh sein, dass ich bei Euch bin, Haimon, mein Freund, denn ich kenne den Weg zur Watling Street genau“, hatte Fulke behauptet und Haimon hatte sich darauf verlassen. Doch nun wurde es schon langsam hell und sie irrten immer noch durch enge, finstere Gassen und ausgestorbene Straßen, ohne ihrem Ziel näher zu kommen. Die Gegend wirkte heruntergekommen, zwielichtige Gestalten lungerten unter den Türstöcken herum und verschwanden, sobald man sich an sie wandte. Als sie in eine Sackgasse gerieten, die direkt in die Themse zu münden schien, blieb Haimon schließlich stehen und sah Fulke wütend an: „Das hat doch so keinen Sinn, Sir, Ihr wisst doch auch nicht mehr, wo wir sind!“
Fulke grinste ihn hämisch an: „Doch, wir sind genau da, wo ich hinwollte!“
Bevor Haimon etwas erwidern konnte, sah er ein Messer in Fulkes Faust aufblitzen.
Haimons Hand zuckte zum Schwertknauf, doch da spürte er schon das Messer mit einem sengenden Schmerz in seinen Bauch fahren und sank zu Boden.
Teil I
Dicke schwarze Wolken türmten sich im Osten, doch die aufgehende Sonne fand einen Weg, ein paar ihrer gleißenden Strahlen darunter hindurch zu schicken. Wie die Finger Gottes zeigten sie hier auf den Wald, da auf einen kleinen Weiler zwischen grünen Wiesen und goldgelben Feldern, dort auf die graue, mächtige Burg.
Marian stand auf dem Wehrgang der Burg von Nottingham und blickte dem neuen Tag entgegen. Das tat sie jeden Morgen, wenn es ihr möglich war. Es war ein schöner Sommer gewesen bisher, Regen und Sonne hatten sich genau im richtigen Maße abgewechselt. Doch jetzt, wo die Bauern mit der Ernte beginnen wollten, schien sich das Wetter zu ändern. Heute dachte sie jedoch nicht an die Sorgen der Bauern, sondern war in Gedanken weit weg. Auf den Tag genau war es nun zehn Jahre her, dass sie mit ihrem Vater, Sir Richard at the Lea und einer Schar Ritter und Soldaten nach Norden geritten war. Das Herz war ihr schwer gewesen vor Trauer um Alan a‘Dale und vor Furcht vor dem, was sie vorfinden mochten. Nie hätte sie gedacht, dass es so lange dauern würde, die Ritter und Soldaten zusammenzurufen und auszurüsten, und fast hatte sie geglaubt, dass sie zu spät kommen würden und Robin, John, Will, Much und all die anderen bereits der Übermacht von Gisborne und seinen Verbündeten erlegen waren. Es war ein schrecklicher Tag gewesen, und doch – in dem Moment, als sie Robin in den Arm nehmen konnte, als sie seine Trauer und Verzweiflung, aber auch das Glück über ihre Versöhnung teilen konnte, hatte sie gewusst, dass sie angekommen waren. Dort, wo all das Schreckliche hingeführt hatte. Und heute…
Mit einem kleinen Lächeln vertrieb Marian die trüben Gedanken. Und blickte wieder auf die Sonnenstrahlen, die sicher bald ihren Kampf gegen die Wolken gewinnen würden.
Heute war sie mit ihrem Leben rundum zufrieden und glücklich. Auch wenn eine ganze Menge Arbeit auf sie wartete. Marian wandte sich widerstrebend ab und ging zur Treppe. Gerade als sie den Fuß auf die erste Stufe setzte, trat Robin aus dem Pferdestall in den Burghof. Sie blieb noch einmal stehen. Wie immer, wenn sie ihn sah, wurde ihr warm ums Herz. Er war die ganze Nacht im Stall gewesen, um bei der Geburt des neuesten Sprosses von Follow, seinem alternden Hengst, dabei zu sein, und sie konnte bis hier oben sehen, dass er müde aber glücklich war. Anscheinend war alles gut gegangen. Geduldig stand er jetzt Alan Rede und Antwort, der gerade zusammen mit Edith über den Burghof gestürmt war und ihm nun mit einer für einen Neunjährigen wohl ganz gewöhnlichen Neugier Löcher in den Bauch fragte. Edith hörte den beiden mit großen Augen zu. Marian musste unwillkürlich grinsen. Edith war so wissbegierig und naseweis, wie sie wohl als kleines Mädchen selbst gewesen war.
Obwohl Robin sie unmöglich bemerkt haben konnte, schaute er in dem Moment hoch und ihre Blicke trafen sich. Sie lächelten sich kurz zu, und Marian kam es vor, als würde einer der Sonnenstrahlen direkt in ihr Herz scheinen und es erwärmen, so leuchtete Robins Blick. Marian wäre am liebsten hinuntergerannt und hätte sich ihm wie ein junges Mädchen in die Arme geworfen. Sie liebte ihn noch immer genauso wie vor zehn Jahren.
Auch andere Frauen auf der Burg machte ihm oft schöne Augen. Wie auch die dunkelhaarige, sehr hübsche junge Magd, die gerade bei ihm ankam. Marian erkannte, dass sie das frische Hemd für Robin über dem Arm trug, mit dem sie eigentlich Aldith, die Amme, zu ihm geschickt hatte, weil sie sich denken konnte, dass seine Geburtshelfertätigkeit nicht ohne Schmutz und Flecken abgegangen sein konnte. Mildred hieß die Magd, und sie schien in letzter Zeit auffallend oft nach einem Vorwand zu suchen, sich in Robins Nähe begeben zu können. Sie grüßte ihn jetzt besonders freundlich und stellte sich so auf, dass er all ihre Reize gut zu sehen bekam. Doch Robin achtete gar nicht darauf, was Marian recht beruhigend fand. Sie wusste zwar tief in ihrem Innern, dass sie Robin vertrauen konnte und er sie nicht betrügen würde, aber seit Edrics Geburt vor einigen Monaten, von der sie sich lange Zeit nicht richtig erholt hatte, war er ihr immer ausgewichen, wenn sie Zärtlichkeit suchte, und so war ihr schon manchmal der Gedanke gekommen, dass er vielleicht eine andere haben könnte. Doch sein Verhalten Frauen gegenüber hatte sich nicht geändert, wie sie beobachten konnte. Er war immer höflich und zuvorkommend, zeigte aber nie darüber hinaus Interesse. So auch jetzt: er nahm der Magd das Hemd freundlich aus der Hand, doch ihren Versuch, ihm beim Umziehen zu helfen, wehrte er ab und widmete sich gleich wieder den beiden Kindern. Die drei gingen zurück zum Stall, und Marian konnte sich denken, dass die beiden nicht viel Überzeugungskraft gebraucht hatten, um Robin zu überreden, ihnen das Fohlen gleich zu zeigen. Alan und Edith waren auch beide Pferdenarren und nutzten jede Gelegenheit, mit in den Stall zu gehen.
Marian seufzte und machte sich nun doch endlich auf den Weg nach unten. Gerne wäre sie jetzt bei Robin und den Kindern im Stall. Aber sie musste in die Küche, um mit der Köchin die Vorräte durchzugehen und zu sehen, was heute auf dem Markt eingekauft werden sollte. Danach musste sie mit dem Tuchhändler, den sie für heute einbestellt hatte, den Stoff für die jährlich neuen Hemden der Bediensteten ansehen und einen möglichst guten Preis aushandeln. Aber vielleicht konnte sie ja danach mit Robin für ein paar Stunden in den Wald reiten, bevor sie später die Vorbereitungen für das Abendessen überwachen musste, zu dem heute Vertreter der Handwerker und Händler aus Nottingham geladen waren.
Seit Robin vor fünf Jahren tatsächlich Sheriff von Nottingham geworden war, gab es nicht mehr oft Gelegenheit, sich zu zweit zurückzuziehen oder gar für ein paar Stunden alles hinter sich zu lassen. Marian konnte immer noch nicht so recht glauben, dass alles, was sie an diesen schrecklichen Tagen vor fast genau zehn Jahren mit ihrem Vater ausgehandelt hatten, wahr geworden war.
Sie hatte Robin geheiratet, und sie waren die glücklichsten Menschen der Welt gewesen. Alle Schwierigkeiten und Feindseligkeiten waren an ihnen abgeprallt, sogar Geoffrey de Staunton mit seinem Hass und seiner Eifersucht ertrugen sie spielend. Der versuchte, ihnen jeden Tag in der Burg das Leben schwer zu machen, schließlich hatte Robin all das bekommen, was er eigentlich selbst hatte haben wollen: Marian zur Frau und die Aussicht, Sheriff und letztlich sogar Earl of Huntingdon zu werden. Trotzdem hatte Sir Richard darauf bestanden, ihn als Steward zu behalten: „Glaub mir, Robert, er macht seine Sache nicht schlecht. Und wenn er in Nottingham bleibt, kannst du ihn wenigstens im Auge behalten“, hatte er gesagt und Robin musste zugeben, dass Sir Richard Recht hatte. Schließlich hatte auch Marian eingewilligt, obwohl sie vermutete, dass es ihrem Vater Spaß machte, ihnen so viele Steine in den Weg zu legen wie er nur konnte.
Vor fünf Jahren hatte Sir Richard dann tatsächlich wahr gemacht, was er lange angedeutet hatte, und sich auf seine Ländereien in der Normandie zurückgezogen. Und Robin Hood – der sich natürlich nicht mehr so nannte, den aber doch noch alle so in Erinnerung hatten – war Sheriff von Nottingham geworden. Die Aufregung darüber war groß gewesen, nicht zuletzt bei den Adligen der Grafschaft. Doch irgendwie hatte Robin es nach einem harten ersten Jahr geschafft, sich den Respekt der Adligen zu verdienen – zumindest der meisten von ihnen, denn dass er Peter of Stretton, Roger de Clary und deren Freunde auf seine Seite bringen könnte, lag nicht im Bereich des Möglichen. Er war immer gerecht gewesen, und das hatte ihm oft schlaflose Nächte bereitet. Die Macht die er nun innehatte, berauschte ihn nicht, wie es manch anderem Mann in solch einer Position erging. Er empfand es im Gegenteil als schwere Bürde, besonders, wenn er Urteil über die Menschen sprechen musste, auf deren Verbrechen die Todesstrafe stand. Robin hatte Marian einmal erklärt, dass er immer das Gefühl hatte, sich etwas anzumaßen, wenn er über Leben und Tod entscheiden sollte, und sie verstand ihn nur zu gut. Sicher hatte noch nie ein Sheriff, Herr oder gar König am eigenen Leib erfahren müssen, wie es ist, in einem Kerker zu sitzen, gefoltert zu werden und jederzeit mit dem Tod rechnen zu müssen. Marian hatte ihn sehr darin unterstützt, Folter und unnötige Quälereien im Kerker der Burg abzuschaffen. Doch wann immer es nicht auf die Kosten der Armen und Schwachen ging, war Robin den Adligen in ihren Belangen entgegengekommen und hatte sie so zufriedenstellen können. Wenn nun die Steuereintreiber in die Dörfer kamen, verbreiteten sie nicht mehr Angst und Schrecken. Robin hatte Anweisungen gegeben, in besonderen Fällen nachsichtig zu sein und lieber die Steuern zu stunden als der betroffenen Familie, deren Ernährer vielleicht krank oder gar gestorben war, auch noch das Letzte, das sie hatten, wegzunehmen. Zur großen Überraschung des Verwalters de Staunton waren es aber nach einigen Jahren nicht weniger, sondern mehr Steuereinnahmen, und so war letztlich sogar der König mit der ganzen Sache zufrieden.
Ausgerechnet in dem Jahr, in dem Robin Sheriff geworden war, war ihre erste Tochter, Edith, zur Welt gekommen, zwei Jahre danach Gytha und erst vor neun Monaten hatte Edric das Licht der Welt erblickt. Er war ein großer und sehr kräftiger Junge und die Geburt hatte lange gedauert und war sehr anstrengend gewesen. Zu allem Überfluss hatte Marian die Nachgeburt nicht vollständig geboren und lag lange danach im Fieber. Nur mit Hilfe von Bruder Tuck, den Robin völlig verzweifelt eines Nachts aus Hampstead Abbey geholt hatte, hatte Marian das Fieber überlebt. Nun war der kleine Edric der Sonnenschein der ganzen Familie, wenn er fröhlich quietschend durch die Binsen am Boden kroch und jeden anlachte, dem er dabei begegnete, und Marian dachte kaum noch an die dramatische Zeit.
Doch Robin ließ dieses Ereignis nicht los. Noch nie zuvor hatte er solche Angst gehabt, denn er konnte sich beim besten Willen nicht vorstellen, wie er ohne Marian weiterleben sollte. Ohne sie hätte er nie die Kraft gefunden, den Alltag in Nottingham durchzustehen, auf der Burg, die ihm oft so eng war, dass die hohen, dunklen Mauern ihm fast den Atem nahmen. Marian kam viel besser zurecht mit diesem Leben, wusste meistens den richtigen Weg, wenn es darum ging, schwierige Entscheidungen zu treffen, und schaffte es spielend, den Intrigen der anderen Adligen aus dem Weg zu gehen. Robin hatte sich oft gewünscht, in den Sherwood zurückkehren zu können, oder wenigstens auf einem kleinen, abgeschiedenen Landgut wie dem, das er in Edwinstowe zu bauen begonnen hatte, mit Marian und den Kindern in Ruhe leben zu dürfen. Doch er wusste, dass er diesen Preis zahlen musste, und meistens zahlte er ihn gern.
Marian war in den letzten zehn Jahren immer schöner geworden, fand er, als er sie da oben auf der Burgmauer stehen sah: Im Wind wehten ihre Haare und die Sonnenstrahlen beleuchteten sie. Natürlich hatten die drei Schwangerschaften sie verändert, doch nicht zum Nachteil, wie Robin fand. Ihre Schönheit kam ohnehin von innen heraus; sie verbreitete Wärme um sich, zog jeden mit ihrem Lachen in den Bann, beruhigte schreiende Kinder ebenso wie aufgeregte Bittsteller mit ihrer stillen Freundlichkeit. Robin wäre am liebsten zu ihr auf die Burgmauer gegangen und...
Eine Magd unterbrach seine Gedanken mit einem Gruß und Robin schenkte ihr kurz seine Aufmerksamkeit. Marian hatte sie anscheinend mit einem frischen Hemd zu ihm geschickt, und Robin konnte Marians Umsicht nur einmal mehr bewundern: Sie hatte gewusst, dass Robin, einmal aus der Stalltür getreten, nicht mehr dazu kommen würde, sich umzuziehen. Das würde er allerdings auch nicht hier und jetzt tun, mitten im Burghof, wie es ihm die junge Magd vorschlagen wollte. Als Alan ihn wieder am Ärmel zupfte, war er froh über die Ablenkung und erklärte ihm, dass das Pferdefohlen mit den Vorderbeinen voraus auf die Welt gekommen war, wie es bei Pferden üblich war. In Gedanken sah er dabei aber Edrics Geburt vor sich, denn der Junge hatte sich auch mit den Füßen voraus in die Welt gekämpft und die Angst, die er damals um Marian gehabt hatte, war wieder greifbar.
Seitdem fürchtete er, dass sie wieder schwanger werden und dann vielleicht tatsächlich bei der Geburt sterben könnte, und so war er Marian seither mit immer neuen Ausreden ausgewichen, wenn sie abends zu Bett gingen. Leicht war das nicht, und sie hatten auch nicht darüber geredet, denn Robin bekam in solchen Dingen immer noch selten den Mund auf.
Vielleicht sollte er heute versuchen, ein paar Stunden Zeit zu finden und mit Marian in den Wald zu reiten, hinunter zum Flusstal. Dort würde er sich vielleicht freier fühlen und könnte ihr alles erklären.
Aber wie so oft holte ihn der Alltag schneller ein, als ihm lieb war. Noch bevor er mit seinen Kindern die Stalltür erreicht hatte, hörten sie Lärm am Tor zum Burghof, und Robin erkannte unter den anderen Stimmen Geoffrey de Staunton, der lautstark Befehle gab. Dann erschien er auch schon im Torbogen, flankiert von einer älteren, dicken Frau, die auf ihn einredete, und einem Soldaten auf der anderen Seite, der einen jungen Burschen gepackt hatte. Der Junge zitterte und sah sich ängstlich um. Er erinnerte Robin an ein wildes Tier in der Falle, das verzweifelt nach einem Ausweg sucht. Besondere Angst jagte ihm wohl de Staunton ein mit seiner großen, massigen Gestalt und dem unerbittlichen Ausdruck auf seinem Gesicht. Immer wenn Geoffrey in seine Richtung blickte, senkte der Junge schnell den Kopf. Robin fiel erst jetzt richtig auf, wie Geoffrey in den letzten Jahren an Gewicht zugelegt hatte. Kein Wunder, dass er auf den kleinen Bengel furchteinflößend wirkte.
Inzwischen hatte Robin auch gehört, was die Alte de Staunton schimpfend erzählte: der Junge hatte ihren Geldbeutel gestohlen. In solchen Momenten hasste Robin es, der Sheriff zu sein. Auf Diebstahl stand eine grausame Strafe: dem Schuldigen wurde die Hand abgeschlagen. Robin sah durchaus ein, dass es wichtig war, das Eigentum der Menschen zu schützen, die oft selbst nur das Nötigste zum Leben hatten. Doch was hatte der arme Junge noch für eine Chance, wenn er nun eine Hand verlor? Er musste weiterhin betteln oder gar stehlen, da niemand einem bestraften Dieb Arbeit geben würde, selbst wenn er sie einhändig überhaupt ausführen könnte.
Geoffrey de Staunton sah so aus, als wollte er die Strafe hier und jetzt durchführen lassen, und es sähe ihm durchaus ähnlich, Robin gar nicht erst davon in Kenntnis zu setzen. Doch diesmal hatte er Pech! Schnell rief Robin den Stallknecht zu sich, der gerade mit Wassereimern zu den Pferden wollte, und bat ihn, mit Alan und Edith schon einmal zu dem Fohlen zu gehen. „Ich komme gleich nach! Stellt nichts an, ihr zwei!“ Die Kinder sahen enttäuscht aus, doch lieber wollten sie jetzt das Fohlen sehen, als auf ihren Vater zu warten, und so folgten sie Edwyn, dem Knecht.
Mit einem flauen Gefühl im Bauch ging Robin hinüber zu der Gruppe mit dem gefangenen Dieb.
„Was geht hier vor?“ Robin ließ seine Stimme laut und befehlsgewohnt klingen.
De Staunton blickte auf, und als sein Blick auf Robin fiel, konnte man für einen kurzen Moment die Abscheu erkennen, die er für ihn empfand. Er hatte sich schnell wieder im Griff und sagte beflissen: „Nichts, worum Ihr Euch selbst kümmern müsstet, my Lord Sheriff! Die Sache ist klar: Der Kerl hat dieser ehrbaren Frau den Beutel stehlen wollen. Der Dieb wird gleich in den Kerker geführt und der Henker wird ihm die Hand abschlagen, wie das Gesetz es vorsieht!“
Der Blick, mit dem de Staunton Robin musterte, war so finster, dass Robin vermutete, er würde ihm am liebsten auch gleich dieselbe Strafe zukommen lassen. In Geoffreys Augen hatte er das verdient, und zwar so oft, dass seine Hände dafür nicht ausreichten und er letztendlich am Strang enden müsste, anstatt hier den Sheriff zu spielen.
Der Gefangene war bei Geoffreys Worten zusammengezuckt und fing leise an zu wimmern. Er war schrecklich mager, hatte zahllose blaue Flecken an den Armen und im Gesicht und trug einen völlig zerfetzten Kittel. Viel Erfolg konnte er mit seiner Dieberei nicht haben, dachte Robin. Er ging gar nicht auf de Stauntons Worte ein, sondern wandte sich an die Frau: „Wo ist denn dein Beutel jetzt, gute Frau?“
Die Frau verbeugte sich vor ihm und schob dann ihren Umhang zurück, um unter ihrer Schürze den Lederbeutel hervorzuziehen, der an einem Gürtel befestigt war: „Hier, my Lord Sheriff!“, sagte sie.
„Also hat der Dieb ihn dir schon wieder zurückgegeben?“ „Nein nein, Herr, ich hab ja noch rechtzeitig gemerkt, wie er sich an dem Beutel zu schaffen gemacht hat und hab den Kerl gleich gepackt, bevor er sich wieder aus dem Staub machen konnte!“
„Dann hat der Junge dich also gar nicht bestohlen?“
De Staunton runzelte wütend die Stirn. Versuchter Diebstahl wurde ja noch nicht mit der gleichen, gnadenlosen Maßnahme bestraft. Würde es Robin schon wieder gelingen, einen seiner Sachsen vor der gerechten Strafe zu bewahren?
Die Frau sah ein bisschen verwirrt aus, und sagte zögernd: „Naja, nein, eigentlich nicht, aber wenn ich es nicht bemerkt hätte, dann wäre das Geld weg gewesen…“
„Außerdem hat er es sicher nicht zum ersten Mal versucht!“, fiel de Staunton ein. „Er hat ein richtiges Diebesmesser bei sich gehabt, mit dem er die Schlaufen durchschneiden kann, seht hier!“ Geoffrey hielt ein Messer mit einer kurzen aber sehr scharfen Klinge hoch. Wieder überging Robin de Stauntons Einwurf einfach – er konnte sich nicht jedes Mal mit Geoffrey auf einen Streit einlassen, das kostete zu viel Zeit und Kraft - und schickte den Soldaten mit dem Gefangenen in die Verliese. „Bring ihn in eine Zelle und gib ihm Wasser und Brot. Ich werde später selber mit ihm reden!“
Der Junge sah ihn mit einem Blick an, in dem sowohl Angst als auch Hoffnung steckten. Was er von diesem Mann zu erwarten hatte, konnte er wohl noch nicht einschätzen, aber jedenfalls sah er nicht so böse aus wie der andere.
Robin nahm de Staunton das Messer aus der Hand und begutachtete es eingehend. In den letzten Wochen waren schon öfter Diebstähle gemeldet worden, bei denen Beutelschneider am Werk gewesen waren. Robin hegte den Verdacht, dass eine neue Gruppe von Dieben nach Nottingham gekommen war. Vielleicht war der Junge einer von ihnen und konnte ihm noch nützlich sein, wenn er ihn dazu brachte, etwas über seine Bande zu verraten?
An die Frau gewandt, sagte Robin: „Es war richtig von dir, gleich hierher zu kommen, gute Frau! Ich werde schon dafür sorgen, dass hier Gerechtigkeit geübt wird!“ Robin wusste nur zu gut, dass die Leute auch gerne mal das Gesetz in die eigene Hand nahmen, wenn sie dem Sheriff nicht zutrauten, in ihrem Sinne zu walten. Und um Geoffrey zu beschwichtigen, dessen unterdrückte Wut er förmlich spüren konnte, sagte er: „Ich denke, dass die Diebstähle in den letzten Wochen mit diesem hier zusammenhängen. Vielleicht gehört der Kleine zu der Bande und wir können etwas aus ihm herauskriegen.“
Als Robin sich umdrehte und nun doch endlich zur Stalltür ging, war er sich sicher, dass sich Geoffreys Blicke in seinen Rücken bohrten. Es war nicht leicht für ihn gewesen, täglich mit der Missgunst seines ehemaligen Rivalen zurechtzukommen, besonders seit Sir Richard in der Normandie war und Robin Sheriff geworden war. Es gab kaum einen Tag, an dem Geoffrey ihn nicht spüren ließ, wie sehr er ihn verachtete. Und da dies auf Gegenseitigkeit beruhte, gab es anfangs fast täglich Streit, der, wäre es nach den beiden Kontrahenten gegangen, irgendwann in einem Zweikampf auf Leben und Tod geendet hätte. Doch Marian hatte Robin ins Gewissen geredet, und inzwischen machte sich Robin insgeheim einen Spaß daraus, Geoffrey so gelassen und gleichgültig zu begegnen, dass ihn das noch mehr reizte als ihre Wortgefechte früher. Geoffrey konterte dies mit einer derart übertriebenen Unterwürfigkeit, dass jeder merken konnte, wie absurd er es immer noch fand, vor diesem ehemaligen Verbrecher dienern zu müssen.
Im Moment war Robin das alles jedoch völlig egal; er wusste, dass Geoffrey nicht so weit gehen würde, einen seiner ausdrücklichen Befehle zu missachten und dem jungen Dieb etwas anzutun. Also konnte er jetzt zu den Kindern in den Stall. Die gedämpfte Ruhe des Pferdestalls war oft sein Rückzugsort hier in der Burg, manchmal fühlte er sich den Tieren mehr verbunden als den Menschen mit ihrem wichtigtuerischen und eigensüchtigen Gehabe. Nicht selten hatte er das Gefühl, sein alter Wegbegleiter Follow sei der Einzige, der ihn wirklich verstand.
Kaum hatte er die Stalltür geöffnet, kam ihm schon Alan entgegen: „Papa, es ist ja wirklich ein Hengst!“ Und Edith kam dazu und rief mit enttäuschter Stimme: „Aber er sieht gar nicht aus wie Follow! Er ist ganz schwarz.“ Robin lachte, denn – so erklärte er Edith – Falben wie Follow kamen meist schwarz zur Welt und wechselten erst später die Fellfarbe.
Es gab kaum etwas Friedlicheres als den Anblick einer Stute, die ihr Fohlen säugte, fand Robin, und er hätte stundenlang dastehen und dem begeisterten Geplapper seiner Kinder zuhören können. Gerade fragte Alan: „Wie willst du ihn nennen, Papa?“ Und Robin zuckte die Achseln und antwortete etwas geistesabwesend: „Das weiß ich noch nicht, Alan. Überleg du dir doch einen Namen!“, denn ihm wollte der Anblick des kleinen Diebes nicht aus dem Kopf. Und dann öffnete sich auch noch die Stalltür und ein Page richtete ihm aus, dass die Gesandtschaft der jüdischen Gemeinde jetzt eingetroffen sei.
Die Juden konnte er nicht warten lassen. Sie würden es sicher als Unhöflichkeit auffassen, da das Verhältnis zwischen Christen und Juden, die erst seit wenigen Jahrzehnten hier in England ansässig waren, grundsätzlich ziemlich schwierig war. Darüber hinaus war die Stimmung in der Stadt gerade ziemlich gereizt. Seine Aufgabe als Sheriff bestand darin, alles zu versuchen um die Wogen zu glätten und ein friedliches Miteinander zu gewährleisten. Das allerdings war komplizierter als es sich anhörte. Mit einem Seufzer riss er sich los, zog sich noch schnell das frische Hemd an, vertraute die Kinder wieder der Obhut des jungen Stallknechts Edwyn an und ging hinüber in die Halle. Er hoffte inständig, dass Marian auch dort war. Er kannte niemanden, der es so gut verstand wie sie, einen Weg durch solch heikle Angelegenheiten zu finden.
Doch seine Hoffnung sollte enttäuscht werden. Marian war nirgends zu sehen, und in der Halle war es eigentümlich still. Die Bediensteten, die hier zu tun hatten, huschten geduckt an den drei Männern mit den seltsamen Hüten vorbei und wandten meist noch den Blick ab, als wäre es gefährlich, den Fremden in die Augen zu schauen. Zum Glück konnte Robin sich wenigstens auf Edmund, seinen Schreiber, verlassen. Der junge Mann war einmal Mönch in Hampstead Abbey gewesen, doch dann hatte er sich verliebt und seine Gelübde gebrochen. Als Vater Kolumbanus ihn daraufhin aus der Gemeinschaft der Brüder entließ, hatte er Robin gebeten, ihm diese Anstellung zu geben, da niemand sonst einen abtrünnigen Mönch bei sich haben wollte und er den jungen Mann sehr schätzte. Der Abt hatte Recht behalten: Edmund war klug und sehr sorgfältig und er wusste Situationen richtig einzuschätzen. So war auch er es, der gerade mit großer Gelassenheit den drei Juden Wein anbot, während sie auf den Lord Sheriff warteten.
Robin klopfte sich noch schnell ein paar Strohhalme von den Hosen und ging dann auf die Fremden zu: „Seid willkommen in meiner Halle. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu lange warten lassen. Aber falls ihr selbst Kinder habt, werdet ihr sicher verstehen,“ fügte er mit einem entwaffnenden Lächeln hinzu, „dass wir noch das neugeborene Fohlen im Stall anschauen mussten!“
Der jüngste der Männer, offensichtlich überrascht ob dieser Begrüßung, sah Robin gleich mit einem kleinen Lächeln ins Gesicht, das zeigte, dass er sehr gut verstand, was Robin meinte. Seine beiden Begleiter schien Robins Offenheit aus dem Konzept gebracht zu haben, sie wussten wohl nicht so recht, ob sie sich beleidigt fühlen sollten. Schließlich ergriff einer der Älteren, der ein wenig größer und kräftiger war als die anderen, das Wort. „Wir danken Euch, Sheriff, dass Ihr Euch Zeit für uns nehmt. Ich bin Aaron ben Josua, das ist mein Sohn Tobias, und das ist Obadiah ben Sina, unser Ältester.“
Aaron wollte weiterreden, doch Robin unterbrach ihn schnell: „Wollen wir uns nicht setzen, Aaron ben Josua? Dort kann uns auch eine Magd eine kleine Erfrischung bringen.“ Er führte die drei an einen Tisch in der Nähe eines großen Fensters, durch das Licht in die Halle fiel. Die drei Juden tauschten verwunderte Blicke. Selten wurden sie im Haus eines Christen so unvoreingenommen behandelt. Ob der junge Herr sie nur um den Finger wickeln wollte, um dann freundlich aber gnadenlos ihr Gesuch abzulehnen?
Robin dagegen fühlte sich lange nicht so selbstsicher, wie er tat. Für ihn waren alle Menschen gleich viel wert, denn er hatte am eigenen Leib erfahren, wie schnell man in dieser Welt ins Unglück stürzen konnte, ungeachtet aller Privilegien, die eine bestimmte Herkunft mit sich brachte. Daher war es nicht verwunderlich, dass er die Juden genauso willkommen hieß und in seiner Halle bewirtete wie jeden anderen auch. Doch da er auch nicht mehr über ihren Glauben und ihre Gebräuche wusste als die meisten anderen Christen, fühlte er sich wie auf zu dünnem Eis, das bei der nächsten falschen Bewegung bersten konnte.
Als sie sich gesetzt hatten, wartete Robin darauf, dass Aaron weiterreden würde, doch der war aus dem Konzept geraten, und so ergriff der junge Tobias das Wort: „My Lord Sheriff, wir kommen um Eure Hilfe zu erbitten. Seit dem Zwischenfall mit dem ermordeten Jungen kommt es immer wieder zu Übergriffen auf unsere Häuser. Vor einer Woche zogen einige betrunkene Männer durch unser Viertel und zerschlugen Fenster, und vor zwei Tagen erst wurde eine brennende Fackel in ein Haus geworfen. Zum Glück war es ein Steinhaus, und das Feuer wurde schnell entdeckt. Aber Ihr wisst sicher selbst, welche Gefahren so ein Feuer für unser Viertel und die ganze Stadt birgt.“
Robin hatte der Schilderung des jungen Mannes mit wachsendem Unmut gelauscht, und schließlich nutzte er eine Pause des anderen. Aufgebracht sagte er: „Aber das kann nicht sein! Es ist doch zweifelsfrei bewiesen, dass der Mörder des Kindes keiner von euch war! Der Kerl hat gestanden, und ich habe ihn öffentlich hängen lassen!“
Der schreckliche Fall hatte Nottingham in diesem Frühjahr in Atem gehalten, und der grausame Mord an dem kleinen Kind hatte Robin so entsetzt, dass er ein einziges Mal ohne zu zögern die Todesstrafe verhängte und sogar eine öffentliche Hinrichtung befahl, was in den letzten fünf Jahren beileibe nicht oft geschehen war. Es war eine kluge Entscheidung gewesen, nicht zuletzt, weil immer wieder das Gerücht aufgekommen war, die Juden hätten den Jungen auf dem Gewissen. Robin war sicher gewesen, mit der Überführung des wahren Täters alle anderen Verdächtigungen aus der Welt geschafft zu haben.
„Wollt Ihr damit andeuten, dass wir nicht die Wahrheit sagen?“ Diesmal sprach der dritte, Obadiah, der als der Älteste vorgestellt worden war. „Denkt Ihr, wir hätten uns diese Vorfälle nur ausgedacht, um Euch Ärger zu machen?“
Robin sah den Alten verwirrt an. Doch bevor er noch etwas erwidern konnte, mischte sich Aaron wieder ein: „Ich denke nicht, dass der Sheriff so etwas andeuten wollte, Obadiah.“ Er legte dem Alten beschwichtigend eine Hand auf den Arm. Dann wandte er sich wieder Robin zu. „Es gibt einen Priester in der Stadt, der auch nach der Hinrichtung des wahren Mörders Stimmung gegen uns macht. Seine Kirche liegt in der Nähe der ersten Häuser unseres Viertels.“
Pater Martin, fiel Robin ein, ein unangenehmer Mensch von der Abtei St. Mary’s in York, der den Vorstand über die reichste Gemeinde in Nottingham hatte, da dort die wohlhabenden Händler und die Goldschmiede ihre Häuser hatten. Sie hatten sich vor einigen Jahren sogar eine steinerne Kirche leisten können. Und der Priester machte ihm Schwierigkeiten, wann immer er konnte.
Robin runzelte die Stirn und sagte verärgert: „Dann werde ich wohl mal ein ernstes Wörtchen mit Pater Martin sprechen müssen.“ Eine sehr unangenehme Aufgabe, denn zu den Menschen, die dieser Priester wohl zusammen mit den Juden am liebsten in der Hölle gesehen hätte, gehörte auch Robin selbst.
Der junge Tobias sah Robin in die Augen und für einen kleinen Moment lächelte er ihn mitleidig an. Robin grinste schief zurück. Ich kann beileibe nicht verstehen, was an diesen Juden so anders sein soll, dachte Robin bei sich. Im Grunde wusste auch er nur das, was die Kirche über sie verbreiten ließ, und er hatte noch nie viel mit ihnen zu tun gehabt: die Juden hatten ihren Rabbi und den Ältesten, und sie regelten ihre Streitigkeiten meist untereinander, ohne den christlichen Sheriff einzubeziehen. Aber ansonsten waren es wohl doch Menschen wie alle anderen auch, die die gleichen Sorgen, Gefühle und Gedanken hatten.
„Es ist gut von Euch, dass Ihr mit dem Priester sprechen wollt, Herr“, sagte Aaron jetzt, „doch ich fürchte, das wird nichts nützen. Das Zusammenleben unserer beider Religionen wird sich immer schwierig gestalten. Deshalb wollten wir Euch eine andere Lösung vorschlagen.“
Robin sah ihn erwartungsvoll an, und Aaron fuhr fort: „Wir haben uns überlegt, ob es vielleicht möglich wäre, das Judenviertel mit einer Art Schutzmauer zu umgeben. Nach Anbruch der Nacht wird niemand mehr eingelassen. Vielleicht könntet Ihr in Erwägung ziehen, so eine Mauer in Nottingham zu bauen?“
Robin sah die drei Männer nachdenklich an. Praktisch wäre es möglich, denn das Judenviertel grenzte an zwei Seiten an die Stadtmauer, und man müsste nur eine relativ kurze Mauer durch die Häuser ziehen. Doch die Idee gefiel ihm ganz und gar nicht. Die Juden waren mit William dem Eroberer nach England gekommen, lebten also erst seit ein paar Generationen hier und waren für die meisten Engländer immer noch Fremde. Schon jetzt war das Verhältnis von Juden und Christen von gegenseitigem Misstrauen und Vorurteilen geprägt. Wenn jetzt auch noch eine ganz handfeste Mauer den Blick aufeinander versperrte, trug das sicher nicht zur besseren Verständigung bei.
Robin musste erst seine Gedanken ordnen, und so zog sich die Stille ziemlich in die Länge.
Obadiah, der Älteste, meinte den Grund für das Zögern des Sheriffs erkannt zu haben und sagte: „Wenn es um das Geld geht, das so ein Mauerbau kostet, so würden wir uns natürlich daran beteiligen.“
Robin winkte ab. „Das ist es nicht. Aber mir gefällt die Vorstellung einfach nicht. Schon jetzt wissen wir kaum etwas übereinander… Denkt ihr nicht, dass so eine Mauer auf jeder Seite das Misstrauen schürt, weil man nicht mehr mitbekommt, was auf der anderen Seite passiert? Und wollt ihr wirklich so leben, hinter Mauern eingesperrt? Denn Tore kann man nicht nur von innen schließen, zum eigenen Schutz, sondern auch von außen, um euch einzusperren.“
Der junge Tobias entgegnete heftig: „Wir wollen nur, dass wir uns auf den Straßen wieder sicher fühlen können, dass unsere Frauen und Kinder nicht verfolgt werden und dass unsere Häuser vor Übergriffen geschützt sind! Wir wollen ohne Angst leben!“
Das konnte Robin sehr gut nachvollziehen. „Natürlich, das verstehe ich ja. Und es ist gut, dass ihr deshalb zu mir gekommen seid, denn ich kümmere mich um die Sicherheit aller Bürger dieser Stadt.“
Tobias schnaubte ärgerlich.
Schließlich ergriff Aaron wieder das Wort: „Ich verstehe, was Ihr meint, Lord Sheriff. Und natürlich birgt es auch Nachteile, wenn man in einer Stadt wie Nottingham hinter abgeschlossenen Mauern lebt. Aber wir haben im Ältestenrat lange darüber gesprochen, und ich sehe keine andere Lösung.“
Robin dachte immer noch nach, und als er schließlich sprach, sah er den jüngsten der drei Männer an: „Was haltet ihr davon, wenn ich einen Trupp zusammenstelle, der abends die Gassen des Judenviertels patrouilliert und bewacht? Ein Trupp, der zur Hälfte aus meinen Soldaten und zur Hälfte aus wehrhaften Männern aus eurem Viertel besteht?“
Tobias sah ihn überrascht an, dann musste er unwillkürlich lachen: „Und unsere Männer tragen dabei Holzstöcke in der Hand, mit denen sie den Störenfrieden Angst einjagen, oder wie stellt Ihr Euch das vor? Habt Ihr vergessen, dass es uns Juden nicht erlaubt ist, Waffen zu tragen?“
Nun war es an Robin, überrascht zu sein. „Tatsächlich? Das habe ich wirklich nicht gewusst. Verbietet es euch eure Religion?“
Obadiah warf ein: „So wie es euch Christen eure Religion verbietet, denn handelt ihr nicht auch nach den Zehn Geboten, in denen es heißt: Du sollst nicht töten?“
Robin sah den Alten an und seufzte insgeheim. Er hatte natürlich Recht mit dem, was er sagte, aber theologische Streitgespräche gehörten nicht gerade zu seinen Stärken.
„Darf ich dazu etwas sagen, Sir Robin?“, mischte sich Edmund, der Schreiber, ein, der die ganze Zeit im Hintergrund gestanden hatte, Feder und Pergament griffbereit, falls er gebraucht werden sollte um etwas zu dokumentieren.
„Bitte!“ Robin war erleichtert. Als ehemaliger Mönch wusste Edmund sicher eine passende Antwort.
Edmund räusperte sich und sagte: „Die Gelehrten streiten seit jeher darüber, ob ein Christ Waffen tragen darf oder nicht, doch in diesem Fall liegt die Antwort woanders. Der Sheriff von Nottingham hat einen Erlass herausgegeben, der es den Juden untersagt, Waffen zu tragen.“
Nun war Robin erst recht verwundert: „Wann soll ich das erlassen haben?“
Edmund schüttelte den Kopf: „Nicht Ihr, Sir, das war bereits vor über zwanzig Jahren, als Sir Richard of Huntingdon Sheriff war.“
Robin, der schon an seinem Verstand gezweifelt hatte, fragte seinen Schreiber: „Gibt es eine Möglichkeit, diesen Erlass aufzuheben?“
„Das kann ich nachprüfen. Wenn er nicht vom König oder dem Bischof ausging, sondern nur vom Sheriff unterzeichnet ist, sehe ich nicht, warum Ihr den Erlass als dessen Nachfolger nicht ändern könntet.“
Robin nickte Edmund zu: „Danke, Edmund. Überprüfe das, sobald du Zeit dafür findest!“ Und zu den Juden gewandt fuhr er fort: „Sollte es möglich sein, dieses Verbot rückgängig zu machen, wärt ihr dann mit meinem Vorschlag einverstanden?“
Die drei berieten sich kurz in ihrer Sprache untereinander, dann sagte Obadiah: „Wir müssen das zuerst im Ältestenrat besprechen.“
Robin nickte und erhob sich: „Dann kommt doch nächste Woche wieder her. Bis dahin habe ich die Sache mit dem Erlass geklärt und ihr könnt mir sagen, wie eure Gemeinde zu dem Vorschlag steht. Gehabt euch wohl.“
Die drei erhoben sich ebenfalls und verabschiedeten sich mit ehrerbietigen Verbeugungen.
„Ich werde schon jetzt meine Wachen darauf hinweisen, ein Auge auf Randalierer in eurem Viertel zu haben!“, versprach Robin den dreien noch, dann schloss sich die Tür hinter ihnen.
Robin atmete tief durch. Als er sich umdrehte, sah er Edmund hinter sich stehen, der ihn beobachtete. Robin grinste ihn an: „Danke, dass du mir aus der Patsche geholfen hast!“
Edmund grinste zufrieden zurück: „Das ist gern geschehen! Ihr habt die Juden sehr beeindruckt, glaube ich.“
Robin zuckte die Achseln und griff nach seinem Becher, den er noch unberührt auf dem Tisch stehen sah.
„Mich übrigens auch!“, hörte er da Marians Stimme. Als er sich umdrehte, war sie schon bei ihm, umarmte ihn und gab ihm einen Kuss. „Ich hab ein wenig gelauscht!“ Robin zog sie an sich. Ihm war sofort wieder eingefallen, dass er heute die Mittagszeit hatte nutzen wollen, einmal mit seiner Frau ein paar Stunden allein zu sein. „Hast du gerade Zeit?“, fragte er.
„Kommt darauf an wofür!“, sagte sie mit einem neckischen Lächeln.
„Wir könnten ein bisschen ausreiten, in den Wald oder zum Flusstal…“
„Oja! Daran hab ich auch schon gedacht!“ Marian sah ihm sehnsüchtig in die Augen. „Lass uns sofort verschwinden, ehe wieder jemand kommt und etwas von dir will!“
„Gut, aber ich muss noch…“ Der kleine Junge, der unten in einer Zelle saß und auf sein Schicksal wartete, war ihm wieder eingefallen. Schnell erzählte er Marian davon.
Sie sah ihn einen Moment an, dann sagte sie: „Weißt du, ich glaube es schadet nicht, wenn er noch eine Weile warten muss. Ihm passiert ja nichts weiter, und vielleicht ist er sogar eher bereit, mit dir zusammenzuarbeiten, wenn du ihn jetzt ein wenig schmoren lässt.“
Robin dachte kurz darüber nach und nickte dann. Er machte sich von Marian los und trank schnell den Becher leer, dann griff er ihre Hand und sie liefen gemeinsam zum Stall.
Sobald die dämmrige Kühle des Sherwood Forest sie umgab, schien es Robin als fiele alle Last von ihm ab. Er konnte wieder freier atmen und alle Gedanken an die große, stinkende Stadt mit ihren Problemen und Abgründen abschütteln. Marian war an seiner Seite. Sie summte leise eine Melodie vor sich hin, die Sonne, die hier und da durch das Blätterdach fiel, ließ ihr Haar aufleuchten, und Robin fühlte sich um Jahre zurückversetzt, als er an den Moment dachte, in dem Marian um die Biegung im Flusstal geritten kam und er sie seit langer Zeit wiedergesehen hatte. Er war von ihrer Schönheit ganz verzaubert gewesen, und das war er bis heute.
Als sie das Flusstal erreichten, stiegen sie ab, ließen die Pferde grasen und gingen Hand in Hand den Fluss hinauf.
„Willst du zu Alans und Emmas Grab?“, fragte Marian.
Robin schüttelte den Kopf. „Heute nicht.“
„Wir müssen Alan bald einmal mit dorthin nehmen und ihm von seinen wahren Eltern erzählen“, meinte Marian. Robin blieb stehen und sah sie erschrocken an: „Meinst du wirklich, dass er schon alt genug dafür ist?“
„Er wird bald zehn Jahre“, sagte Marian achselzuckend.
„Und es wird nicht leichter, nur weil wir es länger vor uns herschieben.“
Sicher, damit hatte sie natürlich Recht. Aber Robin kam es so vor als sei es erst gestern gewesen, als sie ein winziges Neugeborenes aus diesem Flusstal heraustrugen. Sie hatten Alan a’Dales und Emmas Sohn von Anfang an geliebt wie ein eigenes Kind, und Robin hatte Angst davor, Alan die Wahrheit zu sagen, denn er wollte den Kleinen nicht verlieren.
„Ach Robin, Alan wird dich immer wie einen Vater lieben! Er hätte keinen besseren haben können! Mach dir keine Sorgen!“
Robin nickte. Seine Gedanken waren aber schon ganz andere Wege gegangen. Emma war nach Alans Geburt gestorben, am Kindbettfieber, wie ihnen Bruder Tuck erklärt hatte. Auch Marian wäre beinahe daran gestorben, erst vor ein paar Monaten. Und damit war er bei dem Problem angelangt, das er mit ihr besprechen wollte.
Robin entdeckte einen weichen, sandigen Platz am Ufer des kleinen Flusses. Sie setzten sich auf Robins Umhang, Marian schmiegte sich an ihn und Robin legte ihr einen Arm um die Schultern.
„Erzähl mir von der Geburt des Fohlens heute Nacht!“, bat Marian.
Robin schaute auf das sonnenbeschienene, glitzernde Wasser, doch er sah es nicht. Er fing an zu erzählen, doch in Gedanken war er weit weg, bei einer der schrecklichsten Winternächte seines Lebens.
Der Schneesturm war über Nottingham hereingebrochen, als sei das Ende der Welt gekommen. Die finsteren Wolken hatten schon den Tag zur Nacht gemacht, doch als es um Mitternacht immer noch um die Türme heulte und pfiff, als wären die Wiedergänger draußen unterwegs, konnte ich mehrere der Bediensteten dabei beobachten, wie sie sich heimlich bekreuzigten. Am liebsten hätte ich sie deshalb zurechtgewiesen, ich konnte ihr abergläubisches Gehabe nicht länger ertragen. Doch die Angst schnürte mir die Kehle zu.
Kaum einer schlief in dieser Nacht, wie auch in den Nächten zuvor, ich konnte mich kaum noch erinnern wie viele es waren, seit Marian unseren Sohn geboren hatte und nun blutend und schwach im Fieber lag. Aber irgendwann würde es aufwärts gehen, die Hebamme hatte gesagt, dass es sich bald entscheiden würde, und dann würde das Fieber wieder sinken und Marian zu Kräften kommen. Dessen war ich mir ganz sicher.
Als ich die Hebamme bemerkte, die gerade aus dem Vorraum zu unserer Schlafkammer kam, setzte mein Herz einen Moment aus und ich musste mich mit der Hand an der Mauer abstützen, weil meine Welt zu wanken schien. Das Gesicht der Hebamme war aschfahl, völlig reglos. Meine Sicherheit zerbröselte mit einem Schlag zu Staub.
Nach einer Weile, die mir wie eine Ewigkeit vorkam, fand ich den Mut zu fragen: „Ist sie… ist Marian tot?“
„Das Fieber sinkt nicht, und… Eure Frau hat keine Kraft mehr, my Lord. Ich… ich kann nichts mehr für sie tun. Es geht zu Ende.“
Ich schüttelte heftig den Kopf. Marian hatte keine Kraft mehr? Das war doch lächerlich.
„Ich habe die Magd nach einem Priester geschickt, my Lord. Ihr könnt jetzt zu ihr, wenn Ihr wollt.“
Immer noch schüttelte ich den Kopf. Ein Priester? Was für eine sinnlose Idee, was sollte Beten denn jetzt noch nützen? Es musste doch irgendetwas geben, was ich tun konnte!
Plötzlich fiel es mir ein: Es gab nur einen Priester, genauer gesagt, einen Mönch, der jetzt noch helfen konnte. Ohne einen weiteren Gedanken an die Hebamme zu verschwenden drehte ich mich um und rannte die steile Wendeltreppe hinunter.
„Aber, my Lord, wollt Ihr jetzt nicht bei ihr bleiben? Ihr solltet Abschied nehmen!“ Die Stimme der Hebamme hallte schrill im Treppenhaus nach.
Unten in der Halle begegnete mir Edmund. Er brauchte nur einen Blick in mein Gesicht um zu wissen, dass ich etwas Unvernünftiges tun würde.
„My Lord! Was ist geschehen?“
Ich rannte an ihm vorbei zur Tür, doch er stellte sich mir in den Weg.
„Sir Robin, ihr könnt nicht dort hinaus! Der Sturm! Und es ist eisig kalt!“
Einen kurzen Augenblick hielt ich inne, aber nur um Edmund an der Schulter zu packen: „Die Hebamme will einen Priester. Ich hole den einzigen, der Marian helfen kann. Ich reite zu Bruder Tuck. Und niemand wird mich daran hindern!“
Damit schob ich ihn zur Seite und öffnete die Hallentür.
Draußen erwartete mich die Hölle. Wie vermutlich jeder Christ hatte ich sie mir immer heiß, stickig und glühend rot vorgestellt. Doch ihre Flammen waren eisig kalte Schneeböen, der Teufel war der Sturm, dessen Augen hin und wieder Blitze schleuderten, seine Arme versuchten mich umzustoßen, und seine Klauen, der knietiefe Schnee am Boden, saugten sich an meinen Füßen fest und machte das Gehen fast unmöglich.
Irgendwie schaffte ich es zum Stall, irgendwie ließ sich Follow, das einzige Pferd, das mir überallhin bedingungslos folgen würde, dazu überreden, mit mir in diese weißgraue Hölle hinauszureiten.
Zuerst dachte ich, ich würde es niemals bis Hampstead Abbey schaffen können. Es war viel zu kalt, der Schnee lag viel zu hoch und der Wind stemmte sich uns mit solcher Kraft entgegen, dass Follow kaum vorwärts kam. Nach einer Ewigkeit erreichten wir jedoch den Sherwood Forest, und hier wurde es besser. Die Bäume fingen den Wind ein wenig ab, der Schnee lag nicht ganz so tief, und als ich die Straße verließ, um auf einem der kleineren Pfade eine Abkürzung zu machen, konnte Follow im dichteren Wald sogar im Trab gehen.
Als ich mich nach Stunden, in denen mich nur die panische Angst, Marian zu verlieren, aufrecht hielt, dem Waldrand näherte, hatte sich der Wind fast gelegt. Im aufkommenden Tageslicht konnte ich die Schneeflocken erkennen, die immer noch so dicht fielen, dass Follows Ohren das letzte waren, was ich vor mir sehen konnte.
Dennoch, es konnte nicht mehr weit sein bis Hampstead, ich meinte sogar, das leise Läuten der Glocke, die die Mönche zum Gottesdienst rief, hören zu können, jetzt wo endlich nicht mehr das Heulen des Windes jedes andere Geräusch fortriss. Ich stieg ab und kämpfte mich mit meinem Pferd am Zügel durch hüfthohe Schneewehen, bis ich vor der Pforte stand.
Mit Fäusten hämmerte ich gegen das Holztor und ließ nicht ab, bis meine Finger bluteten. Schmerzen spürte ich dabei nicht, die Finger waren blaugefroren und taub.
Endlich hörte ich Geräusche, offenbar räumte jemand den Schnee, der sich von drinnen gegen das Tor türmte, mit einer Schaufel weg.
Der Bruder Pförtner öffnete schließlich die kleine Klappe und streckte sein verschlafenes Gesicht heraus. Er wollte sicher eine Rüge ob dieser ungeduldigen Störung aussprechen, doch ich kam ihm zuvor.
„Holt Bruder Tuck. Es geht um Leben und Tod!“
Der Pförtner machte ein verständnisloses Gesicht.
„Beeilt Euch! Wir müssen nach Nottingham, so schnell es geht!“
„Nach Nottingham? Bei diesem Wetter? Seid Ihr noch ganz bei Trost?“
Da war meine Geduld zu Ende. Ich griff durch die Luke, erwischte eine handvoll Kutte und die Kreuzkette des Bruders und zog ihn ein Stück näher zu mir heran: „Ich bin der Sheriff von Nottingham,“ zischte ich, „und Ihr holt jetzt auf der Stelle Bruder Tuck. Meine Frau braucht seine Hilfe. Er soll seine Medikamente mitnehmen und Ihr lasst ihm einen Maulesel satteln. So schnell Ihr könnt. Habt Ihr mich verstanden?“
Erschrocken nickte der Mönch, und als ich ihn losließ, verschwand er schleunigst aus meinem Sichtfeld.
Es kam mir vor wie eine halbe Ewigkeit, die ich an das Tor gelehnt auf Bruder Tuck warten musste. Gnadenlos zeigte mir mein inneres Auge nun die Bilder, denen ich während der letzten Stunden der Anstrengung entkommen konnte: Marian, wie sie schrie und kämpfte um unseren kleinen Sohn auf die Welt zu bringen, ihr erschöpftes aber glückliches Gesicht, als er in ihren Armen lag. Marians bleiches, teilnahmsloses Gesicht, die eingesunkenen Augen, als das Blut kam und das Fieber. Was, wenn Bruder Tuck auch nichts mehr für sie tun konnte? Was, wenn wir zu spät kamen? Dann hätte ich sie in ihren letzten Stunden allein gelassen, würde keinen Abschied mehr von ihr nehmen können, ihr sagen, wie sehr ich sie liebte, dass ich ohne sie nicht leben konnte, wollte…
Als sich das Tor schließlich öffnete, fiel ich beinahe in den Schnee. Bruder Tuck stützte mich, und ich sah erleichtert, dass er bereits in dicke Mäntel gehüllt war und einen Maulesel am Zügel führte.
„Was ist geschehen?“, fragte er. „Ist etwas bei der Geburt schief gegangen? Wenn ich mich nicht täusche, müsste Marian in diesen Tagen entbinden.“
Ich schüttelte den Kopf: „Ich erzähle dir alles auf dem Weg. Wir dürfen keine Zeit verlieren!“
Tuck nickte, dann reichte er mir ein dunkles Wollbündel: „Du solltest den Mantel anziehen, sonst habe ich in Nottingham gleich zwei sterbenskranke Patienten!“
Wortlos warf ich mir den dicken Wettermantel um und stieg auf mein Pferd.
Wir kamen einigermaßen gut voran, das Unwetter war weitergezogen, auch der Schneefall hatte nachgelassen. Dass die Sonne ab und zu durch die Wolken kam und mit ihren Strahlen eine märchenhafte Winterwelt beleuchtete, kam mir wie Hohn vor.
Bruder Tuck war sehr still geworden, als er meinen Bericht gehört hatte.
„Du hättest mich früher holen lassen sollen.“
Das war alles, was er dazu sagen wollte.
Ja, warum hatte ich das nicht getan? Noch vor wenigen Tagen schien meine Welt in Ordnung gewesen zu sein, ich hatte der Hebamme geglaubt, dass sie alles im Griff hatte, dass das alles nichts Ungewöhnliches nach einer schweren Geburt war. Dann hatte es tagelang gestürmt und geschneit. Niemand war auf den Gedanken gekommen, die Burg zu verlassen, schon gar nicht so einen weiten Weg durch den Sherwood Forest zurückzulegen. Wenn wir jetzt zu spät kamen, würde ich mir das niemals verzeihen können.
Als wir Nottingham erreichten, lag eine seltsame Stille über der Burg. Alle Gespräche waren gedämpft, man warf mir nur mit gesenkten Augen mitleidige Blicke zu, und sogar Geoffrey de Staunton, der mir in der Halle über den Weg lief, verkniff sich eine seiner üblichen spöttischen Bemerkungen. Aber all das nahm ich nicht richtig wahr. Auch wenn ich so erschöpft war, dass ich mich kaum mehr auf den Beinen halten konnte, nahm ich zwei Stufen gleichzeitig und stürmte mit Bruder Tuck im Schlepptau in Marians Zimmer. Dort war alles dunkel, Kerzen standen um das Bett, in dem reglos eine schmale, blasse Gestalt lag, kaum zu erkennen unter dem riesigen weißen Laken. Ich blieb an der Schwelle stehen, als wäre ich gegen eine durchsichtige Wand gelaufen.
„Zu spät. O mein Gott, wir sind zu spät!“
Bruder Tuck drängte sich an mir vorbei und schüttelte den Kopf, als er eilig auf das Bett zu ging.
„Noch nicht, mein Sohn. Nutze deinen Kopf, sonst bist du hier keine Hilfe. Sie atmet, das siehst du doch.“
Ich schluckte und sah genauer hin. Tatsächlich, nahezu unmerklich hob und senkte sich das Laken über Marians Brust.
Die folgenden Tage vergingen so langsam, jede Stunde kam mir vor wie ein ganzer Tag, und während Bruder Tuck blutstillenden Sud kochte, fiebersenkende Medikamente verabreichte, Marians Unterbauch massierte oder einfach nur bei ihr saß und ihren Puls fühlte, hatte ich Zeit, in all der Untätigkeit der Angst Raum zu geben, die sich in mein Herz fraß. Für Alan und Edith, die kleine Gytha und den Säugling bei seiner Amme hatte ich kaum Trost, wusste nicht, wie ich ihnen die Angst nehmen sollte, die sie in meinen Augen lasen. Die Vorstellung, den Rest meines Lebens ohne Marian an meiner Seite verbringen zu müssen, machte mich völlig teilnahmslos.
Als dann nach fünf durchwachten Nächten schließlich Bruder Tuck aus der Tür der Schlafkammer trat und sagte „Geh zu ihr, mein Sohn. Sie braucht dich jetzt“, war ich sicher, dass sie endgültig im Sterben lag.
Mit letzter Kraft riss ich mich zusammen, ging zu ihr und kniete mich neben dem Bett in die Binsen. Vorsichtig ergriff ich ihre Hand. Sie war kühl und schlaff. Reglos lag Marian da, als würde sie die Berührung gar nicht wahrnehmen. Nichts als Marians ruhige tiefe Atemzüge waren zu hören. Ich weiß nicht wie lange ich da kniete und Marian mit tonloser Stimme anflehte, bei mir zu bleiben, mich nicht allein zu lassen. Doch irgendwann merkte ich, dass das nicht das Ende war. Ja, ihre Hand war kühl, doch das bedeutete, dass sie kein Fieber mehr hatte! Sie lag reglos und schlaff da, doch sie atmete tief und gleichmäßig, weil sie schlief, ruhig und entspannt, ein erholsamer Schlaf, der endlich Heilung bringen konnte! Gerade als ich das begriffen hatte und wieder zu hoffen wagte, kam Bruder Tuck wieder herein, lächelte mich fröhlich an und legte das in eine Decke gewickelte Bündel, das er bei sich trug, in Marians Arme.
„Es wird ihr guttun, ihr Kind bei sich zu haben, auch wenn sie schläft. Wie heißt er eigentlich, euer Sohn?“
„Als das Kleine dann da im Stroh lag, hat es sich erst nicht bewegt und ich dachte schon, es sei tot. Aber dann haben wir es mit Stroh abgerieben und die Stute hat ihm die Nüstern abgeleckt, und irgendwann war es kräftig genug um seine Beinchen zu sortieren und aufzustehen“, schloss Robin seinen Bericht.
Marian nahm Robins Hand und zeichnete die Linien seiner Handfläche nach. Dann küsste sie die Innenseite seiner Finger und der Hand. Robin schloss die Augen und schluckte mühsam. Dann zog er seine Hand weg. Sie ahnte nichts von seinen Gedanken, und er wusste nicht recht, wie er es anfangen sollte. „Emma ist damals am Kindbettfieber gestorben, das hat Bruder Tuck gesagt.“
Mit einem kleinen, enttäuschten Seufzer setzte Marian sich auf und sah Robin von der Seite an. Er sah schrecklich ernst aus. „Ich weiß. Das ist keine Seltenheit!“
„Eben!“ Robin drehte sich ruckartig zu ihr um und sah ihr beinahe verzweifelt in die Augen. „Nach Edrics Geburt, Marian, da wärest du beinahe gestorben, tage- und nächtelang hatte ich Angst, dass du nie wieder die Augen aufmachst. Marian, ich könnte ohne dich nicht leben, und ich will es auch gar nicht!“
Marian sah ihn an. „Ich hab es doch überlebt, Robin, es ist ja wieder alles gut!“
„Aber was ist, wenn du wieder schwanger wirst, wenn die nächste Geburt noch schwieriger wird und du wieder Fieber bekommst? Ich will dich nicht verlieren, Marian, um nichts in der Welt!“ Endlich war es heraus.
Das war es also, begriff Marian, darum fielen Robin immer die seltsamsten Ausreden ein, damit er nicht gleichzeitig mit ihr zu Bett gehen musste; darum brach er Küsse oder Zärtlichkeiten abrupt ab, fast so wie früher, als sie noch im Sherwood gewesen waren und er meinte, sie nicht lieben zu dürfen. Nur hatte er es diesmal geschafft, mit ihr zu reden, bevor die angestauten Gefühle sich in irgendetwas entluden, das keiner von ihnen so recht wollte.
Marian sah Robin tief in die Augen. „Ich liebe dich so sehr, Robin.“ Doch dann konnte sie auch ein kleines Grinsen nicht mehr unterdrücken und sagte spitzbübisch: „Weißt du, ich muss nicht schwanger werden, wenn ich es nicht will.“
Und bei dem dummen Gesicht, das Robin jetzt machte, musste sie einfach laut lachen, ob sie wollte oder nicht. Robin war überhaupt nicht zum Lachen zumute. „Was soll das heißen?“
„Das soll heißen, dass ich weiß wie ich verhindern kann, schwanger zu werden. Und zwar nicht, indem du mich nie wieder anrührst“, sagte Marian geheimnisvoll.
„Ach ja? Ist das so ein Altweiberzauber, bei dem man irgendwelche Amulette oder Kräuter unters Kopfkissen legt und Sprüche darüber spricht? Auf so etwas mag ich mich nicht verlassen müssen.“
Marian fand das Gespräch eigentlich ziemlich lustig, doch sie merkte, dass Robin gerade überhaupt keinen Sinn für Humor hatte, und so erklärte sie ihm, dass es bestimmte Tage gab, an denen es ungefährlich war, miteinander zu schlafen.
Robin sah sie mit zweifelndem Gesichtsausdruck an, als sie geendet hatte. „Ehrlich gesagt klingt das für mich immer noch nach Altweiberzauber…“
„Ist es aber nicht. Sogar Bruder Tuck weiß darüber Bescheid!“
Robin musste nun doch lachen: „Bruder Tuck? Was weiß denn ein Mönch von solchen Dingen?“
„Offensichtlich mehr als du! Oder glaubst du, die edlen Damen, die ihn zu sich rufen, haben immer nur Kopfschmerzen?“
Robin schwieg. Wenn er darüber nachdachte, kam es ihm doch nicht mehr so abwegig vor. Seine Gedanken gingen zurück zur Pferdegeburt von heute Nacht. So eine Stute war ja auch nicht immer rossig… Wahrscheinlich hatte Marian Recht und es gab so eine Lösung für ihr Problem. Frauen waren eben doch ein einziges großes Geheimnis…
Mit einem Mal schien es ihm, als würde er Marians Liebkosungen noch immer auf seiner Hand spüren. Er zog seine Frau an sich und flüsterte ihr ins Ohr: „Ist heute zufällig einer der Tage, an denen nichts passieren kann?“
Marian grinste und überlegte einen Augenblick. Dann schüttelte sie bedauernd den Kopf. „Nein, leider nicht. Im Gegenteil. Wir müssten bis Ende der Woche warten.“ Robin seufzte. Aber dann tröstete er sich damit, dass er nun schon so lange gewartet hatte, dass es auf ein paar Tage mehr oder weniger auch nicht mehr ankam.
A ls Robin am nächsten Morgen aufwachte, hörte er, wie draußen der Regen vom Himmel prasselte. Schon gestern am späten Nachmittag, als sie aus dem Sherwood zurückgekehrt waren, hatte es zu regnen begonnen. Sie waren tropfnass auf der Burg eingetroffen, und die Kinder hatten einen großen Spaß daran gehabt, in den Pfützen herumzupatschen, die ihre triefende Kleidung auf dem Steinboden hinterließ.
Später war Robin noch hinunter in den Kerker gegangen, um mit dem kleinen Dieb zu sprechen.
Er hasste diesen Ort noch immer, und er ging nie ohne eine Fackel oder Öllampe hinunter. Schon der modrige Geruch, der ihm auf der Treppe entgegenschlug, verursachte ihm Übelkeit. Wie es der Zufall wollte, hatte der Soldat den Jungen genau in der Zelle untergebracht, in der er vor langer Zeit selbst eingesperrt gewesen war, Tage und Nächte ohne Licht, Essen und Ansprache. Nichts, an das er gerne erinnert werden wollte. Als ihm der Wachmann die Tür aufschloss, wies er ihn an, sie offen zu lassen und davor stehen zu bleiben.
Der Junge kauerte in einer Ecke und hatte die Arme um die Knie geschlungen. Er war unfassbar dürr, die Knie und Ellenbogen standen spitz hervor. Als sich die Tür öffnete, blickte er ängstlich auf und kniff die Augen zusammen, weil ihn das Licht blendete.
Robin steckte die Fackel in eine Halterung neben der Tür und ging eine Armlänge von dem Kleinen entfernt in die Hocke.
„Wie heißt du?“, fragte er den Jungen vorsichtig.
Der Kleine schwieg.
„Und wie alt bist du?“
Wieder keine Antwort.
„Hör mal, Junge, ich bin der Sheriff von Nottingham, und du musst mit mir reden, wenn ich dir helfen soll!“
Noch immer gab der Kleine nichts von sich, stattdessen suchten seine Augen nach einer Möglichkeit zu entkommen.
Robin seufzte. Der Junge war völlig verängstigt, aber Robin hatte das Gefühl, dass er sich gar nicht in erster Linie vor ihm fürchtete. Wer wusste schon, was ihm in seinem kurzen Leben widerfahren war, und was dahintersteckte, dass er zum Dieb geworden war.
„Mein Stellvertreter, der große böse Kerl, den du heute Morgen schon gesehen hast, möchte dir die Hand abhacken lassen“, sagte Robin. „Ich dagegen finde, du hättest noch eine Chance verdient. Aber du musst schon mit mir reden, wenn ich mich für dich einsetzen soll!“
Der Junge sah ihn jetzt mit großen Augen an. Die Erinnerung an die Strafe, die ihm drohte, schien gewirkt zu haben, denn er sagte jetzt leise: „Graham. Und ich bin zwölf.“
Robin hätte nicht gedacht, dass der Junge älter war als Alan. Aber wahrscheinlich hatte er in seinem ganzen Leben noch nie genug zu essen gehabt, da konnte er nicht groß und stark werden.
„Wo sind deine Eltern, Graham?“
Der Junge schaute zu Boden und zuckte mit den Achseln: „Weiß nicht.“
„Stiehlst du für dich selbst? Oder gibt es jemanden, der dich schickt?“
Ohne aufzusehen antwortete er fast unhörbar: „Für mich selbst!“





























