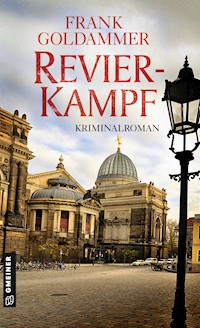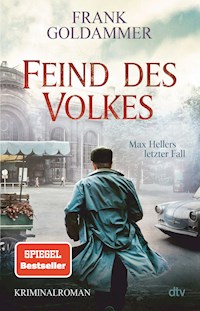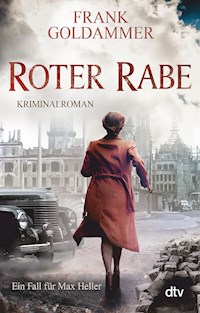
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG
- Kategorie: Krimi
- Serie: Max Heller
- Sprache: Deutsch
Spion im eigenen Land Im Spätsommer 1951 kehrt Oberkommissar Heller mit seiner Familie aus dem staatlich genehmigten Ostseeurlaub nach Dresden zurück. Für seine Frau Karin geht die Fahrt gleich weiter, denn sie hat überraschend die Reiseerlaubnis in den Westen zu Sohn Erwin erhalten. Heller ist besorgt. Doch sein neuer Fall lässt ihm keine Zeit zum Grübeln: Zwei unter Spionageverdacht stehende Männer, Zeugen Jehovas, sterben in ihren Gefängniszellen. Und es geschehen weitere mysteriöse Todesfälle. Bei einem der Opfer wird eine geheimnisvolle Botschaft gefunden: »Eine Flut wird kommen.« Heller beschleicht eine schreckliche Ahnung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 453
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Frank Goldammer
Roter Rabe
Kriminalroman
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
8. September 1951, Nachmittag
Es war still im Zugabteil. Heller war erschöpft und müde. Seine Glieder fühlten sich taub und schwer an. Das rhythmische Klack-Klack der Eisenbahnräder untermalte die Stille, nur unterbrochen vom metallischen Quietschen in den Kurven. Heller konnte nicht schlafen. Mit brennenden Augen starrte er aus dem Fenster.
Karin saß ihm gegenüber. Annis Kopf lag in ihrem Schoß und sie kraulte das schlafende Kind hinter dem Ohr. Die anderen Passagiere im Abteil, Herr und Frau Kramer aus Radebeul und ein stiller Mann in Zivil, der sich nicht vorgestellt hatte, dösten. Die lange Fahrt, die Wartezeiten in Berlin, die ewigen Kontrollen und der Umweg über Potsdam hatten sie allesamt so ermüdet, bis sogar die ewig lamentierenden Kramers verstummt waren. Sie waren jetzt schon acht Stunden unterwegs, und die Fahrt war noch lange nicht zu Ende.
Obwohl der Zug langsam fuhr, verwischte vor Hellers Augen die Welt. Er war zu müde, um seinen Blick zu fokussieren. Der Schatten des Waggons begleitete ihn, huschte über Gräser, Büsche und Häuser hinweg und wurde größer, je länger die Fahrt andauerte. Heller hatte den Kopf an die Scheibe gelehnt, was sonst gar nicht seine Art war. Seit ein paar Tagen war er in einer seltsamen Stimmung, eigentlich schon seit Beginn ihrer Reise an die Ostsee.
Sehr überraschend war Niesbachs Offerte gekommen, zehn Tage Urlaub in einem FDGB-Heim in Ahrenshoop anzutreten. Er sollte das als eine Belobigung betrachten, hatte der Chef der Kripo ihm zu verstehen gegeben, für seine Verdienste beim Aufbau der DDR und des Sozialismus. Heller hatte das mit keinem Wort kommentiert. Der wahre Grund blieb natürlich unausgesprochen. Niesbach wusste, dass Heller sich zu einem Parteibeitritt weder erpressen noch locken lassen würde. Er selbst schien es aufgegeben zu haben, Heller zu drängen, aber sicherlich wurde er von höherer Stelle weiterhin genötigt, es zu versuchen.
Karin, die seit einem Jahr als Schreibkraft bei den Sachsenwerken arbeitete und seitdem auch Mitglied des FDGB war, hatte problemlos Urlaub bekommen. Auch das, wusste Heller, war das Werk der SED. Vermutlich hatte ein Anruf bei ihrem Abteilungsleiter oder der Kaderleitung genügt. Pflegetochter Anni sollte erst nächstes Jahr eingeschult werden. Zum einen war man sich wegen ihres Alters nicht sicher, zum anderen galt sie noch immer als sehr still und zurückgezogen.
Heller hatte dem Urlaub zugestimmt. Seiner Frau und dem Mädchen zuliebe.
Karin nestelte an ihrem Rucksack und zog etwas hervor. Heller starrte unverwandt aus dem Fenster und ließ seinen Blick über die Felder streichen. Er wusste nicht genau, wo sie sich jetzt befanden. Königs Wusterhausen lag schon hinter ihnen. Zwischen den zerstörten Städten Rostock, Berlin und Dresden war es, als hätte es nie Krieg gegeben. Auf den abgeernteten Äckern sah man immer wieder Menschen, die sich nach einzelnen Ähren bückten oder Kartoffeln aufklaubten.
»Magst du?«, fragte Karin und hielt Heller die Trinkflasche entgegen. Er sah kurz auf und schüttelte den Kopf. Anfangs hatte es geheißen, ein Mitropa-Wagen sei angehängt, doch das hatte sich als Trugschluss erwiesen. Beim letzten Halt vor Berlin hatte er die Blechflasche noch einmal mit Wasser füllen können. Während der Gepäck- und Passkontrollen in Berlin war es ihnen verboten gewesen auszusteigen. Seinen Pass und den des stummen Mannes hatten sie besonders sorgfältig kontrolliert. »Als ob wir Verbrecher wären«, hatte Frau Kramer gemurmelt, als sie wieder allein im Abteil waren.
Karin schraubte die Flasche auf und trank direkt daraus. Heller beobachtete sie dabei. Ihr blondes Haar war in der Sonne heller geworden und sie hatte Farbe im Gesicht bekommen. Karin blickte auf, fühlte sich ertappt, lachte und verschluckte sich beinahe.
»Es schlafen doch alle«, entschuldigte sie sich flüsternd für ihr Verhalten.
Heller schüttelte kurz den Kopf. Deshalb hatte er sie nicht angesehen.
»Hoffentlich hat sie etwas zu essen da, wenn wir daheim sind«, flüsterte Karin weiter.
»Bestimmt«, erwiderte Heller, obwohl ihm gerade gar nicht zum Sprechen zumute war.
»Hoffentlich hat sie das Haus nicht abgebrannt«, fügte Karin halb scherzend und halb ernsthaft hinzu. Frau Marquart war seit einiger Zeit ihre größte Sorge. Sämtliche Nachbarn hatte Karin vor ihrer Abreise instruiert, nach der alten Dame zu sehen, in deren Haus sie nach wie vor wohnten und die so vergesslich geworden war in den letzten zwei Jahren. So rapide hatte sich deren Zustand verschlechtert, dass sie manchmal vergaß, einen Satz zu beenden oder die Milch vom Herd zu nehmen, oder sie trank ihren Tee kochend heiß, was sie nicht einmal zu spüren schien.
»Ich habe noch so viel zu tun, wenn wir angekommen sind«, stöhnte Karin. Doch ihrem Gesicht war anzusehen, dass die Unternehmungslust sie gepackt hatte. Heller spürte die Veränderung seiner Frau mit jeder Faser. So viele Jahre hatte sie sich aufgeopfert, erst für die Jungen, dann im Krieg, der keinen Raum gelassen hatte für Individualität, dann in den schweren Jahren danach. Doch seit einigen Wochen schien sie zu glühen. Ihr Gesicht leuchtete und sie war förmlich aufgeblüht, wie Heller sie zuletzt an dem Tag erlebt hatte, als es hieß, der Krieg sei zu Ende.
Dabei drohte längst wieder der nächste Krieg. Seit einem Jahr kämpften die Amerikaner in Korea, und jeder wusste, dass die Sowjets die Kommunisten dort mehr als nur unterstützten, auch wenn sie es nicht offen taten. Der Ton zwischen den ehemaligen Alliierten war seit der Währungsumstellung und der Berlinblockade noch schärfer, die Bedrohungen immer realer geworden. Die Fronten zwischen der DDR und der BRD waren völlig verhärtet, und man warf sich gegenseitig vor, an der Teilung Deutschlands Schuld zu haben.
Man hatte es an den Kontrollen bemerkt. Als Polizist war es ihm seit einiger Zeit verboten, Westberliner Boden zu betreten. Auslöser dafür war der Zwischenfall mit ein paar Funktionären vom Kulturbund, die nur dreihundert Meter über Westberliner Gelände abgekürzt hatten. Sie waren von der Westberliner Polizei aufgegriffen, die mitgeführten Akten konfisziert worden. Nun konnten sie nicht zurück in die DDR, denn ihnen drohte hier der Prozess wegen Spionage und Boykotthetze. Die Regierungen waren nervös, die Nerven zum Zerreißen gespannt. Jederzeit konnte der noch fern ausgetragene Konflikt zwischen den Großmächten auf deutschen Boden überschwappen und in einem Krieg ausgefochten werden, der entscheiden sollte, wer die Welt beherrschte, und als dessen Ergebnis einzig die totale Vernichtung Deutschlands sicher schien.
»Es wird schon alles gut sein«, beruhigte Heller eher sich selbst als Karin. Er zwang sich, nicht schwarzzusehen, und beschwor seinen Glauben an den klaren Menschenverstand, der sich der Konsequenzen eines Atomkrieges schon bewusst sein würde.
Karin nickte und sah für einen Moment aus dem Fenster.
»War das nicht schön?«, seufzte sie unvermittelt. »Wer hätte gedacht, dass das Wetter so herrlich wird. Und der Strand, fast nur für uns. Anni hat in den vergangenen Tagen mehr gesprochen als in den letzten beiden Jahren zusammen. So gelöst war sie.«
Gelöst, das war das Wort, nach dem Heller gesucht hatte. Karin wirkte gelöst, geradezu befreit.
Karin sah auf Annis Kopf, der in ihrem Schoß lag, und lachte erneut.
»Sie hat noch Sand im Ohr«, flüsterte sie. »Bestimmt wird noch in zwei Wochen alles voller Sand sein.«
Zwei Wochen, dachte Heller. So lange würde Karin weg sein. Wie sehr sie sich freute auf ihre nächste Reise, während er von Wehmut überrollt wurde. Sie wollte sich die Freude nicht mit traurigen Gedanken verderben und eigentlich tat sie gut daran. Auch er sollte dankbar sein für diese vergangenen zehn Tage.
»Machst du dir Sorgen um mich?«, fragte Karin, beugte sich ein wenig vor und berührte seine Hand.
»Ein wenig schon«, murmelte Heller. »Nicht ungefährlich, die Reiserei.«
»Das musst du nicht, Max, ich kann auf mich aufpassen. Das weißt du!«
Anni regte sich und Karin lehnte sich wieder zurück. »Max, hast du gehört?«
Er nickte. Und im Grunde wusste er es ja auch. Aber das war nicht alles. Der Urlaub war wirklich schön. Die Ostsee, der Weststrand, die Villa, in der sie untergebracht waren. Das schlichte, aber reichliche Essen in der HO-Gaststätte. Das Rauschen der Wellen, die Wärme, der laue Wind. Die Weite. Alles war schön. Zu schön. Ab jetzt würde sich alles an diesen zehn Tagen messen müssen. Und zum ersten Mal seit Jahren schien ihm ein sonst so beständiger Teil seines Lebens ungewiss.
9. September 1951, Vormittag
»Hast du auch alles?«, fragte Heller und sprach fast zu leise gegen den Lärm auf dem Bahnhof Dresden Neustadt an. Auf dem Bahnsteig herrschte reges Treiben, unzählige Menschen redeten, riefen und lachten durcheinander, Gepäckstücke wurden in die Waggons gereicht, weiter hinten kreischten die Bremsen eines einfahrenden Zuges. Die Lautsprecher knackten und die kaum verständliche Durchsage kündigte, vielfach hallend, die baldige Abfahrt des Zuges an, mit dem Karin erst einmal nach Leipzig fahren würde.
»Hat du deinen Pass? Die Reisegenehmigung? Die Fahrkarten?«, fragte Heller und schaute seine Frau besorgt an.
»Max, das fragst du nun zum fünften Mal.« Karin lächelte vorwurfsvoll und traurig. »Du musst sie jetzt nehmen«, bestimmte sie dann.
Heller nickte und wollte Anni, die sich an Karins Hals klammerte, wegziehen. Seitdem das Mädchen den Bahnhof gesehen und damit realisiert hatte, dass Karin wirklich wegfahren würde, war sie untröstlich. Vorsichtig löste Karin Annis Arme von sich, die aber nicht loslassen wollte. Heller gelang es schließlich, das Kind zu sich zu ziehen und neben sich auf den Bahnsteig zu stellen. Doch schon war Anni wieder zu Karin gerannt und klammerte sich an deren Hüfte.
Heller seufzte und legte seine Hand auf Annis Kopf. »Vergiss nicht, immer alles abstempeln zu lassen, aber lass den Rückreisetag nicht vorschnell eintragen. Sollte sich etwas ändern, kannst du das auf diesem Schein nicht mehr korrigieren, das ist nicht erlaubt.«
»Max, das weiß ich auch. Du hast es mir mehr als einmal erklärt. Ich muss jetzt einsteigen.«
»Und lass nie das Gepäck aus den Augen!«, ergänzte Heller mit ernster Stimme.
»Werde ich nicht. Anni, du musst jetzt loslassen.«
»Will mitfahren!«, schluchzte das Mädchen.
Karin befreite sich aufs Neue und ging in die Hocke, um Anni in die Augen sehen zu können. »Du darfst leider nicht mitfahren. Aber du musst auf den Vati aufpassen und auch auf Frau Marquart, damit sie keinen Unsinn anstellt. Versprichst du mir das, ja? Und in zwei Wochen bin ich wieder da, das verspreche ich dir. Ich bringe dir auch ganz bestimmt etwas mit.« Sie streichelte Anni die Tränen von der Backe.
»Scholade?«, fragte das Mädchen und versuchte die Tränen wegzublinzeln, was ihr nur schlecht gelang.
»Scho-ko-lade, ja. Sei schön artig, auch im Kindergarten, hörst du?« Karin gab dem Mädchen einen Kuss auf die Wange, erhob sich und strich ihr noch einmal über das gescheitelte und zu zwei langen Zöpfen geflochtene Haar. Heller bezweifelte, ob er in der Lage sein würde, dem Kind die Haare so zu flechten, obwohl Karin es ihm im Urlaub mehrmals gezeigt hatte. Nun gab sie ihm einen beinahe flüchtigen Kuss und stieg schnell die drei steilen Stufen hinauf in den Waggon.
Heller, der mit diesem kurzen Abschied nicht gerechnet hatte, wollte noch etwas sagen, doch verstummte dann. Sie hatte recht. Sie konnte auf sich aufpassen. Bis nach Eisenach war ihre Reiseroute gesichert. Doch sobald sie die Grenze überschritten hatte, war sie, um nach Köln zu kommen, auf die Eisenbahnverbindungen drüben angewiesen, hatte weder einen Fahrplan noch einen Fahrschein und besaß nur zweihundertfünfzig Deutsche Mark der DDR und musste sich darauf verlassen, dass sie diese gerecht eintauschen konnte. Noch immer bestand jederzeit die Gefahr, beraubt zu werden. Und wie die Zustände im Westen waren, konnte Heller nur ahnen. Im März war in Thüringen ein Volkspolizist über die Grenze hinweg erschossen worden.
Da erschien Karin am offenen Fenster ihres Zugabteils. Heller nahm Anni auf den Arm, woraufhin das Mädchen sofort die Arme nach Karin ausstreckte. Heller trat einen kleinen Schritt zurück. Vielleicht hätten sie das Kind zu Hause lassen sollen. Ihm allein fiel es schon schwer, Karin wegfahren zu sehen. Wie mochte es erst Anni ergehen, die das alles nicht verstand und nur Angst um die Frau hatte, von der sie glaubte, es sei ihre Mutter.
»Ich komme bald wieder, Anni, ich verspreche es dir. Du musst nicht weinen! Ich besuche deinen Bruder, den Erwin, weißt du. So lange hab ich den nicht mehr gesehen. Freust du dich nicht für mich, dass ich ihn wiedersehen darf?«
Ihre schon lange beantragte Reisegenehmigung nach Westdeutschland war ebenso überraschend gekommen wie Niesbachs Urlaubsangebot.
»Lass ihn ein Foto von sich und seiner Frau machen«, bat Heller, doch auch das hatte er schon drei Mal gesagt.
Karin lächelte nur und winkte. Dann gellte ein Pfiff und der Zug fuhr mit einem Rucken an. Heller hob die Hand. Plötzlich war ihm, als müsste er noch etwas sagen. Etwas, das ihm seit dem Eintreffen der Reisegenehmigung vor vier Wochen auf der Zunge lag. Etwas, weswegen er letzte Nacht nicht hatte schlafen können. Doch die Worte wollten ihm nicht über die Lippen kommen, weder in den vergangenen Wochen noch jetzt, da es die letzte Gelegenheit war. Es war einfach zu albern.
Auf seinem Arm brach Anni wieder in Tränen aus und winkte heftig, als versuchte sie, Seifenblasen aus der Luft zu schnappen. Und dann war es zu spät, etwas zu sagen, und er stand einfach da und sah zu, wie der Zug die dunkle Bahnhofshalle verließ, um ins gleißende Mittagslicht einzutauchen.
Die wenigen auf dem Bahnsteig zurückgebliebenen Leute verstreuten sich und es wurde merklich ruhiger um sie herum.
»Wollen wir sehen, ob wir irgendwo eine Bockwurst bekommen?«, fragte Heller das Mädchen und setzte es ab.
»Mit Sempf?«, fragte sie leise.
»Mit Senf, ja, und möchtest du Luftschaukel fahren?« Er hoffte, die Schaukel stand noch am Alaunplatz, wo er sie zuletzt vor dem Urlaub gesehen hatte.
Anni nickte und fasste nach seiner Hand. Für den Moment schien sie sich damit abgefunden zu haben, dass Karin weggefahren war. Sei nicht dumm, ermahnte Heller sich selbst. Sei nicht dumm.
Und trotzdem fühlte er sich mit einem Mal ganz und gar verloren.
10. September 1951, Morgen
»Max!« Oldenbusch fuhr aus seinem Stuhl, kaum dass Heller die Tür zu seiner Schreibstube geöffnet hatte. Auch der junge Salbach erhob sich. Heller stellte die Aktentasche ab und hängte Schiebermütze und Jacke an die Garderobe.
»Max, war es schön? Du siehst ja aus wie ein Neger!«, rief Oldenbusch, nahm Hellers Hand und schüttelte sie ein wenig zu euphorisch, wie Heller feststellte. Auch Peter Salbach schien höchst erfreut zu sein, seinen Chef wiederzusehen. Der kürzlich zum Unterkommissar beförderte Kollege hatte sich erst mal zurückgehalten, doch nun schüttelte auch er Heller kräftig die Hand.
Ein klein wenig befremdet darüber nahm Heller seine Tasche und setzte sich an seinen Tisch.
In der Zwischenzeit hatten sie sich ein wenig professioneller eingerichtet in ihrem Kellerabteil. Die Beleuchtung war verbessert worden. Zwei Wochen lang hatte eine Elektrikerfirma Kabel gezogen und hell leuchtende Lampen montiert. Die alte Schreibtischlampe, die so lange als Provisorium diente, hatte er aber behalten.
»Erzähl doch mal, wie war es?«, fragte Oldenbusch. Wie Bittsteller standen die beiden vor Hellers Tisch. Heller lehnte sich zurück.
»Herrliches Wetter, ohne Ausnahme. Dabei sagten die Einheimischen, der ganze Sommer sei kühl und regnerisch gewesen. In einer richtigen Villa haben wir gewohnt. Die wurde beschlagnahmt und ist nun ein FDGB-Heim. Es ist wirklich herrlich da.«
Heller hatte lange darüber nachgedacht, ob es gerecht war, dass diese Häuser enteignet worden waren. Wiederum standen diese vielen Zimmer nun dem normalen Arbeiter zur Erholung zur Verfügung.
»Und Essen?«
»Essen gab es genug, allerdings immer nur Graubrot mit Margarine und Marmelade zum Frühstück und Muckefuck. Richtigen Kaffee habe ich nur einmal getrunken, da war Karin in einem Frisiersalon. Blaues Haus hieß das. Das ist da oben ganz berühmt. Die verkaufen auch Bücher. Dort ist ja eine Künstlersiedlung in Ahrenshoop. Sehr interessant, wirklich.«
Der allerletzte Abend fiel ihm ein, als sie nach dem Essen noch einmal allein am Strand gewesen waren. Nur Karin und er. Heller verstummte. Es war ihm ganz recht, dass er hier in seinem Büro war. Die Arbeit würde ihn davon abhalten, ständig an Karin denken zu müssen und darüber, ob sie schon heil angekommen war.
»Ich war letzten Dienstag bei Frau Marquart, wie du gebeten hattest. Sie wusste gar nicht mehr, wer ich bin, ich musste es ihr mehrmals erklären«, sagte Oldenbusch.
Heller seufzte. Der Zustand der alten Dame machte ihm Sorgen. Sie noch einmal mehrere Tage allein zu lassen, war eigentlich nicht mehr möglich.
Heller blickte zu Oldenbusch hoch. »Und bei dir, Werner? Neuigkeiten?«
Oldenbusch schüttelte den Kopf. Heller beließ es dabei. Im Frühjahr hatte Werner sich mit einer jungen Frau verlobt, die in Moskau Maschinenbau studiert hatte. Vor zwei Wochen war sie plötzlich verschwunden, und es sah ganz so aus, als sei sie in den Westen gegangen. So verletzt Oldenbusch deshalb auch war, mehr Gedanken sollte er sich über die Reaktion seiner Partei machen. Der Verdacht des Verrates war heutzutage schnell ausgesprochen.
Oldenbusch aber tat so, als sei nichts. »Seid ihr auch mit dem Schiff gefahren? Ist das überhaupt erlaubt?«
»Werner, was ist los?«, fragte Heller eindringlich.
Oldenbusch atmete tief durch und warf einen raschen Blick zu Salbach.
»Es ist ein riesiger Schlamassel«, seufzte er dann.
Heller hob gespannt die Augenbrauen, beugte sich vor und langte nach Bleistift und Notizheft. »Ich höre.«
»Kaum warst du weg, kam eine Meldung, dass in der Verwaltung vom Friedhof in Tolkewitz eingebrochen wurde, auch im Krematorium. Die Einbrecher richteten einigen Schaden an, verwüsteten die Büros, und offenbar wurden einige Särge gestohlen, vermutlich wegen des Holzes. Und ein Leichenwagen kam weg. Wir haben eine Spurenaufnahme durchgeführt. Die nächsten Tage verliefen ganz ruhig. Letzten Freitag wurde ich dann zu Niesbach bestellt. Im Rahmen einer groß angelegten Aktion des Ministeriums für Staatssicherheit gab es eine erhebliche Anzahl von Verhaftungen.«
»War mein Sohn involviert?«, fragte Heller schnell dazwischen.
Oldenbusch zögerte. »Nicht dass ich wüsste, aber der ist doch sowieso in Potsdam, oder?«
Heller nickte knapp. Klaus besuchte die Schule des erst im Februar gegründeten Ministeriums. Zwischenzeitlich war er zu den Weltjugendfestspielen in Berlin beordert worden.
»Gegen wen richtete sich die Maßnahme? Wie lautete der Vorwurf?«
»Bei den Verhafteten handelt es sich um Mitglieder der Wachturmgesellschaft. Die Anklage lautet Boykotthetze gegen demokratische Einrichtungen und Spionage. Ihnen werden Kontakte zum amerikanischen Geheimdienst nachgesagt. Es gibt konkrete Hinweise, vor allem aus sowjetischen Geheimdienstkreisen und vom MGB.«
Heller legte seinen Stift nieder und klappte das Notizbuch zu, ohne etwas geschrieben zu haben.
»Die Zeugen Jehovas? Es hat doch im letzten Jahr schon Prozesse gegen Zeugen Jehovas gegeben. Hier, in Dresden. Ich meine mich zu erinnern, dass lange Zuchthausstrafen verhängt wurden.«
Oldenbusch nickte. »Sie hatten sogenannte Gebietskarten über ihr Büro in Magdeburg in den amerikanischen Sektor nach Wiesbaden-Dotzheim weitergeleitet, auf denen sie Adressen und Vorkommnisse notiert hatten. Offenbar war man bei dieser ersten Aushebung nicht konsequent genug gewesen.«
Heller sagte nichts und sah Salbach an, der außer einer Begrüßung noch nichts gesagt hatte. Salbach war ein guter Mann, aufmerksam und tüchtig. Heller selbst hatte ihn zum Dienst in der Kripo animiert und dafür gesorgt, dass er in seine Abteilung aufgenommen wurde. Doch gerade wegen ihm schwieg Heller jetzt. Er wollte weder sich noch Salbach in die Bredouille bringen, indem er Dinge sagte, die von eifrigen Staatsschützern falsch verstanden werden konnten. Aber die aufkommende Paranoia der Regierenden der DDR erinnerte ihn allzu sehr an die des untergegangenen Dritten Reiches. Niemand war vor Verdächtigungen sicher und die einzelnen Behörden versuchten sich durch besonders eilfertiges Handeln hervorzutun. Auch sein Sohn Klaus hatte das Weltjugendtreffen nicht zu seinem Vergnügen besucht, sondern um sich die Namen jener zu notieren, die trotz Verbotes heimlich Westberlin besucht hatten, Kontakt zu den aus der BRD angereisten Jugendlichen pflegten oder anderweitig auffällig wurden. Und verdächtig war im Prinzip jeder, der zu den Spielen delegiert worden war.
Heller fragte sich, welchen Schaden die recht kleine Gruppe gläubiger Menschen mit diesen Gebietskarten der DDR zugefügt haben sollten.
»Also, was ist geschehen?«
»Zwei der Festgenommenen brachte man aus Platzmangel in unserem Untersuchungsgefängnis unter. Oskar Machol und Julius Weichert, beide Mitte vierzig. Das war letzten Donnerstag, besser gesagt in der Nacht zum Freitag.«
»Also vom sechsten zum siebten September?«
»Ja, und am Freitagmorgen waren sie tot. Beide haben offenbar Selbstmord begangen.«
»Offenbar?«
Oldenbusch holte von seinem Schreibtisch ein Blatt und reichte es seinem Vorgesetzten. Heller las den Bericht, las ihn noch einmal und rieb sich dann mit der Hand im Genick, wo sich ein wenig Haut vom Sonnenbrand pellte.
»Peter, holen Sie zwei Stühle.« Salbach beeilte sich, seinen und Oldenbuschs Stuhl zu holen. Heller deutete ihnen an, sich ihm gegenüber hinzusetzen. »Also?«, fragte er dann. »Was hat das jetzt für uns zu bedeuten?«
»Seither geht es hier drunter und drüber. Die Sowjets machen uns große Vorwürfe. Sämtliche Wärter wurden schon zur Vernehmung gebracht. Niesbach wurde gleich in die Kommandantur bestellt. Alle sind hochgradig nervös und fangen an, sich gegenseitig zu beschuldigen.«
»Inwiefern?«, fragte Heller.
»Nicht richtig aufgepasst zu haben. Im besten Falle.« Oldenbusch zupfte sich an der Nase.
»Sie behaupten, dass jemand seine Hände im Spiel gehabt haben könnte? Jemand vom Personal?« Unwahrscheinlich, wenn sie eher zufällig in diesem Gefängnis untergebracht worden waren, dachte er sich.
»Wer hat denn die Verteilung der Festgenommenen bestimmt?«
Oldenbusch hob die Schultern. »Also, das weiß ich nicht.«
Werners Verhalten machte Heller langsam ungehalten. Es war fast, als sei dem Mann jegliche Selbstsicherheit abhandengekommen. Doch auf einmal verstand Heller.
»Du bist selbst verhört worden? Und Sie auch, Salbach?«
Beide nickten.
»Mensch, Max, die waren nicht gerade freundlich«, murmelte Oldenbusch. »Sechs Stunden haben sie mich dabehalten und Peter auch. Oben auf der Bautzner. Erst haben sie mich zwei Stunden in einer Zelle sitzen lassen. Dann haben sie mich vier Stunden lang immer wieder dasselbe gefragt und ich habe immer wieder dasselbe erzählt. Dabei hatten wir gar nichts damit zu tun gehabt. Aber die verdächtigen jeden hier. Du hast übrigens auch gleich einen Termin bei Niesbach. Der steht auf der Kippe, sag ich dir, den mögen die Russen sowieso nicht mehr.«
Heller hatte von Niesbachs Niedergang schon mitbekommen, obwohl dieser Erzkommunist war, Spanienkämpfer und jahrelang in der Emigration in Moskau. Doch offenbar galt auch das nichts mehr heutzutage. Sie trauten ihren eigenen Leuten nicht mehr. Paranoid war das.
»Und Niesbach wird von mir verlangen, dass ich was herausfinde?« Heller öffnete die Handflächen und sah seine Gegenüber fragend an.
»Wäre es Mord, müssten wir alle um unsere Posten fürchten«, sagte Salbach leise.
»Und um unsere Leben«, fügte Oldenbusch hinzu. »Die würden uns allesamt Verrat vorwerfen.
Heller wusste, dass Werner nicht übertrieb. Es gab anscheinend nur noch Gut und Böse und nichts dazwischen. Sechs Jahre lang war man ein guter Kommunist, ein Held, und am nächsten Tag eine Unperson.
»Genug der Mutmaßungen. Werden wir konkret. Ich nehme an, du wurdest erst spät informiert, und es war dir nicht möglich, eine ordentliche Spurenaufnahme durchzuführen.«
»Doch. Nachdem man feststellte, dass den beiden Männern nicht mehr zu helfen war, beließ man alles so, wie es war, und rief uns. Ich konnte einige Fotografien anfertigen sowie Fingerabdrücke nehmen.«
»Ist es denn anzuzweifeln, dass sie Selbstmord begingen? Auf diesem Bericht steht Strangulation. Haben sie sich erhängt?«
Statt eine Antwort zu geben, beugte sich Oldenbusch weit zu seinem Schreibtisch hinüber und langte nach einer Mappe, die er Heller gab.
Heller öffnete sie, breitete die Fotos, Zeichnungen und Formulare aus. Dann schaltete er die Schreibtischlampe ein und betrachtete die Fotos genau.
»So wurden sie gefunden?«, fragte er dann und drehte das eine Bild um neunzig Grad. Es war nicht gut ausgeleuchtet. Es sah aus, als hinge der Mann mit einem dicken Strick an einer Eisenstange, seine zu weite Hose schien seltsamerweise an der Wand zu kleben.
Oldenbusch nahm Heller die Fotografie aus der Hand und drehte sie wieder zurück. »So ist es richtig.«
»Sie lagen auf dem Boden? Beide?«
»Sie haben sich ihrer Hemden entledigt, diese dann zu einer Art Strick gedreht. Den haben sie an der Eisenstange befestigt, die unten an die Pritsche zur Verstärkung geschweißt ist. Dann haben sie ihre Köpfe in die Schlaufe gesteckt und müssen sich auf dem Boden liegend mindestens zwanzig Mal um sich selbst gedreht haben, bis die Schlaufe sich so eng um den Hals schnürte, dass ihnen die Blutzufuhr zum Gehirn abgedrosselt wurde. Sie wurden bewusstlos und starben dann an Sauerstoffmangel.«
»Und beide taten das unabhängig voneinander, in getrennten Zellen?«, fragte Heller noch einmal nach, obwohl es genau so im Bericht stand.
Oldenbusch nickte und sah auf seine Armbanduhr. »Beide auf dieselbe Art und Weise, und wohl auch zur selben Zeit.«
»Wann habe ich den Termin bei Niesbach?«, erkundigte sich Heller.
»Um acht. Wenn er noch da ist … Niesbach, meine ich.«
Heller sah auf seine Uhr und nickte. Dann beugte er sich wieder über die Bilder. »Sie steckten also ihre Köpfe in die Schlinge, legten sich auf den Boden und drehten sich um sich selbst. Zwangsläufig schnürt es einem die Luft und die Blutzufuhr ab. Wie lang dauert so etwas?«
»In der Regel nur wenige Minuten, bis man bewusstlos ist, und nur wenige Minuten mehr, um zu sterben. Fünf, vielleicht?«
»Mit Vorbereitung?«, fragte Heller skeptisch.
»Soll ich es einmal vorführen?«, fragte Salbach.
Heller sah den jungen Polizisten erstaunt an, dann nickte er.
»Moment noch«, bat er und sah auf seine Uhr, bis der Sekundenzeiger auf zwölf stand. »Und … los!«
Salbach knöpfte sein Hemd auf, zog es aus, begann es zu wringen und zu drehen, bis sich eine Art Seil gebildet hatte, lief dann zum Rohr des Heizkörpers, schob das Seil dahinter und verknotete die Enden.
»Schon gut, Peter!«, rief Heller, leicht amüsiert über den Übereifer Salbachs, als dieser, nur im Unterhemd, nun auch noch den Kopf in die Schlinge stecken wollte. »Ich habe zwei Minuten gezählt. Rechnen wir noch zehn Minuten dazu. Zwölf Minuten. Das genügt tatsächlich, sich mehr oder weniger unbemerkt umzubringen. In welchen Abständen sollen die Wärter die Zellen kontrollieren?«
»Dafür gibt es keine einheitlichen Richtlinien«, brummte Oldenbusch.
Salbach entknotete sein Hemd, zog es wieder über seinen sportlichen Körper und knöpfte es zu.
»Keiner kann nachweisen, ob die Wärter ihrer Pflicht nachgekommen sind. Es lag auch kein Hinweis auf Selbstmordabsichten vor. Eigentlich kann man niemandem einen Vorwurf machen«, sagte er.
»Nun ja, wenn man einen Menschen in Gewahrsam nimmt, übernimmt man auch die Verantwortung für ihn. Wenn er in der Haft ums Leben kommt, muss man uns das zum Vorwurf machen. Besteht die Möglichkeit, dass die beiden Leichen vor eurem Eintreffen manipuliert wurden?«
»Natürlich«, antwortete Oldenbusch knapp. »Aber wahrscheinlicher ist es doch, dass die beiden Gefangenen sich abgesprochen haben. Sie schienen bei ihrer Einlieferung aufs Äußerste erregt zu sein, wurde uns berichtet.«
»Peter sagte gerade, es lag keine Suizidabsicht vor.«
»Wir geben nur wieder, was wir von Dritten erfahren haben.«
»Von den Vernehmern der Sowjets?«
»Vom Ministerium für Staatssicherheit der UdSSR.«
»Der MGB steckt mit dahinter?«
»Ich sag ja, Chef, das war eine große Sache. Und möglichweise hatten die beiden wirklich Grund, sich umzubringen. Dann können uns die Russen nur Nachlässigkeit vorwerfen.«
»Du meinst den Wärtern«, verbesserte Heller und erntete bedeutsames Nicken. »Aber ist es für gläubige Menschen wie den Zeugen Jehovas nicht eine schwere Sünde, sich selbst zu töten? Wo befinden sich die Toten jetzt? Bei Kassner?«
»Die Sowjets haben sie abgeholt.«
Heller hatte das geahnt. Er erhob sich. »Ich werde jetzt zu Niesbach gehen.«
»Es ist noch zu früh«, warf Salbach ein, der Heller noch nicht ganz so gut kannte wie Oldenbusch.
»Wenn Niesbach an einem Gespräch mit mir liegt, wird er mich auch eher empfangen«, sagte Heller. »Danach besuchen wir das Untersuchungsgefängnis. Melden Sie uns an, Peter. Ich will beide Zellen sehen.«
»Wie war denn Ihr Urlaub, Herr Oberkommissar?« Niesbach wollte freundlich sein und nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen, das war ihm deutlich anzusehen. Er massierte sich dabei mit geschlossenen Augen die Schläfen, während er sprach.
»Er war sehr schön. Sehr erholsam«, antwortete Heller.
»Und Ihre Frau? Sie ist gerade in Köln, oder? Ihren Sohn Erwin besuchen.« Noch immer hielt Niesbach die Augen geschlossen.
»Ja, das ist sie. Zwei Wochen lang.«
»Ihre Tochter ist nicht mit?« Niesbach nahm die Hände herunter und sah Heller an. Worauf seine Frage zielte, war eindeutig.
»Für sie lag keine Reisegenehmigung vor«, sagte Heller ungeduldig. »Genosse Niesbach, bitte halten wir uns nicht mit formellem Geplänkel auf. Ich bin über die jüngsten Geschehnisse informiert. Sagen Sie mir, wie ich damit umgehen soll.«
»Wie würden Sie denn damit umgehen?«, fragte Niesbach und verbarg mit dieser Gegenfrage nur schlecht seine Schwäche.
»Ich werde sie untersuchen, wie ich es sonst auch machen würde.«
»Richtig, so hatte ich das von Ihnen auch erwartet. Wir müssen unseren sowjetischen Freunden zeigen, dass auf uns Verlass ist. Die Vorkommnisse werden auf das Gründlichste untersucht und ausgewertet. Wir müssen denjenigen, der dafür verantwortlich ist, dingfest machen und bestrafen. Vorkommnisse wie diese schaden dem Aufbau des Sozialismus aufs Erheblichste! Verlorengegangenes Vertrauen muss wieder aufgebaut werden.«
Auf das Gründlichste, auf das Erheblichste, wiederholte Heller in Gedanken und wunderte sich über seinen Vorgesetzten. Das war ganz untypisch für den sonst ruhigen und gesetzten Mann. Wenn er diesen Fall untersuchen sollte, hätte ein einfacher schriftlicher Bescheid der untersuchenden Staatsanwaltschaft genügt. Dieser Termin war reine Zeitverschwendung. Heller erhob sich. Niesbach stand ebenfalls auf.
»Ich begleite Sie nach draußen Heller, ich habe einen kleinen Weg zu erledigen.«
Niesbach öffnete die Tür zu seinem Vorzimmer. Seine Sekretärin Frau Schindler, die gerade die Schreibmaschine bearbeitete, unterbrach ihr Fingerspiel und sah auf.
»Bin gleich zurück!«, rief Niesbach, öffnete auch die nächste Tür und verließ gemeinsam mit Heller das Zimmer. Schweigend liefen die beiden Männer den Flur entlang. Als Heller ins Treppenhaus abbiegen wollte, zupfte Niesbach ihn am Ärmel und deutete mit seinem Blick auf die Pendeltür am anderen Ende des Ganges. Heller verstand und begleitete seinen Chef zu den Toiletten. Noch immer schweigend betrat Niesbach den Toilettenvorraum, Heller folgte ihm und beobachtete stumm, wie der schmale Mann die Kabinen überprüfte, um sicherzustellen, dass sie alleine waren. Dann lehnte sich Niesbach an ein Waschbecken und schaute Heller besorgt an.
»Max, die Sowjets sind aufgebracht. Ein Mitarbeiter des MGB unterstellte mir wortwörtlich, wir hätten die beiden Verdächtigen umgebracht. Ich habe diesen Vorwurf mit aller Entschiedenheit zurückgewiesen und wurde dabei vom Polizeipräsidenten unterstützt. Über das Wochenende haben sich die Wogen ein wenig geglättet, doch gerade jetzt schlägt uns wieder großes Misstrauen entgegen.«
»Welchen Grund sollten wir denn gehabt haben, diese Männer umzubringen?«, fragte Heller skeptisch.
Niesbach fuhr auf. »Sie wissen doch so gut wie ich, dass es keinen Grund geben muss, Max. Fünfundzwanzig Millionen Tote sind den Sowjets Grund genug. Selbst mir gegenüber sind sie misstrauisch, obwohl ich in Spanien gekämpft habe und zehn Jahre lang in Moskau war. Ich bin Deutscher, deshalb misstrauen sie mir. Max, gehen Sie mit aller Vorsicht an den Fall heran. Handeln Sie vollkommen transparent, geben Sie Informationen weiter, suchen Sie den Kontakt zum MfS. Ich nehme an, es wird sowieso bald ein Verbindungsoffizier Kontakt zu Ihnen aufnehmen.«
»Welches Ermittlungsergebnis wäre Ihnen denn das liebste?«, fragte Heller leise.
»Ein eindeutiges. Eines, das keinen Spielraum zulässt, um anders ausgelegt zu werden.«
»Dazu brauche ich die Leichen. Ich muss die Wärter vernehmen können und ich muss das Umfeld der Toten abklopfen. Genau genommen müsste ich Zugang zu den Akten der Verdächtigen bekommen. Ich nehme an, sie wurden eine Zeit lang beobachtet, ihre Wege, ihre Kontakte, ihr Schriftverkehr. Vielleicht ergibt sich daraus schon etwas, worauf man eine ordentliche Ermittlungsarbeit aufbauen kann.« Heller verstummte.
»Heller, machen Sie das, was Sie machen können. Ich habe den Verdacht, dass an dieser Sache mehr hängt als nur die üblichen Verdächtigungen.« Niesbach sah Heller bedeutungsvoll an. »Etwas soll hier geschehen. In dieser Stadt. Ich habe keine Ahnung, was.« Dann beugte er sich über das Waschbecken und wusch sich die Hände. An einem groben grauen Handtuch trocknete er sie sich ab.
»Warten Sie noch eine Minute«, befahl er Heller dann und verließ den Raum.
Heller sah ihm nach. Er ließ ungefähr zwanzig Sekunden verstreichen, dann ging auch er.
10. September 1951, Vormittag
Heller ließ sich von dem Wärter durch den langen Kellergang führen, in dem sich der provisorische Zellentrakt befand. Die vielen massiven Holztüren waren geschlossen. Ihm folgte ein weiterer Wärter. Ihre Schritte hallten durch den langen Gang. Ansonsten war es still.
Vor der Tür mit der Nummer siebzehn blieb der Wärter stehen, schob den Schieber des Gucklochs beiseite und warf einen Blick in die Zelle.
»Gefangener, stellen Sie sich links von der Tür, mit dem Gesicht zur Wand!«, befahl er dem Insassen. Dann schloss er auf.
»Ich dachte, die beiden Zellen wären unbelegt«, bemerkte Heller.
»Wir brauchen jeden Platz. Die Zellen wurden uns wieder freigegeben«, erklärte der Wärter. Dann schob er den großen Riegel beiseite und öffnete die Tür. Der zweite Wärter hatte sich mit einem hölzernen Knüppel neben der Tür positioniert, bereit, einen möglichen Angriff abzuwehren. Heller warf einen Blick in die Zelle. Der Inhaftierte stand wie befohlen und regte sich keinen Millimeter. Er trug eine Hose ohne Gürtel, ein dünnes Hemd und Strümpfe an den Füßen. Die Pritsche war blank, nicht einmal eine Decke lag auf ihr. Es gab noch einen Tisch, der in die Wand eingelassen war. Sonst nichts. Der Boden war blanker Beton.
Wenn die Zellen schon wieder belegt waren, hatte es kaum einen Sinn, noch einmal gründlich nach Spuren und Fingerabdrücken zu suchen. Er konnte nur hoffen, dass Oldenbuschs Spurensuche etwas gebracht hatte. Noch fehlte es an Fingerabdruckkarteien zum Abgleich. Außerdem müsste dann jeder Wärter, der hier Dienst tat, seine Fingerabdrücke abgeben, und jeder, der in den Wochen zuvor in der Zelle eingesessen hatte.
Heller ging leicht in die Hocke und betrachtete die Eisenstange, die am Fußende der Pritsche aus der Wand ragte, schräg nach oben führte und ans Eisengestell der Pritsche geschweißt war. Er wusste aus Erfahrung, dass Menschen, die sich umbringen wollten, das auch irgendwann taten. Dass aber beide Gefangene unabhängig voneinander auf exakt dieselbe ungewöhnliche Weise sich umgebracht hatten, gab ihm zu denken. Es gehörte schon einiges dazu, sich selbst zu erdrosseln. Sich an einem Strick aufzuhängen, mochte das eine sein. Sich aber unablässig um sich selbst zu drehen, vor allem wenn einem der Strick schon längst die Kehle zudrückte, bedurfte wohl eines besonders starken Dranges, sich zu töten.
»Lassen Sie den Mann rühren und schließen Sie die Tür wieder, ich habe genug gesehen«, befahl Heller und richtete sich auf. »Und Sie hatten Dienst, als die beiden tot gefunden wurden?«, fragte er den Beamten der die Tür geöffnet hatte und nun wieder schloss.
»Nein, er war’s«, sagte der Wärter und deutete auf seinen Kollegen. »Ich habe erst am Tag danach davon erfahren. Bin aber ebenfalls vernommen worden«, fügte er in leicht vorwurfsvollem Ton hinzu.
»Lassen Sie uns in Ihr Dienstzimmer gehen«, bestimmte Heller.
Schweigend, wie sie auch gekommen waren, gingen sie nun wieder bis zu der kleinen Wachstube zurück, die auch mal eine Zelle gewesen war und jetzt mit einem Holztisch, zwei Stühlen und einer Lampe mit angenehmem Licht ausgestattet war. An der Wand hingen zwei vergilbte Drucke von Landschaftsgemälden. Eines der neuen Telefonmodelle mit Bakelitgehäuse und ein kleines Regal mit Ablagefächern standen auf dem Tisch.
Heller setzte sich und holte sein Notizbuch hervor. »Setzen Sie sich«, befahl er dem Wärter. »Ihr Name?«
»Möbius, Viktor«, antwortete der Mann. Der andere Wärter lehnte leger im Türrahmen.
»Und Sie?«, fragte Heller.
»Ich war ja gar nicht da«, wich dieser aus.
Heller sah ihn streng an. »Wollen Sie mir jetzt bitte Ihren Namen nennen!«
»Tegelmann, Winfred.«
Heller notierte es sich und wandte sich wieder an den anderen Wärter. »Sie haben die beiden gesehen?«
»Ja, einer war hier in der siebzehn, der andere drüben in der dreiundzwanzig. Ich hab beide gesehen«, erwiderte Möbius.
Heller musterte den älteren Mann. »Sind Sie schon lange im Dienst?«
»Seit fünf Jahren jetzt. Vorher war ich Steinmetz, dann im Krieg in Russland in der Etappe.«
»Haben sich in den vergangenen fünf Jahren schon einmal Insassen umgebracht?«
»Jawohl, aber nicht auf diese Art. Einer hat sich am Fenstergitter erhängt, deshalb wurden diese abgeschafft und die Fenster zugemauert. Einem gelang es, sich am Bettgestell die Pulsader aufzureißen, weshalb wir an sämtlichen Pritschen die Ecken rund feilen mussten.«
»Sie laufen die Gänge auf und ab während der Schicht? Sehen Sie in jede Zelle hinein?«
»Nein, nicht immer. Da würden wir ja nie fertig werden. Wir schauen nach, ob die Insassen schlafen. In der Nacht bekommen sie zwei Decken. Wenn alles ruhig ist, muss man doch nicht andauernd kontrollieren.« Möbius war bereits in Abwehrhaltung gegangen.
»Aber den beiden galt doch besonderes Augenmerk, nicht wahr?« Heller sah den Mann nicht an, sondern schrieb etwas in sein Buch.
»Da dürfen Sie mich aber nicht fragen, ich hatte hier nicht Dienst, sondern der Rehm. Der hat die auch gefunden.«
Nun sah Heller dem Mann streng in die Augen. »Es ist auch in Ihrem Interesse, dass Sie mir möglichst eindeutige Antworten geben. Ist Ihnen klar, wie wichtig die Sowjets diesen Vorfall nehmen?«
Möbius nickte. »Weil der Ami angeblich etwas plant.«
Heller sah den Mann an. »Der Ami? Der Amerikaner? Meinen Sie das im Allgemeinen oder haben Sie etwas Konkretes im Sinn?«
Möbius sah zu seinem Kollegen und schien schon zu bereuen, etwas gesagt zu haben.
»Na ja, angeblich suchen die jemanden. Die Russen, meine ich. Einen Spion. Sie nennen ihn den Ami, mehr weiß ich auch nicht.«
»Und es hieß, die beiden Toten hätten Kontakt zu dem Ami?«
»Ich weiß gar nichts, Sie wissen doch, wie die Leute immer reden, ganz bestimmt ist das auch nur ein Gerücht. Dass die Amis hier eine Atombombe hochgehen lassen wollen und so.«
»Ausgerechnet hier?« Heller stutzte. »Warum nicht in Berlin?«, konnte er sich nicht verkneifen zu fragen.
»Weil da der Ami selber sitzt«, antwortete Möbius wie aus der Pistole geschossen. Er hatte sich wohl schon seit Längerem Gedanken darüber gemacht. Auch Tegelmann schürzte die Lippen und nickte.
»Nun gut«, Heller hatte keine Zeit. »Sie haben die beiden gesehen bei ihrer Einlieferung? Weichert und Machol?«, fragte er Möbius.
»Das habe ich.«
»Welchen Eindruck hatten Sie von ihnen. Waren sie ruhig, aufgeregt, verzweifelt? Haben sie geschrien?«
»Die waren völlig durch, gezittert haben sie. Sie hatten Fieber und haben uns erst das Aufnahmebüro und dann die Zellen vollgekotzt.«
»Sie haben sich erbrochen? Beide? Wurden sie von einem Arzt untersucht?«
»Es ging drunter und drüber. Das Telefon klingelte, jemand war dran, der sich gar nicht erst vorstellte. Es hieß, wir bekommen ein paar Untersuchungshäftlinge. Dann passierte aber nichts und wir telefonierten herum, aber niemand wusste etwas. Und plötzlich standen sie vor der Tür. Ein großer schwarzer Opel und ein Russenlaster. Es gab Geschrei, und sie brachten vier Männer herein. Die wurden aber wieder mitgenommen, und dann haben sie die anderen beiden gebracht.«
Heller hatte Mühe, das alles mitzuschreiben. »Was war der Anlass des Streits bei den Sowjets?«
»Ich kann kein Russisch.«
Heller sah auf. »Sie waren in Russland und können kein Russisch? Irgendeiner Ihrer Kollegen vielleicht? Hat keiner von Ihnen verstanden, warum es ein solches Durcheinander gab?«
»Nein, Herr Oberkommissar.«
Heller schüttelte verständnislos den Kopf. »Dann überließen die Sowjets Ihnen die Männer? Haben Sie die Aufnahmeformulare ausgefüllt? Wer hat diese unterschrieben? Hat sich der sowjetische Vorgesetzte vorgestellt?«
»Nein, nichts von all dem. Wir sollten die Männer nur in Gewahrsam nehmen. Mehr nicht. Dann zogen sie alle wieder ab. Kaum waren die weg, sind uns die beiden schon umgekippt.«
»Und Sie oder Ihre Vorgesetzten ließen keinen Arzt kommen?«
Möbius rutschte unruhig auf seinem Stuhl herum. »Wir haben das ab und zu, dass einer hysterisch wird oder sich so sehr ereifert, dass er ohnmächtig wird. Die Russen sind ja nicht zimperlich, und wer von denen eingesammelt wird, ahnt ja, was ihm blüht. Bautzen oder Sibirien. Vielleicht hatten die ja vorher auch gesoffen. Zumindest mussten wir so was denken. Wir haben ihnen dann Wasser gegeben und sie durften sich hinlegen. Dann war erst mal Ruhe und wir dachten, die schlafen. Ein Arzt schien da nicht notwendig zu sein. Vielleicht waren sie ja auch so aufgeregt, weil sie schon wussten, dass sie sich umbringen werden?«
Heller schrieb schweigend weiter und ließ sich dabei nicht aus der Ruhe bringen, auch als der Wärter seinen Bericht längst beendet hatte.
»Haben die Männer gebetet?«, fragte Heller auf einmal.
»Was?«, fragte Möbius verblüfft.
»Gebetet«, wiederholte Heller deutlich. Wo war nur das gute alte ›Wie bitte‹ geblieben? »Zu Gott gebetet.«
»Also«, Möbius sah fragend zu Tegelmann, doch der zuckte nur mit den Achseln. »Nicht dass ich wüsste. Aber der Rehm hatte Schicht in dem Gang, er hat sie gefunden, den müssen Sie fragen.«
»Und wo finde ich den?«
»Der ist in Haft. In der Bautzner, in einer der Villen, in denen der MGB sitzt, hab ich gehört.«
Heller klappte sein Notizbuch zu. Vielleicht konnte ihm Doktor Kassner weiterhelfen bezüglich des Gesundheitszustandes der Häftlinge. Sofern Kassner überhaupt an die Leichen kam. Die Wärter misstrauten auch ihm und glaubten, er würde sie für die Sowjets aushorchen. Das schien ihnen eine größere Bedrohung zu sein als eine Atombombe in der Stadt.
Heller erhob sich. Auf was für Ideen die Leute nur immer kamen, dachte er sich.
»Ich brauche alle Namen der Wärter, die Dienst hatten, als die beiden Männer eingeliefert und als sie tot aufgefunden wurden. Auch die Namen derer, die am Tag zuvor Dienst hatten. Ich brauche die Dienstpläne der letzten Woche und die Namen aller Insassen. Ich nehme an, untereinander gibt es keinerlei Kontakte?«
»Das ist strengstens untersagt und würde sofort unterbunden.« Möbius sah zu Tegelmann, der auf der Unterlippe kaute, und begann dann in der Ablage zu suchen. Er holte eine Mappe hervor, der er einige Blätter entnahm. Er sah sie durch, sortierte einige aus, reichte sie Heller.
»Das sind nicht die Originale, nur Durchschläge, deshalb habe ich die unleserlichen Stellen mit Bleistift nachgezogen. Damit Sie sich nicht wundern.« Er hielt Heller die Blätter hin. Heller zögerte, ehe er zugriff. Möbius’ Hand zitterte.
»Kann ich das Telefon benutzen?«, fragte Heller.
»Nein, Sie müssen oben das vom Pförtner im Erdgeschoss nehmen.«
Heller nickte. »Danke. Weitermachen!«
»An diesen Walter Rehm kommen wir nicht einfach so ran«, empfing Oldenbusch seinen Vorgesetzten, als dieser zurück im Büro war. »Es ist nicht einmal sicher, ob er in der Bautzner Straße sitzt oder am Münchner Platz. Salbach habe ich zum Meldeamt geschickt, am Telefon war niemand bereit, Auskunft zu geben. Ich hoffe, du bist damit einverstanden.«
»Natürlich, gut gemacht, Werner.« Heller setzte sich, nahm die Dienstpläne hervor und betrachtete sie eine Weile. Dann hielt er eines der Blätter gegen das Deckenlicht.
»Im Zug zurück von der Ostsee saß ein Ehepaar mit im Abteil. Zuerst waren sie ganz zurückhaltend, als sie sich aber sicher fühlten, fingen sie an zu klagen. Man bekomme nichts zu kaufen, selbst wenn man Geld habe. Überall stehe man an. Der Russe mische immer mit. Drüben gebe es alles. Wie die Leute eben immer reden. Und natürlich haben sie auch gewusst, dass ein nächster Krieg droht. Ich musste sie darum bitten, sich allein schon wegen Anni zurückzunehmen. Der Wärter gerade eben glaubt sogar, die Amerikaner wollen eine Atombombe in die Stadt schmuggeln und uns in die Luft sprengen.«
Anstatt zu antworten, erhob sich Oldenbusch und legte Heller etwas auf den Schreibtisch. Im Gegenzug gab Heller ihm den Dienstplan.
»Fällt dir etwas daran auf?«, fragte er Oldenbusch und betrachtete den Zettel vor sich.
Es war ein Flugblatt. Vorsicht bei Gesprächen, NKWD hört mit, las er. Ein finster dreinblickender Mann in sowjetischer Uniform untermalte die Warnung. Diese und ähnlich lautende Flugschriften werden von Agenten des westdeutschen, vom CIA unterstützten KgU verbreitet, stand erklärend dabei. Es ist sicher, dass diese Organisation Sabotageakte plant und durchführt sowie Spionage betreibt. Es gilt erhöhte Wachsamkeit auf allen Ebenen, in den öffentlichen Ämtern und in den Verwaltungen und Einrichtungen der Volkspolizei und der HVA.
»Kam vorhin mit der Hauspost«, sagte Oldenbusch und gab Heller den Dienstplan zurück. »In Leipzig und Karl-Marx-Stadt hat es Verhaftungen gegeben. Der KgU betreibt ein ganzes Netz von Agenten in der DDR. Die Anweisungen und Informationen fließen über die Ostbüros der SPD.«
»Was heißt das? KgU?«
Oldenbusch malte Anführungszeichen in die Luft. »Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit. Und das ist ja nur eine Truppe. Dann gibt es noch den CIA und die Organisation Gehlen. Wir sind ja schon komplett unterwandert. Die knöpfen sich die Leute vor, die in den Westen gegangen sind. Die plaudern bestimmt freiwillig alles Mögliche aus. Und das wird dann über den RIAS hinausposaunt.«
Heller lehnte sich zurück. »Glaubst du das? Diese Geheimdienstgeschichten? Sabotage? Spionage? Eine Bombe?«
Oldenbusch hob langsam die Schultern und legte dabei den Kopf leicht schief, wie er es immer tat, wenn er eine Antwort geben musste, die seinem Chef nicht gefallen würde. »Du weißt doch, die Leute übertreiben gerne. Aber ein Funken Wahrheit ist eben auch immer dabei.«
»Die Leute werden nicht schlauer. Was haben die alles in den letzten Kriegsmonaten erzählt! Ich glaube, hier leiden alle an Verfolgungswahn. Wo soll das denn hinführen, wenn jeder jedem misstraut?«
Heller sah auf die Uhr. Er hoffte, Salbach würde noch vor dem Mittag zurückkommen, damit sie noch etwas erreichen konnten an diesem Tag.
Oldenbusch beugte sich ein wenig vor und senkte die Stimme. »Ich habe gehört, dass die Kesselexplosion im Kraftwerk Mitte im Juli inzwischen auch vom MfS untersucht wird.«
»Das war nachgewiesenermaßen ein Unfall.«
»Inzwischen geht man aber davon aus, dass es sich um einen Akt der Diversion handelt, Sabotage also. Das haben die Experten nämlich nicht ausgeschlossen. Es war höchstwahrscheinlich ein Unfall, stand im Abschlussbericht. Und dieser hätte von einem Saboteur herbeigeführt werden können.«
Heller starrte vor sich hin. Nicht einmal mehr denen schenkte man noch Gehör, die es wissen müssten. So weit waren sie schon einmal gewesen. Dann aber riss er sich zusammen. Es hatte keinen Zweck, sich im endlosen Lamentieren über die Menschheit zu verlieren. Er tat gut daran, sich den Einzelschicksalen zu widmen, die er tagtäglich kennenlernte.
»Nichtsdestotrotz, mir scheint es seltsam, dass zwei so gläubige Menschen sich umbringen. Dem müssen wir nachgehen. Sobald Salbach wieder auftaucht, soll er sich Informationen über die Wachturmgesellschaft besorgen, über deren Lebensweise, Gebote und ihre Einstellung dem Staat gegenüber. Und zwar im Allgemeinen und besonders gegenüber der DDR.«
»Vielleicht taten die ja nur so, als seien sie gläubig«, gab Oldenbusch zu bedenken.
»Ja, aber zu welchem Zwecke?« Heller sah Oldenbusch fragend an, ließ ihm aber keine Zeit zu antworten. Er tippte auf den Dienstplan. »Ist dir etwas aufgefallen?«
»Ja, es sieht aus, als hätte jemand nachträglich etwas ausradiert. Gegen das Licht gehalten, ist das Papier heller und dünner an dieser Stelle. Und weil über die Spalte hinausgeschrieben wurde, kann man in der Nachbarspalte sogar noch einen Buchstaben erkennen. Ich denke, es ist ein M oder ein doppeltes N.«
Heller nickte erfreut. »Tegelmann. Er stand vorhin dabei, als ich seinen Kollegen befragte. Er hat den Plan manipuliert. Offenbar sollte er Dienst haben an dem Abend, doch er hat mit Walter Rehm getauscht. Fragt sich, warum, und warum er es nicht einfach gesagt hat. Es ist bestimmt nicht unüblich, Dienstzeiten zu tauschen.«
10. September 1951, Mittag
Oldenbusch bog langsam in die Burgenland Straße ab, bremste und hielt auf Hellers Handzeichen, ohne den scharfkantigen Granitbordsteinen zu nahe zu kommen. Nachdem er vor zwei Jahren auf Hellers Befehl während einer Verfolgungsfahrt seinen geliebten Ford Eifel hatte zu Schrott fahren müssen, hatte er als Ersatzfahrzeug einen alten Tempo A 400 bekommen. Doch mit dem dreirädrigen Pritschenwagen herumzufahren, verursachte bei Oldenbusch fast körperliche Qualen, weshalb er so lange bei Niesbach insistierte, bis ihm ein nagelneuer hellgrauer IFA F9 als Dienstwagen zugewiesen worden war, ein Fahrzeug, das ihm dem Rang eines Kriminalkommissars angemessen erschien. Nun hegte und pflegte er diesen, als wäre er sein Eigen, und hatte dessen Spritzigkeit aus lauter Vorsicht noch kein einziges Mal auf die Probe gestellt.
»Siehst du dort? Was ist das für eine Marke?«, fragte Heller und deutete auf einen schwarzen Wagen, der an der nächsten Querstraße parkte. Die Sonne stand hoch und das Wetter war wenig herbstlich. Der Sommer glühte noch nach und erinnerte Heller schmerzlich an die zurückliegenden Tage an der Ostsee.
Oldenbusch kurbelte sein Fenster ganz hinunter. »Ein Opel!«, wusste er sofort.
»Die Wärter erzählten etwas von einem schwarzen Opel, vermutlich vom MGB.«
»Jemand sitzt im Wagen. Wollen wir aussteigen?«, fragte Oldenbusch.
»Wir müssen ans andere Ende der Straße, Haus Nummer drei. Fahr einfach weiter. Wir haben ja nichts zu verbergen.«
Oldenbusch legte den Gang ein und fuhr an. Als sie die nächste Kreuzung passierten, versuchte Heller ganz ungeniert einen Blick in den Opel zu werfen, doch die Sonne reflektierte genau auf der Frontscheibe des Wagens und blendete ihn. Kaum waren sie vorbeigefahren, fuhr der Opel an, bog an der Kreuzung ab und entfernte sich schnell.
»Wollen wir auch Abstand halten, damit nicht gleich alle weglaufen?«, fragte Oldenbusch und grinste.
»Wir parken selbstverständlich vor der Haustür. Ich spiele hier doch nicht Räuber und Gendarm!«
»Also … na ja«, meinte Oldenbusch zögernd.
Heller seufzte. »Werner, du weißt, wie das gemeint ist.«
Haus Nummer drei war ein großes für sich stehendes Haus mit vier Etagen. Das Grundstück, auf dem es stand, war dagegen sehr klein, ein hoher Holzzaun trennte es vom Gehweg und den Nachbargrundstücken.
Heller stieg aus und warf die Tür ein wenig zu heftig zu, was Oldenbusch mit einem vorwurfsvollen Blick quittierte. Heller ging zur Haustür, die nicht abgeschlossen war, und betrat den kühlen Flur. Für einen Moment stützte er sich an der braun lackierten Hauswand ab, um sein rechtes Bein zu entlasten. Seit einiger Zeit, eigentlich schon seit Monaten, schmerzte ihn wieder der rechte Fuß, obwohl er ihn nicht mehr belastete als sonst und auch kein Wetterumschwung anstand. An der Ostsee hatte er den Schmerz fast vergessen, doch nun war es ihm, als müsste er doppelt dafür büßen. Hatte sich die alte Verletzung in den letzten zwanzig Jahren nur gelegentlich bemerkbar gemacht, schien der Schmerz jetzt dauerhaft und latent pulsierend, er verschwand einfach nicht mehr.
Oldenbusch war hinter ihm in den Flur getreten. Heller stieß sich von der Wand ab und nahm sich der Haustafel an. Sorgfältig verglich er die Namen mit denen in seinem Notizbuch. »Machol und Weichert. Die haben in einem Haus gewohnt. Zweite und dritte Etage. Gehen wir hinauf.«
»Es ist so still hier.« Oldenbusch lauschte. Langsam fiel die Haustür hinter ihm zu.
Heller war auf der Treppe schon einige der blank gebohnerten Stufen hinaufgestiegen. Oldenbusch folgte ihm.
»Es ist keiner da!«, rief plötzlich eine weibliche Stimme aus dem Hausflur. Die beiden Polizisten kehrten wieder um. Eine alte Frau, weitaus älter als Frau Marquart, stand in der Tür zur Erdgeschosswohnung. Sie trug einen schlichten Hausmantel, ihr weißes Haar war zu einem strengen Dutt gebunden und sie stützte sich auf einen Gehstock.
»Kriminalpolizei. Wir wollen zu Frau Machol und zu Frau Weichert.«
»Es ist niemand mehr da. Gar niemand. Die Russen haben alle mitgenommen. Alle im Haus, nur mich nicht.«
»Alle wurden verhaftet?« Jetzt sah Heller, dass die Wohnungstür neben dem Schloss gesplittert und nur notdürftig vernagelt war.
»Ja. Wenn Sie also jemanden suchen, wenden Sie sich an die Russen.« Die alte Frau wollte ihre Tür wieder schließen.
»Moment bitte!«, rief Heller und kam näher, um das Namensschild zu lesen. »Frau Girtlitz. Sagen Sie, sind alle im Haus hier Zeugen Jehovas?«
»Jehovas Zeugen. Ja, wir haben diese Gemeinschaft selbst gewählt, es sind ja nicht mehr viele von uns übrig geblieben.«
»Sie meinen, nach den Verhaftungen im vorletzten Jahr?«
»Ich meine, nach dem Nationalsozialismus! Wir waren einige hundert in Dresden, aber die meisten wurden abgeholt. Die meisten kamen nicht zurück aus den KZ, auch nicht mein Enkel. Auch Herr Machol und Herr Weichert waren zum Arbeitsdienst gezwungen, dann zu zwölf Jahren Zuchthaus verurteilt und letztlich ins KZ gebracht worden. Vier Jahre waren sie in Buchenwald, bis zur Befreiung.«
Heller überlegte einen Moment, wie er fortfahren sollte, ohne seine Kompetenzen zu überschreiten, doch angesichts der Umstände konnte er wohl kaum noch viel Unheil anrichten.
»Wissen Sie vom Tod der Herren Machol und Weichert? Und von den näheren Umständen?«
Frau Girtlitz nickte knapp. »Ich wurde nicht offiziell unterrichtet, weil ich keine direkte Angehörige bin. Aber ich habe davon gehört, ja. Aber, wollen Sie nicht hereinkommen?« Die alte Frau ließ Heller und Oldenbusch eintreten.
Heller staunte über die Größe der Wohnung, doch dann erkannte er, dass die Frau nicht allein hier wohnte.
»Wer lebt denn noch hier?«
»Mein Sohn und die Urenkel.«
»Und alle sind verhaftet worden? Die Urenkel auch?« Heller sah sich noch einmal prüfend um. Es sah nicht danach aus, dass kleine Kinder hier lebten.
Frau Girtlitz schüttelte den Kopf. »Bitte setzen Sie sich, ich kann Ihnen Wasser anbieten. Und hier, das können Sie zur Lektüre mitnehmen.«
Die Frau hielt den Männern zwei Broschüren entgegen. Heller setzte sich an den Esstisch, Oldenbusch folgte seinem Beispiel.
Königreich Gottes, las Heller, während die Frau, die offenbar an einer schmerzenden Hüfte litt, in die Küche humpelte und mit Gläsern hantierte.
»Wissen Sie«, rief sie halblaut, »für uns gibt es nur den einen Führer. Und nur ein Reich. Das Königreich Gottes. Jesus Christus herrscht in diesem Reich, er spricht für uns zu Gott.«
Nun kehrte sie mit zwei Gläsern auf einem Tablett zurück. Oldenbusch sprang von seinem Stuhl auf und nahm ihr das Tablett ab.
»Sie können sich denken, dass es Hitler nicht gefiel, dass wir ihm nicht gehorchten. Unsere Männer verweigerten den Waffendienst, auch heute noch. Deswegen wurden wir angefeindet und werden es nach wie vor. Unter Hitler hat man versucht, uns zu vernichten, und jetzt holen sie sich den Rest.«
»Sie meinen, der Vorwurf der Spionage ist nicht gerechtfertigt?«
»Ich meine, Gott tut, was er tun muss.«
Das war keine Antwort, doch Heller war nicht hier, um das zu erörtern. »Wann haben Sie Herrn Machol und Herrn Weichert zuletzt gesehen?«
»An dem Tag, als sie verhaftet wurden. Wir leben hier wie in einer großen Familie, sehen uns jeden Tag.« Die alte Frau stand immer noch im Zimmer. »Hatten Sie das Gefühl, dass es den beiden nicht gut ging, waren sie krank?«
»Sie waren bei bester Gesundheit«, erwiderte die Frau rasch und blieb unbewegt auf ihren Stock gestützt stehen.
»War Ihnen denn bewusst, dass sie möglicherweise beobachtet wurden und unter Verdacht stehen, Spionage zu betreiben?«
»Natürlich, und es war uns auch klar, dass sie eines Tages kommen und uns alle holen werden. Doch was sollen wir tun? Wir arbeiten, wir beten und es ist unsere Pflicht, den Menschen vom Königreich Gottes zu berichten.«
»Sie meinen, Sie missionieren?«
»Wir versuchen die Menschen zu retten, vom falschen Glauben zu befreien oder von ihrer Gottlosigkeit. Es sind schwere Zeiten für uns.«
Und trotzdem stehen sie es durch, kommentierte Heller in Gedanken. Er konnte das verstehen und dann auch wieder nicht. Offenbar gab ihnen der Glaube den nötigen Halt, alle Unbill zu ertragen. Andererseits machte er ihnen das Leben schwerer als nötig. Und wenn ihr Glaube so stark war, wenn sie so wenig korrumpierbar waren, warum sollten sie dann spionieren? Was konnte ihnen der Westen verheißen, das Jehova nicht konnte.