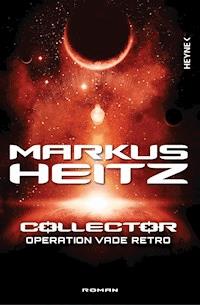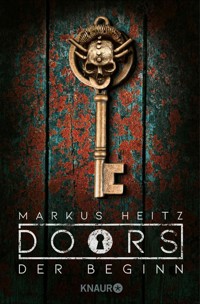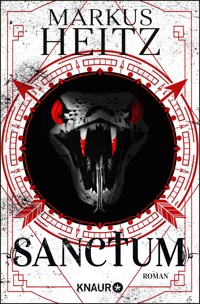
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Pakt der Dunkelheit
- Sprache: Deutsch
»Gott braucht einen Dämon, um den Teufel aufzuspüren.« Rom, Ewige Stadt, Hort uralter Geheimnisse. Hierhin führen die Spuren einer Verschwörung, in deren Mittelpunkt Eric von Kastell steht, der Werwolfjäger. Immer wieder trifft er auf das Vermächtnis einer Frau, die im 18. Jahrhundert um ihr Leben kämpfte: Gregoria, die Äbtissin eines entweihten Klosters. Eric und Gregoria sind untrennbar verbunden durch die heiligste Substanz, die sich auf Erden findet: Das Sanctum kann Wunder wirken – oder den Tod bringen … Sanctum von Markus Heitz: Spannung pur im eBook!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 851
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Markus Heitz
Sanctum
Knaur e-books
Über dieses Buch
»Gott braucht einen Dämon, um den Teufel aufzuspüren.«
Rom, Ewige Stadt, Hort uralter Geheimnisse. Hierhin führen die Spuren einer Verschwörung, in deren Mittelpunkt Eric von Kastell steht, der Werwolfjäger. Immer wieder trifft er auf das Vermächtnis einer Frau, die im 18. Jahrhundert um ihr Leben kämpfte: Gregoria, die Äbtissin eines entweihten Klosters. Eric und Gregoria sind untrennbar verbunden durch die heiligste Substanz, die sich auf Erden findet: Das Sanctum kann Wunder wirken oder den Tod bringen.
Inhaltsübersicht
Prolog
22. Juni 1767, Saint-Alban, Schloss der Familie de Morangiès
Macht Euch nicht lächerlich, Abbé. Die Bestie ist tot.« So, wie Pierre-Charles, Comte de Morangiès, es sagte, klang es nach einem Befehl. Wie immer, wenn die Rede auf das Un-tier kam, das im Gévaudan mehr als drei Jahre lang gewütet hatte.
Abbé Acot saß dem alten Comte gegenüber. Vor ihm stand ein Glas Wein, ein edler Tropfen, wie er ihn nur selten zu schmecken bekam. Obwohl die Sonne durch die geschlossenen Fenster des hohen Raumes fiel und die Hitze drückend über dem Gévaudan lag, schien sie an den dicken Mauern des Schlosses zu scheitern. Dennoch schwitzte der Abbé in seiner einfachen schwarzen Priesterkutte, die angesichts der Pracht um ihn herum wie das schäbige Gewand eines Bettlers wirkte. Kleine Perlen rannen aus den kurzen, schwarzen Haaren über seine Stirn.
Er war kaum dreiundzwanzig Jahre alt und wagte es trotzdem, dem mächtigsten Mann des Gévaudan die Stirn zu bieten – einem Mann mit viel Einfluss am französischen Hof, dem es ein Leichtes wäre, einem einfachen Abbé das Leben schwerzumachen. Dieses Wissen um die möglicherweise nur noch ein paar Worte entfernte Hölle auf Erden half nicht, die Nervosität des Abbés zu besänftigen. Also trank er mehr Wein, als gut für ihn war, doch er benötigte allen Mut, den er aufbringen konnte.
Dabei war der Abbé alles andere als ein furchtsamer Mensch. Er saß nur deswegen im Salon des Schlosses, weil er mit solcher Eindringlichkeit am Tor darum gebeten hatte, eingelassen zu werden, dass es unmöglich gewesen war, ihn abzuweisen. Es ging wirklich um Leben und Tod.
Acot schluckte, wischte den Schweiß von der Stirn und sah dem Mann in die graugrünen Augen. Selbst im Sommer verzichtete der Comte, zugleich Marquis von Saint-Alban, Chevalier de Saint-Louis, Seigneur zahlreicher Pfarreien und einst erfolgreicher Lieutenant Général Seiner Majestät, nicht auf seine Weißhaarperücke und die schwere, bestickte Jacke in Dunkelblau. Beides verlieh ihm eine zusätzliche Aura der Autorität, die jeden Besucher leiser und demütiger sprechen ließ, als es vielleicht notwendig gewesen wäre.
»Es ist ein Wolf erlegt worden, das möchte ich zugestehen, mon Seigneur.«
»Es war die Bestie. Das sollte sich auch bis in die Pfarreien herumgesprochen haben, die Ihr durchwandert, Abbé.« Der Comte hob das Glas. »Lang leben der Marquis d’Apcher und seine Jäger.«
Acot trank den Wein aus. Ein Brennen in seinem Magen zeigte ihm, dass die Säure ihm nicht bekam. Dafür stieg sein Mut. »Und ich bestehe darauf, mon Seigneur: Das Biest streicht noch immer durch die Wälder. Man hat dem Volk einen Wolf gezeigt, und zwar nicht, weil der wahre Anblick der Bestie zu schwer zu ertragen ist, sondern weil sie noch keiner erlegt hat.«
»Abbé!« Morangiès stellte das Glas so hart auf den Tisch, dass es zwischen Stiel und Kelch zerbrach. Der rote Wein ergoss sich über den dunklen Holztisch. »Da seht Ihr, was Ihr mit Euren Torheiten angerichtet habt. Ein edler Tropfen ist verloren gegangen.«
»Torheit, mon Seigneur?« Acot beugte sich rasch nach seiner Tasche, um dem Blick zu entkommen, der ihn für diese Anmaßung mit Sicherheit getroffen hätte, und holte einen Packen handschriftlicher Notizen hervor. »Diese hier sammele ich, seit die Bestie aufgetaucht ist. Ich befrage Augenzeugen, Opfer und Jäger. Und ich habe mir den Wolf, den man durchs Gévaudan schleift, bis er zusammen mit Chastel seinen Weg nach Versailles machen wird, genau angesehen.« Er wedelte mit den Papieren. »Nichts, aber auch nichts stimmt mit dem überein, was die Menschen mir beschrieben haben, mon Seigneur. Die Bestie ist da draußen und wird wieder Menschen fressen!«
Morangiès streckte die beringte Hand nach den Blättern aus. Acot reichte sie ihm zögerlich. »Ihr wisst, dass Ihr gegen das Gebot des Königs verstoßt, indem Ihr behauptet, die Bestie lebt?«, sagte er beiläufig und dennoch drohend.
»Welches Interesse habt Ihr, mon Seigneur, mir und den Pfarreien weismachen zu wollen, dass die Bestie tot ist?«, retournierte der Abbé unerschrocken – und erschrak selbst über den Klang seiner Worte. Nun war er zu weit gegangen … doch er musste den Mann überzeugen, die Jagd nicht aufzugeben! Das war er Gott und den Menschen in dieser Region schuldig.
Morangiès zog die Augenbrauen zusammen. Scheinbar achtlos legte er die Aufzeichnungen neben sich, außer Reichweite des jungen Mannes, und legte eine Hand auf sie. Eine Geste, welche die Beiläufigkeit Lügen strafte. »Wie redet Ihr mit mir? Was wollt Ihr mir da unterstellen, Abbé?«
»Ich unterstelle Euch gar nichts, mon Seigneur. Ich wundere mich nur, dass Dutzende von Menschen das Offensichtliche nicht erkennen wollen.« Er zeigte auf die Notizen. »Darin steht alles. Die Bestie lebt, und die Menschen müssen gewarnt werden.«
»Eure Zweifel werden sich legen, wenn Ihr seht, dass es keine weiteren Opfer mehr gibt«, schwächte der Marquis ab und ignorierte die geöffnete Hand des Abbés, der sein Eigentum stumm zurückerbat. »Bis dahin konfisziere ich im Namen des Königs diese Unterlagen, um die Bevölkerung vor Euren Theorien zu bewahren, die nur neue und sinnlose Unruhe ins Gévaudan tragen.«
»Mon Seigneur, das…«
»… ist meine Pflicht, geschätzter Abbé«, fiel ihm Morangiès in die Rede. »Ich kann nicht zulassen, dass die Männer und Frauen schon wieder in Furcht leben.« Sein rechter kleiner Finger tippte zweimal auf den Stapel. »Und bedenkt, was Ihr mit Euren Mutmaßungen in Versailles anrichtet. Ihr würdet den König der Lüge bezichtigen, und welche Auswirkungen das für Euch haben wird, werdet Ihr Euch selbst ausmalen können.« Er zog an der Klingelschnur, die neben ihm hing. Gleich darauf erschien ein Bediensteter und nahm die Papiere in Empfang. »Ich schütze Euch damit, Abbé. Ihr müsstet mir dankbar sein.«
Die Worte saßen. Acot sank zusammen und starrte auf seine Notizen, die unerreichbar für ihn geworden waren. Er wusste nicht, was er sagen oder tun sollte. Ausgerechnet jetzt wurde kein Wein und damit kein neuerlicher Mut mehr nachgeschenkt.
»Mon Seigneur, Monsieur Jean Chastel erbittet Euer Gehör«, sagte der Livrierte – leise zwar, aber doch so, dass es der Abbé ebenfalls hörte.
»Schick ihn weg.«
»Er sagte, es sei sehr dringend und dass es um Euren Sohn ginge«, beharrte der Bedienstete. »Und um seinen Sohn Antoine.«
Acot stutzte. Dass der Marquis den Helden des Gévaudan nicht empfangen wollte, hatte sicherlich etwas zu bedeuten. Auch der Name des jüngeren Sohnes, Antoine, war ihm mehr als einmal bei seinen Nachforschungen begegnet. Still pries er den Herrn für die Vorsehung und wartete gespannt, was geschah.
Und tatsächlich – der Comte änderte seine Meinung. »Bring ihn herein. Abbé Acot wollte uns eben verlassen.« Morangiès nickte ihm zu, die graugrünen Augen blickten hart. »Einen angenehmen Tag wünsche ich Euch. Denkt an unsere Abmachung und hütet Eure Zunge davor, von Dingen zu berichten, die so nicht stimmen. Ihr würdet es bereuen.«
Acot stand auf und verneigte sich. Er musste sich beherrschen, um sich nicht durch weitere unbedachte Worte unwiderruflich in Misskredit zu bringen. Er dachte keinesfalls daran, mit seinen Nachfragen aufzuhören, aber das wiederum sollte den Marquis nichts angehen.
In der Halle begegnete er Chastel, einem kräftigen Jäger im besten Mannesalter mit langen, weißen Haaren und einem markanten Antlitz. Seine einfache Kleidung hatte gelitten, war angesengt und zerrissen, als sei er durch brennende Dornenbüsche gesprungen. In der Linken hielt er seinen Dreispitz, in der Rechten die doppelläufige Muskete, mit der er die angebliche Bestie vor den Augen des Marquis erlegt hatte.
Acot ging ohne zu zögern auf Chastel zu. »Ich bin Abbé Acot, Monsieur Chastel«, stellte er sich vor. »Ich suchte nach Euch, doch bisher haben sich unsere Wege noch nicht gekreuzt. Helft mir, die Wahrheit zu sehen.« Er trat einen weiteren Schritt an den Mann heran, stand nun direkt neben ihm und neigte den Kopf nach vorn. »Sagt, habt Ihr die wahre Bestie erlegt oder seid Ihr ein Rädchen in diesem verwirrenden Spiel um Wahrheit und Lüge, das weitere Menschenkinder das Leben kosten wird?« Er sprach leise, damit ihn der livrierte Diener nicht verstehen konnte, doch mit großem Nachdruck. »Bei der Liebe Gottes, sprecht die Wahrheit!«
Chastel sah ihn mit merkwürdig verschleiertem Blick an. »Die Liebe Gottes? Ich fürchte, ich habe bislang nur seinen Hass kennen gelernt.« Mit diesen Worten ging er an ihm vorbei und folgte dem Livrierten die Treppen hinauf zum Salon.
Jean Chastel ging nicht zum ersten Mal durch das Schloss, vorbei an getäfelten Wänden und den Porträts der Ahnen, an Landschaftsgemälden, edlem Porzellan und anderem wunderbar zur Schau gestelltem Reichtum. Doch diesmal würdigte er all die Pracht ebenso wenig wie die Andenken aus den Zeiten, als der Marquis noch ein bekannter und bewährter Soldat des Königs gewesen war. Ein Held auf dem Schlachtfeld, ruhmreich, vielfach ausgezeichnet. Und doch genauso verflucht wie ich, dachte Jean.
Endlich stand er vor der Tür des Salons. Sie wurde ihm erst geöffnet, nachdem er noch einmal warten musste, um ihm deutlich zu machen, wie unwichtig seine Gegenwart dem Marquis war. Der Bedienstete machte einen Schritt in den Raum und verkündete laut seinen Namen, dann zog er sich wieder zurück.
Jean wusste, was er tun sollte, doch er fand keinen Anfang, sondern klammerte sich an Hut und Waffe. Erst nach einer Weile suchte sein Blick den seines Gegenübers. »Mon Seigneur«, sprach er mit deutlichem Zittern in der Stimme, »Ihr seht einen verzweifelten Mann vor Euch, dem die Bestie beinahe alles genommen hat, was er liebt.«
»Und dennoch habt Ihr über sie triumphiert, Monsieur. Meinen Glückwunsch dafür.« Der Marquis zeigte mit vornehmem Handschwung auf den Sessel ihm gegenüber. »Nehmt Platz und schildert, was ich für Euch tun kann, Monsieur.«
Jean ließ sich in das Polster sinken. Auf unerklärliche Weise fühlte er sich vor de Morangiès wie ein Schuljunge, der dem Vater gestehen musste, dass er einen Apfel gestohlen oder ein gutes Glas zerbrochen hatte. Der Adlige wirkte trotz der nicht übermäßig protzigen Uniform unglaublich autoritär und beeindruckend, eine wahre Majestät.
»Ich jagte die Bestie jahrelang, mon Seigneur, in vielen Pfarreien, und streckte sie endlich nieder. Aber ich fürchte … es gibt eine zweite, die auf dem besten Wege ist zu entkommen.«
»Eine zweite? Ihr redet so wirr wie Abbé Acot, Chastel.« De Morangiès versuchte es mit Unfreundlichkeit, obwohl auch seine innere Anspannung offenkundig stieg.
Jean schüttelte den Kopf. »Nein, mon Seigneur. Eine der Bestien war … war mein Sohn, den ich mit meinen eigenen Händen getötet habe.« Er schwieg, weil die Gefühle aufstiegen und ihn zu überwältigen drohten. Der Dreispitz vibrierte, da die Finger das Zittern an ihn weitergaben. Jean atmete ein und aus, fing sich und setzte erneut an. »Aber er war nicht die einzige Bestie. Es gibt Hinweise, mon Seigneur, dass Euer Sohn etwas damit zu tun hat.«
De Morangiès starrte ihn an, doch Jean hielt dem Blick stand. Und dann schien sich plötzlich etwas im Gesicht des Adligen zu verändern. Er langte hastig nach seinem Glas und stürzte es hinab. »Ihr seid wahnsinnig, Chastel«, raunte er. »Vollkommen wahnsinnig! Seid Ihr in der Wildnis …«
»Ich bin sicherlich nicht wahnsinnig, auch wenn ich in diesem Aufzug vielleicht den Eindruck erwecken mag. Seit dem Brand im Kloster folge ich der Fährte einer Bestie, die von den Mauern wegführte und quer durchs Gévaudan ging, um letztlich hier zu enden. Ich kenne diese Spuren, mon Seigneur, ich kenne sie sehr genau. Und Ihr auch.«
De Morangiès legte die Fingerspitzen aneinander und schluckte. »Ich sehe keinerlei Verbindung zu meinem Sohn, Chastel«, sagte er und hielt die Maskerade aufrecht, so gut es ging, aber der unstete Blick, der es nicht wagte, Jeans Augen zu treffen, verriet zu viel.
Diese Unsicherheit machte Jean mutiger. »Es war Euer Sohn, mon Seigneur, der uns aus dem Gefängnis von Saugues befreit und vor der Strafe bewahrt hat.« Er stand auf, warf den Dreispitz auf den Stuhl und lehnte die Muskete gegen die Lehne. »Und Euer Sohn, mon Seigneur, kennt meinen Sohn aus den Tagen in der Fremde. Ich weiß nicht, was sich damals ereignete, aber ich bin mir sicher, dass sie mehr als nur Bekannte waren.« Jean beugte sich über den Tisch. »Bei den Toten, die mein Sohn und Euer Sohn zu verantworten haben, bitte ich Euch, die Wahrheit zu offenbaren: Ist Euer Sohn eine Bestie? Kennt er die Frau, die das Bestienweibchen ist? Trägt er die Schuld, dass mein Antoine zum reißenden Tier geworden ist, und unterrichtete er ihn im Morden, mon Seigneur? Sagt mir, was Ihr wisst!«
Der Marquis sah minutenlang auf den Tisch, abwesend und mit immer bleicherem Ausdruck, dann senkte er den Kopf und bedeckte das Gesicht zur Hälfte mit der Hand. »Es ist ein furchtbarer Fluch, Chastel«, flüsterte er verzweifelt. »Er kann nichts dafür.«
»Er ist nicht länger Euer Sohn, nicht mehr der Mensch, den Ihr einst in die Welt gesetzt habt, mon Seigneur. Ich … auch ich selbst habe lange Zeit gebraucht, um mir einzugestehen, dass Antoine für immer verloren ist.« Jean kannte die Gefühle, die im Marquis tobten; dennoch gewährte er ihm kaum Mitleid. Der Adlige hatte die Taten seines Sohnes zu lange gedeckt und hätte es weiterhin getan, wenn er nicht erschienen wäre, um ihn zur Rede zu stellen. »Das Feuer im Kloster ist sein Werk, mon Seigneur, daran gibt es keinen Zweifel für mich. In den Flammen starben mein zweiter Sohn und seine Verlobte.« Er sah dem Marquis fest in die Augen, doch merkte schon, wie ihn seine Gefühle zu übermannen drohten. »Das Sterben muss enden.«
»Ihr … Ihr verlangt das Leben meines Sohnes?«
Jean berührte den Lauf seiner Muskete. »Ich habe allen Grund, danach zu trachten. Und wenn wir ihn nicht aufhalten, mon Seigneur, wird er weiter sein Unwesen treiben und mit der Frau noch mehr Bestien erschaffen. Denkt an die Menschen Eurer Heimat!« Er sank vor dem Marquis auf die Knie und hob bittend die Arme, die leeren Handflächen nach oben gereckt. »Helft mir, mon Seigneur, Euren Sohn ausfindig zu machen und ihn zusammen mit seiner Gefährtin zu töten, damit sie den Keim des Bösen nicht weitergeben.« Tränen liefen ihm über die Wangen. »Verhindert das Leid weiterer Unschuldiger, ich bitte Euch. Lasst sie nicht erleiden, was ich erlitten habe.« Er senkte das Haupt.
De Morangiès schluckte, streckte die rechte Hand aus und berührte Jeans Schulter. »Steht auf, Chastel. Ich kann … Ich kann Euren Wunsch unmöglich erfüllen!«
Der Wildhüter stemmte sich mit Hilfe seiner Muskete auf die Beine. »Euer Sohn ist ein Dämon und kein menschliches Wesen, mon Seigneur«, flüsterte er. »Durch ihn verbreitet sich dieser Fluch weiter und weiter. Euer Sohn ist vor mir geflohen.« Dabei wandte er sich wieder dem Marquis zu. »Er weiß, dass ich sein Geheimnis kenne.«
De Morangiès rang nach Atem, nahm ein Glas und goss sich Wein ein, stürzte ihn hinab und schenkte sich wieder nach. Wieder trank er die Hälfte auf einen Zug. »Vielleicht habt Ihr Recht, Chastel«, sprach er tonlos. »Vielleicht ist François’ Stunde und die seiner Gefährtin gekommen. Ich kann und will ihn nicht länger decken. Meine Zaghaftigkeit tötete genügend Unschuldige, und mein Gewissen hat sich seit Jahren nach einem Mann wie Euch gesehnt, Chastel. Ich selbst … ich konnte es einfach nicht.« Er suchte Jeans Blick, und auf einmal zeigten seine Augen keine Spur mehr von Unsicherheit. »Aber wenn ich Euch sagen soll, was ich weiß, habe ich eine Bedingung.«
»Welche wäre es, mon Seigneur?«
»Niemand darf jemals die Wahrheit erfahren. Tötet ihn aus dem Hinterhalt, in einem vermeintlichen Duell, lasst es nach einem Kampf aussehen, das ist mir gleich. Aber niemand soll den Eindruck haben, dass François etwas mit der Bestie des Gévaudan zu tun hatte.«
»Das werde ich.« Jean verneigte sich, dankbar, die Geschichte zum Abschluss bringen zu können und die Bestien auszurotten.
»Was wisst Ihr von dieser Sache, Chastel? Lasst uns offen miteinander sein … Erzählt mir alles.«
»Ich ahne vieles und weiß nichts.« Jean begann mit seinem Bericht an jenem Tag im Wald bei Vivarais, als sie den ersten Werwolf erschossen hatten. Wie der Leidensweg von Antoine begann und er sich immer weiter zu einer mordenden Bestie entwickelt hatte; wie er seinen Bruder und ihn in Gefahr gebracht hatte, was ihnen Malesky über die Wandelwesen berichtet konnte und wie sie Antoine schließlich im Wald töten mussten. Dabei verschwieg er auch nicht das Gefecht mit den Unbekannten, die an einem lebenden Werwolf interessiert gewesen waren.
De Morangiès hörte zu und unterbrach ihn kein einziges Mal, dann schloss er die Augen. »Es ist, wie Ihr vermutet habt, Chastel«, gestand er langsam. »Mein Sohn François ist ein Loup-Garou. Der Fluch traf ihn auf seiner Reise im Mittelmeer, als er seinem König diente. Von diesem Moment an veränderte sich mein Junge. Er wurde unstet, änderte seinen Lebenswandel und wurde ein Herumtreiber, der brutale Neigungen und seinen Hang zu Frauen auslebte.« Er hob die Lider und sah Jean an. »Er war einst ein guter, freundlicher Junge, Chastel. Aber die Bestie in ihm hat ihn zu einem wilden Tier gemacht. Ich wollte es nicht wahrhaben, dachte an eine Gemütskrankheit oder eine Bedrückung der Seele und machte mir weis, ich sei schuld. Weil ich, der bewährte Kämpfer für den König, zu viel von ihm gefordert hätte. Doch in einer Vollmondnacht sah ich mit eigenen Augen, was aus ihm geworden war.« Er bedeckte sein Gesicht erneut mit den Fingern und schluchzte. »Aber er ist immer noch mein Sohn, Chastel. Ich klammerte mich an die Hoffnung, dass es ein Mittel dagegen gäbe, und versuchte vieles, für das Gott mich im Jenseits strafen wird.«
Jean spürte eine Spur Mitleid für den Marquis, das sich gegen die Wut auf den Mann stemmte, der ein mörderisches Wesen hatte frei umherlaufen lassen.
»Er ließ sich nicht einsperren, Chastel«, raunte de Morangiès mit bebenden Schultern. Er erahnte die Gedanken des Wildhüters. »Er lachte mich aus und lebte sein Leben. Aber als die Morde geschahen und er nachweislich nicht an den Orten gewesen sein konnte, glaubte ich an seine Unschuld. Oder besser gesagt«, er senkte den Blick, »ich redete mir ein, dass er unschuldig war, und machte Jagd – wie er – auf die andere Bestie.«
»Auf meinen Sohn, der von Eurem Sohn lernte, mon Seigneur.«
»Ja, vermutlich wird es so gewesen sein«, sagte der Marquis erschüttert.
Schweigend saßen sie im Salon. Der eine Mann trauerte um seine Söhne, der andere bereitete sich auf den Tod seines eigenen Sprösslings vor, während die Nacht hereinbrach und die Livrierten erschienen, um die Kerzen zu entzünden.
De Morangiès verlangte nach einer neuen Flasche Rotwein, noch bevor er die andere leerte. »Auch ich habe gelernt, Chastel. Mit der Krankheit meines Sohnes und den Morden gingen weitere merkwürdige Begebenheiten einher.« Er ließ etwas zu essen bringen. In seiner Stimme steckte der Alkohol, machte sie undeutlicher und dramatischer. »Menschen, die nach meinem Sohn suchten, tauchten im Gévaudan auf. Die Art der Morde, die er abseits im Vivarais begangen hatte, lockte sie an. Der Legat, den Ihr erschossen habt, war nur einer davon.« Er bedeutete seinem Gast, sich zu stärken und von dem Braten, dem Brot und dem Gemüse zu nehmen, das gerade hereingebracht wurde.
»Die Männer im Wald waren diese anderen, mon Seigneur?« Jean nahm sich Brot und schnitt Fleisch von der gebratenen Hirschkeule.
»Ihr habt es erfasst. Es waren aber keine Italiener, wie Ihr angenommen habt, sondern Rumänen.« Er stand auf, ging zu einem Sekretär und öffnete eine kleine Schublade. Mit etwas Metallischem, Goldenem kehrte er zurück und legte es vor Jean auf den Tisch. »Das haben wir einem von ihnen abgenommen, als sie zum ersten Mal im Gévaudan auftauchten.«
Jean sah eine goldene Kette mit festen Gliedern; der Anhänger bestand aus einer dicken Fassung, in die ein Reißzahn eingelassen war. Ein Reißzahn, wie er nur zu einem Loup-Garou passte! »Wer sind sie?«
»Sie nennen sich selbst Orden des Lycáon. Sie verehren die Bestien und streben nach der vermeintlichen Göttlichkeit, die sie der Sage nach durch Zeus erhalten haben. Sie suchen nach den Loup-Garous, beschützen sie vor Gefahren und trachten danach, in einem Ritual von ihnen entweder gebissen oder zerfleischt zu werden. Wie es für einen Akoluthen endet, hängt von dem Willen des Loup-Garou ab.«
»Wahnsinnige!« Jean konnte nicht fassen, was er da hörte. Das bedeutete, dass seine Arbeit mit François’ Tod lange nicht beendet war. Er würde nicht ruhen können, bevor er nicht auch diesen Orden ausgemerzt hatte. »Wisst Ihr mehr über sie, mon Seigneur?«
»Nicht mehr, als ich Euch bereits sagte. Ich ahne nur, dass mein Sohn die Geheimnisse des Ordens kennt.«
»Und wo finde ich ihn, mon Seigneur?«
De Morangiès legte die Hände zusammen. Ein letztes Mal überlegte er, haderte mit seiner Entscheidung. »Rom«, sagte er schließlich. »Er ist nach Rom gereist, um eine Sache zu Ende zu bringen, wie er meinte.« Der Marquis wischte sich die Hände an einer Serviette ab, kehrte zum Sekretär zurück und nahm Tinte und Federkiel zur Hand. »Das ist die Anschrift der Absteigen, die er gern benutzt. Ich schreibe Euch außerdem den Namen von zwei seiner Freunde auf. Solltet Ihr mit den Adressen nicht weiterkommen, fragt sie nach Beistand.« Er schrieb das Blatt beinahe voll, danach setzte er einen großen Tropfen Siegellack darunter und drückte seinen Ring hinein. »Das ist alles, was ich für Euch tun kann, Chastel.« Er legte einen Beutel dazu. »Das sind einhundert Livres. Sie werden Euch ein wenig helfen, hoffe ich. Solltet Ihr weitere Unterstützung benötigen, lasst es mich wissen.«
»Ihr seid sehr großzügig, mon Seigneur.«
De Morangiès kehrte an den Tisch zurück und reichte Beutel und Blatt an den Wildhüter. »Nein, ich bin nicht großzügig. Ich erkaufe mir nur Euer Schweigen, Chastel. Mein Gewissen kann ich nicht mehr reinwaschen. Nehmt das Geheimnis meiner Familie eines Tages mit ins Grab und vergebt mir heute schon, einem bangenden Vater, dass ich nicht eher handelte, wie Ihr es bei Eurem Sohn Antoine getan habt.«
»Ich werde nichts erzählen, mon Seigneur. Das gelobe ich.« Jean stand auf. »Was ist mit seiner Gespielin, die meinen Antoine zum Loup-Garou machte? In welcher menschlichen Gestalt verbirgt sie sich?«
»Ich kann es euch nicht sagen. Ich habe die Ausgeburt der Hölle nur einmal gesehen, in ihrer abscheulichen Gestalt. Doch soweit ich weiß, ist sie fort, und ich lasse bereits von meinen Männern überall nach ihr suchen. Überlasst sie mir, damit Ihr das blutige Handwerk nicht allein ausüben müsst.« Der Marquis strich gedankenverloren über das Silberbesteck.
»Ja, mon Seigneur.« Jean wollte gehen, da ergriff der Marquis seinen rechten Ärmelaufschlag.
»Eines noch: Tötet meinen Sohn schnell, Chastel. Auch wenn er Euch unvorstellbares Leid zugefügt hat, rächt Euch nicht auf diese Weise. Bedenkt, dass er wie Euer Sohn Antoine ein Opfer geworden ist.«
»Wenn es in meiner Macht liegt, wird ihm eine einzige Silberkugel aus dieser Muskete die Erlösung bringen.« Jean verneigte sich vor dem alten Marquis und verließ eilends das Schloss.
Die Sorge um die einzige Person, für die er noch inbrünstige und aufrichtige Liebe empfand, trieb ihn vorwärts, geradewegs zu dem Pferd, das er sich für sein letztes Geld gekauft hatte.
Als er sich in den Sattel schwang, bemerkte er den roten Kratzer am Handgelenk, den er seit jenem Tag trug, an dem er Antoine getötet hatte.
Er war noch immer nicht verheilt.
Und er brannte wie Feuer.
I. Kapitel
Kroatien, Plitvice, 23. November 2004, 10:11 Uhr
Es schneite so stark, als wolle Gott die Sünden der Welt unter einem dichten, weißen Mantel verbergen.
Eric von Kastell saß in der kleinen Wartehalle des Gelegenheitsflughafens und hasste das Wetter. Der Kaffee, den er von einer netten Mitarbeiterin bekommen hatte – der einzigen Mitarbeiterin – war unglaublich stark und schrie nach einem halben Liter Milch und einem Pfund Zucker. Obwohl er beides nicht bekam, trank Eric die schwarze Brühe. Immerhin wusste er, dass sie seinem Herz keinen bleibenden Schaden zufügen konnte. Zumindest diese eine Sicherheit war ihm geblieben.
Er trug einen Schneetarnanzug und einen schwarzen Mantel darüber, in der Linken hielt er die Tasse, in der Rechten das Handy, das seit dem Anruf seiner Schwester hartnäckig schwieg. Kein Anatol, keine Justine. Es blieb tot. Tot wie die Nonne im Hotel.
Eric stand auf, schaute aus dem Fenster und versuchte, die graue Wolkendecke, die gelegentlich zwischen den weißen Flocken zu erkennen war, mit wütenden Blicken zu verscheuchen. Er musste hier weg, so schnell wie möglich. Lena brauchte ihn. Er brauchte Lena. Dringend.
Hinter ihm klapperte eine Tür, kalter Wind ließ ihn frösteln und trug ihm den Geruch eines unbekannten Menschen zu. Dem süßen Parfüm nach zu urteilen war es eine Frau, obwohl die modernen Unisexdüfte es seiner Nase zunehmend schwerer machten, zwischen den Geschlechtern zu unterscheiden. Eine Nylonjacke raschelte, Stiefel polterten gegen den Türrahmen, Eisstückchen fielen klirrend auf den alten Linoleumboden und zerbrachen.
Er nippte an der Tasse und wandte sich langsam um. Er sah eine Frau in einer dicken, hellgrünen Daunenjacke, die ihren Kopf mit einer Sturmmaske vor dem eisigen Wetter schützte; darüber trug sie eine Mütze und einen Schal. Für einen Augenblick wünschte sich Eric, dass es seine Halbschwester Justine wäre, dass sie sich nur einen Scherz mit ihm erlaubt hatte. Doch natürlich wusste er, dass es nicht so sein konnte. Justine machte keine Scherze. Das lag, wie er widerwillig zugeben musste, in der Familie.
Die Frau knotete den Schal auf, zog Mütze und Haube ab und ging zum Schreibtisch, hinter dem die Flughafenmitarbeiterin saß und ein Computerspiel spielte. Sie führten eine kurze Unterhaltung auf Kroatisch, dann gab ihr die Blonde eine Mappe. Die Mitarbeiterin öffnete sie und nahm Stempel und einen Stift zur Hand. Frachtpapiere.
Anscheinend fehlte etwas. Die Frau tastete an sich herum, wühlte zuerst in den Außentaschen, dann öffnete sie die Jacke, die Hand glitt in die Taschen des Innenfutters. »Verdammt«, fluchte sie. »Wo ist denn …« Von ihr unbemerkt fiel ein gefaltetes Blatt Papier heraus und segelte unter den Tisch.
Eric trat zu ihr, bückte sich, hob den Zettel auf und reichte ihn ihr. »Suchen Sie den?«
Sie sah ihn verwundert an, danach richteten sich ihre hellgrünen Augen auf das gesuchte Dokument. »Gott sei Dank«, sagte sie erleichtert und nahm das Papier entgegen. »Sie haben mir unglaublich viel Warterei erspart.« Sie lächelte. »Einen Moment, bitte.« Sie wandte sich der Flughafenmitarbeiterin zu und verfiel ins Kroatische. In kurzer Zeit wurde alles Notwendige geregelt.
Die Blonde drehte sich wieder zu ihm. »Nochmals vielen Dank«, sagte sie. »Wie kann ich mich erkenntlich zeigen? Sind Sie an der Wettervorhersage interessiert?«
»Nur, wenn Sie mir sagen, dass es zu schneien aufhört«, erwiderte Eric.
»Irgendwann sicher«, antwortete sie lakonisch, nahm eine Tasse vom Beistelltisch und schenkte sich von dem Kaffee ein.
»Wann hört es auf?«
»Im Radio haben sie gesagt, gegen Nachmittag.« Sie kostete und verzog das Gesicht. Dann begann sie, Eric über den Tassenrand hinweg zu mustern. Ihre Reaktion auf ihn fiel deutlich positiver aus. Er hatte ihr Interesse geweckt. »Sie sehen nicht aus wie ein Tourist.« Sie prostete mit der Tasse in seine Richtung. »Ich bin Isis Kristensen.«
Er stieß mit ihr an. »Simon. Simon Smithmaster«, stellte er sich vor. Unter normalen Umständen wäre er auf ihre Neugier eingestiegen, hätte geflirtet und sie vielleicht sogar auf dem gemeinsamen Flug in der Toilette genommen … Aber seit er Lena kennen gelernt hatte, war sein Appetit auf andere Frauen versiegt. »Ich war zu Besuch hier. Alte Freunde von mir wollen eine Pension eröffnen, und ich habe ihnen ein bisschen beim Umbau geholfen.«
»Dann sind Sie von Beruf … was?« Isis betrachtete seine Hände. »Maurer?«
»Nein, ich bin einfach nur recht geschickt, was die Finger angeht.« Alte Gewohnheiten legte man offensichtlich doch nicht so leicht ab, wie er gedacht hatte. Eric unterdrückte ein Grinsen und fuhr mit einem deutlich weniger auf einen Flirt hinauslaufenden Tonfall fort: »Ich kann fast alles, was man auf dem Bau so braucht.« Er musterte sie. »Und Sie?«
»Habe was abgeholt.«
»Muss was Größeres sein.« Eric deutete mit der Kaffeetasse auf die kritzelnde und stempelnde Mitarbeiterin, die in dem Moment nach einem Ordner griff, ihn aufschlug und darin blätterte. »Sie sucht Ausfuhrvorschriften, nehme ich an. Wollen Sie einen der Seen mitnehmen?«
Isis grinste. »Nein, will ich nicht. Aber bei lebenden Tieren wird es immer etwas komplizierter. Auch wenn es nur ein Fischotterpärchen ist.«
»Verstehe.« Er steckte sein Handy ein und fuhr sich durch die halblangen schwarzen Haare, um die Strähnen aus seinem Gesicht zu wischen.
Isis trank und blitzte ihn über den Rand der Tasse hinweg an. »Wohin geht es denn?«
»Zuerst nach Rijeka und von dort nach … Triest.« Beinahe hätte er ihr seinen wahren Zielort genannt. Aber da es Isis nichts anging, belog er sie lieber. »Wohin bringen Sie Ihre Fischotter?«
»Erst einmal nach Rijeka. Von dort bringt mich der Flieger nach Wien.«
»Die Tiere sind für die Nachzucht im Zoo, nehme ich an?«
»Nein. Sie sind für einen Zirkus bestimmt. Wir arbeiten an einer neuen Nummer mit Fischottern, und weil es im Nationalpark derzeit ein paar zu viele gibt, haben wir ihnen ein junges Pärchen abgekauft.« Sie schaute an ihm vorbei zum Fenster hinaus. Isis spürte wohl, dass sich der Mann nicht für sie interessierte, und schenkte nun ihrer Umwelt mehr Beachtung. »Es lässt nach. Sieht für unseren gemeinsamen Flug gut aus.«
Die Mitarbeiterin sagte etwas, knallte den letzten Stempel auf das letzte Blatt, klappte die Mappe zu und stand auf, um Isis die Unterlagen zurückzureichen.
»Ich muss raus, die Tierchen zeigen.« Isis wickelte sich wieder dick ein und folgte der Frau hinaus in den lange nicht mehr so heftigen Schneefall. Eric war allein.
Sofort kehrten die Erinnerungen an die vergangenen Tage zurück. Der Tod seines Vaters. Lenas Entführung. Die Nachricht der Schwesternschaft, dass er nach Rom kommen sollte, wenn er sich um Lena sorgte. Der Kampf gegen die Lycaoniten. Und dann auch noch der Tod von Schwester Ignatia, den er nicht beabsichtigt hatte. Ganz zu schweigen von diesem ominösen Fauve, der ihn wie ein Phantom verfolgte und seine Geheimnisse kannte. Seine dunkelsten Geheimnisse, die Fauve auf Film gebannt hatte und mit denen er ihn erpressen würde. Oder wollte er mit ihm spielen, ihn quälen? Ihn … ausschalten? Fauve trieb ein sehr undurchsichtiges Spiel. Nur eins stand fest: Gerieten die Aufnahmen mit dem toten Mädchen und ihm der Polizei in die Finger, würde seine bisherige Tätigkeit als Schutzengel der Menschheit unmöglich werden.
Nein, es waren keine guten Zeiten. Besser gesagt: Es war die schlechteste aller bescheidenen Zeiten, die er im Augenblick ertragen musste. Er fühlte sich jeglicher Kontrolle beraubt, als Spielball von verschiedenen Organisationen, von der Schwesternschaft bis zu den Lycaoniten. Jeder wollte ihn für seine eigenen Ziele in seine Gewalt bringen.
»Scheiße«, fluchte er halblaut und leerte seine Kaffeetasse. Wie sehr er es doch verabscheute, nur reagieren statt agieren zu können! Es wurde für ihn jede Sekunde deutlicher, dass sein bisheriges Leben nicht mehr in der Art funktionierte, wie es das in den vergangenen Jahren getan hatte. Zu viele Menschen wussten von ihm und von dem, was er tat. Und wie er es tat.
Eric musste lachen. Das bedeutet, dass ich entweder sehr viele Menschen umbringen oder ganz offiziell sterben muss, um in Ruhe gelassen zu werden.
Die beiden Frauen kehrten zurück, schüttelten sich den Schnee von der Kleidung und pellten sich aus den vielen Lagen von Jacken und Pullovern, die sie gegen die Kälte vor der Tür geschützt hatten. Isis trug ein enges blaues Hemd und eine passgenaue schwarze Hose. Eric registrierte ihren sehr trainierten Körper, der die rundliche Flughafenmitarbeiterin plump aussehen ließ.
»Entweder Trapezkünstlerin oder Bodenturnerin«, sagte er anerkennend.
»Tierpflegerin … aber ich muss auch wie alle anderen beim Aufbau mit anpacken«, erklärte Isis belustigt. »Nebenbei kümmere ich mich noch ein bisschen um die Küche, aber mit den Artisten habe ich nichts zu schaffen. Ich bin nicht beweglich genug, und meinen Tieren macht das nichts aus.« Sie verzichtete auf den Kaffee, den ihr die Frau anbot, und sprach kurz mit ihr. »Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich halte mich an einen Tee. Noch ein Kaffee und mein Herz setzt aus.«
Eric wollte eben etwas erwidern, da vernahmen sie deutliches Motorenbrummen. Zwei trübe Kreise leuchteten plötzlich im grauen Himmel auf und schwebten dicht nebeneinander zur Erde herab. Die Flughafenmitarbeiterin starrte aus dem großen Fenster, dann packte sie das Funkgerät und schrie in das Mikrofon.
»Sie sagte, dass er keine Landeerlaubnis hat«, übersetzte Isis, »woraufhin er meinte, dass sie sich ihre Anweisungen irgendwohin schieben soll. Er müsse landen, geräumte Piste oder nicht.«
Das Dröhnen wurde lauter. Die Maschine tauchte aus den Schneeflocken auf, rauschte über die Piste, zog weiße Schleier hinter sich her und schien nicht zu bändigen zu sein. Ein unerfahrener Pilot hätte sicherlich einen Crash verursacht, aber der Mann im Cockpit verstand sein Handwerk. Das Flugzeug beschrieb einen Bogen und kam endlich vor dem Hangar zum Stehen.
»Das war eine ziemliche Meisterleistung«, sagte Isis. »Ich habe gedacht, dass er über die Landebahn schießt und sich in den Schnee bohrt.«
Sie verfolgten, wie der Pilot ausstieg und auf das Gebäude zukam, ein schwarzes Köfferchen in der rechten Hand. Er hatte kaum die Tür geöffnet, da bekam er von der Mitarbeiterin eine Flut von Beschimpfungen an den Kopf, die er mit einem Lachen und einer Handbewegung abtat. Er nahm sich einen Kaffee, gab ihr einen dicken Schmatzer auf die Wange und setzte sich lässig hinter den Schreibtisch.
Eric grinste. »Da soll mal einer sagen, die Abenteurer unter den Männern seien ausgestorben.«
Die Flughafendame beruhigte sich. Sie versetzte dem Mann einen spielerischen Schlag gegen den Oberarm, dann lachte auch sie. Während die beiden sich angeregt unterhielten, bearbeitete sie seine Papiere, die er ihr aus dem Köfferchen reichte. Als sie damit fertig war, sprach sie Isis an.
»Sie sagt, wir können schon mal zur Maschine gehen. Unser Held der Lüfte wird noch tanken und die Ladung verstauen. In einer halben Stunde heben wir ab.« Sie streifte Pullover und Jacke über, nahm ihr Handgepäck und schlenderte zur Tür. Eric folgte ihr.
Sie stapften durch den Schnee zur zweipropellrigen Maschine, einer ziemlich mitgenommenen Dornier 328. Sie stiegen durch die schmale Luke ins Innere und machten es sich auf den abgewetzten Sitzen bequem.
Anscheinend hatte die Dornier einige Umbauten über sich ergehen lassen müssen. Eric kannte den Typus Maschine, der in Deutschland für Kurzstreckenflüge eingesetzt wurde. Keine Maschine hatte so ausgesehen wie diese hier. Die Anzahl der Sitze war auf zwanzig reduziert worden, die Decke war niedriger, dafür befand sich eine türlose Zwischenwand im hinteren Teil der Kabine. Er wollte gar nicht wissen, was der Pilot Illegales dahinter verbarg.
Nach und nach gesellten sich weitere Passagiere zu ihnen, sodass sie bald zu elft in der Maschine saßen. Die Männer und Frauen unterhielten sich nicht, schauten entweder aus dem Fenster oder packten Zeitschriften aus und lasen.
»Was machen Sie in Triest?«, nahm Isis die Unterhaltung wieder auf, um nicht schweigend in der Maschine zu sitzen und sich zu langweilen. »Noch eine Pension hochziehen?«
»So ähnlich.«
»Schon gut, ich frage nicht weiter.« Sie stand auf und ging nach hinten, wo der Pilot gerade zusätzliche Fracht zwischen den leer gebliebenen Sitzen verstaute.
Eric seufzte und schloss die Augen. Er würde schlafen oder wenigstens so tun, um einen Grund zu haben, sich nicht mit ihr unterhalten zu müssen. Es gelang ihm, die Strategie beizubehalten. Er hörte, wie sich Isis und der Pilot unterhielten, und spürte, dass ihm eine Karte zwischen die Finger geschoben wurde, dann erwachten die Motoren zum Leben.
Das gleichmäßige Dröhnen schwoll an, die Dornier beschleunigte und presste die Passagiere in die Sitze. Schließlich hob sie ab. Eric spürte das vertraute, aufregende Ziehen im Bauch, wie er es als Kind auf der Schaukel genossen hatte. Es ging in den Steigflug, das Flugzeug rüttelte und bockte, doch schließlich beruhigte es sich. Eric schlief ein.
Erst als die Maschine auf der Landebahn von Rijeka aufsetzte, schreckte er aus seinem Schlaf hoch. Die Karte war ihm aus der Hand gefallen, sie lag auf dem verdreckten Teppichboden zwischen seinen Stiefeln.
Isis saß neben ihm, schaute zu ihm und schenkte ihm ein flüchtiges Lächeln. »Jetzt haben Sie unseren Flug vollkommen verpasst. Die Wolken sahen toll aus.« Sie schnallte sich ab und reichte ihm die Hand. »Hat mich gefreut, Sie kennen zu lernen, Simon.«
»Ebenfalls«, erwiderte er noch leicht verschlafen und rückte seine Brille zurecht. »Sagen Sie, wie hieß der Zirkus noch gleich? Vielleicht komme ich mal vorbei.«
»Er heißt Fratini. Wir haben eine Website mit den Tourneedaten – wenn Sie es wirklich ernst meinen sollten … Bis dann, Simon.« Sie verschwand, vermutlich in den Frachtraum zu ihrem Fischotterpärchen.
Eric hob die Karte auf. Eine Visitenkarte des Piloten, Mailadresse und Handynummer inklusive. Offenbar hegte der Mann die Hoffnung, dass er seine Dienste eines Tages noch mal in Anspruch nahm. Eric steckte sie ein, nahm sein Handgepäck und stieg aus der Dornier. Er war der letzte Passagier, die anderen hatten die Maschine bereits verlassen.
Er musste einhundert Meter über das Rollfeld bis zum Terminal laufen. Dabei kam er an einigen großen, bunten Fahrzeugen mit der Aufschrift Fratini vorüber, die vor einem gewaltigen Frachtflugzeug parkten und auf das Verladen warteten. Erics empfindliche Nase bemerkte die unterschiedlichsten Wildtiergerüche, von Löwen über Tiger bis zu Bären. Das war die Menagerie, von der Isis gesprochen hatte.
Plötzlich rannten einige Männer und Frauen auf die Lastwagen zu, schwenkten Transparente, riefen Parolen und machten sich sofort an den Verriegelungen der Auflieger zu schaffen. Ein Kamerateam lief neben ihnen her und filmte sie. Die Türen flogen auf, dahinter kamen große Käfige und Transportboxen zum Vorschein.
Die Frachtarbeiter des Flughafens eilten herbei, wurden aber von den Eindringlingen mit den Transparenten abgedrängt und festgehalten. Die ersten Schlösser an den Käfigen wurden aufgebrochen, lautes Brüllen und aufgeregtes Fauchen erklang.
Eric war sich nicht sicher, was er nun tun sollte. Einerseits ging es ihn nichts an, wenn Pseudotierschützer ihre Aktionen durchführten … aber andererseits bedeuteten umherlaufende Bären und Löwen auf dem Flughafen eine nicht geringe Gefahr für die Gäste. Trotzdem, er hatte überhaupt keine Lust, den Helden zu markieren, schon gar nicht vor der Kamera … »Scheiße!« Er ließ sein Gepäck fallen und hastete auf die Lkw zu.
Einer der Tierschützer stellte sich ihm in den Weg, aber bevor der Mann den Arm heben konnte, bekam er Erics Faust mitten auf die Nase. Aufheulend stürzte er auf den rissigen Asphalt und blieb liegen.
Erics Ziel war die Frau, die sich am nächstgelegenen Käfig zu schaffen machte. Hinter den Gitterstäben tobte ein gewaltiger Eisbär und warf sich mit seinen sicherlich fünfhundert Kilogramm gegen die Tür seines Gefängnisses, das unter der Wucht und der Kraft erzitterte. Was ein ausgewachsener, wütender Eisbär anzurichten vermochte, wusste Eric: Er würde der Frau den Kopf von den Schultern schlagen. Aber … etwas an der Raserei des Bären war merkwürdig. Eric konnte es nicht genau einordnen, doch für einen Moment schien es ihm so, als würde das Tier nicht seine Wut und Verunsicherung herausbrüllen, sondern versuchen, seine selbsternannte Befreierin vom Wagen zu vertreiben.
Die Frau ließ sich nicht beirren, hob den Bolzenschneider und durchtrennte die Bügel des Schlosses. Alles, was den Eisbär nun noch am Ausbruch hinderte, war ein Metallstift, nach dem sie gerade ihre Finger streckte.
Endlich erreichte Eric sie. »Nein«, rief er und hielt ihre Schulter fest. Sie schlug mit dem Bolzenschneider nach ihm, er tauchte unter dem schweren Werkzeug ab und versetzte ihr einen harten Schlag gegen das Kinn. Sie verdrehte die Augen und fiel vor ihm auf den Boden.
Ein Mann kam dazugesprungen. Er hielt einen Hammer und schlug damit nach Eric. Seine Kämpferinstinkte ließen ihn sich ducken und bewahrten ihn vor Schaden – aber der schwere Hammer krachte gegen den Bolzen und zerschlug ihn; hell klirrend fielen die Trümmerstücke auf den Boden.
Der Mann schaute nach der Kamera und rief auf Englisch: »Freiheit für die gefangenen Kreaturen!« Dann zückte er eine Taserwaffe, die elektrisch geladene Pfeile verschoss. Offensichtlich wollte er dem Freiheitsdrang des Eisbären nachhelfen.
»Du beschissener Idiot!« Eric versetzte ihm einen Tritt gegen den Oberkörper. Der Mann krachte gegen die Aufbauten des Lkw und rutschte benommen daran zu Boden. Dennoch feuerte er den Taser ab, die erste Nadel prallte gegen einen Gitterstab, die zweite traf das Tier und jagte ihm einen kurzen Stromstoß durch den Leib, bevor Eric den Mann mit einem harten Schlag richtig außer Gefecht gesetzt hatte.
Der wütende Eisbär tobte fürchterlich und sprang. Die Tür gab auf der Stelle nach. Der Bär landete schwer auf dem rissigen Asphalt und richtete sich sofort vor Eric auf die Hinterbeine auf. »Ich war es nicht«, sagte Eric mit einem gequälten Grinsen und zog seine Pistole. Er wusste, dass es schwierig sein würde, den Angreifer mit der verhältnismäßig kleinkalibrigen Waffe aufzuhalten. Doch das Wegrennen konnte er sich ebenso sparen, ein Eisbär holte einen Menschen spielend ein.
Das gereizte Tier war mindestens drei Meter groß. Mit entblößten Zähnen und nach hinten geklappten Ohren kam auf es auf Eric zu, brüllte und schlug mit den Tatzen in die Luft.
»Friss die da.« Eric zeigte auf das Filmteam, machte zwei Schritte rückwärts und legte an. Er zielte auf den geöffneten Rachen.
»Bitte, helfen Sie uns«, stammelte der Mann mit der Kamera und ging mit zitternden Beinen vorsichtig auf ihn zu, um sich hinter Erics Rücken zu stellen. Seine Tonassistentin folgte ihm, kreidebleich und mit flehendem Blick.
Auch neben ihnen erklang plötzlich ein Knurren. Aus den Augenwinkeln bemerkte Eric einen Löwen, der aus seiner Box entkommen war. Im gleichen Moment sprang ein schwarzer Panter auf das Dach des Lkw und starrte Eric aus seinen gelben Augen an. Die Raubtiere kreisten ihn und das Kamerateam der Tierschützer ein.
Erics Kehle trocknete innerhalb von zwei Sekunden aus, sein Magen schrumpfte zusammen, während er überlegte, wie er am besten entkam. Wenn er es an dem Eisbär vorbei bis in den leeren Käfig schaffte … Aber er musste auch an die Tierschützer denken, die neben ihm standen oder bewusstlos am Boden lagen. Es gab nur eine Möglichkeit – er musste schneller schießen, als er es jemals zuvor getan hatte. Konzentrier dich, befahl Eric sich selbst. Er entsicherte die Waffe.
»Nein!« Plötzlich stand Isis neben ihm. Sie hielt große, rohe Rippenstücke in der einen Hand, drückte seine Waffe mit der anderen nach unten und schrie gleichzeitig den Eisbären an. Sie ging dabei auf ihn zu und schwenkte die blutigen Rippen.
Eric hielt sie für vollständig wahnsinnig. Einen besseren Weg, um ein wildes Tier zu einem Angriff zu provozieren, gab es kaum … einmal davon abgesehen, es mit einer Neun-Millimeter anzuschießen.
Der Eisbär sog die Witterung des Fleisches auf, neigte sich nach vorn und brüllte. Isis schrie tapfer zurück und warf eine Portion der Rippchen über ihn hinweg in seine Box.
Die Tonfrau wimmerte, der Kameramann beruhigte sie mit leisen Worten; Eric selbst vergaß für einen Moment zu atmen.
Das Raubtier brüllte noch einmal –
– ließ sich auf alle viere nieder, kehrte murrend in den Käfig zurück und stürzte sich sofort auf das Fleisch.
»Bleiben Sie stehen und rühren Sie sich nicht«, befahl Isis Eric und den Tierschützern mit fester Stimme, streckte die Arme mit den übrigen Rippenstücken aus und zeigte sie dem Panter und dem Löwen. Dann bewegte sie sich vorwärts und verschwand zwischen den Wagen. Ohne die anderen Menschen eines Blickes zu würdigen, lief ihr die Löwin hinterher. Nur der Panter verharrte noch einen Moment auf dem Wagen und warf Eric einen langen Blick zu. Dann sprang auch er vom Dach herunter und verschwand.
Bald darauf hörte Eric das Geräusch von sich schließenden Eisengittern und das leise Fauchen der Tiere.
Schließlich kehrte Isis zurück. Ihr Gesicht war blass.
»Wie haben Sie das gemacht?«, fragte er gebannt.
»Ich kenne sie lange genug – und vor allem kennen sie mich. Meinen Geruch, meine Stimme«, gab Isis zurück und schloss die Tür hinter dem Eisbären, der sich in die hinterste Ecke zurückzog und sich zum Fressen auf den Boden kauerte. Seine wachen Augen aber blieben auch weiterhin auf Eric gerichtet.
Isis ersetzte die zerstörte Verriegelung durch einen Schraubenzieher, den sie aus der Werkzeugkiste unter dem Käfig nahm. »Ich habe einige von ihnen aufgezogen. Ich weiß, wie man mit ihnen umgehen muss.« Sie sah vorwurfsvoll auf die Halbautomatik. Eric verstaute sie rasch und drehte sich zu dem Mann mit der Kamera um. »Was war das für eine Aktion?« Er nahm ihm das Gerät mit einer raschen Bewegung weg, schaltete es aus und öffnete das Kassettenfach.
»Hey, das gehört mir!«, protestierte der Mann schwach in schlechtem Englisch und musste dennoch zusehen, wie Eric die Kassette herausnahm und einsteckte.
»Tierschützer, schätze ich.« Isis sagte es sehr verächtlich.
»Ganz genau!« Der Mann sah sie empört an. »Man kann es wohl kaum als artgerecht bezeichnen, wie Sie Ihre Tiere halten! Sie machen Profit und lassen die stolzen Geschöpfe leiden. Das ist unsere Art, gegen die verachtungswürdige Haltung zu protestieren.«
»Indem Sie sie freilassen? Sie zu Tode erschrecken? Was für eine Scheiße!«, gab Isis wütend zurück und ging mit erhobenen Fäusten auf den Mann zu. »Sie haben keine Ahnung, wie viel Mühe wir uns mit unseren Schützlingen geben!«
Eric hielt sie zurück. »Lassen Sie das die Polizei machen, sonst bekommen Sie nur eine Anzeige wegen Körperverletzung«, riet er ihr und warf dem schon wieder ziemlich verängstigen Mann die Kamera zu. »Und Ihnen sage ich nur eins: Recht am eigenen Bild. Deswegen konfisziere ich die Aufnahme, die ohne mein Einverständnis gemacht wurden.«
Die Tonfrau hatte ihre Schreckstarre nun endlich abgeschüttelt und griff nach der Hand des Mannes. »Los, weg hier!« Die beiden liefen los und ließen ihre bewusstlosen Kollegen zurück.
Jetzt erschien mehr Flughafenpersonal, auch Zirkusleute rannten herbei und hielten diejenigen Eindringlinge fest, die es nicht mehr rechtzeitig geschafft hatten zu flüchten.
Isis sah zu dem Eisbären und schüttelte den Kopf. »Unverantwortlich, diese Aktion. Die Tiere hätten getötet werden können.« Sie entdeckte den Taser auf dem Boden. »Wie bescheuert ist das denn? Die quälen unsere Tiere, nicht wir.« Isis sah Eric an. »Danke, dass Sie eingegriffen haben. Auch wenn Sie sich merken sollten, dass Sie mit einer so kleinen Waffe bei unseren Schützlingen nicht besonders weit gekommen wären.«
»Ich schätze mal, ich war keine besonders große Hilfe.« Er drehte den Mann, der bewusstlos am Boden lag, mit dem Fuß um.
»Sie verschafften mir die Zeit, die ich brauchte, um das Schlimmste zu verhindern.« Sie reichte ihm die Hand. »Ich nehme an, mein Vater möchte sich bei Ihnen bedanken. Hätten Sie Zeit?«
Eric sah auf die Uhr. »Nein, entschuldigen Sie. Meine Maschine geht bald, und wenn ich meinen Flug nach Triest verpasse, werden einige Menschen sehr sauer auf mich sein.« Er lächelte schief. »Dagegen wäre Ihr Eisbär harmlos.«
»Dann bleibt mir nur, mich bei Ihnen zu bedanken.« Isis griff in ihre Jackentasche, zog eine Freikarte für den Circus Fratini hervor und schrieb ihre Handynummer darauf. »Wenn Sie mal in der Nähe unseres Zirkus sind, rufen Sie an.«
Er nahm das Geschenk, hob zum Abschied die Hand und machte sich mit seinem Handgepäck eilig auf den Weg zum Terminal. Kurz vor dem Eingang reinigte er die Pistole von Fingerabdrücken und warf sie in ein leeres Ölfass voller alter Putzlappen. Spätestens auf dem römischen Flughafen würde ihn die Waffe in Schwierigkeiten bringen, und davon besaß er auch so schon jede Menge.
Eric checkte ein und saß bald darauf im Flugzeug nach Rom. Er wünschte sich, Isis’ bewundernswerte Fähigkeiten zu besitzen, dann könnte er die Wandelwesen nur mit dem Klang seiner Stimme zum Aufgeben bewegen. Ein Wandelwesen-Flüsterer mit blutigen Rippchen in der Hand. Er musste lächeln.
Eric bekam von der Stewardess einen Drink gereicht, dann genoss er das Sterne-Essen, das in der ersten Klasse serviert wurde: Hühnerbrüstchen an Safransoße, Babykartoffeln und Wurzelgemüse.
Mit seinen Gedanken war er trotzdem bereits auf dem Petersplatz, wo das Treffen mit der Schwesternschaft stattfinden würde, bei dem sie sich über Lena einigen wollten. Bis dahin blieben weniger als zehn Stunden. Das genügte ihm jedoch, um Vorbereitungen zu treffen.
Unbewaffnet würde er nicht mit den Nonnen sprechen. Christliche Orden hatten in der Vergangenheit oft genug bewiesen, dass sie durchaus in der Lage waren zu töten. Er wollte nicht ihr Opfer werden.
II. Kapitel
22. Juni 1767, in der Nähe der Klosterruinen von Saint-Grégoire, Südfrankreich
Jean kam sich seit seinem Besuch beim Marquis vor, als sei er aus einem Fiebertraum erwacht, in dem nichts anderes eine Rolle gespielt hatte als der Tod der Bestie. Sämtliche Ängste und Sorgen waren von seinem Verstand hintenan gestellt worden, und jetzt schlugen sie umso härter auf ihn ein.
Vor allem kreisten seine Gedanken um Gregoria. Er machte sich schwere Vorwürfe, sie mit ihren schweren Verbrennungen allein in der Obhut der Dörfler gelassen zu haben, aber die Jagd auf den Dämon hatte Vorrang gehabt. Sie würde es verstehen. Sie musste.
Er ritt zur Ruine des Klosters, wo eine Gruppe Dorfbewohner damit beschäftigt war, die Steine auf Karren oder auf Lasttiere zu laden und damit nach Hause zu fahren. Günstiges Baumaterial für Ställe. Niemand schien die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass die Klosteranlage wiederaufgebaut werden könnte und dass sie sich gerade Kirchendiebstahls schuldig machten.
Das Feuer hatte die Wiesen um das Kloster herum verschont. Büsche und Gras wirkten im Gegensatz zu den verkohlten Steinen auf merkwürdig unwirkliche Art lebendig und ließen die Trümmerhaufen noch trostloser aussehen.
Jean schulterte seine Muskete und ging auf einen jungen Mann zu, der zwei Korbtaschen an der Seite seines Esels voll packte. Er trug halblange Hosen, ein dreckiges Hemd und eine Kappe über dem langen blonden Haar und schreckte zusammen, als Jeans Schatten über ihn fiel.
»Bonjour. Ich suche Äbtissin Gregoria«, fragte er. »Wohin ist sie gebracht worden?«
»Gebracht? Ihr meint, in der Nacht nach dem Brand?« Der junge Mann bückte sich, hob einen weiteren Stein auf und wuchtete ihn auf den Stapel. Der Esel schrie protestierend, sein Kreuz bog sich weit durch. Fluchend wischte der Mann sich den Schweiß aus den Augen und verscheuchte die Mücken, die ihn umschwirrten und sofort wieder auf seinem nassen Gesicht landeten. »Ihr habt demnach nichts von dem Wunder vernommen?« Er sah zu Jean auf, der nicht von seinem Pferd abgestiegen war. »Sie ist auf ihren eigenen Füßen gegangen, Monsieur.«
»Was sagt Ihr da?«, fragte Jean verwundert.
»Äbtissin Gregoria ist gesegnet, Monsieur. So wahr, wie sich Steine in den Korbtaschen meines Esels befinden, so wahr ist es, dass ich sie mit eigenen Augen aufstehen und davongehen sah.« Er schlug nach dem Esel, der an seinem Hemdrücken zupfte. »Und noch wahrer ist es, dass ihre Haut so rosig und frisch wie die eines Neugeborenen oder einer Comtesse war. Sie rieb sich die verbrannte Haut einfach ab, ohne Schmerzen und Geschrei. Gott liebt sie, Monsieur.«
Jean beschloss, den Worten des jungen Mannes nicht zu glauben. Vermutlich war Gregoria in dem Schockzustand, in dem er sie verlassen hatte, aufgestanden und hatte daher keine Schmerzen verspürt. »Wohin ging sie?«
»Nach Saugues, habe ich gehört.«
Jean wendete sein Pferd. »Danke, Monsieur.« Er wollte gerade losreiten, als der Mann noch etwas sagte.
»Seid Ihr nicht Monsieur Chastel, der Jäger, der die Bestie getötet hat?«
Jean schnalzte mit der Zunge und trieb sein Pferd an. »Nein.«
Er ritt über die Wiese in Richtung der Straße nach Saugues. Kurz bevor er sie erreichte, sprang ein Junge mit kurzen braunen Haaren aus dem Gebüsch und stellte sich mutig vor das Pferd. »Ihr seid doch Monsieur Chastel!«, sagte er mit Verschwörermiene. »Ihr wurdet mir genau beschrieben, und ich warte schon einige Tage auf euch.«
Jean zügelte das Pferd. »Wer schickt dich?«
»Mein Name ist Emile Maizière, Monsieur. Meine Eltern haben einen kleinen Hof und«, er schaute nach rechts und links, als würde er einen heimlichen Lauscher erwarten, »einen Gast, den Ihr sicher eben bei den Klosterruinen gesucht habt. Folgt mir, ich bringe Euch hin.«
Die Nachricht verwunderte Jean. Die Maizières waren Camisarden, Nachfahren von vertriebenen Hugenotten, das wusste er vom Gerede der Leute. Ausgerechnet dahin sollte sich die Äbtissin eines Klosters begeben haben?
Emile sah Jean an, dass er sich schwer tat, ihm zu glauben. »Falls Ihr zögert, soll ich Euch daran erinnern, dass es ihr Rosenkranz war, der die Erlösung brachte.«
Jetzt wusste Jean, dass sich Gregoria tatsächlich bei den Camisarden aufhielt. Sie hatte ihm ihren silbernen Rosenkranz gegeben, damit er ihn einschmelzen und zu Kugeln machen konnte, um Antoine zu töten. Er beugte sich nach vorn und hielt dem Jungen die Hand hin. »Steig auf. Du musst nicht laufen.«
Emile schwang sich mit einem Grinsen nach oben, und es ging los. Jean lächelte. Ja, dieser Unterschlupf passte zu Gregoria. Ein Ort, an dem sie niemand vermuten würde.
Bald erreichten sie das kleine Gehöft und stiegen ab. Emile führte an einer aus Granitsteinen gefügten Mauer vorbei um eine Ecke, bis sie dort standen, wo ein Dutzend Hühner im heißen Sand scharrten und ein paar Enten auf einem kleinen, weidenumkränzten Teich voller Entengrütze schwammen.
Gregoria saß auf einer grob gezimmerten Bank im Schatten der tief hängenden Äste, ein Buch auf ihrem Schoß; sie trug ein schwarzes Kleid, das ihr viel zu weit war, und ein dunkles Kopftuch auf dem blonden Schopf.
»Danke, Emile.« Jean fuhr ihm über die kurzen braunen Haare. Dann näherte er sich der Äbtissin, und mit jedem Schritt stieg die Verwunderung darüber, dass der Mann an der Ruine ihn nicht angelogen und nicht einmal übertrieben hatte. Er sah keine Verbände, keine gerötete und sich schälende Haut, und von den schrecklichen Verbrennungen, die er bei ihr in jener Nacht gesehen hatte, war nichts mehr zu erkennen. Es war ein wahrhaftiges Wunder!
Gregoria hörte, dass die Hühner gackernd vor jemandem davonliefen, hob den Kopf und blickte ihn an. Ihre Lippen bewegten sich stumm: Sie nannte seinen Namen. Langsam schloss sie das Buch und erhob sich.
Jean erkannte, dass sie ebenso bewegt war wie er und trotzdem nicht wusste, ob sie ihn umarmen durfte. Endlich hatte er sie erreicht, lehnte die Muskete gegen die Bank und stand unschlüssig vor ihr.
Der warme Sommerwind rauschte in den Weiden, die Oberfläche des Teichs kräuselte sich und sandte kleine Wellen gegen die Böschung; Lichtstrahlen tanzten auf dem Boden und an den Stämmen. Alles um die beiden schien in Bewegung zu sein, nur sie verharrten statuenhaft voreinander, abwartend, stumm – aber mit einer Glückseligkeit in den Augen, die sich nicht an die Starrheit der Körper halten konnte.
Schließlich hielt Jean es nicht mehr aus. Er wollte die Spannung mit einer Begrüßung brechen, wollte einfach nur etwas sagen – doch stattdessen riss er Gregoria einfach an sich und schloss sie mit einer Mischung aus Seufzen und Weinen in die Arme.
Sie erwiderte seine Zärtlichkeit, drückte sich an ihn und vergoss Tränen, die heiß an seinem Hals entlangrannen. Die Zeit schien um sie herum stillzustehen, während sie den Moment der unbeschreiblichen Freude und tiefen Liebe genossen und festhielten.
»Verzeih mir, dass ich dich allein gelassen habe«, sagte Jean. »Aber ich musste die Bestie…« Er verstummte.
Gregoria tupfte sich die Tränen mit dem Kleiderärmel ab, setzte sich und zog ihn neben sich. »Es ist gut«, beruhigte sie ihn. »Schau, was für ein Wunder der Herr an mir vollbracht hat.« Sie zog den Ärmel weiter hoch und zeigte ihm makellose weiße Haut. »Du musst dir keine Vorwürfe machen, Jean.« Jetzt wischte sie seine Tränen ab und streichelte seine rechte Wange und sein Kinn. »Aber du zuerst: Was ist mit der Bestie? Ich dachte, Antoine…«
Er schüttelte seinen weißen Kopf und berichtete von den vergangenen Tagen, von der Begegnung mit Acot und der Unterredung mit dem Marquis. »Es war sein Sohn, der euer Kloster anzündete und dann nach Rom geflohen ist. Aber«, er gab ihr einen Kuss auf die Stirn, »er wird mir nicht entkommen. Der König will mich sehen, danach reise ich ihm nach und töte ihn. Für Pierre, Florence und den Rest der Menschheit.«
Gregoria nahm seine Hand und legte sie zwischen ihre. »Nein, Jean. Er war es nicht. Der Legatus trägt die Schuld an allem. Er behauptete, Dämonen würden im Kloster leben … und hat meine Schwestern getötet. Das Kloster steckte er in Brand, um seine Taten zu verbergen, danach entführte er Florence.« Sie berichtete ihm in aller Ausführlichkeit von dem, was sich im Kloster zugetragen hatte, während Jean, Malesky und Pierre auf der Jagd nach der Bestie gewesen waren. Doch sie verschwieg ihm den Grund für all das – und das Geheimnis, das Florence in sich trug.
»Aber warum Florence?«, fragte Jean stirnrunzelnd.
»Ich weiß nicht, weswegen er sie mitgenommen hat«, log sie und sah zu Boden. »Er ist … er ist ein fanatischer Inquisitor, Jean. Vielleicht will er, dass sie gegen mich aussagt. Die Folter wird sie gefügig machen und zu jeder Aussage pressen.«
Jean seufzte schwer. »Wohin ist er mit ihr gereist? Nach Rom?«
»Ich vermute es.« Gregoria streichelte seinen Handrücken – und verschwieg ihm, dass sie nicht nur ihre Heilung, sondern auch die Vision, die sie nach Rom gerufen hatte, der merkwürdigen Substanz in der Phiole verdankte. Solange sie nicht verstand, was es damit auf sich hatte, war es besser, es geheim zu halten. »Lass uns zusammen gehen.«
»Was willst du in Rom?«
»Ich werde vor den Papst treten und ihm berichten, was sein Legatus treibt.«
Jean runzelte die Stirn. »Woher willst du wissen, dass es nicht im Namen des Papstes geschah?«
»Niemals«, entgegnete sie auf der Stelle. »Der Heilige Vater wird den Legatus seiner gerechten Strafe zuführen und Florence freilassen.«
Jean betrachtete die gekräuselte Oberfläche des Teichs. »Ich frage mich, was der junge Comte in der Nacht des Brandes im Kloster wollte. Hat er es auf Florence abgesehen oder gemeinsame Sache mit dem Legatus gemacht?«, sinnierte er.
Gregoria kam sich schlecht vor, weil sie ihm so viele Dinge vorenthielt, aber sie sah keine andere Möglichkeit. Die Zeit für die Wahrheit würde in Rom kommen, nach der Unterredung mit dem Heiligen Vater; doch erst einmal musste sie nach Rom gelangen.
»Du bleibst am besten hier«, sagte Jean und schaute sie an. Es war ihm sehr ernst.
»Niemals.«
»Gregoria, lass mich zuerst nach Rom reisen und den jungen Comte ausfindig machen. Wenn ich ihn erlegt habe, droht dir nicht mehr Gefahr, als ohnehin auf dich warten wird.« Er hielt inne und suchte nach den rechten Worten, um sie zu überzeugen. »Der Comte ist raffiniert. Er ist schon vor langer Zeit zur Bestie geworden und entsprechend geübt. Nicht wie Antoine. Wenn er deine Witterung in den Gassen aufnimmt, wirst du ein zweites Wunder benötigen, um ihm zu entkommen.«
»Und wenn er deine Witterung aufnimmt? Was dann?«
»Kommt er zu mir, töte ich ihn«, gab Jean zurück. »Ich fürchte mich nicht vor ihm.« Er drückte ihre Finger. »Versprich es mir, Gregoria! Geh nicht allein nach Rom!«
Sie sah seine Sorge und lächelte ihn dankbar an. »Schön«, willigte sie ein. »Ich gehe nicht allein nach Rom.«
Jean nickte befriedigt. »Sehr gut! Ich werde dir schreiben und die Briefe hierher schicken, einen besseren Empfänger kann es kaum geben.« Er langte an seinen Gürtel, nahm die Börse und zählte ihr zwanzig Livres ab. »Nimm sie. Bezahle die guten Leute damit. Sie haben es sich verdient.« Er lächelte. »Du weißt, dass die Maizières Camisarden sind?«
»Es war der Grund, weshalb ich zu ihnen gegangen bin. Es ist der letzte Ort, an dem man eine Nonne vermuten wird, die Dinge gesehen hat, welche einen Legatus schwer belasten und vernichten können. Er hat sicherlich Spione im Gévaudan zurückgelassen.«
»Bislang hat mich keiner verfolgt, das hätte ich bemerkt. Aber ich werde mich nach dem Besuch bei dir offen zeigen. Sie dürfen gerne sehen, wie ich mich auf den Weg zum König mache.« Er lachte erleichtert und gab ihr einen zweiten, schnellen Kuss auf die Wange, zog sie an sich und drückte sie. »Besser, sie folgen mir als dir. Ich kann mit ihnen fertig werden.«
Sie umarmte ihn mit all der Liebe, die sie für ihn hegte. »Geh mit Gottes Segen, Jean. Auf dass er dir helfe, wie er mir in jener Nacht beistand.«