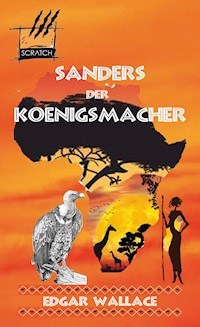
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Afrika-romane
- Sprache: Deutsch
Im neunten Band der Reihe geht es hauptsächlich um Sanders, der als Bezirkshauptmann in Afrika im Namen der britischen Regierung Häuptlinge einsetz, oder hängt. Es ist eine Zeit, in der die großen Weltmächte um koloniale Ehren wetteifern, eine Zeit des Ju-Ju, der Medizinmänner und eines unruhigen Friedens mit Bosambo, dem beeindruckenden Häuptling der Ochori. Als Kommissar Sanders in Urlaub geht, übernimmt der vertrauenswürdige Leutnant Hamilton die Verwaltung der afrikanischen Territorien. Doch wieder einmal schafft es der störanfällige Francis Augustus Tibbetts, genannt "Bones", obwohl er eigentlich helfen will, nur seine eigene Art von unschuldigem und liebenswertem Unfug zu verbreiten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 308
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Edgar Wallace
Sanders der Königsmacher
Die Afrika-Romane 9. Band
Scratch Verlag
Klassik
e-book 127
Originaltitel: Sandi the Kingmaker 1922
Erscheinungstermin: 01.10.2022
© Scratch Verlag
Erik Schreiber
An der Laut 14
64404 Bickenbach
www.scratch-verlag.de
Titelbild: Simon Faulhaber
Vertrieb: neobooks
Inhaltsverzeichnis
Die Propheten des Großkönigs
Sandi! Sandi!
Die Hilfsmittel der Zivilisation
Das Haus des Erwählten
Das Todeszeichen
Das Weib, das in der Hütte war
Bofaba, das Weib
Der König aus dem Süden
Das Verschwinden des Major Hamilton
Der Zaubervogel
Die Schlacht an dem Geisterbergen
Die Teufelshöhle
Biographie
Die Propheten des Großkönigs
In P’pie, einem kleinen Dorf zu Füßen des Hungerberges; des Limpisi oder auch Limbi, wie ihn die Eingeborenen nennen, lebte ein Jüngling, dessen Eltern um seinetwillen ein schauerliches Ende gefunden hatten, als er noch ein kleines Kind gewesen war. In jenen fernen Tagen forderte die „Teufelsmutter von Limbi“, der Schreckensgeist des Felsenskeletts, dessen hagere Schattenzungen quer über den Hütten lagen, doppelte Opfer, und wenn ein Kind an dem ihr geheiligten Tage, dem neunten Tage des jungen Mondes, geboren wurde, so verlangte es die Sitte, dass seine beiden Eltern unter dem Opfermesser starben.
Das Schicksal der Eltern gab dem Kinde den Namen. Durch Zuruf wurde es M’sufu M’goba getauft; und das bedeutet: „der glückliche Knabe, der nicht sein eigener Vater war“. Alle Kinder, die mit ihm dieses Glück teilten, zeichneten sich von jeher durch besondere Klugheit aus, und M’sufu M’goba wurde sogar von den Gespenstern und Teufeln durch besondere Gunst geehrt. Man sagte ihm nach, dass er auf seinen schwachen Kindesbeinen die Höhle der „Heiligen Teufelsmutter“ erklettert habe, ohne dass ihm die Garde der Jungfrauen, die den Höhlenzugang bewachte, auch nur‘ ein Haar gekrümmt habe. Unbefangen sei er in die Felsenkammer gestolpert, aus der noch kein Lebender den Weg herausgefunden hatte, und er habe die Unholdin im tiefsten Schlafe gesehen.
Er kam mit dem Leben davon und gelangte ungefährdet in sein Dorf zurück. So munkelte man, aber auch das nur in tiefster Heimlichkeit. Es sprach davon auf seiner Schlafmatte der Mann mit seinem Weibe, und im Schäferstündchen erzählte es der Liebhaber seiner Geliebten, denn diese beiden haben unbegrenztes Vertrauen zueinander. Laut oder offen sprach keiner von dieser furchterregenden Wundertat, und keiner erwähnte je im Gespräch die Teufelsmutter. Ihrer gedachte man nur in dunklen Gleichnissen und furchtsamen Anspielungen.
Aber dieser Entdeckungsreise und dem geisterhaften Einfluss der Höhle schrieb man die wunderbaren Kräfte zu, die M’sufu M’goha offenbarte, als er herangewachsen war.
So saß er einst beim Mahl mit einer der Familien, die sich in seine Pflege teilten, und plötzlich geschah es, dass er das vorgeschriebene Schweigen brach:
„K’lama und seine Ziege liegen tot bei den Tiefsteinen!“
Die Tiefsteine bildeten das zerklüftete Bett einer abgründigen Talsohle.
„Schweig, Knabe“, herrschte ihn sein entrüsteter Pflegevater an. „Schämst du dich nicht zu sprechen, während ich esse? Merke dir: Wenn der Sinn in die Irre geht, dringen die Teufel um so leichter in den unbewachten Körper des Menschen ein.“
Trotzdem wurde eine Rettungsmannschaft ausgesandt, die K’lama und seine Ziege an der von dem Knaben bezeichneten Stelle fanden: Aus beiden Körpern war das Leben entflohen, und ein alter Mann erzählte schaudernd, was er gesehen hatte. Die Sonne hatte den Scheitel des Hungerberges eben mit goldenem Geschmeide gekrönt, da hatte die toll gewordene Ziege den jähen Sprung getan und K’lama, der sie am Riemen zurückhalten wollte, mit in die Tiefe gerissen. Um die gleiche Stunde hatte M’sufu den Mund in der Hütte seines Pflegevaters aufgetan.
Ein zweites Wunder geschah. Ein Gärtner, namens Doboba, hatte M’sufu beim Bananendiebstahl ertappt und sich mit kräftigen Hieben für die entwendeten Früchte bezahlt gemacht.
„Mann“, sagte M’sufu und rieb sich das brennende Sitzfleisch, „in zwei Nächten wird dich ein Baum erschlagen und zu den Geistern gesellen!“
Genau zwei Nächte nach dieser Weissagung starb Doboba den Tod, den M’sufu ihm verkündet hatte.
M’sufus Ruhm breitete sich mit der Schnelligkeit eines Steppenfeuers aus. Selbst in den geheimen Winkeln der Königshütte raunte man sich seine Taten zu. Und dann kam der Erste Minister des Königs, sein Seni-seni, Oberhäuptling der Tofolaka, ein Mann von Macht und Ansehen, in höchsteigener Person.
„O M’sufu, künde mir die Zukunft“, sprach Kabalaka zu dem schwarzen Propheten, und vor dem ganzen erschauernden Dorf, das Isidi über die Ankunft des Würdenträgers und seines Gefolges von Speerträgern und Tanzweibern entsetzte, weissagte M’sufu: „Herr, deine Ernte wird gut sein und besser als gut. Aber die Saat der Fongini wird sterben, und die Erde wird aus Mangel an Regen aufbrechen.“
„Was noch?“, fragte Kabalaka gnädig; denn er hasste die Fongini und ihren Häuptling Lubomala, dessen Einfluss auf den Großkönig ihm im Wege war.
„Herr“, sagte der junge Seher, indem er beträchtlich schwitzte, „der Sohn deines Weibes ist krank und dem Tode nahe, aber wenn der Mond sich zur Schale formt, wird er wieder aufleben.“
Kabalaka senkte die Stirn, denn er liebte den Sohn seines Weibes. Dann trieb er sogleich zum Aufbruch und kehrte in Eilmärschen nach Rimi-Rimi zurück. Er fand das Kind auf ein Totenlager gestreckt, und nasser Lehm beschwerte ihm die Lider.
„Wartet, bis der Mond sich zur Schale formt, und das Kind wird leben“, verkündete Kabalaka in zuversichtlichem Ton, aber inwendig spürte er den schweren, dumpfen Schlag seines Herzens. An jedem Morgen zogen die Weiber hinaus, um die grünen Blätter zu pflücken; in die sie ihre Leiber beim Totentanz hüllen. Aber als der Mond im ersten Viertel stand, öffnete das Kind die Augen und bat lächelnd um Milch.
Eine Woche später barg das Volk von Treuland - denn das ist die Bezeichnung für Rimi-Rimi - mit großer Mühe die reiche Ernte, und an diesem Tag betrat Lubomala, der Häuptling der Fongini, die Hauptstadt und bat um Erlass des Tributs.
„Meine Ernte ist vernichtet, o Großkönig“, klagte er. „Wir hatten keinen Regen, und die Erde ward rissig vor Dürre.“
In dieser Nacht sandte der Großkönig nach M’sufu, und der Prophet, den eine herrliche Messingkette, ein Geschenk des dankbaren Kabalaka, schmückte, traf in der Hauptstadt zur gleichen Stunde ein, als die Garde des Königs den Kommissar der britischen Regierung mit ihren Speerschäften zu Boden stieß.
Hughes Lloyd Thomas war vor seinem Eintritt in den Kolonialdienst Laienprediger gewesen, dessen feurige Beredsamkeit sein keltisches Heimatdorf bis in die Tiefen aufgewühlt hatte. Ein Mystiker, seltsam gefeit wie alle Kelten, war er in keine der Fußangeln geraten, die auf jeden gewissenhaften Mann lauern, der in den britischen Kolonien Dienst tut.
Es war die unbesiegbare Geistigkeit dieses Mannes, seine todbereite Märtyrerseele, die das merkwürdige Lächeln in sein Gesicht zauberten, mit dem er in das finstere Antlitz K’saluga M’popos sah, des großen Königs und Oberherrn über viele tributpflichtige Völker.
Man hatte vor der Hütte des Großkönigs Pflöcke in den Boden gerammt und den Gefangenen daran gefesselt, so dass er mit schmerzhaft ausgereckten Gliedern dalag. Sein Kopf glühte, denn dicht hinter ihm brannte des Königs Lagerfeuer und versengte ihm das Haar. Sein abgetragener Drillich war steif von seinem Blute, durch die Risse seiner Jacke schimmerte seine weiße, gewölbte Brust und das braune V, das die Sonne in seine Hemdöffnung gemalt hatte. Aber obwohl die ewige Finsternis bereits ihre düsteren Schatten über sein Haupt warf, schlug sein Herz mit großem, stolzem Schlag, und er lächelte und dankte Gott, dass keines Weibes Antlitz erbleichen, keiner Mutter Herz zerbrechen und keines Kindes Stirn sich trüben würde, wenn die Nachricht von seinem Ende in die Heimat gelangte.
„Ho, Tomini“, sagte der Großkönig spöttisch und blinzelte durch seine schmalen Augenschlitze auf den Gefangenen nieder, „du hast mich vor allem Volk zum Palaver gerufen. Hier bin ich.“
Lloyd Thomas war am Halse so gefesselt, dass er seinen Kopf zur Seite wenden konnte, und tat er es, so bot sich seinem Blick ein Ausschnitt der gewaltigen Menschenmasse, die gekommen war, um seinem Ende beizuwohnen. Die vorderen Reihen kauerten am Boden, dann kamen welche, die hockten und über ihre Vordermänner hinwegsahen und dann kamen solche, die standen, Gesicht an Gesicht, eng aneinandergepresst; Menschheit auch sie, und in aller Augen brannte die abgründige Gier, ihn auf schreckliche Weise sterben zu sehen. Selbst die Kinder drängten sich, zappelnd vor Ungeduld, herbei. Es war niemand in ganz Rimi-Rimi, der sich das spannende Schauspiel seines Todes entgehen lassen wollte.
„Ich kam in Frieden, K’saluga M’popo“; sagte Lloyd Thomas. „Ich kam, um Fergisi und seine Tochter zu sehen. Böse Nachrichten haben uns von ihnen erreicht, und Fergisis eigenes Weib beklagte sich bei unserem König und sprach von einem Todespalaver in Rimi-Rimi. Darum hat mein König mich gesandt, den Überbringer vieler schöner Geschenke, und fordert dich durch meinen Mund auf, alles zu sagen, was du von dem Schicksal des Gottesmannes weißt.“
Die Geschenke waren vor dem Königssitz zu einem stattlichen Haufen getürmt. Da waren Ballen aus Tuch und Seide, schimmernde Halsketten, Spiegel in vergoldeten Rahmen, so wie Könige sie lieben.
Der König zog seinen Blick von dem Gefangenen zurück und bückte sich, um ein Halsband aufzuheben. Er hielt es einen Augenblick in der Hand und ließ das geschliffene Glas aufblitzen. Dann warf er es wortlos ins Feuer. Auf einen Wink seines Herrn ergriff Kabalaka den Rest und schleuderte ihn in die aufflammende Glut.
Lloyd Thomas biss die Zähne zusammen; denn er wusste, was da zu bedeuten hatte.
„Wenn ich schon sterben muss, so; lass midi rasch sterben, o König“, sagte er gelassen.
„Lasst Jububu und Tara vor mein Angesicht kommen“, befahl de König, „und lasst sie zeigen, wie gut sie es verstehen, einen Menschen zu häuten.“
„Zwei nackte Männer traten aus dem Vorhang von Qualm und Rauch hervor, und in ihren Händen funkelten die kleinen Messer.
„O König“, sagte Lloyd Thomas, in seiner Stimme schwang der Spott, in seinen Augen glühte sein Feuer, „O Schinder von Menschen und Schlächter unschuldiger Mädchen, einen Tag lang und einen andern Tag lang wirst, du noch leben. Doch dann wird einer an meine Stelle einer kommen, der wird dich unter Tausenden herauswittern, und eure Körper wird er den Fischen zum Futter vorwerfen:“
„Die Enthäuter sollen ihre Arbeit langsam verrichten“, sagte der König und rieb sich sein stoppliges Kinn. Die beiden Männer, die zu Füßen des Gefangenen saßen, nickten und prüften die Schärfe ihres Messers an ihren Handflächen.
„Kommen wird er. Ich sehe ihn mit den Augen meines Geistes“, rief der verurteilte Mann. Sandi Ingonda, der Tiger, der Vertilger von Königen!“
„Kot.“ Der König erhob sich halb von seinem Stuhl, und es zuckte in seinem faltigen Gesicht.
„O Männer, lasst mich sprechen“, sagte er heiser, „dieser Mann redet gottlose Worte, denn Sandi ist tot. Aber selbst, wenn er lebte, wie will er die Geisterberge überqueren? Meine Truppen hüten die Pässe. Oder, wenn er den Strom befährt; wie will er mit seinem Puck-a-Puck die Strudel bezwingen?“
„Er wird kommen“, sagte der Gefangene feierlich, „und er wird dort stehen, wo ich _ liege, und in jener Stunde wirst du sterben, K’saluga M’popo.“
Der Großkönig blinzelte, als stäche ihm die Sonne in die Augen. „Das sind böse Worte, und der sie spricht, ist ein Lügner. Denn Sandi ist nicht mehr unter den Lebenden. Sagte der Akasava nicht, dass Sandi auf die schwarzen Wasser ging und durch ein Loch aus der Welt fiel?“
„Großer König, es ist, wie du sagst“, bestätigte Kabalaka: Der König lehnte sich in seinen. Stuhl zurück.
„Wenn Sandi kommt, stirbt er den Tod“, schwor er, aber während er sprach, spürte er in seinem Rücken eine unheimliche Kälte. „Ich, der ich die Tochter des Gottesmannes in die Erde sandte und ihn selber in die Arme der Unholdin von Limbi, ich kenne keine Furcht!
„O M’sufu!“ Aus dem Kreise der Frauen, die hinter dem Könige saßen, trat ein Jüngling hervor, der eine glitzernde Kette trug.
„O M’sufu, sieh diesen Mann. Und nun künde uns. Wird Sandi dies Land betreten, das Cala Cala, das Land der Allimini, war? Und bedenke wohl, wir hielten ein großes Palaver ab, als die weißen Frentschis kamen. Wie dürfte da Sandi, der weder Frentschi noch Allimini, sondern Inegi ist, es wagen, seinen Fuß in dieses Land zu setzen?“
M’sufu fühlte den Glanz und die Bedeutung dieses einzigartigen Augenblicks; und er stolzierte mit zurückgeworfenem Kopf und ausgebreiteten Armen in die Mitte des Platzes.
„Höre mich an, großer König. Höre. M’sufu, der über geheimnisvolle und wohltätige Kräfte verfügt. Er sagt dir, Sandi wird nie wieder in dieses Land kommen, er ist so gut wie tot.“
Der Großkönig sprang auf die Füße, und seine Knie bebten. „Hört ihn“, brüllte er und griff nach seinem Speer, der neben ihr auf dem Boden lag. „O Tomini, höre diesen Mann, denn er sprich die Wahrheit, und du bist ein Lügner - ein Lügner - ein Lügner!“ Und bei jedem Schimpfwort stieß er zu, obgleich er sich die Mühe hätte sparen können; denn bereits der erste Speerstoß hatte Lloyd Thomas entseelt.
Der Großkönig blickte auf sein Werk, und der Kopf wackelte ihn „O Ko“, sagte er. „Das Palaver hat böse geendet, denn ich habe ihn zu rasch getötet. M’sufu, deine Stimme klang meinen Ohren lieblich. Du sollst im Schatten meiner Hütte wohnen. Aber wenn der Teufel in deinem Herzen ist und deine Zunge falsch geredet hat, so sollst du liegen, wo der liegt, der jetzt erkaltet ist, und meine Enthäuter sollen deine Klageschreie hören.“
*
Es liegt etwas Bedrückendes und Schweigengebietendes in der Atmosphäre des britischen Kolonialamtes, das ernüchternd und lähmend auf den Besucher wirkt. Die Feierlichkeit weiter Korridore und hoher bleicher Fenster drängt sich als Erstes dem Eintretenden auf. Aber wen er den Korridor entlangwandert, und die düsteren Türen wollen kein Ende nehmen, so meint er unwillkürlich, in einem Gefängnis zu sein, in dem hinter jeder Zellentür ein Schwerverbrecher einsam und weltenfern haust. Zu gewissen Tagesstunden liegen diese Flure da wie die Gassen einer toten, verzauberten Stadt. Nur zuweilen taucht ein Schreiber auf und huscht wie ein Gespenst vorbei. Irgendwo dröhnt eine Tür mit nachhallendem Echo wie ein Kanonenschuss über dem Grabe eines betrauerten Beamten.
An einem Oktobernachmittag schritt ein hochgewachsener, von Wind und Sonne gebräunter Mann durch einen dieser verlassenen Korridore. Seine Schritte hallten dumpf, wie in einem Klostergang oder in einem Grabgewölbe wider. Zuweilen blieb er stehen und prüfte die Nummer einer Tür, die er mit einem offenen Brief in seiner Hand verglich. Endlich hatte er die richtige Tür gefunden. Er zögerte einen Augenblick und hob dann die Hand. Eine unterwürfige Beamtenstimme beantwortete sein Klopfen. Zwei jüngere Beamte mit eingefrorenen Mienen saßen sich an zwei Schreibtischen so gegenüber, dass jeder von ihnen den gleichen Blick durchs Fenster hatte.
Bei Sanders Eintreten erhob sich einer der jungen Leute mit einer Schwerfälligkeit, die auf ein vorzeitiges Altern schließen ließ. Auch das gehörte zur Atmosphäre des Kolonialamtes.
„Herr Sanders?“ Er flüsterte den Namen mehr, als er ihn sprach. „Jawohl, der Herr Unterstaatssekretär erwartet Sie!“ Er schaute auf seine Uhr. „Ich denke, er wird Sie sofort empfangen können. Wollen Sie, bitte, einen Augenblick Platz nehmen!“
Sanders war zu ungeduldig und zu nervös, um sich zu setzen. Wie alle Menschen, die an ein Leben in freier Natur gewöhnt sind, hatte er ein Grauen vor den Büros, wo vom grünen Tisch aus regiert und dekretiert wurde, und nur selten und in langen Zwischenräumen hatte er die Zentrale seiner amtlichen Tätigkeit aufgesucht. Der junge Mann, der in einem angrenzenden Zimmer verschwunden war, kehrte zurück und ließ Sanders eintreten. Es war ein hoher Raum, dem ein breiter Marmorkamin und ein mächtiger Diplomatentisch steife Würde verliehen.
Ein Herr kam Sanders entgegen und begrüßte ihn, noch ehe er ihn erreicht hatte, mit einem bewillkommnenden Lächeln. Die freie Menschlichkeit, die aus diesem Lächeln sprach, erhellte sogar noch die katakombenhafte Düsterkeit des Raumes und verhalf dem Besucher zu einem Anflug seiner gewohnten Frische.
„Setzen Sie sich doch bitte, Herr Sanders“, lautete die freundliche Aufforderung, und diesmal nahm Sanders bereitwillig den dargebotenen Platz.
Der Unterstaatssekretär war ein sehniger Herr mit magerem Gesicht und feinen Zügen, dessen kurzsichtige Augen einen überaus wohlwollenden Blick hatten. Unter diesem Blick gewann Sanders schnell seine Laune wieder. Der Unterstaatssekretär schien es nicht eilig zu haben, über die Frage zu beraten, die ihm am Herzen lag. Er sprach über Twickenham, über die dort veranstalteten Fußballspiele, über gesellschaftliche Ereignisse der jüngsten Zeit, und erst als Sanders sich bereits zu wundern begann, warum der Brief, der ihn ins Kolonialamt gerufen hatte, als eilig gekennzeichnet war, kam der Unterstaatssekretär plötzlich zur Sache.
„Nicht wahr, es ist Ihnen nicht unlieb, Herr Sanders, dass Sie Afrika mit der Heimat vertauschen konnten?“
„Nein, Herr Unterstaatssekretär“, sagte Sanders hellhörig.
„Und doch ist es ein einzigartiges Land“, gab Sir John Tell zu bedenken, „ein Land, das auch den mit tausend Banden festhält, der sich abgerissen zu haben glaubt. Außerdem bietet es - für den richtigen Mann - gerade heute die günstigsten Gelegenheiten zum Vorwärtskommen. Eine Karriere ist schnell gemacht - in Afrika, lieber Herr Sanders!“
Sanders fand, dass es weise war, zu schweigen und abzuwarten.
„Sie kennen natürlich das Gebiet der Tofolaka und das Land jenseits der Geisterberge“, hub der Unterstaatssekretär wieder an, wobei er angelegentlich mit seinem Federhalter spielte.
„Sie vermuten richtig“, lächelte Sanders. „Rein geographisch betrachtet ist dies Land allerdings noch eine terra incognita.“
Sir John nickte eifrig:
„Wie nannten Sie das Land?“, wollte er wissen.
„Wir nannten es in unseren Berichten das Land des Großkönigs“, erwiderte Sanders lebhaft werdend. „Es grenzt an das Gebiet der Ochori und erstreckt sich über das ganze eine Flussufer. Auf der anderen Seite des Stromes hausen die Akasava. Aber ich bin nur einmal in meinem Leben dahin gekommen und musste die Berührung mit den Negerstämmen aus politischen Rücksichten vermeiden. Es führt ein Bergpfad dorthin, aber er ist nur drei Monate im Jahr passierbar. Der Strom bildet eine Brücke, aber man braucht allerdings dazu einen ganz anderen Dampfdruck in den Kesseln, als ihn die „Zaire“ hergibt - Sie erinnern sich, das war der Name meines Schiffchens -, und hat man ihn nicht, so zerschellt man am Höllentor.“
„Am Höllentor?“, fragte Sir John interessiert. Dann gab er sich selber die Antwort. „Ah - jetzt fällt mir ein, das ist die Felsenenge, die sich der Ochori durch das Massiv der Geisterberge gräbt. Ist diese Stelle nicht durch starke Stromschnellen gefährlich?“
„Zehn Meilen die Stunde“, half Sanders nach. „Wenn diese Wirbel nicht wären, dann hätte vielleicht schon längst der eine oder andere europäische Staat dem Großkönig die Klauen beschnitten. Selbst die Deutschen haben nicht viel ausrichten können, und soviel ich weiß, gehörte das ganze Gebiet noch in ihre Machtsphäre!“
„Nicht eigentlich“, sagte Sir Jahn nach kurzer Überlegung. „Zwei oder drei Nationen zeichneten es in ihre Kolonialkarten ein. Erobert oder gar besetzt hat es keine, und das ist eben der Grund, weswegen ich Sie zu mir gebeten habe, Herr Sanders. Keine der interessierten Großmächte wollte ihre Ansprüche aufgeben, und es blieb nur der übliche Ausweg. Das Land fiel an den ... hm ... Völkerbund!“
Sanders lächelte.
„Das heißt, es ist noch immer Niemandsland!“
„Wenn Sie es so nennen wollen; ja“, gab der Unterstaatssekretär zu. „Inzwischen haben wir vom Völkerbund ein Mandat erhalten, das uns berechtigt, auch in diesem Gebiet mit allem aufzuräumen, was der Zivilisation widerstrebt oder gar den primitivsten Anschauungen von Recht und Ordnung Hohn spricht.“
Er hielt inne und schien auf eine Meinungsäußerung seines Besuchs zu warten, doch Sanders hütete sich, zu seinen Worten Stellung nehmen.
„Wir sind der Meinung“, fuhr Sir John endlich fort, sich taktvoll vorfühlend, „dass ein willensstarker, entschlossener Mann, der eine genaue, ich möchte sagen, übernatürliche Kenntnis des Charakters und der Sinnesart der Eingeborenen besitzt; die fünf jetzt vom Großkönig beherrschten Gebiete in sechs bis sieben Monaten befrieden und einem Lande Gesetz und Recht geben könnte, in dem bisher Grausamkeit, Aberglauben und Tyrannei willkürlich wüteten.“
Wieder machte er eine Pause, und wieder wartete er vergebens. Er erhob sich, ging an die Wand und entrollte eine Landkarte. „Hier ist eine rohe Übersichtskarte des Landes, Herr Sanders“, sagte er mit leiser Aufforderung.
Sanders trat höflich an seine Seite.
„Hier sehen Sie die Geisterberge, an deren westlicher Flanke Ihre alten Freunde, die Ochori, ihren Wohnsitz haben; hier im Osten erstreckt sich das Land der Tofolaka, südlich davon am anderen Ufer beginnt das Gebiet der Bubujala. Hier beschreibt der Fluss eine Krümmung. Dort sehen Sie einen See, dessen Ufer nur angedeutet sind. Noch hat kein Weißer sie betreten.“
„Was ist das für eine Insel“, fragte Sanders plötzlich und wies auf einen kleinen, dunklen Punkt in dem ausschraffierten See.
„Das ist das Eiland der goldenen Vögel - ein hübscher Name für eine Insel, nicht wahr?“ Sanders nickte zustimmend, dann wurde sein Blick zum zweiten Mal gefesselt.
„Rimi-Rimi, die Residenz des Großkönigs“, sagte er kurz und deutete auf einen Kreis.
„Ganz recht - und dort oben im Norden von Rimi-Rimi sehen Sie einen Berg, das ist der Limpisi: Neuland für Sie, Herr Sanders. Das ist etwas anderes als die sumpfige Küste. Berg und Hochfläche, von Großwild belebt, ein Klima, das die zerriebenen Nerven gesund macht.“
„Wohl möglich“, sagte Sanders ruhig und kehrte mit Sir John an dessen Schreibtisch zurück. „Aber ich weiß sehr wenig darüber, und wenn Sie sich an mich als an eine Fundgrube des Wissens gewandt haben, so muss ich Sie leider enttäuschen!“
Der Unterstaatssekretär lächelte.
„Sie werden mich nicht enttäuschen; Herr Sanders, und ich hoffe, am wenigsten in dem, was ich Ihnen zu unterbreiten habe. Ich deutete bereits an, dass wir auf der Suche nach einem Mann sind, der die besten Führereigenschaften mit den hervorragendsten Kenntnissen der schwarzen Psyche verbindet, nach einem Mann kurzum, der sich bei den Eingeborenen in Respekt zu setzen weiß.“
„Es tut mir leid“, begann Sanders hastig.
„Warten Sie nur!“ Sir John unterbrach ihn mit einer schnellen Handbewegung, um einen unwiderruflichen Bescheid abzuwehren. „Der Regierung ist sehr viel daran gelegen, dass dieser Mann recht bald gefunden wird, weil ...“ Sir John zögerte - „nun, vor Ihnen, brauche ich nichts mehr zu verschleiern. Es ist uns etwas Böses da unten, zugestoßen. Wir hatten einen Unterhändler zum Großkönig geschickt. Er hatte die Aufgabe, Nachforschungen über das Schicksal Pergasor des verschollenen Missionars, und seiner Tochter anzustellen.“
„Er wurde getötet?“, fragte Sanders leise. Er wusste, wie schwer dem Unterstaatssekretär sein musste, die Wahrheit zu gestehen: „Wer war es?“
„Lloyd Thomas!“
Sanders nickte vor sich hin.
„Ich habe ihn gut gekannt, Armer Kerl! Aber war es nicht ein wenig - übereilt, ihn allein und ungeschützt in ein so gefährliches Gebiet zu entsenden?“
„Übereilt - hm - ja“, lautete die zögernde Zustimmung. „Ihr Nachfolger, Herr Sanders, hat da einen Irrtum begangen, für den allerdings die Regierung die volle Verantwortung tragen muss. Zur Erklärung möchte ich Ihnen Folgendes sagen. Der Krieg ist an dem Gebiet des Großkönigs vorbeigegangen. Es bestand für keine der beiden Parteien die Notwendigkeit, bis dorthin vorzustoßen, so dass dem König die wertvolle Lektion eines Truppendurchmarsches leider erspart blieb. Andererseits waren die Deutschen ihren Gegnern gegenüber sehr in der Minderzahl, um noch eine nennenswerte Beaufsichtigung des Hinterlandes durchführen zu können. Die Folge ist Unbotmäßigkeit und wachsender Dünkel des Großkönigs. Es ist sogar nicht ausgeschlossen, dass er Ihren alten Bezirk angreift“, sagte Sir John sehr ernst. „Nach allem, was uns zugetragen wurde, ist Lloyd Thomas unter größter Nichtachtung empfangen worden. Die Geschenke, die er mitbrachte, wurden im Ratsfeuer verbrannt.“ Sanders hob den Kopf.
„Das ist ein böses Zeichen. Es bedeutet so viel wie die Ansage einer Erzfehde. Alle Wirren bei den Nordochori und den Akasava haben so ihren Anfang genommen.“
Er schwieg eine Weile und überlegte mit gerunzelten Brauen. Da war es, als schüttle er eine Last von seiner Schulter.
„Ich würde mich der Regierung gern zur Verfügung stellen“, sagte er, „aber offen gestanden, das Kapitel Afrika ist für mich beendet, möchte es nicht wieder aufschlagen.“
Der Unterstaatssekretär rieb sich das Kinn und sah geflissentlich seinem Gegenüber vorbei.
„Wir haben ein sehr ansehnliches Schiffchen nach dem Stromgebiet entsandt. Es stellt im Vergleich mit der Zaire eine wesentliche Verbesserung dar und verfügt über die dreifache Maschinenkraft.“ Sanders schüttelte den Kopf:
„Es tut mir leid“, beharrte er bei seiner Weigerung.
„Sie können sich Ihre Offiziere selbst auswählen, und wir würden Ihrer Wahl auch dann nicht widersprechen, wenn sie auf Herren fiele, die den Dienst inzwischen quittiert haben. Wir würden sie sogar beim Wiedereintritt in den Dienst entsprechend im Range erhöhen“, setzte Sir John bedeutungsvoll hinzu. „Ich höre zum Beispiel, Ihr Schwager, Hauptmann Hamilton ...“
„Dem geht es wie mir“, fiel Sanders schnell ein, obwohl er in diesem besonderen Fall hätte zögern können. Denn Hamilton trug schwer an einem Liebeskummer. Er hatte sich heftig um eine Schönheit beworben, die ihm einen reicheren Freier vorgezogen hatte.
„Und wie steht es mit Tibbetts?“, erkundigte sich Sir John: „Oh, der sitzt jetzt auf dem Geldsack“, sagte Sanders lächelnd, „schwerlich würde er das Westend Londons mit den afrikanischen Dschungeln vertauschen wollen.“
Der Unterstaatssekretär zuckte bedauernd die Achseln und erhob sich.
„Es tut mir leid, dass ich keine bessere Überredungskunst besitze. Überlegen Sie sich mein Angebot auf alle Fälle, Herr Sanders, und lassen Sie sich bis zur endgültigen Entscheidung noch ein paar Tage Zeit. Noch eine Frage, ehe wir uns trennen. Das St. Michael- und das St. Georgkreuz ist Ihnen wohl schon verliehen, nicht wahr?“
„Jawohl, Herr Unterstaatssekretär“, sagte Sanders mit einem leichten Lächeln auf seinem sonnenverbrannten Gesicht.
„Eine Aufgabe, die sechs Monate Zeit kostet, schwer, aber interessant“, sagte der Unterstaatssekretär scheinbar ziellos und starrte geistesabwesend in die Luft. „Eine Aufgabe, deren glückliche Beendigung die Regierung nicht vergessen würde, Herr Sanders. Für einen Mann wie Sie“ - er machte eine kleine schmeichelhafte Handbewegung und gestattete sieh ein verbindliches Lächeln - „bedeutet natürlich der Baronet-Titel nichts. Aber die Damen lieben diesen kleinen Schmuck. Sie sind ja auch verheiratet, Herr Sanders? Nun - natürlich sind Sie es! Auf Wiedersehen also!“ Er streckte die Hand aus, und Sanders schüttelte sie. „Übrigens“, fügte er rasch hinzu, „Fergusons Schicksal will mir nicht aus dem Sinn. Und noch Schlimmeres befürchte ich für die junge Tochter. Frau Ferguson kommt beinahe jede Woche einmal und fragt händeringend; ob wir noch immer keine Nachricht haben.“
Sanders nickte. Die Frau des verschollenen Missionars hatte sich auch an ihn gewandt, und er wollte in diesem Augenblick lieber an sie denken.
„Sie glaubt fest daran, dass ihre Tochter als Gefangene in der Gefangenschaft eines Unterhäuptlings lebt - wenn man das Leben nennen kann. „Tausendmal besser, sie ist tot“, sagte Sanders und verbarg ein Schaudern.
Er ging nach einem letzten Abschied. Der greisenhafte Jüngling, der seine Tage im Meldezimmer fristete, erschien wie aus dem Nichts gezaubert und öffnete ihm die Tür.
Der Zufall wollte es, dass sich in Twickenham an dem gleichen Abend eine kleine Gesellschaft versammelte, die durch Afrika Erinnerungen eng miteinander verknüpft war. Nur die junge Dame, deren Einladung Tibbetts bei der Hausfrau beauftragt hatte und die von ihm mit drolliger Ehrerbietung und wechselnden Ausdrücken der Verliebtheit angeredet wurde, stand noch etwas außerhalb dieses intimen Kreises. Außer Tibbetts, der vor kurzem noch in der City geglänzt hatte und der jetzt sein Heil in der Wirtschaft versuchte, war noch Hamilton erschienen. Hamiltons ehemalige Hauptmann einer Kompanie dunkelhäutiger Haussas stand noch stark im Schatten seiner Enttäuschung, und auch die Frau des Hauses, Patricia Sanders, war nicht ganz so strahlend wie Tibbetts, den seine Kameraden ausschließlich Bones nannten, er bestehe nur aus Haut und Knochen (so sagten sie), Tibbetts, kam natürlich zu spät, und da alle schon bei Tisch saßen, merkte er wie gedrückt die Stimmung war.
„Beeile dich, Bones“, knurrte ihn Hamilton an, „es scheint dir nicht aufgefallen zu sein, dass wir eine geschlagene halbe Stunde auf dich warten!“
Bones war ins Zimmer gestürmt. Er zupfte noch an seinem Binder, aber fast im gleichen Augenblick hatte er drei Verbeugungen gemacht, eine feierliche zu seiner Tischdame hin, eine respektvolle zu Sanders und eine herzliche vor Patricia. Hamilton schüttelte ihm die Hand, als er neben ihm Platz nahm.
„Tag, alter Knabe! Es lebe die Tomatensuppe!“
„Tomatensuppe?“, fragte Hamilton und schaute mit gekrauster Stirn auf seinen Teller. „Ich glaube, das ist Juliennesuppe!“
„Teurer Alter, wer wird gleich so genau sein!“, fragte Bones mit erhabenem Vorwurf. „Ich meine die Tomatensuppe im Allgemeinen, denn wenn sie nicht wäre, wer kaufte mir dann meine Tomaten. Schon der gute, alte Shakespeare pflegte zu sagen ...“
„Halte den Schnabel und iss deine Suppe“, wies Hamilton ihn zurecht.
„Es lebe die Landwirtschaft, es lebe die Tomatenzucht, es lebe der künstliche Dünger“, sagte Bones begeistert und hielt seinen Löffel in halber Höhe zwischen Mund und Teller, ohne in seinem Überschwang darauf zu achten, dass inzwischen die Juliennesuppe den nicht ungewöhnlichen Weg vom Löffel herab auf seine weiße Hemdbrust fand. „Man reiche mir auf der einen Hand die ganze Industrie der Welt, auf der andern ein Beet mit Tomaten ...“
„Man reiche ihm ein Mundtuch und einen Schlabberlatz“, brauste Hamilton auf, „denn das hat er am nötigsten. Mensch, Bones hast du denn gar kein Taktgefühl? Merkst du nicht, dass etwas Besonderes in der Luft liegt?“
„Haben Sie sich endlich entschlossen, Landwirt zu werden?“, fragte Sanders über den Tisch herüber.
„Ja, Herr Sanders“, sagte Bones mit der Wärme einer schönen Überzeugung. „Es gibt nichts Herzigeres als rote Tomaten, und ich habe mir eine fabelhafte Methode ausgedacht, sie auch im Winter zu züchten. Man gebe einer jeden Tomatenpflanze eine Wärmflasche! Im Ernst“, ereiferte er sich, als Hamilton trocken und spöttisch auflachte, „wenn man neben jeder Wurzel eine tönerne Flasche vergrübe und sie von Zeit zu Zeit mit heißem Wasser füllte; warum sollten dann die Tomaten nicht auch im Winter gedeihen!“
„Ich freue mich, dass Sie mit so ehrlicher Begeisterung an Ihrem neuen Beruf hängen“, sagte Sanders, ein Lächeln unterdrückend, „denn nun wird das, was ich Ihnen zu sagen habe, Sie kaum aus der Fassung bringen. Man hat mir nämlich das Angebot gemacht, nach Afrika zurückzugehen, das heißt, nicht ganz in unser altes Gebiet, sondern weiter landeinwärts, in die Wildnis, über die der Großkönig gebietet.“ Bones und Hamilton legten gleichzeitig den Löffel nieder.
„Du meine Güte“, sagte Bones sanft und ergeben.
„Ich habe das Angebot natürlich abgelehnt“, fuhr Sanders gelassen fort.
„Natürlich“, sagte Bones.
„Sehr richtig“, bestätigte Hamilton.
„Unsere Aufgabe war befristet, sie sollte sich über sechs Monate nicht hinausziehen ...“
„Unsere Aufgabe?“, fragte Bones. „Täuscht mich mein Ohr, oder sagten Sie wirklich: unsere Aufgabe, teuerster Kommandeur?“
„Ich sagte: unsere Aufgabe, Bones, denn darauf lief es hinaus“, lächelte Sanders. „Man legte mir nahe, auf meine alten Offiziere zurückzugreifen, und erklärte sich bereit, sie bei Übernahme der Aufgabe zu befördern. Das würde Hamilton zum Major machen, und Sie, Bones, würden die Würde eines Hauptmanns mit Fassung zu tragen haben.“
Bones räusperte sich, aber Sanders kam ihm zuvor.
„Wie gesagt, ich habe abgelehnt. Selbst auf sechs oder sieben Monate möchte ich nicht nach Afrika zurück.“
„Hat man dir selbst irgendwelche Vorteile versprochen“, erkundigte sich Patricia.
Sanders lächelte.
„Nun, ich denke, man würde sich auch mir gegenüber erkenntlich erweisen, aber das alles verlockt mich kaum. Außerdem hast du doch eben erst Bones Geschäft übernommen, Hamilton, und selbst wenn du wolltest, könntest du dich nicht freimachen.“
„An sich wohl nicht“, meinte Hamilton bedächtig, „allerdings dürfte sich in den nächsten sechs Monaten kaum etwas ereignen, was meine Anwesenheit unbedingt notwendig machte.“
Sanders tat, als habe er diese Einschränkung nicht gehört.
„Wir alle sind inzwischen sesshaft geworden“, fuhr er fort. „Es ist viel von uns verlangt, dass wir nun alles das über den Haufen werfen sollten, und sei es auch nur für die Dauer eines halben Jahres. Außerdem erwartet uns nicht etwa der gemütliche Dienst auf unserer alten Station. Es heißt Neuland erobern, wahrscheinlich sogar mit Waffengewalt. Der Großkönig scheint auf Macht- und Gebietserweiterung - auszugehen. Ihn jetzt kleinzukriegen, ist ein heißes Stück Arbeit.“
„Wirst du etwa in Gefahr sein, wenn du nach Afrika gehst?“ Erkundigte sich die junge Dame zu Bones Linken und sah angstvoll zu ihm auf.
„Was heißt Gefahr, geliebte Goldpuppe“, fragte Bones und wischte sich in die Brust. „Gefahr ist mir ein Dreck an meiner Sohle. Verzeihung ... äh ... ich meine Sekt in meiner Bowle. Gefahr ist mir,“ Er holte zu einem tiefen Atemzug aus, um sich mit voller Lungengewalt in sein geliebtes Thema zu stürzen, doch ein warnender BIick seines früheren Vorgesetzten gab ihm eine ganze Wendung. „In Gefahr, mein süßes Kind, laufe ich eher, wenn ich über die Oxford Street gehe, als im afrikanischen Dschungel. Gefahr! Ha! Ha!“
Bones verfügte über ein Lachen, das die Teller erklirren ließ. „Was kann dir, mein Zuckerpüppchen, denn schon in einem solchen Dschungel begegnen? Vielleicht triffst du einen Löwen. Erschrick nicht. Der alte Kerl hat zumeist gar keine Zähne oder eben erst gefrühstückt. Oder du fällst so einem ollen, kannibalischen Großkönig in den Fressnapf. Ist auch nicht so schlimm, wie es sich anhört. Man muss alles mal durchgemacht haben.“
Es war gut, dass in diesem Augenblick das Hausmädchen ins Zimmer trat und Bones Redestrom unterbrach.
Das Mädchen beugte sich zur Hausherrin nieder und nannte flüsternd einen Namen.
„Frau Ferguson?“, fragte Patricia erstaunt. „Ist das nicht die unglückliche Missionarsgattin, deren Mann in Afrika verschollen ist?“
Sanders nickte seufzend. Er erriet, dass der Unterstaatssekretär mit diesem Besuch seine Trumpfkarte ausspielte.
„Ich muss sie wohl empfangen.“
„Führen Sie die Dame herein, Marie“, sagte Patricia; noch ehe Sanders eine andere Anordnung treffen konnte.
Die Herren erhoben sich, als Frau Ferguson ins Zimmer trat. Sie war eine schlanke, zarte Frau in Trauerkleidung, und zwei tiefe, kummervolle Augen hefteten sich auf Sanders. Der Blick traf ihn ins Herz.
Sanders stellte ihr die Anwesenden vor. Sie nahm schüchtern den Stuhl, den er ihr anbot.
„Werden Sie nach Afrika gehen, Herr Sanders?“, fragte sie flehend. „Sie sind meine letzte Hoffnung.“
Sanders stieg das Blut ins Gesicht.
„Ich bitte Sie, mir glauben zu wollen, dass ich ...“, begann er. Aber Frau Ferguson hatte nicht die Geduld, ihn anzuhören.
„O Frau Sanders, lassen Sie Ihren Gatten nach Afrika gehen. Ich kenne die Größe des Opfers, das Sie bringen werden, aber versetzen Sie sich in meine Lage. Ich bange um das Schicksal meines einzigen Kindes!“
„Meine Frau hält mich nicht zurück“, sagte Sanders, und seine Stimme klang laut, so still war es im Zimmer.
Frau Ferguson starrte vor sich hin. Sie erschauerte.
„Das Unglück traf uns an einem Morgen beim Frühstück“, hob sie nach einer Weile wieder an. „Wir ahnten nichts Schlimmes, denn der Großkönig hatte mit meinem Mann Salz gegessen. Mofobolo, der Jäger des Königs, führte die Mordbande. Henry rief mir zu, ich sollte zum Fluss laufen, wo unser kleines Dampfboot verankert lag. Ich sah, wie man ihn blutüberströmt fortschleppte - und ich ... sah. . . wie Mofobolo mein Kind in den Busch trieb: O mein Gott, Herr Sanders, sie ist in der Gewalt dieses Menschen, und sie war achtzehn Jahre alt. Sie wird zwanzig am Ersten des nächsten Monats!“
„Frau Ferguson ... ich bitte Sie!“
Sanders Gesicht war von Gram verzerrt, und in seinen Augen lag ein Ausdruck der Qual.
„Sie ist in seiner Gewalt ... in der Gewalt eines bösartigen Negers, und jede Stunde, um die Sie Ihre Entscheidung verschieben, fügt der Rohling meinem Kind eine neue Folterung zu.
Die Damen führten die schluchzende Frau hinaus, und die Männer blieben in tiefem Schweigen zurück, jeder mit seinen eigenen Gedanken beschäftigt. Sie hörten, wie die Haustür dumpf ins Schloss fiel, Gummireifen auf dem Kies der Auffahrt knirschten. Dann kamen die Frauen zurück.
Patricia ging an ihrem Gatten vorbei und legte mit leiser Liebkosung die Hand auf seine Schulter. Er nahm ihre Hand und küsste sie. „Ich fahre mit dem nächsten Dampfer nach Afrika“, sagte er. „Wer geht mit mir?“
Die Frage war überflüssig. Hamilton zeigte sein grimmigstes Lächeln. Bones hatte sich auf den Schaukelstuhl gesetzt, sang ein Lied und schwang hin und her. Es war ein Lied mit seltsamem Rhythmus, welches in seiner Kehle rau und drohend klang. Es war der Kriegsgesang der Isisi, den sie in dröhnendem Chor anstimmten, wenn die „Zaire“ von ihren Expeditionen zurückkehrend, an der Flusskrümmung auftauchte und an dem kleinen Landungsplatz der Station anlegte.
Sandi, der Recht setzt vor Trug,
er, der des Nachts kommt gegangen,
er, der Usumbi erschlug
und der N’gombo gehangen,
der die Kranken rettet von Schmerz und Tod,
der die Armen schützt vor Hunger und Not,
Sandi! Sandi! Sandi!
Über die Geisterberge,
vom Tal zum Gipfel und wieder zum herab,
drang der schrille Wirbel eines Lokoli,
und der Signaltrommel der Ochori,
der als Erster die Botschaft aussandte,
legte seine Liebe und seinen ganzen Stolz hinein.
„Sandi ... der Würger ... schnelle Geber der Gesetze ... Sandi ... lebt!“
*
Man hörte die Botschaft in Rimi-Rimi und brachte sie vor den Großkönig. Schaum trat auf seine Lippen, keuchend flog der Atem seinem Munde, und seine Augen rollten in den Höhlen.
„Bringt mir M’sufu, den Propheten“, heulte er, „und ruft mir meine Enthäuter. Heute Nacht gibt es einen Wundermann weniger im Land. Sie brachten M’sufu, und sie folterten ihn, bis gegen Morgengrauen die Seele aus seinem blutenden Körper entfloh.
Sandi! Sandi!





























