
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Oetinger
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Leonard und seine Freunde konnten die Sabotage der Traumproduktion verhindern, doch schnell wird klar, dass die Gefahr für Sansaria und die Menschenwelt noch nicht gebannt ist. Während sich die Menschen auf der Erde langsam wieder erholen, zerfällt Sansaria. Und der Mann auf dem Eisbrecher in der Arktis schmiedet weiter finstere Pläne: er hat es auf die Träumlinge der Menschen abgesehen. Jene Wesen, die dafür zuständig sind, dass die Menschen träumen. Wird es Leonard gelingen, sie vor dem Untergang zu bewahren?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über dieses Buch
Sansaria ist immer noch vom Untergang bedroht! Nach und nach löst sich die Traumwelt auf. Und der Mann auf dem Eisbrecher in der Arktis schmiedet längst neue finstere Pläne. Diesmal hat er es auf die Träumlinge abgesehen, jene Wesen, die dafür sorgen, dass die Menschen träumen. Wird es Leonard und seinen Freunden gelingen, diese zauberhaften Gestalten und damit die Welt zu retten?
Für David,
das magischste Wesen von allen
Erstes Kapitel
Schwer atmend stand Leonard vor der Tür des Gartenhäuschens und trat unschlüssig von einem Fuß auf den anderen. Es war ein besonders kalter Oktobersonntag und sein Atem bildete weiße Wölkchen in der Luft. Ringsum lag Laub im hohen Gras und die Blumen in den Beeten waren verblüht, was das Gelände traurig aussehen ließ. Dass er es überhaupt vor die Tür geschafft hatte, war ein kleines Wunder, da ihm in den letzten Wochen schon der Gedanke an Uhlgars Häuschen alle Kraft geraubt hatte.
Nach der Nacht der langen Messer in Sansaria, wie der große Kampf von den Bewohnern des Traumlandes seither genannt wurde, war Leonard einfach wieder zur Schule gegangen. Er erledigte nachmittags seine Hausaufgaben und hörte Gabriel zu, der ihm unermüdlich versicherte, dass er sich keine Vorwürfe machen durfte. Er aß mit seiner Mutter zu Abend und wartete in seinem Zimmer darauf, das Geräusch eines Motorrads zu hören. Doch bei alldem fühlte er sich innerlich mehr tot als lebendig. Dass Uhlgar den Giftpfeil abgefangen hatte, der für ihn bestimmt war, konnte Leonard sich einfach nicht verzeihen. Nachts ließ ihn das Bild, wie sein großer Freund niedergestreckt auf der Mistelstraße lag, nicht schlafen. Und tagsüber verfolgte ihn die Erinnerung an sein Versprechen, ein Meister zu werden. Aber wozu soll ich die Prüfung noch bestehen, wo sich das Problem mit den Träumen in Luft aufgelöst hat?, fragte er sich. Und wozu das Tor mit den drei goldenen Siegeln finden, wenn sich sowieso niemand mehr dafür interessiert?
Der Koffer mit den Zauberfarben lag zwar noch unter seinem Bett, doch seit der Schlacht benutzte Leonard ihn nicht mehr täglich und noch seltener blätterte er im Druidenbuch. Und in dem roten Lederbuch, das Informationen zum Tor mit den drei goldenen Siegeln enthalten sollte, war er erst recht nicht weitergekommen. Stattdessen quälte er sich mit Vorwürfen und hoffte auf eine Nachricht von Philomena. Ihr im Traum zu begegnen, hätte ihm sogar gereicht. Doch nichts. Sendepause. Nada. Ist sicher besser so, redete er sich ein, ich hätte Sansaria sowieso enttäuscht. Zumal ihm sämtliche Tugenden fehlten, die einen Helden seiner Meinung nach auszeichneten: Er war weder besonders mutig, noch konnte er andere für eine Sache begeistern. Und ein herausstechendes Talent hatte er auch nicht. Beim Malen war er inzwischen ganz gut geworden, aber das konnte ebenso gut an den Farben liegen.
Die Einzige, die ihm tatsächlich eine Auskunft zu all dem hätte geben können, wollte er nicht fragen. Denn seit Kassiopeia ihn gegen seinen Willen aus Sansaria wegbracht hatte, war die Annullatorin für ihn gestorben. Gabriel war zwar davon überzeugt, dass Kassiopeia nur zu ihrem Besten gehandelt hatte, doch Leonard glaubte fest daran, dass Uhlgar ohne ihren Verrat nichts passiert wäre.
Da Leonard ihm allerdings versprochen hatte, im Gartenhaus nach dem Rechten zu sehen, stand er nun frierend auf seiner Matte.
Stell dich nicht so an, das ist das Mindeste, was du ihm schuldest, machte Leonard sich Mut und drückte die Klinke mit Schwung hinunter. Er stolperte durch die Tür, die hinter ihm geräuschvoll ins Schloss fiel. Dunkelheit umgab ihn und es roch tröstlich nach Zimt und Kräutern. Danach hatte Uhlgar auch immer gerochen.
Leonard tastete nach dem Lichtschalter. Als die Deckenlampe den Raum ausleuchtete, spürte er einen Stich in der Brust. Uhlgars Bett war gemacht, auf dem Teppich davor stand ein Paar riesiger, bestickter Pantoffeln. Den Acapulco-Chair, den er gezeichnet hatte, entdeckte Leonard in einer Ecke. Zögernd trat er an das Bett, strich mit einer Hand über die Decke und zog die Lade des Nachtkästchens auf. Einige Salben kullerten darin gegeneinander, darunter lagen ein Block und ein Kugelschreiber sowie Gutscheine für eine Eisdiele in der Stadt. Im zweiten Fach stapelten sich geblümte Nachthemden, die nach Lavendel dufteten. Leonard sah unter dem Kissen und der Matratze nach, hinter dem Landschaftsbild und unter dem Teppich, doch nirgends fand er eine Nachricht oder sonst einen Hinweis.
Dabei war er sicher, dass Uhlgar ihm mit seinen letzten Worten etwas hatte mitteilen wollen. Leonard ging zum Schrank, dessen Türen durch eine Fahrradkette verschlossen waren. Uhlgar bewahrte darin sein Fläschchen Allesheil auf, und falls er etwas Wertvolles besaß, würde Leonard es bestimmt darin finden. Er rüttelte an dem Schloss, musste aber schnell einsehen, dass er so nicht weiterkommen würde. Also durchkämmte er das Zimmer nach dem passenden Schlüssel. Er klopfte den Holzboden nach möglichen Hohlräumen ab, sah über dem Türstock und in den Blumenkästen neben dem Eingang nach, doch vergeblich.
»Lass es uns mit der Schlüsselblume aus dem Druidenbuch versuchen«, sagte Gabriel am nächsten Tag in der Pause, nachdem Leonard ihm von seinem Problem erzählt hatte. »Die Schlüssel sollen alle möglichen Schlösser öffnen, warum nicht auch das?«
»Gute Idee«, antwortete Leonard, der von der Pflanze noch nie gehört hatte. »Kommst du nachher mit zu mir?«
Gabriel nickte mit vollem Mund, hocherfreut, dass sie endlich wieder Pläne schmiedeten, und schwer damit beschäftigt, einen Müsli-Riegel klein zu beißen.
»Und am Wochenende verkleiden wir uns und ziehen durch die Stadt«, sagte Gabriel.
Leonard sah ihn ratlos an, also ergänzte Gabriel, »Na wegen Halloween. Hörst du mir eigentlich auch mal zu? Ich habe dir schon unschlagbare Ideen für unsere Kostüme geliefert, du musst sie nur noch malen.«
Leonard seufzte und zuckte mit den Schultern.
Nach der Schule nahmen sie den Bus und gingen das letzte Stück schweigend zur Federspielvilla. Gabriel ließ sich von seinem Longboard tragen, das gerade mal ein paar Zentimeter über der Straße schwebte. Als sie das kleine Tor zu dem Kiesweg passierten, der zu Leonards Haus führte, raschelten die Sybellinischen Schüttelpalmen über ihnen mit ihren prächtigen Wedeln.
»Komm, ich male uns erst noch eine Pizza«, sagte Leonard und eilte, zu Gabriels Überraschung, voraus. »Ich habe einen Riesenhunger und mit vollem Magen geht das mit den Schlüsseln gleich viel besser.«
»Einen Schokopudding würde ich auch vertragen«, rief Gabriel ihm nach und flog vor Begeisterung einen Looping. Danach sah er sich hektisch um. Doch zum Glück hatte ihn niemand gesehen.
Oben in seinem Zimmer zerrte Leonard den Zauberkoffer unter dem Bett hervor, ließ die Schnallen aufschnappen und klappte die langen Farbtürme aus. Wie jedes Mal, wenn er das tat, lief ihm ein wohliger Schauer den Rücken hinunter. Die Öltuben schimmerten einladend in den sattesten Tönen. Er betrachtete ein Bremerblau, das so intensiv war, wie der Abendhimmel vor einem Gewitter. Darüber ein elegantes Venezianischrot und ein Orange, so spritzig, dass er Orangensaft in seinem Mund schmecken konnte. Im Turm daneben reihten sich Kreiden im schönsten Pastellverlauf aneinander, von den dunkelsten Noten ganz unten bis zu hellsten Gelbtönen oben.
»Da fehlen aber einige«, sagte Gabriel und deutete auf die Lücken.
Leonard nickte und nahm einen Papierbogen aus dem Koffer, den er auf dem Boden glatt strich. »Seit letzter Woche verschwinden manche Farben, wenn ich mit ihnen male.«
»Was soll das heißen? Lösen sie sich in Luft auf?«, fragte Gabriel, der bei den Farben inzwischen alles für möglich hielt. »Und was hat das zu bedeuten?«
»Keine Ahnung«, antwortete Leonard niedergeschlagen. »Vielleicht, dass mir die Zeit wegrennt? Oder dass ich doch nicht der Auserwählte bin?«
»Das glaube ich nicht«, sagte Gabriel und betrachtete den Koffer skeptisch. »Die Farben funktionieren doch noch, oder?«
»Bisher schon.« Leonard wählte die richtigen Stifte aus und wenig später flutschten zwei Pizza Margherita mit extra Mais aus dem Papier und landeten auf den Tellern, die sie bereitgestellt hatten. Die beiden verspeisten sie gierig, dann machten sie sich an die Arbeit.
Gabriel fand die Schlüssel-Pflanze im Druidenbuch und reichte Leonard die aufgeschlagene Seite. Clavis-Blume stand über einem filigranen Strauch. Das etwa vierzig Zentimeter hohe Gewächs endete in dichten Blätterbüscheln, in deren Mitte je eine gelbe Blüte saß.
»Wie läuft’s?«, fragte Gabriel wenig später und schaufelte sich einen Löffel Schokoladenpudding in den Mund, während Leonard die Pflanze auf dem Papier zum Leben erweckte.
»Ganz gut, soweit«, entgegnete Leonard und malte konzentriert die letzte Blüte aus. Sein Strauch war vom Original kaum noch zu unterscheiden.
»Sieht großartig aus«, nuschelte Gabriel beeindruckt.
Leonard betrachtete die Blüte, die er mehr gedacht als gezeichnet hatte, und wollte gerade die Farbe »Mango-Gelb, Burma« ablegen, als er plötzlich aufschrie und seine Hand schüttelte.
»Was ist passiert?«, rief Gabriel und sprang auf die Beine.
»Jetzt ist die nächste verschwunden«, antwortete Leonard und betrachtete perplex seine Finger, die die Farbe gerade noch gehalten hatten. In seiner Handfläche breitete sich ein Kribbeln aus, das den Arm hinaufschoss und für einen Augenblick seinen ganzen Körper ausfüllte.
»Hast du Schmerzen?«
»Nein, es hat sich nur kurz seltsam angefühlt.«
Gabriel nickte erleichtert und hielt konzentriert nach der Farbe Ausschau, die jedoch nirgends im Zimmer zu finden war. Zuletzt kroch er sogar unter das Bett.
»Das kannst du bleiben lassen. Die ist genauso weg wie die anderen«, sagte Leonard resigniert. Er gab sich Mühe, sich nichts anmerken zu lassen, doch insgeheim machte er sich Vorwürfe. Wie soll ich jemals ein Meister werden, wenn ich es nicht einmal schaffe, auf die Zauberfarben aufzupassen?
Wenig später schraffierte er das letzte Blatt der Druidenpflanze und ließ den Strauch aus dem Blatt rutschen.
Draußen dämmerte es bereits. Es war noch kälter geworden und die Erde in Uhlgars Blumenkästchen gefroren. Gabriel und Leonard traten im Häuschen an die große Werkbank, über der Uhlgars Werkzeuge an einem langen Brett hingen. Sie griffen sich eine Schaufel und eine Harke und bearbeiteten damit die Erde, die sie anschließend nach drinnen schleppten und auf die Werkbank legten, nicht ohne vorher ein Tuch ausgebreitet zu haben. Sie warteten, bis die Erde aufgetaut war, dann setzten sie den Clavis-Strauch draußen ein. Während die Sonne verschwand, betrachteten sie keuchend ihr Werk.
»Jetzt musst du nur noch die Richtige pflücken«, sagte Gabriel und klopfte sich Erde von den eiskalten Fingern.
»Ich weiß. Der Stempelboden der Blüte soll der Schlüsselbart werden.«
Sie gingen in die Villa zurück und kochten sich einen Tee. Gabriel rief bei seinen Eltern an, um zu fragen, ob er bei Leonard übernachten konnte. Und da Leonard trotz allem immer noch die besten Noten in seiner Klasse bekam, hatten Gabriels Eltern weiterhin die Hoffnung, er könne einen guten Einfluss auf ihren Sohn haben, und erlaubten es.
Als Leonards Mutter von der Universität nach Hause kam, gab es Stollen und Aufschnitt, Salat ohne Öl, aber mit Balsamico, und bevor sie ins Bett ging, schenkte Erika sich einen Schluck Rum in die Tasse ein.
Oben in seinem Zimmer blickte Leonard, im Pyjama am Fenster stehend, noch einmal nach unten auf das Gartenhäuschen und hoffte, dass die Pflanze in der Nacht nicht erfrieren, sondern anwachsen würde.
»Selbst wenn wir unseren Eltern alles erzählen würden, wer würde uns glauben?«, fragte Gabriel. Er döste schon halb weg, als Leonard zu ihm unter die Deckte schlüpfte. Das Bett war breit genug für beide, und bevor Leonard die Augen schloss und hoffte, von Sansaria und Philomena zu träumen, dachte er über Gabriels Frage nach.
Am nächsten Morgen schlichen die beiden als Erstes in Schlafanzügen und Stiefeln die Treppen hinunter und sahen draußen nach der Druidenpflanze. Zu ihrer Freude war sie angewachsen und reckte ihre Blüten entschlossen der Sonne entgegen. Leonard hatte sich die dazugehörige Erklärung schon am Vortag beim Malen durchgelesen und musterte die Blüten nun ausgiebig, bevor er schließlich eine kleinere abbrach.
Er drehte die Blüte behutsam in seinen Fingern und tatsächlich, an der Stelle, an der sie am Stiel gesteckt hatte, erkannte er nun metallene Zacken, die eindeutig an einen Schlüssel erinnerten. Gabriel hielt ihm die Tür des Gartenhäuschens auf, das Leonard heute größer vorkam, und folgte ihm nach drinnen. An der Fahrradkette ließ sich der Blütenschlüssel zuerst butterweich in das Schloss stecken, doch dann blockierte er und bewegte sich keinen Millimeter weiter. Leonard zog ihn mit Mühe wieder heraus und wollte ihn gerade ein zweites Mal probieren, als die Blüte in seiner Hand zu Staub wurde.
»Die war es wohl nicht«, kommentierte Gabriel das Offensichtliche.
Leonard pflückte eine zweite Blüte vom Strauch, doch wie die erste zerbröselte sie nach einem weiteren erfolglosen Versuch.
»Konzentriere dich«, spornte Gabriel Leonard an und klopfte ihm aufmunternd auf den Rücken.
Leonard verdrehte die Augen, stellte sich jedoch wieder vor den Strauch und breitete seine Handflächen darüber aus. Er dachte an Uhlgars Worte, dass man mit ganzem Herzen und ganzer Leidenschaft bei der Sache sein musste, wenn man wollte, dass etwas gelang. Er kam sich dabei irgendwie lächerlich vor, doch gerade als er aufgeben wollte, spürte er etwas Warmes unter seiner linken Hand. Er blinzelte und sah unter einem Blatt eine Blüte aufleuchten. Die muss es sein, dachte er. Er pflückte sie und reichte sie Gabriel, der sie vorsichtig in das Vorhängeschloss steckte. Sie machten beide einen Satz, als es umstandslos aufsprang.
»Wir haben es geschafft!«, jubelte Gabriel und fiel Leonard um den Hals. Arm in Arm hüpften sie vor Freude durch das Zimmer, bis sie außer Atem waren. So sehr hatte sich Leonard lange über nichts mehr gefreut.
»Mach ihn auf«, forderte er Gabriel auf, der die Kette des Schranks mit zitternden Fingern löste.
Zweites Kapitel
Philomena hielt das Sträußchen Wohlauf-Tulpen in ihrer Hand fest umschlossen, als sie sich im fünften Stock des Chiron-Krankenhauses zwischen zwei Sanitätern hindurchzwängte. Die beiden hatten gerade ihre Nachtschicht beendet und schlurften durch den hellgrün gestrichenen Flur, der sie ebenso krank aussehen ließ wie die Patienten, die in den Zimmern links und rechts des Ganges stöhnten.
»Langsam, junge Dame«, schimpfte ihr der eine hinterher.
»Das ist ein Krankenhaus und keine Rennstrecke«, sagte der andere. Philomena murmelte eine Entschuldigung, drosselte ihr Tempo jedoch erst vor dem Wachmann, der aussah wie ein Sumo-Ringer und ein paar Gänge weiter die Tür mit der Nummer 521 bewachte.
»Lange nicht gesehen«, begrüßte sie der Wachmann, erhob sich ächzend von seinem Stuhl und deutete auf die Blumen in ihrer Hand. »Sind die für mich?«
Philomena schüttelte den Kopf und drückte ihm stattdessen ein Fläschchen Schwerelosigkeit in die Hand, das er sofort in seiner Uniform verschwinden ließ. Der Wachmann blickte sich um, versicherte sich, dass die Luft rein war, und öffnete die Tür einen Spalt weit. »Du hast fünf Minuten.« Philomena schlüpfte hinein.
Drinnen war es dunkel. Lediglich ein schwaches Licht über dem Krankenbett in der Mitte des Zimmers beleuchtete das schlafende Gesicht eines großen Mannes mit wirrem Haar und dichtem Bart, dessen Füße unter der Decke herausragten und an das Bettgitter stießen. Philomena nahm die Vase mit den Vergissmeinnicht vom Nachtkästchen und warf sie stirnrunzelnd in den Mülleimer. Sie ging zum Waschbecken, füllte frisches Wasser in die Vase und steckte ihren Strauß hinein.
»Wohlauf-Tulpen beschleunigen die Heilung«, sagte sie mehr zu sich selbst als zu dem Kranken und betrachtete die orangefarbenen Blütenkelche, die sich in der Vase aufrichteten. »Tut mir leid, dass ich so lange nicht vorbeigekommen bin, aber der Prozess hat sich endlos hingezogen. Gestern haben sie Max und die anderen endlich auf Bewährung freigesprochen. Du kannst dir ja vorstellen, wie erleichtert wir darüber sind.« Sie ließ sich auf den Besucherstuhl neben dem Bett plumpsen, vermied es jedoch, dem Kranken ins Gesicht zu sehen. »Allerdings muss Damian wegen Anführung einer regierungsfeindlichen Vereinigung und Sachbeschädigung ins Gefängnis. Er geht zwar in Berufung, aber alle sagen, es sähe nicht gut für ihn aus. Und von Cosimo dem Listigen fehlt nach wie vor jede Spur. Clara Zertusia lässt ihn zwar suchen, aber ehrlich gesagt, weiß ich nicht, was das noch bringen soll.« Philomena biss sich auf die Lippen und überlegte, ob sie die Situation beschönigen sollte. Falls er sie hören konnte, würden ihn die Neuigkeiten in Sansaria höchstwahrscheinlich betrüben, und das konnte nicht gut für ihn sein. Andererseits fühlte es sich wunderbar an, endlich jemandem ihre Sorgen anzuvertrauen. Vor allem ihm.
»Ehrlich gesagt, läuft hier überhaupt nichts mehr rund, seit dem Problem mit der Traumdistribution«, platzte es schon aus ihr heraus, als sie noch am Überlegen war, was sie noch erzählen wollte. »Das ›Institut für Inspiration und künstlerische Muse‹ hat zwar vor ein paar Tagen den Betrieb wieder aufgenommen, genau wie ›Klipp & Klar‹. Aber obwohl die Menschen wieder träumen, kommt nicht genug Glee bei uns an, und was das für Folgen hat, kannst du dir ja vorstellen. Jedenfalls machen sich alle Sorgen, wie es weitergehen soll.«
Philomena schreckte zusammen, als sie draußen Stimmen hörte. Die dazugehörigen Schritte kamen näher, entfernten sich jedoch wieder. »Ansonsten gibt es nicht viel Neues. Außer, dass die Arktische Scherenhecke vor Spurs Spezialitätengeschäft im Sansaria Boten zur Attraktion Ersten Grades erklärt wurde. Stell dir vor, davor drängeln sich täglich Hunderte Besucher und die Regierung überlegt angeblich, wie sie dafür Eintritt verlangen kann. Na ja, ich war seit dem Abend nicht mehr dort, aber irgendwann will ich sie mir auch noch mal aus der Nähe ansehen.«
Philomena betrachtete die großen Hände, die unter der Decke hervorlugten. Elektroden und Schläuche führten von ihnen zu blinkenden Geräten und einem Tropf, die aufgereiht neben dem Bett standen.
»Es wird Zeit«, raunte der Wachmann durch den Türspalt und Philomena erhob sich.
»Spur und Garbutin werden noch vermisst«, flüsterte sie dem Kranken auf dem Weg zur Tür zu, »genau wie Cassius und Hanka. Bei Leonard muss ich mich auch dringend wieder melden. Er macht sich große Sorgen um dich, also halte bitte durch, Uhlgar. Wir brauchen dich! Ich fürchte, dass uns das Schlimmste noch bevorsteht.«
Während Philomena sich durch die Krankenhausgänge den Weg nach draußen bahnte, beugten sich eine Etage über ihr zwei Ärztinnen über Cassius, der, wie Hanka im Bett neben ihm, noch genauso versteinert dalag, wie in all den Wochen zuvor.
Damians Männer hatten die beiden noch in der Nacht, in der die Uniformierten zusammengebrochen waren, aus dem Finsterwald geholt und auf die eigens für sie reservierte Station gebracht. Hier wurden sie unter strengster Geheimhaltung von den besten Ärztinnen Sansarias therapiert. Bisher jedoch ohne jeden Erfolg. Bei Uhlgar wussten die Experten, was geschehen war, sie konnten ihn behandeln, und auch wenn sein Zustand sich kaum verbessert hatte, war eine positive Wende möglich. Bei Hanka und Cassius wussten die Spezialistinnen aber nicht einmal, was ihnen im Finsterwald zugestoßen war. Geschweige denn, welche Therapie die richtige sein könnte.
»Lassen Sie für morgen wieder heiße Wickel mit Allesheil vorbereiten«, beauftragte die Chefärztin einen Pfleger. »Und wann liefert Druidenmeister Dunkel endlich die bestellte Bewegungsdrang-Tinktur?«
»Diese Woche nicht mehr«, antwortete der junge Mann niedergeschlagen. »Sein Sekretär hat uns ausgerichtet, dass die dazu benötigten Pflanzen nicht genug Glee enthalten …«
»Nicht einmal die Druidenpflanzen haben noch genügend Glee«, wiederholte die Ärztin besorgt und tauschte einen ernsten Blick mit ihrer Kollegin aus.
»Mehr weiß ich leider auch nicht«, antwortete der Pfleger.
»Schon gut, informieren Sie mich bei der kleinsten Veränderung«, sagte die Chefärztin und verließ das Zimmer, gefolgt von ihrem gedrungenen Assistenten, der alle ihre Anmerkungen mit unsichtbarer Tinte in eine verschließbare Kladde notiert hatte.
Vor dem Krankenhaus huschte Philomena am markanten Profil von Cosimo dem Listigen vorbei, das im Dritten Quartier überall auf den verschnörkelten Litfaßsäulen plakatiert war. Unter Cosimos Bart stand eine Nummer, unter der man sich melden sollte, wenn man sachdienliche Hinweise zu seinem Verbleiben hatte. Neben und über seinem Porträt hatten Tagelöhner eigene Zettel angebracht, auf denen sie um Arbeit bettelten. Bin kräftig, unkompliziert und zu allem bereit. Körperliche Arbeit aller Art, pro Tag ein Taler, stand auf einem gelben Zettel. Auf einem blauen daneben zeigte ein Pfeil zurück auf den ersten, darunter stand in zittrigen Druckbuchstaben: Mache das Gleiche, aber billiger.
Hier hat sich in den letzten Wochen einiges verändert, dachte Philomena und erinnerte sich an die Professoren und Künstler, die in dem Quartier normalerweise durch die Straßen schlenderten.
Philomena schielte zu der Gruppe Minen- und Wanderarbeiter aus den äußeren Randgebieten hinüber, die den Eingang zum kleinen Park blockierten, den sie sonst immer als Abkürzung nahm. Die Erwachsenen und Kinder trugen zerschlissene Umhänge und schienen ihren halben Hausstand mitzuschleppen. Philomena drängelte sich durch ein paar abgemagerte Wolkenschafe, stieg über Kisten mit Honigkatzen und kurvte um sechs Säcke mit Rauch-Erbsen, die ihr den Weg versperrten. Als sie den Park erreichte, sah sie, dass auch da viel mehr los war also sonst. Neben ein paar Spaziergängern traf man dort sonst nur Liebespärchen und Vogel-Kundler, aber nun war er voll und die Bänke alle besetzt. Einige Familien hockten mitsamt Haustieren vor kleinen Huckehäusern, die man leicht transportieren und aufstellen konnte, und die bis zu zwanzig Personen Platz boten, obwohl sie von außen nicht viel größer als eine Hundehütte wirkten. Aber nicht alle Park-Besucher waren so gut ausgestattet, einige hatten es sich provisorisch unter einem Baum gemütlich gemacht, Tücher zwischen die Äste gespannt und ein Acht-Personen-Sofa darunter gestellt, das abends für die gesamte Gruppe ausgezogen wurde.
»Wäre ich nicht mitten in der Nacht durch das Blöken der Schafe aufgewacht, wären wir abgerutscht! Samt Haus und Kindern!«, hörte Philomena einen Mann erzählen. Er gestikulierte dabei wild mit seinen Händen. Sein Zuhörer klopfte ihm beruhigend auf die Schultern.
»Immerhin haben wir es geschafft. Mein Pferd Mina hingegen …« Bei der Erinnerung brach der Mann in heftiges Schluchzen aus. »Ich konnte sie einfach nicht festhalten …«
»Mein Beileid«, tröstete ihn sein Gegenüber, und einige Umstehende rückten zusammen, um ihm Mut zuzusprechen. Mehr konnte Philomena nicht verstehen, weil die Worte verschluckt wurden. Aber der besorgte Tonfall drang noch zu ihr durch.
Obwohl die Fremden im Park jedes Mal verstummten, sobald Philomena an ihnen vorbeilief, schnappte sie auf dem Weg noch weitere Satzstücke auf.
»… und wenn es sich bis hierher frisst?«, fragte ein schmächtiges Mädchen einen Mann, dessen Umhang vollkommen verschlissen war. »Was dann?«
»Wird es schon nicht.«
»Wenn aber doch?«
»Was ist denn passiert?«, fragte Philomena, blieb stehen und beugte sich zu der Kleinen hinunter.
»Der Wald und unser Feld sind verschwunden«, antwortete das Mädchen mit großen Augen. »Die waren eines Morgens einfach weg.«
»Was soll das denn heißen?«, fragte Philomena verdutzt.
»Wir sprechen nicht mit Städtern«, brummte der Mann und zog das Mädchen eilig von ihr fort. »Ihr wollt uns hier ja nicht haben und ihr habt uns noch nie geglaubt.«
Drittes Kapitel
An den Hunger hatte Ron der Mutige, sich inzwischen gewöhnt. Dass er ihn überhaupt spürte, erinnerte ihn an die Tatsache, dass er kein Träumling mehr war. Stattdessen war er als Ronin dazu verdammt, den Rest seines Lebens allein zu verbringen. Doch die Erinnerung an Cosimo den Listigen, der so tapfer gewesen war, verbat ihm, seiner Traurigkeit nachzugeben. Und statt sich eine Mulde im Sand auszuheben, um sich darin einzurollen, wie er es am liebsten getan hätte, trieb er sich zur Eile an. Am ersten Tag seiner Reise war er noch über jedes kleine Tier erschrocken, das ihm auf seinem Weg durch die Wüste begegnete. Vor der Springmaus hatte er sich ebenso gefürchtet wie vor den Skorpionen, dem Fuchs und der Hornviper, die sich eine Weile neben ihm her schlängelte. Am meisten hatte ihm jedoch die Kälte zu schaffen gemacht. Sobald die letzten Sonnenstrahlen verschwanden, wurde der glutheiße Sand unter seinen Füßen in kürzester Zeit eiskalt. Um nicht zu erfrieren, marschierte Ron in der Nacht noch schneller und staunte beim nicht enden wollenden Erklimmen und Herabrutschen der Dünen über die Millionen Sterne über sich.
Am dritten Morgen hatte er am Horizont einen dunklen Streifen entdeckt, der sich bewegte und seitdem steuerte er darauf zu. Am Nachmittag erkannte er, dass es sich dabei um eine Karawane handelte, am nächsten Mittag hatte er sie eingeholt. Vor ihm in einer Sandmulde hatten sieben Frauen und Männer mit ein paar Lanzen und einigen Tüchern ein schmales Sonnendach gespannt. Darunter schliefen sie an ihre Sattel und kauernden Kamele gelehnt. Ron schlich sich vorsichtig an, robbte sich zu einem Kamel und fand in dessen Satteltasche ein paar Datteln, die er gierig verspeiste. Seinen Durst stillte er an der daneben hängenden Wasserflasche.
»Hey, du da. Pass auf das Glee auf!«, rief Ron dem Träumling eines Beduinen zu, der einen Meter neben ihm hockte, und deutete dabei auf den Haufen Traumenergie, der vor diesem auf die Erde tropfte. »Das muss nach oben.«
Doch der Angesprochene reagierte nicht und ließ das Glee weiter achtlos zu Boden rinnen, wo es im Sand versickerte.
»Hallo? Schau doch mal!« Ron deutete auf die Verschwendung und wendete sich hilfesuchend an die anderen Träumlinge. »Warum sagt denn keiner was?« Zu seinem Schrecken musste er jedoch feststellen, dass die anderen Träumlinge es ihrem Kollegen gleichtaten. Die gesamte Traumenergie der Reisegruppe versickerte in bunten Decken oder rann über Kamelfelle in den Sand, statt über die Ohren der runzeligen Wesen nach oben zu strömen. Ron sprang von einem Träumling zum nächsten, richtete ihre Ohren auf und rüttelte sie an den Schultern. Doch die Wesen stierten ihn nur verständnislos an, sobald er von ihnen abließ, machten sie weiter wie zuvor. Vielleicht sind sie krank?, dachte er und rückte zur Sicherheit ein Stück von ihnen ab. Vielleicht leiden sie an einem Virus oder vielleicht war in Sansaria auch etwas nicht in Ordnung. Was immer es war, er musste dringend nach Italien. Denn dort würde er laut Cosimo jemanden finden, der ihn ins Traumland bringen konnte. Nachdem Ron dem traurigen Schauspiel noch eine Weile zugesehen hatte, machte er es sich in einer Satteltasche gemütlich. Ich werde trotzdem bei der Gruppe bleiben, beschloss er. Das Risiko, mich in der Wüste zu verirren, ist einfach zu groß. Und obwohl ihre Träumlinge nicht fit sind, scheinen diese Leute zu wissen, wo es langgeht.
Die nächsten Tage und Nächte waren monoton. Nachmittags und nachts trottete die Karawane über scheinbar nie enden wollende Dünen, machte zwischendurch kurz Rast und mittags, wenn es zu heiß wurde, schlug sie ihr Lager auf. So ging es jeden Tag, Ron hörte bald auf, zu zählen. Seine einzige Zerstreuung waren die Kamele. Er ritt täglich auf dem Kopf eines anderen Tieres und tatsächlich schienen sie seine Anwesenheit mal mehr, mal weniger zu spüren. Dass seine ehemaligen Artgenossen auch weiterhin nicht auf seine Kontaktversuche reagierten, führte er darauf zurück, dass er inzwischen ein Ronin war. Ein Verstoßener. Vielleicht wollten sie deshalb nichts mit ihm zu tun haben. Er hatte ohnehin größere Sorgen. Immer wieder rief er sich Cosimo und dessen Auftrag ins Gedächtnis und hoffte, nicht zu spät zu kommen.
Er musste nach Catania gelangen, um dort im Botanischen Garten so lange bei der Garibaldi-Statue zu warten, bis ein Sansarianer auftauchte. Ich werde Cosimo nicht enttäuschen, machte Ron sich Mut. Und sein Opfer wird nicht umsonst gewesen sein. Bei der Erinnerung an die Explosion, die die Pläne des bösartigen Glatzkopfes vereitelt und Cosimo das Leben gekostet hatte, ballte er vor Entschlossenheit die kleinen Hände zu Fäusten.
Am Abend des achten Tages erreichten sie endlich eine Stadt. Ron konnte es kaum erwarten, seine apathischen Reisegenossen zu verlassen, und wechselte bei der ersten Gelegenheit auf die Schulter eines Mannes, der mit zwei Koffern in den Händen ein Hotel verließ.
»Alles gut bei dir?«, versuchte er ein Gespräch mit dessen Träumling zu beginnen, der mit geschlossenen Augen am Hals des Mannes kauerte. Das Wesen sah zwar ebenfalls nicht gesund aus, aber im Gegensatz zu den Träumlingen der Karawane schien es ihn immerhin zu verstehen. »Ich bin Ron. Wie heißt du?«
»Mir ist schwindelig«, jammerte der Träumling, anstatt die Frage zu beantworten. Er war blass und blinzelte Ron aus zusammengekniffenen Augen an.
»Wovon denn?«, fragte Ron.
»Von diesem schrecklichen Ton. Das geht schon die ganze Zeit so.«
Ron lauschte, konnte außer dem Straßenlärm jedoch nichts Ungewöhnliches hören.
»Ich höre nichts.«
»Du Glücklicher«, stöhnte der Träumling und hielt sich jammernd die langen Ohren zu.
»Zum Flughafen nach Casablanca, bitte«, sagte sein Mensch unterdessen zu dem Taxifahrer, der vor ihm angehalten hatte, und Ron kletterte hinter ihm auf die Rückbank. Im Taxi horchte er erneut. Doch sosehr er sich auch bemühte, er hörte neben der Musik, die aus dem Radio schepperte, und dem gelegentlichen Klackern des Blinkers nichts Ungewöhnliches. Wenigstens stimmt die Richtung, dachte er und hoffte, seinem Ziel schnell näherzukommen.
Viertes Kapitel
»Sind Sie sicher, dass Sie das Stück Hasenschinken nicht doch haben wollen?«, fragte das Wesen aus dem Finsterwald zaghaft und schwenkte die Scheibe vor Hendrix Garbutins Nase hin und her. Garbutin saß in sich zusammengefallen auf einem Hocker und starrte in die Luft. Ganz in grüne Seide gehüllt, winkte der Vizepremierminister ab und machte sich nicht einmal die Mühe zu antworten. Seit ihrer Flucht in das Quartier ohne Namen hatte sich in dem Verschlag des Wesens einiges verändert. Der neue Anbau, für den es eine Wand seiner Hütte eingerissen und in die Verlängerung notdürftig ein Stockbett geschreinert hatte, wurde an den Seiten von grünem Stoff nach draußen abgetrennt. Siphillus Spur hatte über seinem Bett ein Loch in die Seide geschnitten, durch welches man einen spektakulären Ausblick in den Finsterwald hatte. Für so was hatte Garbutin keinen Sinn. Im Gegenteil, das viele Grün, das ihm auch in Form glänzender Gerten, Zaumzeug und Kissen ins Auge sprang, brachte ihn langsam um den Verstand.
Seit ihrer Flucht waren sie mehrmals in Spurs Spezialitätengeschäft gewesen, wo sie sich mit allen möglichen Gegenständen eingedeckt hatten. Inzwischen gab es dort nichts Brauchbares mehr zu holen. Außerdem zerrte das Klackern der Arktischen Scherenhecke vor Spurs Ladentür noch stärker an Garbutins Nerven als das Brüllen der Katonkas im Finsterwald.
Dass Kassiopeia im letzten Moment die Seite gewechselt hatte, konnte Garbutin immer noch nicht fassen. Er verbrachte viel Zeit damit, sich eine besonders grausame Rache für sie auszudenken. Ebenso wie für den Chef des Geheimbundes und Kommandanten der sansarischen Armee. Sie würden für ihren Verrat büßen. Wenn wir wenigstens den Jungen erwischt hätten, dachte Garburtin wieder, dann könnten wir mit Clara Zertusia verhandeln. Doch so waren sie Ausgestoßene und mussten sich verstecken.
»Hat sich Hieronymus gemeldet?«, begrüßte ihn Siphillus Spur gut gelaunt, trat durch die Tür und hievte einen Sack Pilze auf den Tisch. Sein Gesicht war rosig, seine Augen leuchteten und er wirkte um Jahre verjüngt. Sogar Penelope, sein Wiesel, schnurrte. Es huschte lautlos von Spurs Schulter zu Boden, sprang auf ihr gemeinsames Bett und rollte sich zufrieden darauf ein.
»Es gibt nichts Neues«, antwortete Garbutin missmutig. »Man sucht immer noch überall nach uns. Wir sollen weiter hier abwarten, bis sich die Lage entspannt.«
»Das trifft sich bestens, ich mache bei der Dressur der Katonkas endlich Fortschritte.« Spur hängte sein Lasso über den Haken an der Tür und klopfte seinen Umhang ab, von dem Gras rieselte. »Stell dir vor, heute wurde ich nur einmal gebissen!«
»Was du nicht sagst?«, spottete Garbutin. Penelope hob ihre Schnauze und fauchte. »Hätte ich mir denken können, dass Dunkel keine Hilfe ist, wenn es hart auf hart kommt«, motzte Garbutin.
»Sei nicht so negativ. Er meldet sich bestimmt, sobald er einen Plan hat. Entspann dich einfach, wir sind schließlich noch am Leben.«
»Wenn man das in diesem Loch überhaupt so nennen kann«, brummte Garbutin. Bei seinen Worten zuckte das Wesen mit den langen Ohren zusammen.
»Was sagen Sie zu einem Pilz-Ragout mit Blaubeeren für heute Abend?«, fragte es scheu.
»Das kannst du dir sonst wohin stecken«, entgegnete Garbutin grob und stürmte aus der Hütte.
Fünftes Kapitel
Im dritten Quartier ließ Philomena den Park inzwischen hinter sich. Sie passierte den Redaktionssitz des Sansaria-Boten, vor dem seltsame Gestalten standen, wie auch sonst überall im Quartier. Dann steuerte sie auf die nächste Lichtsäule zu und reiste ins Fünfte. Obwohl es in der Löwengasse seit der Nacht der zusammengebrochenen Wachen wieder so ruhig war wie eh und je, wirkte sie immer noch verwüstet. Einzelne Mosaiksteine waren bei dem Kampf gegen die Kieferlinge aus den bunten Bodenverzierungen gebrochen und seitdem nicht repariert worden. Lampen hingen schief in ihren Halterungen und der Putz an den Häusern war abgestoßen und nicht wieder erneuert worden. Philomena hastete die Straße hinunter und erreichte schließlich Meister Dunkels Stammsitz.
»Da bist du ja, meine Liebe!«, begrüßte Justus, der spindeldürre Sekretär, sie an der Dienstbotentür. Er ging durch den Flur voraus, der tief in das Gebäude hineinführte, vorbei an den vielen Regalen mit den bunten Fläschchen. »Du kannst heute mit dem Anrühren der Blumenerde fortfahren«, sagte Justus und ging die Treppe hoch in den ersten Stock. »Und anschließend misst du nach, ob sich der Glee-Wert der Setzlinge verändert hat. Ich habe dir Handschuhe hingelegt, damit du nicht wieder zerstochen wirst.«
»Danke, Justus, aber das macht mir ehrlich gesagt nichts aus«, antwortete Philomena. Dass sie endlich mit den Pflanzen und Blüten arbeiten durfte, wie sie es sich lange gewünscht hatte, fühlte sich noch immer wie ein Wunder an. »Wie machen sich die Neuen denn so beim Verkauf?«
»Frag nicht«, seufzte Justus, und an der Art wie er es sagte, wusste sie, dass er vor ihr mit den Augen rollte, während er eine Stufe nach der anderen nahm. »Der Junge, der Cassius’ Tour übernommen hat, wollte gestern Abend hinschmeißen, und auch der andere schlägt sich bisher höchstens mehr schlecht als recht.«
»Hab Geduld mit ihnen«, antwortete Philomena. »Sobald die sich eingearbeitet haben, läuft es bestimmt besser.«
»Wenn du das sagst.« Justus hörte sich nicht so an, als wäre er ihrer Meinung und wechselte das Thema. »Wie geht es deinem Bruder? Hat er den Prozess und das ganze Trara einigermaßen überstanden?«
»Danke, Max geht es erstaunlich gut. Er wollte heute schon wieder zur Arbeit, aber Mutter hat darauf bestanden, dass er diese Woche zu Hause bleibt und sich erholt.«
»Das ist bestimmt sinnvoll.«
»Ist Meister Dunkel heute da?«
»Ja, aber er hat sich wieder im Arbeitszimmer eingeschlossen und will niemanden sehen. Dabei wollten wir an ein paar neuen Rezepturen arbeiten. Wenn das so weitergeht, verlieren wir noch unsere Aufträge.«
Nachdem Justus sich in die Dienstküche verabschiedet hatte, stieg Philomena die Treppe in den zweiten Stock hinauf. Sie hätte zu gerne noch einen Minz-Taler mit Justus gegessen und erfahren, was er von den Fremden im Dritten Quartier hielt. Doch der spindeldürre Sekretär war heute offenbar nicht in Plauderlaune und das Thema musste warten. In der Umkleidekabine band Philomena ihre Haare zusammen und wechselte in den Hosenanzug und die Stiefel, die sie aus dem Spind zog. Dann schob sie das Armband, das Leonard ihr gemalt hatte, unter ihren Ärmel, nahm sich die Handschuhe und steuerte auf den Raum zu, über dessen Tür »Arcanum Terrae« stand.
Dass sich hinter der Tür eine ganze Landschaft auftat, deren Horizont sie nicht absehen konnte, raubte ihr jedes Mal den Atem. Philomena schritt zur Pinnwand neben der Tür und nahm den Zettel ab, der darauf hing. Dann ging sie zu einer Schubkarre, legte eine Schaufel, eine Karte und zwei Wasserflaschen hinein und stapfte auf die Erdhügel zu, die sich vor ihr zu einem bizarren farbenfrohen Gebirge formierten.
Manche Hügel schimmerten kohlschwarz und auf den einzelnen Erdbrocken konnte man sich in Tausenden Wassertropfen spiegeln. Andere waren weiß wie Mehl und ebenso trocken. Es gab aber auch Haufen, die in den Farben des Regenbogens schillerten, ziegelsteinrote und solche aus azurblauem Perlmutt. Auf die meisten rieselte neue Erde herab, immer dann, wenn sie die Bauern in Sansaria auf ihren Feldern in die dafür vorgesehenen Teletrichter schaufelten. In den letzten Wochen hatte Philomena nur einen Bruchteil der Landschaft erkundet. Ebenso wie sie erst eine Handvoll der zahlreichen Arbeiter kennengelernt hatte, die ihre Schubkarren ebenso wie sie durch das Gelände schoben. Sie beugte sich über ihren Zettel und studierte die Bestellung. Auch für die heutige Mischung würde sie nicht viel weiter in die Landschaft vordringen müssen als bisher.
»Soll mir recht sein«, murmelte sie und steuerte ihren Schubkarren zum ersten Berg. Dort angekommen, schöpfte sie konzentriert eine Schaufel Erde hinein, die in der Karre wie graue Linsen aussah. Bei dem Gedanken an echte Linsen knurrte ihr Magen und sie trank ein paar Schlucke Wasser, die immerhin das schlimmste Hungergefühl linderten. Während sie sich auf die Suche nach klebrigem Silberquarz machte, der reich an vitaminhaltigem Exolat war, dachte sie an Leonard. Dass sie sich in den letzten Wochen nicht mehr bei ihm gemeldet hatte, machte ihr ein schlechtes Gewissen. Andererseits hatte er bei den letzten Begegnungen nicht wirklich auf das reagiert, was sie erzählt hatte. Heute Abend probiere ich es wieder, nahm sie sich vor und schaufelte ein zweites Häufchen Erde in den Karren. Als ihr Magen wieder knurrte, biss sie die Zähne zusammen und machte weiter.
Sechstes Kapitel
»Ernsthaft? Kochbücher?«, sagte Gabriel und betrachtete enttäuscht die Buchrücken, die Uhlgars Schrank fast vollständig ausfüllten. ›Südtiroler Knödel für jeden Geschmack‹ stand auf einem, auf dem daneben ›Spätzle fürs Schätzle‹. Die besten Rezepte aus dem Schwarzwald. Auf einem der oberen Regale entdeckte Leonard Uhlgars Fläschchen Allesheil und öffnete es. Da es leer war, stellte er es wieder zurück.
»Was ist da drin?«, fragte Gabriel und schaute Leonard über die Schulter, der eine kleine Schatulle in der Hand hatte. Vorsichtig hob er den Deckel an, ließ ihn jedoch sofort wieder zuschnappen.
»Also, geh bitte, das ist schon eher unhöflich!«, raunzte eine Stimme und Leonard warf die Schatulle erschrocken von sich.
»Was ist denn?«, Gabriel war ebenso erschrocken wie er, beide ließen das kleine Kästchen nicht aus den Augen.
»Zuerst fand ich es nur gruselig, dass es in der Schachtel so tiefschwarz ist, als würde sie Licht verschlucken. Aber jetzt glaube ich, da ist jemand drin«, flüsterte Leonard und trat vorsichtig näher.
»Da ist wohl einer ganz schlau, nicht wahr?«, hörte er eine spöttische Stimme, die tatsächlich aus dem Kästchen zu kommen schien. Leonard sah Gabriel fragend an.
Die Stimme ertönte weiter, »… als würde es nicht reichen, dass mich ein Dreikäsekoch durch die Luft pfeffert. Ein Glück, dass die weise Wondra das nicht miterleben muss, die Scham darüber hätte sie glatt umgebracht. Dabei ist sie älter als die Zeit selbst. Womöglich unsterblich.«
Leonard ging in die Knie. »Wer bist du?«, fragte Leonard und stupste die Schatulle vorsichtig mit dem Zeigefinger an.
»Ich darf doch sehr bitten! Keine Manieren, die jungen Leute …«
»Mit wem sprichst du?«, fragte Gabriel.
»Hörst du die Stimme nicht?«, entgegnete Leonard erstaunt und deutete auf das Holzkästchen.
Gabriel schüttelte den Kopf, ließ es jedoch ebenso nicht aus den Augen.
»Was machst du, wenn ich den Deckel wieder öffne?«, fragte Leonard.
»Dann würde ich mich erst einmal vorstellen«, antwortete die Stimme, »so habe ich das jedenfalls gelernt.«
»Mach sie schon auf«, drängte Gabriel und Leonard öffnete den Deckel zaghaft. Darin schwebte eine Kugel, so dunkel wie ein schwarzes Loch.
»Was ist da?«, fragte Gabriel, der ihm über die Schulter sah, aber nichts erkennen konnte.
Leonard antwortete: »Eine schwebende schwarze Kugel. Die spricht.«
»Sehr erfreut, mein Herr. Ich bin Szadovir Ombrage der Dritte, aus dem Geschlecht der Schattenlords«, fuhr das sprechende Gebilde fort. »Engster Freund des Lichts und Hüter des Tors mit den drei goldenen Siegeln.«
Leonard sog die Luft ein, während die tiefschwarze Kugel aus der Schachtel schwebte und zügig die Form einer Katze annahm, die genüsslich ihren Buckel streckte. Er wusste nicht, was er unglaublicher fand: das, was er sah, oder das, was er zu hören bekam. Hat die Kreatur gerade das Tor mit den drei goldenen Siegeln erwähnt? Und wie ist sie in dieser Box in Uhlgars Schrank gelandet? In dem Moment verwandelte sich die Katze in einen ausgewachsenen Krieger, der bis hoch zur Decke reichte und zwei Streitäxte in den Händen hielt.
»Ergebener Sohn der Ersten Tochter und letzten Mutter Sansarias«, hallte die Stimme durch Uhlgars Zimmer.
»Du kommst aus Sansaria!«, unterbrach Leonard die Vorstellung, »aber was machst du dann in Uhlgars Schrank in der Schachtel?«
»Auf den richtigen Augenblick warten«, antwortete der Schattenriss, verwandelte sich in eine schwebende Lupe und nahm zuerst ihn und dann Gabriel ins Visier. »Prächtiger Träumling, er hat ganz eindeutig das Zeichen.«
»Kannst du uns zu dem Tor mit den drei goldenen Siegeln bringen?«, fragte Leonard aufgeregt. »Und könntest du es vielleicht einrichten, dass dich mein Freund auch sieht? Er hat ja sowieso schon gehört, dass wir uns unterhalten, und wir machen eigentlich alles gemeinsam.«
Szadovir verwandelte sich in eine männliche Silhouette, zog eine tiefschwarze Schriftrolle aus seinem Anzug und vertiefte sich darin. »Wollen doch mal sehen … nun … gleich haben wie es. Also gut, warum eigentlich nicht? Das ist zwar recht ungewöhnlich, aber wie es scheint, nicht verboten.« Damit rollte er das Papier wieder ein, steckte es zurück, stand auf und räusperte sich. »Sag, wie sehe ich aus?«
»Prima«, murmelte Leonard, »… sehr schwarz«. Er wartete auf ein Zeichen oder einen Spruch, doch Szadovir blieb einfach stehen und tat nichts. Dass Gabriel den Schatten nun auch sehen konnte, merkte Leonard daran, dass sein Freund zu stottern begann. »Un… un… unglaublich …«
Gabriel blickte in das Schwarz, das so dunkel war, dass es in seinen Augen brannte. Es kam ihm so vor, als enthalte es gleichzeitig alles und nichts.
In dem Moment ertönte wieder Szadovirs rauchige Stimme: »Gestatten, mein Name ist Szadovir Ombrage der Dritte, aus dem Geschlecht der Schattenlords. Engster Freund des Lichts und Hüter des Tors mit den drei goldenen Siegeln.«
Gabriel brauchte einige Sekunden, um sich zu fangen. »Hallo, ich bin Gabriel. Gabriel Wolkenstein.«
»Wolkenstein, sagst du?«, wiederholte Szadovir und kratzte sich schwungvoll hinter dem tiefschwarzen Ohr. »Sehr erfreut, sehr erfreut. Warum nur kommt mir der Name so vertraut vor?«
»Du bist eine Art Schattenwesen, nicht wahr?«, fragte Gabriel. »Kannst du uns nach Sansaria und zu dem Tor mit den drei goldenen Siegeln bringen?«
»Ich bin sehr viel mehr als nur ein Schatten«, antwortete Szadovir, der inzwischen die Form eines Hirsches angenommen hatte. Jetzt wechselte er permanent die Form, wie um zu zeigen, was er alles konnte. Er zischte einmal quer durch den Raum, wurde vom Düsenjäger zum Kirchturm, verdoppelte die Schatten, die sich zu Leonards und Gabriels Füßen bildeten, ließ ein Miniatur-Heer die Wand entlang marschieren und schwebte dann scheinbar im Raum, direkt vor ihnen, so nah, dass sie ihn fast berührten.
»Ein Schattenlord eben, aber die Antwort auf eure Fragen ist: ja. Ich kann euch nach Sansaria bringen. Und das Tor mit den drei goldenen Siegeln, das ist quasi meine Heimat. Ich kann es also im Grunde gar nicht abwarten, euch dahin zu bringen. Vorausgesetzt, du meisterst die drei Aufgaben«, sagte er und zeigte mit seinem Schattenfinger auf Leonard. »Sobald sie zu meiner Zufriedenheit gelöst sind, darf ich dir als treuer Diener zur Seite stehen.«
»Wo befindet sich das Tor mit den drei goldenen Siegeln und wo führt es hin?«, fragte Leonard.
»Das darf ich noch nicht beantworten, dazu musste du erst ein paar Fragen richtig beantworten. Doch zu gegebener Zeit erfährst du alles. Wenn du es bis dahin schaffst, meine ich. An den Fragen vorbei, gewissermaßen. Also, bist du bereit?«
»Was passiert, wenn ich einen Fehler mache oder die Antworten nicht weiß?«
»Dann ist die Chance vertan und Sansaria verloren«, antwortete Szadovir leichthin. »Das wäre sehr schade. Persönlich wäre mir langsam nach ein wenig Abwechslung zumute. Streng dich also bitte an.«
»Was haben wir zu verlieren?«, sagte Gabriel und Leonard nickte. Immerhin waren sie dem Tor mit den drei goldenen Siegeln nun einen entscheidenden Schritt näher. Und eine andere Möglichkeit hatten sie sowieso nicht.
»Dann drück deinen Finger zur Bestätigung bitte auf dieses Formular«, sagte Szadovir, und im selben Moment materialisierte sich ein rabenschwarzes, schwebendes Rechteck vor Leonards Nase.
»Aber darauf kann man überhaupt nichts lesen«, protestierte Gabriel.
»Ist sowieso total langweilig, ein absoluter Standardvertrag«, wiegelte Szadovir ab, »mit drei Seiten Kleingedrucktem – schwarz auf schwarz. Einfach unten rechts deinen Zeigefinger draufdrücken.«
Leonard tat, wie der Schattenlord ihm geheißen hatte. Als er das Schattenblatt mit seiner Fingerspitze berührte, durchfuhr ihn ein Prickeln, das sich wie kalte Elektrizität anfühlte. Er untersuchte seinen Finger und Szadovir räusperte sich, während er den Vertrag wieder verschwinden ließ. »Es kann sein, dass du bei einer falschen Antwort erblindest«, murmelte er. »Aber wie genau das passiert, ist mir ehrlich gesagt entfallen.«
»Das ist dir entfallen!?«, schrie Leonard, und Gabriel rief: »Dann machen wir nicht mit!«
»Tut mir leid«, widersprach Szadovir, »unterschrieben ist unterschrieben. Wie unter Artikel 3.9.1 zu lesen war, kommt ein Rücktritt einer Niederlage gleich. Du überlegst dir also besser, ob du es nicht doch probieren willst, nicht wahr?«
»Aber ich konnte auf dem Blatt doch gar nichts entziffern …«
»Das hättest du uns doch sagen müssen«, warf Gabriel ein, »wie kann man denn so etwas Wichtiges vergessen?«
»Nun, ob ihr es glaubt oder nicht, Menschen sind nicht das Zentrum des Universums«, antwortete Szadovir, der sich nun in ein Sternensystem verwandelte. Eine ganze Galaxie aus schwarzen Sternen begann um sie herumzutanzen. »Selbst wenn alle Menschen auf einen Schlag verschwinden würden, wäre ich, Szadovir Ombrage der Dritte, noch immer da. Selbst dann, wenn sich das letzte Körnchen des Universums in Luft auflöst. Es wäre zwar ganz schön langweilig, aber nicht das Ende.«
Leonard stand wie betäubt da und wusste nicht, was er darauf erwidern sollte. Gabriel legte ihm beschützend seinen Arm um die Schulter.
»Also, um ehrlich zu sein, es tut mir leid, dass ich dir dieses Detail verschwiegen habe«, lenkte Szadovir ein. »Ob du mir glaubst oder nicht, ich mache das schließlich auch nicht alle Tage. Da kann einem schon mal ein kleiner Fehler unterlaufen.«
»Ein kleiner Fehler«, wiederholte Gabriel und rollte mit den Augen. »Er muss alles richtig machen, um nicht zu erblinden – und weiß noch nicht mal, was er tun soll. Das ist nicht fair.«
»Da hast du durchaus recht. Als Wiedergutmachung gebe ich euch für die Antworten so viel Zeit, wie ihr wollt. Was sagt ihr dazu?«
Leonard dachte über das Angebot nach. Unbegrenzt Zeit zu haben, klang immerhin ermutigend. Sie könnten die Antworten in Ruhe überprüfen, bis sie sich damit ganz sicher waren, egal ob es Tage, Monate oder sogar Jahre dauerte. Im schlimmsten Fall könnte er Szadovir seine Antwort als alter Mann auf seinem Sterbebett geben.
»Wunderbar, also dann …«, jubelte Szadovir, nachdem Leonard sich einverstanden erklärt hatte. »Lasst uns beginnen!«

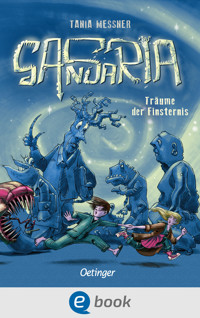













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)













