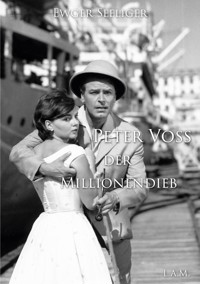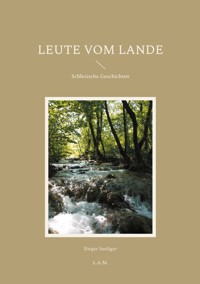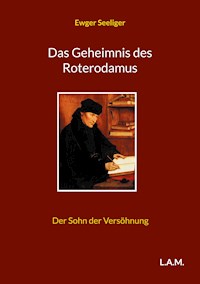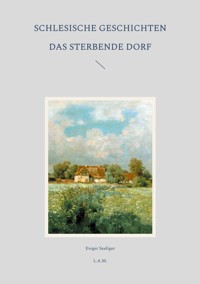
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Schlesische Geschichten Das sterbende Dorf Die Großen fressen die Kleinen auf, das ist Naturgesetz. Schlesien um 1900. Die Industrialisierung macht auch vor dem Städtchen Breugnitz an der Oder nicht halt. Der Erste Bürgermeister, ein skrupelloser Charakter, erkennt die Zeichen der Zeit und will den Fortschritt nicht ganz uneigennützig in seine Stadt bringen. Um seine ehrgeizigen Ziele zu erreichen, muss das angrenzende Dorf Gramkau eingemeindet werden. Hier liefert ihm jedoch der Gemeindevorsitzende und Großbauer Karl Peukert erbitterten Widerstand. Er möchte unter allen Umständen an den alten Traditionen festhalten. Doch auch er muss letztendlich einsehen, dass sich die Zeiten ändern. In seiner eigenen Familie schwinden Autorität und Gehorsam. Die Schwestern Liese und Minna lassen sich nicht mehr vorschreiben, wen sie zu heiraten haben, sondern folgen, was die Liebe betrifft, ihrem Herzen. Für Minna hat das fatale Folgen. Liese kann sich nicht für Max Hanschke, der aus Liebe zu ihr sogar bereit ist, seinen sicheren Beamtenjob aufzugeben, entscheiden. Aber auch Karl Peukert tut sich nicht leicht, eine geeignete Frau für den Hof zu finden. Sein Starrsinn lässt ihn in eine Katastrophe laufen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 298
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ewald Gerhard Hartmann (Ewger) Seeliger
geboren am 11. Oktober 1877 in Schlesien, zu Rathau, Kreis Brieg, gestorben 8. Juni 1959 in Cham/Oberpfalz, zählt zu den erfolgreichsten Schriftstellern des 20. Jahrhunderts. Zu seinen bekanntesten Werken gehört u. a. „Peter Voß der Millionendieb“. Seine schlesische Heimat beschreibt er in „Siebzehn schlesische Schwänke“, „Schlesien, ein Buch Balladen“, „Schlesische Historien“ und in vielen Romanen.
Inhaltsverzeichnis
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
Nachwort
I
Wie immer am Tag vor Himmelfahrt schaute auch heute die Nachmittagssonne um vier Uhr in das Magistratsbüro der Königlichen Kreisstadt Breugnitz an der Oder, und da es der 19. Mai war, spiegelte sie sich mit besonderer Freundlichkeit auf dem kahlen Scheitel des Magistratssekretärs Emil Drenckhan, der mit nickendem Kopf auf seinem Stuhl saß und schlief.
Ihm gegenüber döste am Doppelschreibpult sein Assistent Max Hanschke, ein junger Mann von dreiundzwanzig Jahren, der in diesem Augenblick genauso pflichtgetreu war wie sein Vorgesetzter.
Max Hanschke war ein echtes Kind seiner Vaterstadt und hatte eine kecke Nase, einen flotten Schnurrbart und lustige Augen. Da er eine gute Handschrift sein Eigen nannte, und sein längst verstorbener Vater der dienstälteste Polizeisergeant der Stadt gewesen war, hatte man den hoffnungsvollen Sohn nach Absolvierung der Bürgerschule in das Polizeibüro als Schreiber genommen, von wo er sich unter dem Protektorat des Sekretärs in das Magistratsbüro hinaufgearbeitet hatte. Inzwischen hatte er Zeit und Muße gefunden, als erster Tenor den Männergesangsverein zu verstärken, außerdem gehörte er der Radfahrervereinigung Concordia an und trug sich augenblicklich sogar mit dem Gedanken, einen Ruderklub zu gründen. Andere Sorgen hatte er augenblicklich nicht. Es fiel ihm auch gar nicht ein, wider den Stachel der vaterstädtischen Vorsehung zu lecken, die ihn bereits zum dereinstigen Nachfolger seines Vorgesetzten bestimmt hatte, vorausgesetzt, dass er sich bis dahin entschließen konnte, Emilie Drenckhan, dieses Vorgesetzten mannbare Tochter, als Eheweib heimzuführen.
Max Hanschke war trotz seiner jungen Jahre ein Politikus und sagte vorerst weder ja noch nein. Er ließ die Sache in der Schwebe, spielte jede Woche einmal mit Vater und Tochter unter Assistenz seiner voraussichtlichen Schwiegermutter einen Dauerskat von vier Stunden und freute sich diebisch, wenn er gewann; denn er war im letzten Grunde eine gemütsvolle Natur und ganz und gar kein Spaßverderber, und schließlich war Emilie ein durchaus ansehnliches Mädchen, wenn sie auch in spätestens vier Jahren aus dem Schneider heraus sein musste.
Augenblicklich beschäftigte sich Max Hanschke damit, über die Akten nachzudenken, die ihm sein Vorgesetzter am Mittag durch die zwischen ihnen aufgestapelten Bücher wortlos zugeschoben hatte. In dieser Zeit der Nachmittagsruhe hätte Max Hanschke nicht gewagt, eine Feder anzurühren. Der Schlaf seines Vorgesetzten war ihm viel zu heilig. Außerdem fühlte er sich verpflichtet, scharf auf alle Geräusche zu achten, die sich auf dem Korridor meldeten.
Also blätterte er sehr diskret in den Akten, ohne dass auch nur ein Blatt knisterte. Obenauf lag die Anstellungsurkunde für die Lehrerin Margarete Dobisch, die an die Höhere Städtische Mädchenschule berufen worden war. Max Hanschke war vorwitzig genug, sich sofort eine ältere, spindeldürre Dame vorzustellen. Da aber sah er das Geburtsjahr der Lehrerin.
„Einundzwanzig!“, dachte er und machte eine hochmütige Miene. „Also ein Küken, das eben aus dem Seminar geschlüpft ist.“
Sodann kam ein langer Bericht über die neuen Kasernen. Die Militärverwaltung zeigte nämlich nicht übel Lust, eins der neu zu bildenden Regimenter nach Breugnitz zu legen, falls sich der Magistrat dazu entschließen könnte, die dafür notwendigen Ländereien und Baulichkeiten gegen eine entsprechende Miete herzugeben. Darunter lag ein kurzes, aber scharfes Monitum der Kämmerei an den städtischen Oberförster Seipel, der erst vor einem Jahr den großen, hinter dem Dorf Gramkau gelegenen Stadtwald, der die Haupteinnahmequelle des Magistrats bildete, gesetzt worden war, und dessen Jahresabrechnung als zu wenig spezialisiert gerügt wurde.
So ganz uninteressant also war die Arbeit durchaus nicht auf dem Magistratsbüro. Und wie schon öfters kam auch jetzt Max Hanschke das stolze Gefühl, dass er seine liebe Vaterstadt ein wenig mitregieren durfte.
Aber trotzdem rührte er die Feder nicht an. Morgen, am Himmelfahrtstag, war kein Dienst, es musste auch Arbeit für übermorgen übrig bleiben.
Plötzlich spitzte er die Ohren. Auf dem Korridor ertönten kurze, harte Schritte. Das war der Zweite Bürgermeister, der aus seinem Zimmer kam und direkt auf das Sekretariat zusteuerte. Max Hanschke trat, seiner langjährigen Übung gemäß, seinem verehrten Vorgesetzten mit solcher Geschicklichkeit und Schnelligkeit auf die Hühneraugen, dass er noch reichlich Zeit fand, wie ein Gummiball in die Höhe zu schnellen und sich in Positur zu setzen. Als er Max Hanschke einen dankbaren Blick für die Bemühung zuwarf, schoss auch schon der Zweite Bürgermeister herein. Er war früher Artilleriemajor gewesen und hatte die Angewohnheit, alle Leute, die ihm nicht übergeordnet waren, anzuschnauzen, selbst wenn er die freundlichsten Absichten hatte.
„Hier!“, rief er und warf die Kladde eines Briefes auf Emil Drenckhans Schreibtisch. „Sofort abschreiben und umgehend an den Adressaten befördern! Herr Hanschke wird den Weg machen.“
„Herr Bürgermeister!“, erwiderte der Sekretär pikiert, wobei er sich räuspernd in die Brust warf. „Ich möchte mit allem schuldigen Respekt bemerken, dass Herr Hanschke kein Polizeibote ist, sondern Bürobeamter.“
„Weiß ich!“, schnauzte der Bürgermeister und klopfte ihm militärisch leutselig auf die Schulter. „Weiß ich, mein lieber Drenckhan. Aber da draußen auf dem Peukertschen Hof ist ein Hund, der jeden Menschen in Uniform anfällt. Es wird auf die Dauer zu teuer, jeden Brief da hinaus mit einer neuen Polizeiuniform zu bezahlen. Und verklagen können wir die Leute auch nicht, weil wir sie in guter Laune halten müssen. Auch soll die Sache vorerst mehr privatim behandelt werden. Verstanden? Spätestens um sechs Uhr muss der Brief in den Händen des Adressaten sein; denn heute Abend ist da draußen Gemeindeversammlung. Sie wissen ja, worum es sich handelt.“
Und draußen war er; denn er hatte, da er die linke Hand des Ersten Bürgermeisters war, immer große Eile.
Emil Drenckhan studierte den Brief, und Max Hanschke stand hinter ihm und las mit. Das Schreiben enthielt im Wesentlichen eine Einladung an Herrn Karl Peukert, zwecks einer Besprechung über die Eingemeindung des Dorfes Gramkau, aufs Breugnitzer Rathaus zu kommen.
Unter den zehn Jahren der tatkräftigen Regierung des Ersten Bürgermeisters Bielau hatte die Stadt einen schnellen und ungeahnten Aufschwung genommen. Ihre Vorstädte hatten sich bis an die Grenze des Weichbildes vorgeschoben. Wie drohende Außenforts umschlossen sie gürtelförmig die zahlreichen Fabriken. Zu dem geplanten Kasernenbau war innerhalb der Stadt kein geeignetes Terrain mehr aufzutreiben, und da das Dorf Gramkau unmittelbar in die Vorstadt überging, die anderen Nachbardörfer aber viel weiter im Feld lagen, war die Einbeziehung dieser Landgemeinde in den Stadtbezirk der einfachste Ausweg; denn der Magistrat besaß schon von alters her das Gramkauer Dominium. Und gerade auf diesem Areal sollten die zwölf Kompaniekasernen für das neue Grenadierregiment erstehen.
„Wenn wir nur da nicht ins Fettnäpfchen treten!“, meinte Emil Drenckhan und blickte dabei sehr kritisch zu seinem Assistenten auf. „Diese dickköpfigen Bauern werden sich bedanken, Städter zu werden. Und der Karl Peukert, ohne den ohnehin nichts zu machen ist, ist der dickköpfigste von allen. Ich bin doch wirklich neugierig, ob unser Bürgermeister den klein kriegt.“
„Er wird schon!“, rief Max Hanschke siegesgewiss und tauchte die Feder ins Tintenfass. „Er bringt alles fertig!“
„Und kommen Sie mir heute Abend nicht zu spät zum Skat!“, sagte der Magistratssekretär freundlich, „meine Frau und meine Tochter werden sich sicher freuen, wenn Sie schon zum Abendessen antreten.“
„Ich will‘s versuchen!“, dankte Max Hanschke für die freundliche Einladung und brachte mit flüssiger Feder das Schreiben ins Reine.
Sobald er fertig war, wurde es dem Ersten Bürgermeister zur Unterschrift hineingereicht, und um halb sechs konnte sich Max Hanschke, angetan mit einem überaus modischen Überzieher und einem schwarzen, steifen Hütchen, einen dünnen Spazierstock mit silberner Krücke in der rechten Hand, auf den Weg nach Gramkau machen.
„Ach was! Die Gramkauer Bauern!“, dachte er auf seinem Weg. „Wenn sie nicht wollen, dann müssen sie eben!“
Er war wie alle Breugnitzer Bürger ohne Ausnahme ein aufrichtiger Bewunderer des Ersten Bürgermeisters und erinnerte sich noch sehr gut der alten, verlotterten Zustände, denen dieser tüchtige Verwaltungsbeamte ein Ende bereitet hatte. Jetzt floss in den Rinnsteinen nicht mehr das Abwasser, das damals die Straßen durchduftete und im Winter, terrassenförmig übereinander gefroren, die Bürgersteige überflutet hatte. Jetzt führte eine unterirdische Kanalisation die Abwässer einer Verbrennungsanstalt zu, die weit draußen über der Oder lag. Der Ring und die Hauptstraße waren sogar elektrisch beleuchtet. Das alte holperige Kopfsteinpflaster war selbst in den engsten Nebengässchen verschwunden. Das Oderwasserwerk war stillgelegt worden, und die Stadt wurde seitdem mit Grundwasser versorgt. Trotz dieser erhöhten Belastung des Stadthaushalts war es nicht nötig gewesen, die Steuern wesentlich zu erhöhen. Alle diese Neuerungen hatte der Erste Bürgermeister Bielau, ein Mann von weitem Blick, Energie und rastloser Arbeitskraft, durchzusetzen verstanden. Mit einer bewundernswerten Diplomatie hatte er die ihm anfänglich heftig widerstrebende Stadtverordnetenversammlung zum Nachgeben zu bringen gewusst. Harte Kämpfe hatte es in den ersten Jahren gekostet. Jetzt aber war er längst Sieger auf der ganzen Linie, und was er wollte, das geschah auch.
Nur der Landrat des Kreises, in dessen Verband Breugnitz noch gehörte, machte ihm zuweilen Schwierigkeiten. Die Stadt von dieser unerwünschten Vormundschaft zu befreien, war das nächste größere Ziel, das sich der Bürgermeister gesteckt hatte. Und die Eingemeindung des Dorfes Gramkau sollte der erste Schritt auf dieser Bahn sein.
Max Hanschke war inzwischen ans Ende der Gramkauer Vorstadt gekommen und überschritt die Grenze des Stadtgebiets. Hier stand ein schiefer Pfahl mit einem morschen Schild, das mit altertümlichen, verschnörkelten, wetterzerfressenen Buchstaben den Wanderer über den tatsächlichen Beginn des Dorfes Gramkau und dessen Zugehörigkeit zum Kreis, Hauptmeldeamt und Landwehrbezirk Breugnitz belehrte und jeden Tabaksraucher schlankweg mit einer Geldstrafe von drei Reichstalern bedrohte. Das war ein Überbleibsel der alten Zeit und heute nur eine leere Drohung.
Max Hanschke zog herzhaft an seiner Zigarre und stand nun mitten im dörflichen Leben. Die Straße war staubig und ungepflastert. Federvieh trieb sich darauf herum, und der scharfe Geruch des Düngers machte sich mit seiner Durchdringlichkeit bemerkbar. Er kannte das Dorf Gramkau nur flüchtig. Sehr selten und dann nur zufällig war er dorthin geraten. Für einen Sonntagsspaziergang lag es zu nahe, und irgendwelche Naturschönheiten wies es nicht auf.
Max Hanschke fühlte nach seinem Brief und blieb vor dem ersten Tor auf der linken Seite stehen. Dahinter breitete sich ein sehr geräumiger Hof aus, dessen Mitte die Düngerstätte einnahm. Hier wohnte der Adressat des Briefes. Wie eine feste Trutzburg lag das Anwesen am Eingang des Dorfes. Rechts vom Tor erhob sich das zweistöckige, schiefergedeckte Herrenhaus, das den Giebel der Straße zukehrte. Daran schloss sich der einstöckige Kuhstall, von dem ein paar kleinere Dächer zu der breiten, wuchtigen Scheune führten, die mit drei großen, jetzt geschlossenen Toren den Hof nach hinten abschloss. Dem Herrenhaus gegenüber, ebenfalls mit dem Giebel nach der Straße, lag ein kleineres Wohngebäude, das Auszughaus. Dahinter traten die Wagenremise, der Pferdestall und der Maschinenschuppen für die landwirtschaftlichen Geräte etwas zurück. Die Hühner scharrten auf dem Mist, die Tauben gurrten auf dem Dach ihres Hauses, das malerisch neben der Düngerstätte auf einem dicken, etwas schiefen Holzpfeiler stand, und das Vieh in den Ställen machte sich durch Brüllen, Wiehern und Grunzen bemerkbar. Ein Mensch aber ließ sich nicht blicken.
Von Natur nicht gerade furchtsam, machte Max Hanschke doch bedenklich kleinere Schritte, als er sich durch das offene Tor schob. Diese Vorsicht war nicht unbegründet; denn kaum hatte er die beiden dicken, viereckigen Torpfeiler hinter sich, stürzte eine riesige Dogge auf ihn zu und stellte ihn knurrend und zähnefletschend. Er blieb stehen und betrachtete hoffnungslos sein dünnes Spazierstöckchen. Er wusste wirklich nicht, was er tun sollte. Schließlich zog er in seiner Ratlosigkeit den Brief heraus und fuchtelte damit hin und her. Das nahm der Hund offenbar für eine Aufforderung, den Kampf zu eröffnen, und duckte sich zum Sprunge.
„Nero!“, rief da von links herüber eine Stimme, und der Hund ließ augenblicklich von seinem bereits in Aussicht genommenen Opfer.
Max Haschke sah in dem offenen Fenster des Auszughauses einen alten Mann mit schlohweißen Haaren und glattrasiertem Gesicht, lüftete dankend das Hütchen und stieg die vier Stufen zum Herrenhaus empor. Der Hausflur war mit schwarzen und weißen Fliesen belegt. Und weil niemand kam und keiner dem Pochen Gehör schenkte, klopfte Max Hanschke mehrmals mit seinem Stöckchen auf die Steinfliesen. Allein das Haus war wie ausgestorben. Schließlich stieß er vorsichtig die Tür auf und befand sich in einem ziemlich großen Raum, dessen Mitte ein weißgescheuerter Eichentisch einnahm. An den Wänden standen Bänke und eichene Bretterstühle. Er pochte auf den Tisch. Es kam niemand.
„Das ist doch merkwürdig!“, sprach er halblaut und stieß die nächste Tür auf, die nur angelehnt war.
Ein breiter, mächtiger Herd, in dem ein starkes Kohlenfeuer brannte, und auf dem mehrere große Kessel und Töpfe kochten und überkochten, erregte seine Aufmerksamkeit. Dieser Raum, der ebenfalls menschenleer war, war offenbar die Küche. Max Hanschkes Neugier wuchs. Er fand sich mit dem ihm eigenen Humor in die neue Situation und untersuchte den Inhalt der Kochgefäße. Die Kartoffeln waren ihm bekannt, aber auf Schrot und Kleie konnte er sich keinen Vers machen.
„Soll das vielleicht Viehfutter sein?“, dachte er und drang durch einen rundgewölbten Gang weiter nach hinten vor. Bald führten ihn ein paar Stufen abwärts. Es wurde dunkel. Irgendein unbestimmtes Schauergefühl überlief ihn. Er musste unwillkürlich an einen Räuberroman denken, den er als Junge gelesen hatte, und in dem ein ganz ähnlicher Gang mit einer geheimnisvollen Falltür die Hauptrolle gespielt hatte. Er schloss die Augen und tastete sich mit den Händen vorwärts. Allerhand dumpfes Geräusch kam ihm entgegen. Ketten klirrten.
„Buh!“, brüllte es plötzlich an seinem Ohr.
Er tat die Augen auf und sah sich im Dämmerlicht des Kuhstalls.
„Herrjeses!“, rief die Milchmagd, sprang auf lief mit der vollen Gelte zur Kellertreppe. „Fräulein Liese, kommen Sie schnell, da ist ein feiner Herr im Kuhstall!“
„Nicht möglich!“, rief es aus dem Keller heraus.
Max Hanschke stellte sich in Positur. Es kam jemand die Kellertreppe herauf. Sie mündete in den dunklen Gang, durch den er in den Kuhstall eingedrungen war. Ein Klappern von Holzpantoffeln, leicht und lustig anzuhören, erklang auf den steinernen Stufen.
Und so erschien Liese Peukert. Sie hatte um ihre blonden Flechten ein milchweißes Kopftuch geschlagen. Um ihre schlanke Gestalt straffte sich eine blauweiß gestreifte Schürze. Mit neugierigen, schalkhaften Blicken betrachtete sie den fremden Eindringling. Max Hanschke, der als geübter städtischer Gesellschaftsmensch nur einen ganz kleinen Augenblick seine Geistesgegenwart verloren hatte, zog den Hut und riskierte sogar trotz der dazu wenig passenden Umgebung eine leichte Verbeugung.
„Verzeihung, gnädiges Fräulein“, sprach er, „aber mir ist es, als hätte ich schon einmal das Vergnügen gehabt. Beim vorletzten Fastnachtsball?“
„Sie täuschen sich, gnädiger Herr“, gab sie ihm das Kompliment zurück, „das war meine Schwester. Ich mache mir nichts aus Fastnachtsbällen. Sie wollen gewiss zu meinem Bruder.“
„Gewiss – freilich – natürlich!“, stotterte Max Hanschke, ganz verwirrt über diese unerwartete Abfuhr. „Ich habe hier einen Brief vom Magistrat an Herrn Karl Peukert persönlich abzugeben.“
„Geben Sie her!“, rief sie ungeniert und streckte die Hand aus.
Ihre Art zu heischen war zwingend genug. Max Hanschke zuckte schon mit der Hand nach der Tasche. Allein die von seinem Vater ererbte Beamtendisziplin erwies sich als stärker.
„Nehmen Sie es mir nicht übel!“, bat er mit flehentlichem Augenaufschlag.
„I wo!“, lachte sie offen. „Dann müssen Sie eben warten. Hoffentlich wird Ihnen die Zeit nicht zu lang. Mein Bruder ist auf dem Feld, und bis er heimkommt, kann es noch ein Weilchen dauern.“
„Hm“, machte Max Hanschke, „dann werde ich in einer halben Stunde wieder kommen.“
„So war es nicht gemeint!“, erwiderte sie, „ich kann mich leider nicht um Sie kümmern, weil ich alle Hände voll zu tun hab. Aber ich weiß einen Ausweg. Gehen Sie mal rüber zum Großvater. Der freut sich immer, wenn er Besuch kriegt. Und wenn Sie ihm nicht die Laune verderben, dann rückt er sogar mit einer Zigarre heraus.“
„Oh“, lachte Max Hanschke, „das sind ja erfreuliche Aussichten. Ich werde nicht verfehlen, mein Möglichstes zu tun. Ich weiß ein paar prachtvolle Witze für alte Herren.“
„Das lassen Sie lieber bleiben!“, sagte sie und hob warnend den Finger. „Am besten ist, Sie lassen ihn reden und hören zu. Das mag er am liebsten.“
Damit stieß sie die Kuhstalltür auf, dass das helle Tageslicht hereinflutete. Max Hanschke nahm die Gelegenheit wahr und hob den Blick, den sie ihm aus ihren dunklen Augen voll wiedergab. In diesem Augenblick kam Nero mit lautem Gebell um die Düngerstätte herum, offenbar in der schnöden Absicht, sein unterbrochenes Attentat an dem Eindringling zu vollenden. Aber er nahm davon Abstand, als Liese Peukert dem Fremden mit dem Warnefinger leicht auf die Schulter tippte und rief: „Schäm dich, Nero, das hier ist ein guter Kerl. Marsch in die Hütte!“
Der Hund machte auf der Stelle kehrt, nachdem er Max Hanschke noch einen misstrauischen Blick zugeworfen hatte.
Dem hatte das Tippen auf die Schulter außerordentlich wohlgetan. Er bedauerte nur, dass es nicht länger gedauert hatte.
„Woher wissen Sie denn, dass ich ein guter Kerl bin?“, lächelte er sie an.
„Na!“, gab sie beinahe schnippisch zurück. „Das steht Ihnen doch deutlich genug auf der Nase geschrieben.“
„So?“, machte er verblüfft und befühlte nachdenklich seine Nasenspitze, während Liese Peukert lachend im Kuhstall verschwand.
II
Der alte Peukert setzte sich, als er Max Hanschke über den Hof schrägen sah, aufrecht in seinem Lehnstuhl, in dem ihn die Gicht schon seit Jahren mehr bald als minder gefangen hielt. Als es klopfte, rief er mit lauter Stimme: „Herein!“
Zaghaft tat sich die Tür auf, und Max Hanschke fühlte sich sofort von zwei hellen, stahlgrauen Augen, die unter weißbuschigen Brauen standen, überlegen gemustert.
„Kommen Sie nur her!“, sagte der Alte freundlicher, als es sonst seine Art war. „Und geben Sie den Brief her!“
„Den Brief?“, stammelte Max Hanschke überrascht und fischte in seiner Überziehertasche herum.
„Ja, ja!“, nickte der Alte lächelnd. „Eben den Brief vom Magistrat. Sie kommen doch von dort. Sind Sie nicht der Max, der Sohn vom alten Stadtsergeanten Hanschke? Wir kennen uns doch ganz gut. Ich hab Sie doch mal, als Sie noch ein kleiner Junge waren, bei den Ohren gekriegt, wie Sie mir die Birnen zinsten.“
Da lachte Max Hanschke befreit auf. Ihm war dieses Jugenderlebnis längst entschwunden, und es blieb ihm jetzt nur übrig, sich über das ausgezeichnete Gedächtnis des alten Bauern zu wundern.
„Wissen Sie noch?“, schmunzelte der alte Peukert und machte eine bezeichnende Handbewegung, „Ihr Vater ist den Tag darauf bei mir gewesen und hat sich für die Haue bedankt. Das war ein ganzer Mann und ein ehrlicher Kerl. Damals hab ich gleich gemerkt, dass aus Ihnen was Ordentliches werden wird. Und es ist ja auch was aus Ihnen geworden. Das freut mich.“
Max Hanschke hatte unterdessen den Brief herausgezogen und las nun die Adresse laut vor: „An Herrn Karl Peukert, Wohlgeboren zu Gramkau.“ Erläuternd setzte er hinzu: „Ich habe den strikten Auftrag, den Brief in die Hände des Adressaten zu legen.“
„Nu, ich warte schon drauf!“, lachte der alte Bauer. „Ich heiße Karl Peukert, und in Gramkau wohne ich. Ob ich nun wohlgeboren bin, das überlasse ich dem lieben Herrgott.“
„Fräulein Liese meinte soeben“, versetzte Max Hanschke zögernd, „dass der Brief an Ihren Bruder gerichtet sei.“
„Was so ein Mädel nicht klug ist!“, sprach der Alte kopfschüttelnd. „Geben Sie nur her! Ich bring es schon in Ordnung: Sie sollen keinen Schaden davon haben.“
Da überreichte ihm Max Hanschke das Schreiben, das der Alte umständlich erbrach und aufmerksam durchlas, wobei er die welken Lippen aufwarf.
„Hehe!“, grinste er endlich. „Da kann der Bürgermeister aber lange warten, bis wir zu ihm kommen. Das können Sie ihm sagen.“
„Ich werd mich schön hüten!“, platzte Max Hanschke heraus. „Ich habe persönlich mit der Sache nicht das Geringste zu tun.“
„Nanu?“, rief der Alte verwundert und schaute ihn groß an. „Sie gehören doch mit dazu. Oder sind Sie kein Magistratsschreiber mehr?“
„O doch!“, erwiderte Max Hanschke und zögerte plötzlich.
Seit der Unterredung mit Liese stand er dem Problem der Eingemeindung des Dorfes schon etwas anders gegenüber.
„Nun, ich sehe schon, Sie wollen keine Farbe bekennen!“, meinte der Alte missbilligend, wobei er sich die Hautfalten unter dem glattrasierten Kinn rieb. „Sie sind einer von den Leuten, die hübsch kuschen und keine Meinung haben. Sie sind eben Beamter.“
„Oho!“, begehrte Max Hanschke gekränkt auf. „Ich habe als Beamter auch meine Meinung.“
„Sie sind aber so schlau, sie hübsch für sich zu behalten!“, lachte der Alte grimmig.
„Durchaus nicht!“, trumpfte Max Hanschke auf. „Und wenn Sie meine Meinung hören wollen.“
„Immer heraus damit!“, rief der alte Peukert gespannt.
„Über kurz oder lang kommt die Eingemeindung doch!“, sprach Max Hanschke zaghaft; denn er wurde sich in diesem Augenblick bewusst, dass er Lieses Ratschlag, den Alten reden zu lassen und ihm nur zuzuhören, nicht befolgt hatte.
„Was Sie nicht alles wissen!“, rief der Alte erbost. „Wir lassen uns nicht schlucken. Mag der Bürgermeister seine Kasernen auf den Ring bauen. Da ist noch genug Platz. Niemand kann uns zwingen, nicht mal der Kaiser.“
„Davon ist ja gar nicht die Rede!“, belehrte ihn Max Hanschke. „Vielleicht dauert es noch ein paar Jahre, vielleicht wird nur ein Teil des Dorfes eingemeindet.“
„Keine Quadratrute geben wir her!“, schrie der Alte erregt und schlug auf die Lehne des Stuhls. „Wir wollen keine Städter werden. Wir können uns selbst regieren. Wir brauchen hier draußen keine Polizisten.“
„Gewiss, gewiss!“, versuchte ihn Max Hanschke zu begütigen. „Aber mit der Zeit können sich die Verhältnisse doch so ändern, dass sich in der Gemeindeversammlung eine Mehrheit für die Eingemeindung findet.“
„Da können Sie lange warten!“, lachte der Alte ingrimmig. „Bis zum jüngsten Tag meinethalben.“
„Ein bisschen lange hin!“, lächelte Max Hanschke und versuchte dem Gespräch eine neue Wendung zu geben. „Aber mir ist es schon recht. Mit meinem Gefühl bin ich ganz auf Ihrer Seite.“
„Wirklich?“, rief der alte Bauer sichtlich erfreut.
„Aber mein Verstand sagt mir“, fuhr Max Hanschke mit der Gewissenhaftigkeit eines Beamten fort.
„Bleiben Sie mir bloß mit Ihrem Verstand vom Leibe!“, polterte der Alte los. „Für Ihr bisschen Verstand geb´ ich keinen Dreier. Sie sind ja noch ganz grün hinter den Ohren. Sie mögen´s mir übelnehmen oder nicht, aber in Ihren Jahren da hat man eben noch nicht den richtigen Verstand. Halten Sie sich lieber an Ihr Gefühl, das scheint mir viel vernünftiger zu sein als Ihr Verstand.“
„Sie mögen recht haben“, meinte Max Hanschke, und dachte dabei sehr lebhaft an Liese und ihren freundschaftlichen Rat.
„Mit uns wird der Bürgermeister keine Geschäfte machen“, fuhr der Alte triumphierend fort. „Mit uns nicht! Und wir nicht mit ihm. Wir sind keine Bodenspekulanten. Wir haben das nicht nötig. Wir haben Geld genug.“
Max Hanschke nickte zustimmend. Schließlich hatte der alte Peukert genauso recht wie der Bürgermeister. Jeder vertrat seinen Standpunkt. Es kam eben auf die Machtprobe an.
In diesem Augenblick schlug die alte Zeigeruhr sieben. Der Alte horchte auf, schaute ein Weilchen zum Fenster hinaus und schüttelte den Kopf.
„Mein Enkelsohn kommt nicht mehr“, meinte er dann. „Er wird wohl gleich in die Gemeindeversammlung gegangen sein. Bringen Sie ihm den Brief ins Blaue Ross zum Stickel, drei Höfe weiter!“
Max Hanschke nickte und erhob sich auf der Stelle.
„Sie sind ein vernünftiger Mensch!“, sagte der Alte und drückte ihm kräftig die Hand. „Wenn da drin in der Stadt alle so wären wie Sie, dann wär‘s schon zum Aushalten. Aber seit ihr den neuen Bürgermeister habt, ist rein der Teufel los. Der Mann kann keine fünf Minuten Ruhe halten. Sie dürfen wieder zu Besuch kommen, Herr Hanschke. Und wenn Sie sich diesen Sommer alle Taschen voll Birnen stecken, ich kriege Sie nicht bei den Ohren. Da brauchen Sie sich nicht zu ängstigen.“
„Also auf Wiedersehn, Herr Peukert“, sage Max Hanschke und war draußen.
Nero empfing ihn mit misstrauischem Geknurre und begleitete ihn bis zum Hoftor. Obschon sich Max Hanschke mehrmals umdrehte, bekam er Liese nicht mehr zu Gesicht.
Eilig schritt er die Dorfstraße hinauf. Das zweite Gehöft, das frühere Dominium des Dorfs, war Eigentum des Magistrats. Die Gebäude waren in keinem guten Zustand, auf dem Hof lagen große Haufen alter Pflastersteine. Zwei rotlackierte Sprengwagen standen dabei. Nur ein einziger Arbeiter bewohnte das Anwesen, das ebenso groß wie das Peukertsche Gut war, aber ganz ohne Leben dalag. Seit Jahren stand auf dem Stadtgut der landwirtschaftliche Betrieb still, die dazugehörigen Ländereien waren bisher an die Gramkauer Bauern verpachtet gewesen. Im vergangenen Herbst aber waren die Pachtverträge nicht erneuert worden. Das hing mit dem geplanten Neubau der Kasernen zusammen.
Hinter dem dritten Gehöft, das bedeutend kleiner war, stieß Max Hanschke auf das Blaue Ross des Gastwirts Stickel. Im Ausschank der Vorderstube traf er den Graukopf, wie er Bier in Gläser und Schnaps in kleine und größere vierkantige Flaschen füllte. Im Hinterzimmer tagte die Gemeindeversammlung. Einige Nachzügler schoben sich hinter Max Hanschke herein.
Er wandte sich an den Wirt, der sofort bereit war, dem Gemeindevorsteher Bescheid zu sagen.
Nicht lange danach trat Karl Peukert, der jüngere, heraus. Er hatte eine hohe, aufrechte Gestalt. Blondes, kurzes Haar lag über seiner breiten Stirn. Sein Gesicht war scharf geschnitten und seine Hände waren fest geformt. Ein dunkler, langschößiger Rock mit schwarzen Metallknöpfen umschloss seine straffe Figur. Seine Füße staken in langschäftigen, mit brauner Ackerkrume bedeckten Stiefeln.
Er sah wohl aus wie ein Bauer, näherte sich aber im Wesen und in der Sprechweise mehr einem Städter. In seinen hellblauen Augen war ein Zug von Härte und Trotz, als fürchte er, man könnte ihn seiner Schwäche zeihen.
„Der wird sich noch viel weniger eingemeinden lassen!“, dachte Max Hanschke und überreichte ihm das offene Schreiben mit der Erklärung, dass es der Großvater bereits geöffnet hätte.
„Danke!“, sagte Karl Peukert kurz, doch nicht unfreundlich, überlas es flüchtig und steckte es wortlos ein.
Damit war Max Hanschke entlassen, und er stand in wenigen Augenblicken wieder auf der Dorfstraße. Lange überlegte er nicht. Der Abend war schön, die Luft lau, und die Sonne stand dicht am Horizont. Mitten hinein in ihre Glut führte die Straße. Max Hanschke verspürte nicht die geringste Lust, schon jetzt in das Düster der Stadt zurückzukehren und spazierte gemächlich das Dorf entlang, wobei er sich seine eigenen Gedanken machte. Als Junge hatte er sich hin und wieder auf Gramkauer Gebiet herumgetrieben; denn nicht nur die saftigen Frühbirnen im Peukertschen Garten hatten ihn angezogen. Auch beim Vogelfranz, der am anderen Ende des Dorfes unter einem uralten, oft geflickten Strohdach wohnte, hatte er vorgesprochen, um sich für seine Spargroschen einen Hänfling oder einen Zeisig zu kaufen.
So kam er, gemächlich durch den Straßenstaub schlendernd, an dunklen, bereits geschlossenen Toren der Bauernhöfe, die alle auf der linken, höheren Straßenseite lagen, vorüber zum Dorfteich, der rechts lag und dessen abschüssiges Ufer gegen die Straße hin durch eine schnurgerade Reihe alter halbvertrockneter Spitzpappeln geschützt war. Am Ende des Teiches, dort, wo sich die Straße sanft zu einem kleinen Rinnsal senkte, lag, von einer grünen Dornenhecke umgeben, genau wie früher, das alte, hinfällige Fachwerkhäuschen, das noch immer mit Stroh gedeckt war, und dessen rissige Vorderfront zwei windschiefe Türen und zwei halbblinde Fensterchen zeigte.
„Ob der Vogelfranz wohl noch lebt?“, dachte Max Hanschke, verließ die Straße und drang auf einem schmalen Fußpfad, der sich zum Abfluss des Teiches senkte, bis zur mannshohen Hecke vor.
Da hörte er plötzlich einen Vogel singen und lauschte gespannt auf die tiefen, lockenden Töne, die mit schmelzenden Trillern abwechselten.
„Guten Abend, Herr!“, machte sich da hinter der Hecke eine menschliche Stimme bemerkbar, und ein Mann hinkte heraus, der einen Stelzfuß hatte. Max Hanschke wusste sofort, wer da vor ihm stand.
„Guten Abend, Vogelfranz!“, rief er und trat näher. Wohnt Ihr noch immer in der alten Baracke? Ich dachte, die Bude wäre längst eingestürzt.“
„Nu freilich“, erwiderte der Vogelfranz, und zog seine schäbige Mütze. „Ich wohn noch immer hier. Es wohnt sich in dem Haus ganz schön. Das steht noch gut seine zwanzig Jahre und länger. Woher kennen Sie mich denn?“
Max Hanschke nannte seinen Namen.
„Hanschke?“, wiederholte der alte Vogelsteller freudig überrascht. „Sie sind doch nicht etwa der Sohn vom alten Polizeisergeanten Hanschke?“
„Allerdings!“, bekannte Max Hanschke.
„Nu da, nu da!“, schrie der Vogelfranz außer sich. „Da muss ich Ihnen was erzählen von Ihrem Vater, was Sie noch nicht wissen. Er hat mich nämlich einmal erwischt, wie ich drin in der Stadt auf der Promenade eine Nachtigall gefangen hatte. Das war ein verdammt guter Sänger, und ich hatte schon ein paar Tage auf ihn vigiliert. Wie ich ihn nun glücklich im Sack hab, kommt Ihr Vater um die Ecke. Ausreißen kann ich nicht mit meinem hölzernen Bein. Da hatte er mich eben geschwind beim Wickel und wollte mich zur Wache bringen. Und nun kommt‘s. Es war nämlich morgens früh um fünfe. Und wir beide waren ganz allein. Er hat mich nämlich nicht auf die Wache gebracht, er hat sich meiner erbarmt, genauso wie sich der Herrgott über einen Sünder erbarmt. Ganz genau so! Ich hab ihm nämlich alles haarklein erzählt, wie das so mit dem Vogelstellen gekommen ist. Wie ich schon als kleiner Junge vom Baum gefallen bin, als ich ein Stieglitznest ausnehmen wollte. Die bauen nämlich immer weit draußen in die dünnen Äste. Und so bin ich um mein Bein gekommen. Seitdem hat mich‘s nicht mehr losgelassen. Ich komm nicht mehr von den Vögeln los. Und wenn ich einen seh, den ich noch nicht hab, dann muss ich ihn fangen. Und ich krieg ihn auch. Es ist so wie eine fixe Idee. Und wie ich nun das alles Ihrem Vater erzählte, da wird seine Hand immer lockerer. Und endlich lässt er mich ganz los, wie ich ihn nun darum bitte. Vogelfranz, sagte er zu mir, du bist ein Filou, aber ich hab diesmal nichts gesehen. Erwisch ich dich aber noch einmal, dann nimmt‘s ein schlimmes Ende. Seitdem bin ich nicht mehr über die Promenade gegangen. Sogar die Nachtigall hat er mir gelassen. Das war eine Seele von einem Menschen, Ihr Herr Vater. Keinem Menschen hab ich es erzählt. Und nicht einmal bedanken hab ich mich können; denn bald darauf hat er sich das letzte Mal hingelegt und ist nicht wieder aufgestanden.“
Max Hanschke konnte seine innere Bewegung nicht unterdrücken.
„So ein guter Mann war Ihr Vater!“, fuhr der Vogelfranz fort. „Das haben Sie vielleicht gar nicht gewusst. Und dass ich seitdem nach Herzenslust Vögel fangen kann, das hab ich ihm auch zu verdanken. ,Vogelfranz!‘. hat er damals zu mir gesagt, wenn du das verdammte Vogelfangen einmal nicht lassen kannst, so mach doch eine Eingabe beim Landrat, der erlaubt es dir am Ende.‘ Und das hab ich denn auf der Stelle getan. Unser Herr Lehrer hat mir‘s aufgesetzt, und der Herr Peukert, unser Gemeindevorsteher, hat für mich gutgesagt. Nun kann ich Vögel fangen, so viel ich will, in der ganzen Feldmark Gramkau und auch im Stadtwald, und der neue Oberförster, der mich nicht leiden mag, hat mir gar nichts zu sagen.“
Der Vogel sang noch immer. Die beiden standen jetzt vor dem Fensterchen, und Max Hanschke schaute in die niedrige Stube, die hinten auch ein Fenster hatte. Rings an den Wänden und sogar an den Balken der Decke hingen kleine und größere Vogelkäfige.
„Sie schlafen schon alle“, flüsterte der Vogelfranz. „Wenn Sie sie sehen wollen, müssen Sie einmal bei Tage wieder kommen!“
„Ist das die Nachtigall?“, fragte Max Hanschke und wies auf das Fenster, woher die flötenden Töne kamen.
„Das ist eine Drossel“, erklärte der Vogelfranz. „Die Nachtigall ist mir im vorigen Herbst beim Hochwasser verunglückt. Sechs Jahre hatte ich sie. Bis hierher hat es damals gestanden.“
Dabei wies er in die Mitte der untersten Fensterscheibe.
„Es lässt sich nichts dagegen machen. Ich wohn halt doch gern in dem Haus. Ich schlaf dann auf dem Dachboden und füttere die Vögel durch die Klappe in der Decke. Ich lass sie so lange frei in der Stube fliegen. Wenn Sie noch ein bisschen Zeit haben, dann können Sie meinen Sprosser zu hören kriegen. Vor dem muss sich die Drossel verkriechen.“
„Ich hab Zeit!“, erwiderte Max Hanschke, steckte sich eine Zigarre an, gab dem Vogelfranz auch eine, die er mit großem Dank annahm, und dann setzten sie sich auf das niedrige Bänkchen neben der Haustür.
Eben ging hinter dem Stadtwald blutrot die Sonne unter.
„Nun passen Sie gut auf!“, wisperte der Vogelfranz geheimnisvoll. „Gleich wird der loslegen. Das ist auch so eine Art Nachtigall, aber er ist hier sehr selten. Ich hab ihn aus dem Weidenbusch drüben beim Stadtwald. Der ist seine fünfzig Mark wert. Aber wenn Sie ihn haben wollen, Ihnen schenke ich ihn.“
Ehe Max Hanschke antworten konnte, schluchzte es hinter der alten, blinden Fensterscheibe laut, tief und glücklich auf. Das Gesicht des lahmen Vogelstellers glänzte, seine Augen leuchteten, er verjüngte sich zusehends. Voll, süß und feierlich klangen die kräftigen, melodiereichen Strophen des Sprossergesangs. Max Hanschke lehnte den Kopf gegen die bröckelnde Lehmwand und schloss die Augen, um das Wunder zu genießen. Gegen diese Fülle, gegen diese reinen metallischen Töne, gegen diese seelenvollen Triller und Doppelschläge verblasste der Gesang der Drossel zu einer Stümperei. Wohl eine Viertelstunde lang sang der Sprosser ohne Unterbrechung, und Max Hanschke merkte jetzt, dass die Nacht kühl wurde. Er erhob sich und drückte dem Vogelfranz dankbar die Hand.
„Hat‘s Ihnen gefallen?“, flüsterte der, um den Vogel, der wieder zu singen anhob, nicht zu stören. „Ja, ja, so ein Sprosser, das ist eine Freude. Mir geht so bald nichts darüber. Wollen Sie ihn haben?“
„Nein, nein!“, wehrte Max Hanschke gerührt ab. „Er ist bei Ihnen besser aufgehoben. Sie verstehen sich darauf. Wenn ich ihn hören will, dann komme ich wieder her.“
„Das tun Sie nur!“, rief der Vogelfranz glücklich und humpelte neben ihm zur Straße zurück. „Und im Herbst, wenn die Vögel ziehen, dann müssen Sie einmal mit in den Wald kommen. Dann geh ich mit dem Kauz auf den Fang. Drüben am Waldrand hab ich eine Grube, da kriechen wir hinein. Da kann uns kein Mensch finden.“
„Darüber lässt sich reden“, lächelte Max Hanschke und gab ihm noch einmal die Hand.
Dann ging er seines Weges, während der Vogelfranz zu seinem Häuschen zurückkehrte. Der Sprosser sang nicht mehr allein. Die taube Therese, die die andere Hälfte des Gramkauer Armenhauses innehatte, sang auch. Sie lag schon seit Monaten mit geschwollenen Beinen im Bett und sang jeden Abend den Choral: „Wer weiß, wie nahe mir mein Ende.“
Immer nur die erste Strophe sang sie, die aber wohl zwanzigmal hintereinander. Sie sang mit Inbrunst, doch ohne musikalisches Gehör. Der Vogelfranz hielt gute Nachbarschaft mit ihr, kochte für sie, bettete sie um, machte ihr die nötigen Handreichungen, aber ihr Singen war ihm ein Gräuel. Ärgerlich stieß er die Tür ihres Stübchens auf, brachte seinen bartstoppelumrahmten Mund an ihr linkes Ohr, auf dem sie noch nicht völlig taub war, und schrie: „Halt‘s Maul! Der Sprosser singt.“
Da tat sie keinen Mucks mehr. So viel Respekt hatte sie vor ihrem Nachbarn und seinem Sprosser.
Max Hanschke ging nicht durchs Dorf zurück. Über die Felder schritt er zum alten Hopfensack hinüber. Das war ein altes Fuhrmannswirtshaus an der Provinzialchaussee, die schnurgerade durch das ebene Gelände schnitt und in die rechts und links rechtwinklig die Feldwege mündeten. Max Hanschke trank ein Glas Bier und schritt dann gemächlich die Chaussee entlang auf die Stadt zu. Beim letzten Feldweg, der direkt auf das Peukertsche Gut zuführte, machte er halt. Es schien ihm gar nicht so unmöglich zu sein, dass Liese jetzt am Abend im Garten hinter der Scheune spazieren ging, wo er einst vom alten Peukert auf dem Birnbaum erwischt worden war, und schon machte er linksschwenk und pirschte sich an den hohen Staket Zaun heran. Er war für einen in allerlei Leibesübungen gewandten Menschen, wie Max Hanschke es war, nicht unübersteigbar. Nur der Gedanke an Nero ließ ihn etwas zögern.