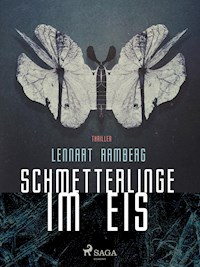
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
In einem Forschungslabor in Spitzbergen muss der Doktorant Kimi Hoorn überraschend das wichtigste Experiment zur Klimabeobachtung allein beenden: Sein Professor ist plötzlich spurlos verschwunden. Als dann auch noch Umweltverbände versuchen, die Forschungen für sich zu vereinnahmen, wird Kimi klar, dass mehr hinter den Experimenten steckt. Die Spur führt nach Russland... -Spannender und brandaktueller Öko-Thriller. Rezensionszitat "Ganz klar ein Buch für unsere Zeit!" (Expressen) "Es war nur eine Frage der Zeit, dass der Treibhauseffekt in die Krimiwelt einzieht." (Sydsvenska Dagbladet) "Ein spannender und gut recherchierte Öko-Thriller, gute und solide Urlaubslektüre." (Blogger kfir/www.lovleybooks.de) Biografische Anmerkung Per Lennart Ramberg ist eun schwedischer Schriftsteller und Ühysiker. Er wurde 1960 in Värmland geboren und lebt heute mit seiner Familie in Stockholm. Mit 27 Jahren promovierte er im Fach Industriephysik und gründete 1997 ein Technikunternehmen, das er später in die USA verkaufte. Von dem Gewinn erwarb er sich Anteile an einer schottischen Whiskybrennerei und - als erste Privatperson in Europa - ein CO2-Emissionsrecht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 507
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Lennart Ramberg
Schmetterlinge im Eis
Ökothriller
Aus dem Schwedischenvon Kerstin Schöps
Saga
»The CF4 [Fluormethan] concentration has been increasing linearly since about 1960 ... [and] has made an essentially permanent contribution to radiative forcing ... produced as byproduct of traditional aluminium production ...«
Aus: Contribution of Working Group Ito the Fourth Assessment Report,im Rahmen des UN-Klimapanels, hrsg. Mai 2007
Kapitel 1
Kimi hatte es sofort bereut, aber jetzt war es zu spät. Er stampfte auf das kleine Stück Wellblechboden, schlug gegen die Fensterscheiben und rüttelte am Türschloss. Die Gondel der Schwebebahn setzte ihre Fahrt nach Ny-Ålesund mit unverminderter Geschwindigkeit fort. Unter seinem Gewicht hin und her pendelnd, ließ sie die Gletscher und Berggipfel von Spitzbergen am Horizont vorbeischaukeln. Was sollte er bloß sagen? Was hatte er, Kimi Hoorn, dem Premierminister schon zu sagen?
Ein Ballon sollte in die Stratosphäre geschickt werden – so viel stand fest. Um dort die klimarelevanten Gase zu messen – so weit auch verständlich. Mit Hilfe einer neuen, einzigartigen Methode – alles klar. Die Wahrheit war jedoch, dass lediglich ein einziger Mensch wusste, wie das funktionieren sollte: Professor Emil Planck, von dem aber seit über fünf Wochen niemand mehr etwas gehört oder gesehen hatte.
Statt des renommierten Forschers schwebte nun ein Ersatzmann aus dem Labor der Zeppelinstation an Stahlseilen heran – der Doktorand Kimi Hoorn, zwei pappende Overheadfolien in den Händen haltend. Der gescheiterte Doktorand Kimi Hoorn, wie er sich selbst nannte. Der Lückenbüßer. Warum hatte er sich nicht einfach geweigert? Das Rascheln seines Jackenstoffs übertönte für einen Augenblick das monotone Heulen des Windes. Er hatte um Aufschub gebeten, aber die Vorstellung des Ballonprojekts war der letzte und wichtigste Programmpunkt der großen Einweihungsfeier, eine Art Finale. Der Höhepunkt und letzte Schachzug des Premierministers. Kimi warf einen Blick auf seine Folien. Handbeschrieben. Auf der reflektierenden Oberfläche sah er sein Spiegelbild, ein schiefes Grinsen hinter grünen Filzstiftbuchstaben. Gedankenversunken strich er sich den Pony zur Seite. Es war, wie es war. Er hatte weder Zeit für eine Rasur gehabt, noch hatte er seine Kaschmirjacke überziehen können.
Die Gondel hielt mit einem Ruck, eine Sekunde später ließ sich die Türverriegelung öffnen. Kimi drückte die Schiebetüren auf, nahm sein Gewehr und zwängte sich mit den Folien unter der Daunenjacke hinaus ins Freie. Die Zündschlüssel steckten im Schneemobil, so wie er alles zurückgelassen hatte. Die Maschine startete sofort, und mit heulendem Motor fuhr er die Strecke durch die vegetationsfreie Landschaft hinunter in das etwa einen Kilometer entfernte Ny-Ålesund. Der feine Schnee wurde von den Kufen aufgewirbelt, ein Rentierkalb trottete von dannen, der Weg in den Ort war leicht und schnell zu befahren.
Zwischen den alten Holzhütten aus der Zeit des Kohletagebaus und den ausgeblichenen Forschungsgebäuden, ebenfalls älteren Datums, stach das neue Botaniklabor mit seiner hellblauen Farbe leuchtend hervor. Darauf steuerte er zu.
Kimi riss die Waffe an die Brust, bevor er von seinem Fahrzeug sprang und die Stufen der Eingangstreppe hochlief. Saß der norwegische Premierminister schon ungeduldig oben im Hörsaal, starrte in die Luft und wartete auf einen total verspäteten Doktoranden? Kimi riss die Glastür auf und wollte in den Eingangsbereich stürmen.
»Stehen bleiben!«
Er hörte die Worte, reagierte aber nicht.
»Bleiben Sie sofort stehen!«
Der Sinn des Gesagten drang jetzt erst zu ihm durch. Kimi sah einen Mann im asphaltgrauen Anzug, der seine Hand unter das Jackett gesteckt hatte, daneben seinen Kollegen mit gezogener Waffe.
»Das Gewehr auf den Boden! Ganz langsam!«
Kimi gehorchte.
»Nicht so schnell! Gehen Sie einen Schritt zur Seite!«
»Wer sind Sie?«, stammelte Kimi.
»Die Frage lautet wohl eher, wer Sie sind? Na, na ... bleiben Sie, wo Sie sind! Sie stürmen hier mit einem Gewehr ins Gebäude und wollen einfach so in den Hörsaal laufen.«
Obwohl ihn niemand dazu aufgefordert hatte, stand Kimi mit erhobenen Händen da. »Selbstverteidigung. Gegen Eisbären.« Er schnappte nach Luft. Die Overheadfolien rutschten aus seiner Jacke. »Alle hier müssen eine Waffe tragen. Das ist Pflicht, wenn man allein da draußen unterwegs ist.«
Der asphaltgraue Sicherheitsbeamte zog die auf dem Boden liegenden Folien mit der Schuhspitze zu sich heran und betrachtete sie mehr oder weniger interessiert. Es knirschte, als das Plastik über den rauen Bodenbelag rutschte. Dann steckte der blaue Beamte seine Waffe wieder ins Holster zurück. »Okay. Wir kennen diese Regelung. Sie dürfen Ihre Hände wieder runternehmen.«
Kimi gehorchte. Seine Hände zitterten.
»Aber es wäre für uns alle einfacher, wenn Sie das nächste Mal nicht so angerannt kämen«, sagte der Blaue und lächelte unsicher, während sein Kollege Kimis Gewehr nahm, das Magazin leerte und ihm die Waffe zurückgab.
Kimi ärgerte sich über die Kratzer auf den Folien, ließ die beiden Männer stehen und drückte die Tür zum Hörsaal des Botaniklabors auf.
Bloß nicht die Zuhörer ansehen oder ihren Blicken begegnen, noch nicht, redete er sich zu. Geh ungezwungen und elegant wie auf einem Laufsteg einfach geradeaus. Die kurze Strecke zum Rednerpult war das Einzige, was ihm in diesem Augenblick durch den Kopf ging.
Mit einer lakonischen Geste wies Kimi den Hörsaaltechniker an, die gesamte Multimediaausrüstung auszuschalten und stattdessen einen alten Overheadprojektor aufs Podium zu schieben. Das Gerät dröhnte laut. Die erste Folie kam auf das Projektionsglas, das Bild wackelte und wurde schief an die Wand geworfen. Aber bevor der Regierungschef und sein Gefolge sich in die Abbildung vertiefen konnten, lenkte Kimi ihre Aufmerksamkeit zurück zum Rednerpult und warf ein zauberhaftes Lächeln in den Saal.
»Mein Name ist Kimi Hoorn. Und eigentlich sollte ich hier gar nicht stehen.«
Hatte sein Lächeln eine Wirkung erzielt? Ja, es schien funktioniert zu haben, und er fühlte sich besser, auch wenn er wusste, dass ihm jede noch so gut einstudierte Mimik nur wenige Sekunden Aufschub verschaffte.
»Ich werde versuchen, Ihnen das geplante Experiment anhand weniger Bilder zu erläutern, die ich auf die Schnelle skizziert habe. Wie Sie aus dem Programm ersehen können, steht Emil Planck hinter dieser Initiative und leitet auch die gesamte Versuchsanordnung. Ich bin sein Assistent. Professor Planck ist selbstverständlich im Besitz weitaus ansprechenderer Bilder und Aufnahmen. Aber ...«
Der Forschungsdirektor des Norwegischen Polarinstituts, ein großer Mann in einem karierten, offenen Hemd, unterbrach ihn mit diplomatischer Eleganz und erläuterte dem Auditorium, dass es Professor Planck leider nicht möglich gewesen sei, an der Konferenz teilzunehmen. Plancks Mitarbeiter Kimi Hoorn habe glücklicherweise so kurzfristig für ihn einspringen können. Seine Brust hob und senkte sich unter dem blau melierten Seidenpullover, und Kimi merkte, wie viel leichter ihm das Atmen fiel, wenn jemand anderes das Wort hatte.
»Ja, hier taucht man wohl auch nicht so mir nichts, dir nichts auf«, warf der Premierminister ein. »Wie oft landet hier ein Flugzeug? Einmal in der Woche? Zweimal?« Ihn schien es offensichtlich zu amüsieren, dass Planck sich dafür entschieden hatte, nicht vor ihm und seiner Gefolgschaft zu erscheinen, die aus der Umweltministerin, zwei Staatssekretären, deren Pressereferenten, acht weiteren Mitarbeitern sowie einigen geladenen Journalisten bestand.
»Was hat dieser Planck denn für andere, wichtige Angelegenheiten zu erledigen?«
Kimi zögerte mit der Antwort, während einer der Mitarbeiter kurz über die Flugverbindungen informierte. Als die erhobene Hand des Premierministers diese Ausführungen abrupt unterbrach, sah er sich jedoch gezwungen, etwas zu sagen.
»Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, wo er sich befindet.« Kimi sah, dass der Premier dies zur Kenntnis nahm, während sich die drei Journalisten weiter hinten im Hörsaal eifrig Notizen machten. Kimi wagte einen neuen Versuch.
»Lassen Sie uns nun kurz das Experiment ansehen, um das es geht! Ziel ist die Messung des Fluormethangehalts in der Stratosphäre. Sie haben richtig gehört, Fluormethan, eines der sechs Treibhausgase, deren Emission laut Forderung des Kyoto-Protokolls reduziert werden soll. Ein äußerst schädliches Gas. Sechstausend Mal schlimmer als das gewöhnliche Kohlendioxid.« Bei diesen Worten zeigte er auf die Sechstausend, die er mit dem Filzstift in die obere Ecke der Folie geschrieben hatte. Durch das Zittern seiner Hand verwischte die Zahl, die Spitze des Stiftes hüpfte unruhig über die Folie. »Die Versuchsanordnung sieht vor, mithilfe eines Forschungsballons Luftproben in circa zwanzig Kilometern Höhe zu nehmen. Niemand hat das bisher so weit im Norden versucht. Ein einzigartiges Vorhaben. Mit dem Ballon werden zwei Stahlflaschen aufsteigen. Wenn er die richtige Höhe erreicht hat, öffnet sich ein Ventil, Luft wird eingesogen, und das Ventil schließt sich wieder. Damit ist die Luftprobe gesichert. Etwas später, in noch größerer Höhe, geschieht dasselbe mit der zweiten Flasche. Danach werden beide abgeworfen.« Kimi zeigte mit dem Stift auf seine naive Zeichnung, auf der die Stahlflaschen wie zwei Bomben vom Korb des kugelrunden Ballons auf ein darunter stehendes Strichmännchen fielen.
»Es wird noch ungefähr eine Woche dauern, bevor wir den Ballon tatsächlich steigen lassen können, möglicherweise auch zwei oder drei. Wir müssen abwarten, bis sich die Jetströme gelegt haben und ihre Richtung ändern. Dann, und nur dann, kann der Ballon gestartet werden. Wir wissen noch nicht genau, wann das sein wird.«
»Und was geschieht danach mit ihm? Also, mit dem Ballon?« Eine Frau mit randloser Brille erhob sich, während sie ihre Frage stellte.
»Er wird davongetrieben ... Unser Interesse gilt selbstverständlich den Flaschen, sie haben Fallschirme, das hatte ich vergessen einzuzeichnen.« Und dann verlor Kimi sich in einer wortreichen Erläuterung darüber, wie das Forscherteam die wertvollen Proben in der Eiswüste aufspüren würde. Nach außen wirkte er ruhig und gelassen, während seine Zunge nervös hinter seinen makellosen weißen Zähnen hin und her fuhr. Er sah, wie die Journalisten ihre Stifte aufs Papier senkten, als sein Bericht den Höhepunkt erreichte: wie die Proben mithilfe einer besonderen Apparatur eingelesen werden würden.
»Ich meine, vorhin die Frage gehört zu haben, wie hoch das zu erwartende Messergebnis sein wird. Wahrscheinlich wird es sich im Bereich von achtzig ppt bewegen. Was ppt ist? Der billionste Teil. Richtig, das ist nicht besonders viel, aber vergessen Sie bitte nicht: Es handelt sich dabei um ein sehr schädliches Gas. Es ist zweifellos eine Herausforderung, eine solche Messung überhaupt vorzunehmen, aber die Ausrüstung hier in Ny-Ålesund ist absolute Weltklasse.«
Hier warf der Forschungsdirektor ein, dass sich das vortreffliche Instrument im Labor der Zeppelinstation befände, und schielte verstohlen zur Uhr.
Fragen zu den Kosten wehrte Kimi ab, indem er lauter kleine Einzelposten aufzählte und es wie eine Antwort klingen ließ, auch wenn es keine war. Als er gefragt wurde, wer die zu quantifizierenden Verursacher der Fluormethanemission seien, antwortete er: »Aluminiumschmelzöfen – die Produktion von Rohaluminium ist die Quelle von bis zu neunzig Prozent des gesamten Fluormethans. Einigen Schmelzofenbetreibern ist es bereits gelungen, ihren CF4-Ausstoß zu reduzieren, anderen nicht. Unabhängig davon, oder fast unabhängig davon, steigt der CF4-Gehalt in der Atmosphäre kontinuierlich an. Natürlich wäre es hinsichtlich des Treibhauseffekts besser, wenn sich der CF4-Gehalt verringerte, denn dieses Gas hält sich eine Ewigkeit in der Atmosphäre, mindestens fünftausend Jahre. Folglich wird der Gehalt, solange wir leben, stetig ansteigen.« Kimi lächelte verlegen.
Der Forschungsdirektor erhob sich mit einem Räuspern.
»Um zum Schluss zu kommen ...«, setzte er an.
Kimi wollte erleichtert aufatmen, als der Direktor vom Premierminister unterbrochen wurde: »Einen Augenblick noch!« Dann wandte er sich an seine Kollegin aus dem Umweltressort. Sie beugte sich eifrig vor, und die beiden unterhielten sich flüsternd.
Kimi blieb abwartend am Rednerpult stehen. Aus dem Getuschel hörte er ein »muss ich fragen« heraus.
Die Angesprochene richtete sich wieder auf, erhob sich dabei fast von ihrem Stuhl und zeigte mit einem teuren Stift in Richtung Podium. »Die vorherrschende Meinung über dieses große Experiment ist – darüber sind wir uns einig –, dass es sich hierbei um das kostspieligste Unterfangen in der Forschungsgeschichte von Ny-Ålesund handelt. Würden Sie uns daher das Vorhaben bitte noch einmal kurz zusammenfassen?«, sagte sie und senkte ihren Stift.
»Wie ich bereits angeführt habe, werden wir Messungen ...«
»Ja doch. Das haben wir schon verstanden. Fluormethan. Stratosphäre. Aber sollten Sie wirklich höhere Werte feststellen, oder gar niedrigere, was würde das bedeuten?«
»Ein niedriger Wert wäre natürlich wesentlich besser ...«
»... als ein höherer, das klingt plausibel. Aber wie lautet Ihre Hypothese? Was ist Ihre wissenschaftliche Annahme?«
»Professor Emil Planck hätte Ihnen da eine konkretere Auskunft geben können ...«
»Geben Sie uns einen Einzeiler, bitte, die Lightversion ist vollkommen ausreichend!«, bat einer der Journalisten aus den hinteren Reihen.
»Die Lightversion ... Ich weiß nicht so recht ...« Kimi tastete nach einem Schlipsknoten, den er nicht hatte.
»Nein, mühen Sie sich nicht mit dem Light ab. Erzählen Sie uns alles so ausführlich wie nötig.« Die Umweltministerin war Professorin in anorganischer Chemie und schreckte offenbar nicht vor ein oder zwei Formeln zurück.
»Ich weiß nicht so genau ... Nein, eigentlich gar nicht. Professor Planck ...«
»... wird in Kürze hier erwartet, damit er die Frage beantworten kann«, der Forschungsdirektor unterbrach Kimi, der sich trotz seines beherrschten Äußeren und seines unverwüstlichen Leinwandlächelns fühlte wie ein Boxer, der die Ringseile touchierte.
»Wir werden mit einer vollständigen Antwort auf Sie zurückkommen, sobald uns dies möglich ist«, fügte der Forschungsdirektor hinzu und bekräftigte seine Worte mit einem Kopfnicken.
Stuhlbeine scharrten über den nagelneuen Linoleumboden, als sich nun die etwa zwei Dutzend Zuhörer erhoben. Viele der Forscherkollegen, die vor Kimi Hoorn am Rednerpult gestanden hatten, diskutierten angeregt, aber gedämpft miteinander, so als würden sie das Gesagte in ihrem kleinen Kreis bewahren wollen. Kimi sah nur ein einheitliches Kopfschütteln, während sie auf den Ausgang zugingen. Einige der Forscher wurden von den Journalisten mit Fragen belagert. Aber offensichtlich sah sich niemand veranlasst, auf ihn zuzukommen, ihn, den Doktoranden von der Universität Göteborg, der nach Ny-Ålesund im Norden von Spitzbergen gereist war, um bei einem epochalen Experiment mitzuwirken, dessen Präsentation allerdings soeben gescheitert war. Verloren stand er da mit seinen verschmierten Folien in der Hand.
Fünfundzwanzig Minuten Vorwarnzeit hatte er gehabt, wovon fünfzehn für den Weg mit der Seilbahn draufgegangen waren.
»Das werden Sie doch mit Bravour meistern!«, hatten seine einzigen Instruktionen gelautet.
Auch schien es bisher keiner ernst genommen zu haben, dass Planck tatsächlich spurlos verschwunden war.
Kimi sank auf einen Stuhl, als hätte jemand die Luft aus ihm rausgelassen. Planck war verschwunden. Auch dieses Mal würde es ihm nicht gelingen. Erneut würde ihm eine große Chance ungenutzt zwischen den Fingern zerrinnen.
Die Regierungsdelegation bewegte sich wie ein kleiner Bienenschwarm zum Ausgang, während der Forschungsdirektor, wie so oft, eifrig mit den Armen wedelte. Die Minister nickten ihm zu. Lachten. Es schien im Großen und Ganzen eine erfolgreiche Einweihungsfeier gewesen zu sein.
Der Premierminister hob sein Glas. »Lassen Sie uns anstoßen – auf Spitzbergen und die Wissenschaft!«
Die Frau gegenüber von Kimi nahm einen großen Schluck aus ihrem Rotweinglas und sah ihm danach viel zu tief und viel zu lange in die Augen.
»Mir gefiel Ihr Auftritt wirklich außerordentlich gut«, sagte sie. »Er war ... anders ... so ... ehrlich.«
Kimi sah sie fragend an. Sein Auftritt war miserabel gewesen, wie wohlwollend man das auch betrachten wollte. Er hatte sich bereits an das äußerste Ende der Tafel gesetzt und hätte am liebsten das ganze Dinner sausenlassen, wenn ihm das möglich gewesen wäre. Ihm fiel nichts Vernünftiges ein.
»Andere wollen immer so wahnsinnig klug erscheinen«, sagte die Frau. »Patent. Raffiniert. So überirdisch intelligent.«
Aha, dachte sich Kimi. Sie kennt mich seit zwei Stunden und behauptet schon jetzt, ich sei dumm.
»... mit anderen Worten, ich hege die Hoffnung, dass ...«, hörte Kimi den Premier sagen. Gleichzeitig war er sich der Tatsache bewusst, dass es kein Zufall sein konnte, dass die Frau sein Bein ein zweites Mal aus Versehen berührte. »... das Wagnis, welches das neue Botaniklabor für uns bedeutet ...« Sie hatte ihren Blick auf den Premierminister gerichtet, als wäre nichts geschehen. Was dachte sie sich eigentlich dabei? »... die Versäumnisse der vorangegangenen Regierung ...« Das war doch ein Zeh, den er da spürte! Sie hat ihren Schuh abgestreift! »... wir Norweger müssen auch an die Zeit nach dem Ölboom denken ...« Kimi schob den Stuhl zurück, stand auf und ging.
Einige Minuten später befand er sich in seinem kleinen Zimmer und ärgerte sich über seine Jacke. Alle anderen hatten Hemd und Schlips zum Dinner getragen. Nur er nicht, er hatte dafür als Einziger einen Leinenblazer angehabt. Und das hier oben, am Nordpol. Nicht einmal seine Kleidung hatte er im Griff.
Er setzte sich aufs Bett und starrte auf die weiß gestrichene Raufasertapete. Er versuchte, sich eine vernünftige Versuchsanordnung einfallen zu lassen, eine, die er in den vergangenen drei Wochen noch nicht im Labor hoch oben auf dem Berggipfel aufgebaut hatte. Er traute sich nicht, Ulrika anzurufen. Wahrscheinlich schlief sie schon und würde einen Herzinfarkt bekommen, wenn das Telefon plötzlich klingelte. Diese Vernissage, zu der sie wollte, war doch erst am Mittwoch? Oder schon heute? Dann wäre sie bestimmt noch unterwegs. Er versuchte, die Bruchstücke seiner Erinnerung zusammenzufügen, aber es gelang ihm nicht. Deshalb wählte er zur Sicherheit den virtuellen Weg, um sie zu erreichen.
Der Bildschirmschoner verschwand beim ersten Tastendruck, das E-Mail-Programm war bereits geöffnet, ein leeres, weißes Textfeld wartete auf ihn. Es durfte auf keinen Fall eine Aufzählung von Trivialitäten werden, für Schneemobile oder Eisbären interessierte sich Ulrika nicht. Es sollte von etwas Großem, Gefühlvollem, Tiefem handeln. Darüber, wie es ihn enttäuschte, wenn andere Menschen nur sein hübsches Äußeres sahen, nicht hinter die Fassade blickten. Er folgte alten, oft bearbeiteten Gedanken, kleidete sie in neue Worte, hämmerte diese in die Tasten und sah, wie sich der Text vor seinen Augen entwickelte.
Er überflog die Mail. Die Klage über seinen Kummer, für attraktiv, aber dämlich gehalten zu werden, umfasste fast fünfzig Zeilen. Er löschte alles und erhob sich vom Schreibtischstuhl.
Dieses Zimmer ging ihm auf die Nerven.
Dabei gab es, objektiv betrachtet, keinen Grund zur Klage. Alles war nagelneu, kein Kratzer auf dem Linoleum, die Kiefernmöbel hell und unbenutzt, die Federn der Jalousien voller Spannung. Er sah sich um. Der Raum war sehr zweckgemäß eingerichtet worden, die Rohre an der Decke waren mit kleinen Schildern versehen, und aus den Lamellen neben dem Schreibtisch drang die Heizungsluft ins Zimmer.
Es war ein Platz für Menschen, die Spitzbergen nur besuchten, um Resultate zu erzeugen, ein professioneller Ort für effektive Menschen.
Er überlegte, wie er an ein großzügiges Glas Whisky kommen könnte, ohne zurück zum Bankett gehen zu müssen. Aber ihm fiel nichts ein.
Erneut begann er, das freie Textfeld zu füllen. Er erzählte von seinem Treffen mit dem Premierminister. Über den kurzen Augenblick im Rampenlicht während der Präsentation des neuen Forschungsvorhabens. Erwähnte seinen Platz am VIP-Tisch beim Dinner. Die Worte sprudelten nur so aus ihm heraus. Und jedes entsprach der Wahrheit. Aber würde Ulrika den Unterton verstehen, die Ironie bemerken? Dass er eigentlich gar nichts zu sagen gehabt hatte? Dass die Person, von der er vollkommen abhängig war, Emil Planck, nicht aufzufinden war? Würde sie das Offensichtliche, das er nicht zu formulieren wagte, begreifen? Dass Plancks Abwesenheit seine letzte Chance zunichtemachte, nach drei ergebnislosen Promotionsjahren endlich den Ansatz einer wissenschaftlichen Entdeckung vorlegen zu können?
Er trat vor den Spiegel und betrachtete lange seine Augen, deren besondere grüne Farbnuance ihm einst in der Kartei einer der führenden Modelagenturen eine eigene Unterrubrik verschafft hatte. Er sah aus wie immer. Wie jemand aus einer x-beliebigen Hochglanzmagazinreklame für klebrige Cremes ohne Eigenschaften, Tabletten ohne Wirkung oder etwas anderes Oberflächliches, das er hinter sich gelassen hatte.
Seine heutige Leistung jedoch war nicht mehr als ein schlechter Witz gewesen, eine weitere Szene in einer Forscherlaufbahn, die sich in Kimis Augen zu einer Farce entwickelte, einer schwarzen Komödie, bei der alle Lacher auf seine Kosten gingen. Er überlegte kurz, aufs Ganze zu gehen, die Posse zu beenden und eine Einladung zu verschicken:
Herzlich willkommen zu Kimi Hoorns Disputatio, in der er seine Dissertation »Woran man erkennt, dass ein Typ hohl ist« verteidigen wird. Hierin geht es um die Hintergründe des soziologischen Gesetzes, welches besagt, dass der Mensch sehr gut aussehende Artgenossen zwar zu schätzen weiß, jedoch gleichzeitig der festen Überzeugung ist, diese wohlgeratenen Exemplare seien wesentlich dümmer als er selbst. Ein herzliches Willkommen sei besonders an all jene Mitglieder der selbsternannten Kulturelite gerichtet, die meinen, sie würden Ulrika Malmsten kennen. Bitte beachten Sie: Diese Disputatio ersetzt die ursprünglich geplante Arbeit über den Einfluss des Fluormethans auf den Treibhauseffekt, die leider mangels Ergebnissen eingestellt werden musste.
Er kicherte und zog sich seinen Fleecepullover und die Daunenjacke an. Ihm war ein möglicher, oder zumindest nicht vollkommen ausgeschlossener Weg eingefallen, wie er mit Plancks Dateien weiterarbeiten könnte. Er schrieb einen Einzeiler an Ulrika, dass er sie liebe, und fuhr mit der Seilbahn zurück ins Labor.
Kapitel 2
Diana McManus sah, wie sich endlich die Tür zwischen den zwei Ölporträts an der Wand öffnete und der Anwalt Lewitt den Konferenzraum betrat. Er lächelte seinem Gast freundlich zu und legte zwei Papierstapel mit Spiralbindung auf den schweren Eichentisch.
»Entschuldigen Sie bitte, dass Sie warten mussten, Frau McManus. Jetzt dürfte so weit alles seine Richtigkeit haben.«
Er zog einen Stift aus der Innentasche seines tadellos sitzenden Jacketts und schob ihn Diana zu.
»Selbstverständlich können Sie den Vertragstext in aller Ruhe noch einmal durchlesen, wenn Sie es wünschen. Kein Problem.« Er strich sich über die zurückgekämmten Haare.
»Absolut kein Problem«, murmelte auch der Mann am Kopf des Tisches und steckte seinen Stift zurück in die Tasche.
Diana hob den obersten Stapel hoch und blätterte die hinteren Seiten durch. Sie wurde daran erinnert, warum ihre Vereinbarung auf über dreißig eng bedruckten Seiten festgehalten werden musste. »Das Abkommen führt nicht zu einem Angestelltenverhältnis«, hieß es in einem der Paragraphen, der auf beinahe zwei Seiten ausführte, was das im Einzelnen bedeutete. »Das Abkommen führt nicht zur Gründung einer Firma«, lautete ein anderer Paragraph. Sie las hier und dort einige Zeilen und war entsetzt, wie Menschen freiwillig ihr Leben mit dem Verfassen von so vielen, sinnlosen Paragraphen verbringen konnten.
Sie warf die Unterlagen mit etwas zu viel Schwung zurück auf den Tisch, so dass sie einmal quer über die glatte Oberfläche rutschten. Überrascht musterte Lewitt sie durch seine Schildkrötenbrille, der andere Mann hingegen hatte seinen Blick auf den Anwalt geheftet.
»Frau McManus ...?«
»Das sieht gut aus.«
»Ach so, ja. Gut! Dann kommen jetzt die Unterschriften ...«
Diana nahm den schweren, kalten Stift in ihre Rechte, blätterte mit der Linken zu den Seiten mit den markierten Zeilen. Unter der einen stand Diana McManus, Generalsekretärin Serve Earth, unter der anderen der nichtssagende Name des zweiten Mannes am Tisch sowie der Name der Firma von den Cayman-Inseln, die er vertrat.
»Ist Ihr Titel so richtig geschrieben?«, fragte Lewitt.
»Ja, Generalsekretärin.«
Sie blätterte mit dem Daumen die Seiten von hinten durch, von den unwichtigen Bemerkungen am Ende bis zu den bedeutungsvolleren im vorderen Teil. »Die Parteien sind sich darüber einig, dass Serve Earth ...« Zuerst las sie die einzelnen Passagen genauso sorgfältig wie beim ersten Mal, ging dann aber dazu über, die Zeilen schnell zu überfliegen, um festzustellen, dass nichts Bedeutsames verändert worden war. Dann schlug sie die Seite für die Unterschriften wieder auf und unterschrieb schwungvoll.
»Und das zweite Exemplar ...« Lewitt legte die Kopie mit der Handbewegung eines Croupiers auf den Tisch, Diana drehte an dem Stift.
Sie beobachtete, wie der andere Mann eine Vollmacht aus der Jacke holte, Lewitt aber hatte kein Interesse daran, diese genauer zu begutachten, und setzte seine Unterschrift neben die von Diana.
Die eigentlichen Akteure sind heute beide nicht vertreten, dachte sie. Dieser Typ ist doch nur ein Mittelsmann, den ich nicht kennenlernen will oder muss. Der Eindruck eines Stellvertreters verstärkte sich noch, als er einen Scheck herausholte, ihn unterschrieb und ihr reichte, ohne eine Spur von Bedenken, sich von einem Betrag dieser Größenordnung zu trennen. Diana steckte das kleine Stück Papier ins Innenfach ihrer flauschigen Umhängetasche.
»So ... Ja, schön! McManus – schottisch?«, fragte der Anwalt.
»Wahrscheinlich früher mal. Ich bin viel herumgekommen«, antwortete Diana. Das klang neutral, befreite von weiteren Verpflichtungen. Sie hatte keine Lust, Details aus dem turbulenten Leben ihrer Familie preiszugeben, die in aller Herren Länder gezogen war, um die Kampfflugzeuge des Arbeitgebers ihres Vaters zu verkaufen.
»Ich verstehe«, sagte Lewitt, öffnete einen Karton und holte ein klobiges, graues Telefon heraus. »Das hier ist auch Teil der Abmachung, die gerade geschlossen wurde«, sagte er und reichte ihr den Apparat. »Das Telefon muss unter freiem Himmel benutzt werden, es darf sich kein Hindernis zwischen Antenne und Satellit befinden.« Diana nickte stumm und ließ das Gerät in ihre Tasche gleiten, spürte sein Gewicht, wie das einer Prothese, von der man sich nicht befreien kann.
Diana und die beiden Herren erhoben sich, besiegelten ihr Abkommen per Handschlag und beendeten ihr Treffen. Ihr Vertragspartner, der zu Beginn seine Forderungen heruntergerasselt hatte und dann mehr oder weniger in Schweigen verfallen war, streckte ihr die Hand entgegen. Sie war warm und feucht, der Rest des Mannes aber wirkte kalt wie ein Fisch. Dich will ich nie wiedersehen, dachte Diana. Sie hatte genug von mahagonigetäfelten Wänden und Holzverzierungen, die an die Oberfläche einer Ananas erinnerten. Sie hatte dieses verworrene Fachchinesisch der Juristen und den dünnen Tee satt, dem sie die letzten drei Stunden ausgesetzt gewesen war. Drei Stunden auf dem Lederstuhl in einem fensterlosen Konferenzraum im zweiten Stock der Anwaltskanzlei von Thornthorp Lewitt. Sie schüttelte sich bei dem Gedanken, dass sie dieser Welt auch angehört hätte, wenn sie nicht rechtzeitig von der Universität gegangen wäre. Erneut durchfuhr sie ein Schaudern, sie wollte nur schnell von hier verschwinden.
»Möchten Sie kein Vertragsexemplar mitnehmen?«, fragte Lewitt, als sie sich zur Tür wandte. Er klang irritiert.
»Nein, das hatte ich eigentlich nicht vor.«
»Aber Ihnen ist doch hoffentlich klar, dass Sie die Verpflichtung haben ...«
»Meine einzige Verpflichtung ist es, ab und zu ein Telefonat zu führen. Trotz all dieser Paragraphen. Das Telefon habe ich, und die Nummer ist notiert.«
»Ja, doch ... Es ist richtig, dass der konkrete Gegenstand der Vertragsabsprache erst während der einzelnen Telefonate formuliert wird, aber wir haben uns doch über eine Vielzahl von Vereinbarungen verständigt – die Rede ist hier von einem vierunddreißigseitigen Vertragstext. Niemand kann sich an so viele Einzelheiten erinnern!« Lewitt nahm die Brille ab, was seine Augen viel kleiner aussehen ließ und auch weniger freundlich als zuvor.
»Ich habe keinen Ort, an dem ich den Vertrag aufbewahren könnte. Und ihn an Bord zu haben, wäre keine gute Idee. Ein anderes Zuhause habe ich im Moment nicht.«
»Und einen eigenen juristischen Beistand sicher auch nicht!«
»Nein, nichts dergleichen.«
Lewitt erklärte sich bereit, die Unterlagen in seiner Akte aufzubewahren. Diana konnte nicht einschätzen, wie selbstlos dieses Angebot war, aber darüber wollte sie sich in diesem Moment keine weiteren Gedanken machen.
Erleichtert stieß sie die Eingangstür auf und verließ das Gebäude. Auf dem kleinen Treppenabsatz blieb sie stehen und hörte die Tür hinter sich ins Schloss fallen. Sie streckte sich, legte den Kopf in den Nacken und kniff die Augen so fest zu, dass sich feine Fältchen bildeten. Dann öffnete sie die Augen wieder und kniff sie erneut zu, mehrere Male hintereinander.
Im Taxi zur Bank konnte Diana kaum einen zusammenhängenden Gedanken fassen. Der Fahrer hatte auf ihren Wunsch, sie zur nächsten Barclays-Filiale zu bringen, lediglich mit einem Nicken reagiert, das Taxameter angestellt und Gas gegeben. Der Bankangestellte am Schalter war dafür weitaus gesprächiger. Er brachte sie zum Lachen, hell und klingend, eine Seltenheit in dieser Welt aus Panzerglas und Mikrofonen.
»Nein, wirklich nicht«, antwortete sie, nachdem sie sich wieder gefangen hatte. »Ich bin keine großzügige Spenderin.«
Sie erklärte, sie sei eine Repräsentantin von Serve Earth und wolle den Scheck auf das Konto der Umweltorganisation einzahlen.
»Ich bin die Generalsekretärin. Wollen Sie meine Legitimation sehen?«
Der Schalterbeamte schüttelte energisch den Kopf.
»So etwas benötigen wir nur, wenn Sie Geld abheben. Es wird wohl niemand beim Überweisen eines Vermögens auf das Konto eines anderen betrügen. Nein, es ist alles in Ordnung so. Gleich wissen wir Bescheid, ob der Scheck gedeckt ist ... so, erledigt ... und die Quittung.«
Als Diana wieder auf der Straße stand, wusste sie zunächst nicht, wohin sie gehen sollte. Sie hatte in letzter Zeit wenig in der Gegend westlich von Kensington Garden zu erledigen gehabt, sich immer mehr im Osten der Stadt, in der Nähe des Hafens aufgehalten. Für Mitte April war es schon ungewöhnlich warm, was ihr zuvor nicht aufgefallen war. Jetzt aber hängte sie sich ihre Jacke über die Schulter. Ihre Kleidung hatte sie sorgsam ausgewählt, um den richtigen Eindruck zu vermitteln. Ausreichend seriös, um Vertrauen zu schaffen, und angemessen alternativ, um ihre eigene Sache glaubhaft zu vertreten.
Emil Planck musste nun so schnell wie möglich erfahren, dass sie jetzt endlich zu ihm aufbrechen konnten. Sie hatte sich lange genug Zeit gelassen. Glücklicherweise war er nicht aufdringlich gewesen, hatte weder angerufen noch gemailt, um sie unter Druck zu setzen. Sie schätzte seine umsichtige Art und war deshalb umso mehr bestrebt, ihm die guten Nachrichten zu verkünden. Das Geld war auf dem Konto. Sie rief ihn an. Planck ging nicht an den Apparat. Sie wartete geduldig die Ansage ab.
»Hej, hier ist Diana McManus von Serve Earth. Es ist alles arrangiert, wir können lossegeln. Natürlich nicht sofort, aber so in drei Wochen, denke ich. Dann sind wir in etwa fünf Wochen in Spitzbergen. Das wird aufregend, ich rufe an, sobald ich Genaueres weiß. Bis dann, alles Gute.«
Der nächste Anruf ging an die Frau, die mittlerweile alleine das mikroskopisch kleine Büro ihrer Organisation leitete.
»Ich bin’s. Es ist vollbracht. Das Geld müsste im Laufe des Tages aufs Konto eingezahlt werden. Ein Haufen Kohle ist das. Nicht, dass du glaubst, es sei ein Fehler, und alles wieder zurücküberweist ... Wie bitte? ... Nein, ich glaube nicht, dass an der Sache was faul ist. Es gibt noch gute Menschen mit zu viel Geld, so kompliziert ist es gar nicht.«
Aber eigentlich war es das eben doch, dachte Diana, einen Hauch komplizierter. Sie beendete das Gespräch.
Die Pforte zu dem kleinen Park neben der Kirche stand offen. Im Schatten der alten Backsteinmauer saßen Leute und picknickten, drei Bänke waren noch frei. Diana wählte die unter einer Weide, vor der der Boden mit dünnen Zweigen bedeckt war. Hier würde sie bestimmt eine Weile in Ruhe sitzen können.
Zuerst die Werft. Sie holte einen dicken Stapel Papier mit lauter Eselsohren hervor, die Kostenvoranschläge und die E-Mail-Korrespondenz. Der Werftbesitzer klang genervt, als er Dianas Namen hörte, beruhigte sich aber schnell wieder.
»Meinetwegen können die Reparaturarbeiten schon morgen beginnen. Geld? Ja, das haben wir. Ganz sicher, auf dem Konto! ... natürlich kann ich Ihnen einen Kontoauszug mitbringen, aber vielleicht wäre ein Vorschuss besser ... Heute noch, versprochen, ich bringe den Einzahlungsbeleg mit ... Die Reserveteile liegen doch seit unserer letzten Abmachung bereit, oder ... auf einem sauberen Stapel? Ja, ich weiß, das war ein wildes Hin und Her, entschuldigen Sie bitte. Aber das Geld ist bald auf Ihrem Konto. Wir sehen uns dann morgen ... Wie bitte? Nein, ich werde den Einzahlungsbeleg bestimmt nicht vergessen.«
Der Nächste war Peter. Sie holte den frankierten Umschlag mit dem Arbeitsvertrag hervor und legte ihn sich auf die Knie, der dicke Papierstapel diente als Unterlage. Sorgfältig trug sie seinen Namen in den Vertrag ein, ungewöhnlich deutlich, ohne zu zittern. Peter Larrington war ein professioneller Skipper, ein ausgebildeter Ocean Yachtmaster, mit Sextant und allem Drum und Dran. Vor kurzem war er noch als Steuermann auf einer 110-Fuß-Segelyacht im Mittelmeer gefahren. Er schien ein sehr zuverlässiger und angenehmer Kerl zu sein, und sie freute sich darauf, ihm von dem unterschriftsreifen Vertrag erzählen zu können. Ihre Nachricht auf seinem Anrufbeantworter beendete Diana mit den Worten, dass sie sich auf die Zusammenarbeit freue und er in den nächsten drei Wochen anheuern könne.
Diana hatte sich für Peter vor allem wegen seiner fachlichen Kompetenz entschieden, weniger wegen seiner politischen Ansichten. Sie war vorgegangen wie eine Regierung bei der Kabinettsbildung, die sich eher für einen politikfernen Justizminister entscheidet. Hin und wieder war die Zusammenarbeit mit einer qualifizierten Person von Vorteil, die ihre Aufgabe mit professionellen Augen betrachtete und frei von ideologischen Überlegungen agierte.
Zuletzt wählte sie die Nummer von Klaus Höltzenbein. Er meldete sich auf Deutsch, wechselte ins Englische und stotterte anfangs ein wenig herum. Im Hintergrund hörte Diana Lärm und Geschrei und ein leises Surren, so als hätte Klaus seine Kamera geschultert, während sie miteinander sprachen.
»Wunderbar. Klar, kannst du mir den Vertrag schicken. Aber das ist nicht so wichtig. Ich komme auch so mit. St. Katharine Docks, ja. Bei den Towern, okay. Kein Problem. Ich nehme den Zug durch den Eurotunnel, sobald das hier abgedreht ist. Phantastisch!«
Klaus war jung, Kameramann und Autodidakt. Auf den ersten Eindruck vollkommen chaotisch, aber Diana hatten seine Arbeitsproben und die Beiträge im Fernsehen tief beeindruckt. Viele Nahaufnahmen, eine Mischung aus fast ungebührlicher Nähe und Weitwinkel. Eine schöne Tiefe und Schärfe in den Zooms, und er war auch sehr bewandert in der digitalen Nachbearbeitung.
Diana hatte immer von so einem Feldfotografen geträumt. Ohne die richtige visuelle Verpackung existierte keine realistische Chance, den Mediendschungel zu durchdringen. Mit dem richtigen Bildmaterial dagegen stand einem die gesamte Medienwelt offen. Die Leute sahen fern und lasen Illustrierte, das war die Realität. Dort wurde der Kampf entschieden. Andere Umweltorganisationen arbeiteten anders, aber das war deren Sache. Diese großen, schwerfälligen Kolosse mit ihren zähen Versammlungen, unendlichen Abstimmungen und Tausenden von Tagesordnungspunkten. Eine Armada von Angestellten rannte dort herum und war besorgt, dass die Mitglieder die falschen Dinge von sich geben könnten, bevor sie spät am Abend wieder in ihren Zelten verschwanden. Ein begnadeter Kameramann und Fotograf wie Klaus bedeutete mehr als zwei Wahlkreise und einen Bezirk, mehr als zehn Mitgliederzeitschriften.
Die Sonne hatte den Kirchturm umrundet und schien jetzt auf ihre Bank. Serve Earth hat eine klare Einstellung zu seinem Umweltengagement, fasste Diana in Gedanken zusammen. Das und ein gutes Boot. Der hohe Mitstreiterverlust stellte keinen besonders großen Schaden dar, zumindest nicht auf lange Sicht. Zwar war es jedes Mal ein Schlag ins Gesicht, wenn einer der Weggefährten die Gangway verließ und sein Hab und Gut an Land trug, aber mittlerweile berührte sie das nicht mehr so. Die Rekrutierung von Peter und Klaus, einem erfahrenen Skipper und einem hungrigen Fotografen, erfüllte ihre Anforderungen für die Spitzbergen-Kampagne in ausreichendem Maße. Sie betrachtete die Reise als eine Kampagne, trotz der sich aufdrängenden Frage, worauf das eigentlich alles hinauslaufen sollte, trotz der Unsicherheit darüber, ob Serve Earth überhaupt von der Aktion profitieren würde. Von dem Scheck mal abgesehen.
Es war irgendwie merkwürdig, dass Emil Planck nichts hatte von sich hören lassen. Sie waren sich nur ein einziges Mal begegnet. In den guten alten Zeiten. Er war im Rahmen einer Umweltkonferenz in La Spezia bei einem kleinen Ausflug nach Elba mit an Bord gewesen. Diana erinnerte sich sehr genau an seine Art, sich auszudrücken, jede seiner Erklärungen zog sich unendlich in die Länge, da sie hauptsächlich aus langen Pausen bestanden. Derselbe Redestil hatte sie erneut verwirrt, als er sich Jahre später bei ihr meldete und sie und die Organisation zu sich einlud. Er hatte einiges an Informationen preisgeben müssen, ehe Diana sich davon überzeugen ließ, dass Planck mit seinen Messungen auf Spitzbergen einem bedeutenden Treibhausgas auf der Spur war, dem die Wissenschaft bis dahin äußerst wenig Beachtung geschenkt hatte. Er hatte gesagt, dass man etwas Entscheidendes entdecken würde, während Serve Earth vor Ort wäre.
Aber es war dennoch sehr bizarr, dass Planck sich so passiv verhielt. Wäre da nicht dieser Scheck gewesen, den sie gerade eingelöst hatte, hätte sie auch keinen weiteren Gedanken daran verschwendet.
Kapitel 3
Michail Alexandrowitsch Gusin beugte sich vor und kniff einem kleinen Schimpansen ins Ohr. Es war steif. Und das Fell war rau. Allerdings glänzte es und hatte eine schöne Farbe. Aber Nastja sollte etwas Kuschliges bekommen. Groß und ganz weich. Er ging mit dem Verkäufer im Schlepptau an dem Regal entlang, das vom Boden bis zur Decke mit Löwen, Elefanten und Affen in leuchtenden Farben gefüllt war. Ein Dromedar in Lebensgröße markierte den Übergang zu der eher traditionellen Bärenabteilung. Er drückte einem Braunbären auf die Nase.
»Gibt es den hier auch eine Nummer größer?«
»Ja, hier in der Ecke, Sir.«
Gusin zerrte prüfend am Auge des ungefähr einen Meter hohen Bären. Es schien festzusitzen. Er hob ihn hoch, setzte ihn wieder ab, schätze Gewicht und Stabilität. Genau das Richtige für meine kleine Dame, dachte er und nickte dem Verkäufer zu, der daraufhin den Teddybären zur Kasse hievte. Dort wartete bereits die Modelleisenbahn mit den sechs Waggons und einem Transformator, die Gusin vor ein paar Wochen schon hatte kaufen wollen. Damals hatte sein kleiner Sohn auf einem der Transportzüge vom Schmelzwerk zum Hafen mitfahren dürfen und war so begeistert gewesen, dass er nicht wieder hatte aussteigen wollen. Gusin bezahlte mit einem dicken Bündel Geldscheine und schob das Wechselgeld zurück über den Tresen, als er sah, wie der Verkäufer das Stofftier in eine schöne weiße Baumwolltasche steckte und diese mit einer bunten Schleife versah.
Im Taxi schielte der Fahrer auf das unförmige Paket. Mein kleines Geheimnis, grinste Gusin in sich hinein. Er stellte sich die neugierigen Blicke der Investoren vor, wenn er die Tasche mit dem Plüschbären neben sich aufs Podium stellen würde. Sicher würden sie denken, er habe Präsente für sie mitgebracht. Offensichtlich keine Materialproben, Aluminiumbarren waren ja vergleichsweise kantig, nein, eher etwas Weiches, Kostspieligeres und Russisches. Pelzmützen zum Beispiel. Er schob den Gedanken beiseite, und das nicht nur wegen der Hitze, die ihn umgab. Schließlich war er nicht nach Dubai geflogen, um sich über jemanden lustig zu machen, weder über die Fondsverwalter, die Analytiker noch über die Privatinvestoren oder wer auch immer gleich seinen Vortrag über LesAl hören würde. Er wusste es ja nicht. Das Publikum war von der Bank eingeladen worden, die auch den Börsengang in London organisierte. Aber er wusste genau: Je größer sein Eindruck auf die Zuhörer war, desto schneller würde der Wert seiner eigenen Aktienanteile an der Firma steigen. Und desto schneller würde sich auch das Risiko verringern, dass sie eines Tages wertlos wurden.
Das galt selbstverständlich für alle Finanzzentren, die er auf seiner Reise durch die Welt besucht hatte. Singapur war ein Erfolg gewesen, Zürich ausgezeichnet und sein allererster Termin – in London – geradezu brillant. Als er dort zum ersten Mal vor Leuten stand, die er von der Notwendigkeit überzeugen musste, beim Börsengang in London LesAl-Aktien zu kaufen, hatte er gespürt, wie sich Hoffnung in Erwartung verwandelte. Gusin war drauf und dran, den Teddybären fest zu umarmen, als er sich an diese Premiere erinnerte.
»Testpublikum« hatte die Bank seine Zuhörer damals genannt, als Gusin erstmals allein auf dem Podium stand, umgeben von Präsentationsbildern. Vor ihm saßen einige ausgewählte Großkunden der Bank, denen ein Vorkaufsrecht eingeräumt worden war, für das Entgegenkommen, sich ein oder zwei Minuten ihrer wertvollen Zeit zu nehmen, um anstelle der sonst üblichen Abstimmung ihre Meinung zu dem Vortrag zu äußern, zu sagen, warum sie dieses Paket kaufen oder sofort verwerfen würden.
Gusin erinnerte sich genau an das Gesicht des Investitionschefs der Allied Insurers. In den kleinen Augen des Iren hatte man das Eurozeichen förmlich leuchten sehen können, als wäre es in seine Netzhaut gebrannt, als er, Michail Gusin, die Prognosen der zu erwartenden Bruttogewinnspanne der kommenden Jahre verkündete. Ihm war es anhand eines Rückblicks auf bisherige Entwicklungen gelungen, allen Einwänden zuvorzukommen. Denn der Gewinn lag sogar noch höher als im Laufe seiner eigenen Amtszeit bei LesAl. Er erinnerte sich auch gern an die Finanzanalytikerin eines Pensionsfonds, eine Französin im Seidenkleidchen, die sich auf die Kosten der Elektrizitätswerke versteift und ganz offensichtlich die Zahlenangaben in Rubel als Summen in Dollar gelesen hatte. Pas du tout, keineswegs, hatte er eine seiner neuen französischen Vokabeln angebracht und ihr daraufhin erläutert, dass die Verbindlichkeiten lediglich ein Zehntel der Summe ausmachten, die sie angenommen hatte. Peinlich berührt hatte sie ihren Kopf gesenkt und sich eifrig Notizen gemacht.
Die Bankiers waren vor der ersten Begegnung mit den Investoren äußerst unruhig gewesen. Sie hatten ihn mit unpassenden Tipps überhäuft und ihn hauptsächlich mit Hinweisen genervt, wie er die Fragen über den Umwelteinfluss von LesAl abwehren sollte. Sie schienen ganz eindeutig seinen direkten und offenherzigen russischen Charme unterschätzt zu haben. Die Bankleute, die er für den Börsengang engagiert hatte, waren alle Herdentiere, Männer und Frauen hinter uniformierten Nadelstreifenfassaden. Sie alle betonten die Vokale und Diphthonge in derselben Art und Weise und hatten eine Schwäche für Dienstleistungsunternehmen, in die sie sich einkaufen konnten, ohne sich ihre Anzüge schmutzig zu machen. Die Wahrheit jedoch war, dass die meisten ernstzunehmenden Investoren nach echten Fabriken, die tatsächlich Produkte herstellten und reale Gewinne erzielten, geradezu lechzten. Am Ende war ihm lediglich eine einzige umweltrelevante Frage gestellt worden! Die Mitarbeiterin eines Hedge-Fonds aus Boston hatte die mit Kernkraft betriebenen Eisbrecher aber nur aus einem einzigen Grund angesprochen: Sie wollte selbst gerne an einem der Winterkonvois teilnehmen, um sich angeblich die Logistik genauer ansehen zu können. Natürlich dürfte sie mit einem Eisbrecher mitfahren! Wenn sie dafür die Emission der Aktien befürwortete, würde sie auch eine Kabine mit Blick aufs Vordeck bekommen. Er würde sie mit vier Kisten Champagner an den Nordpol schicken, wenn sie das wollte. Bei einem erfolgreichen Börsengang würde genug Geld da sein ... für alles.
Gusin warf einen Blick auf seine teure Armbanduhr und bat den Taxifahrer, am Hotel vorbeizufahren. Er hatte keine Lust, den Bankiers etwas über die Spielsachen zu erzählen. Außerdem blieb noch genug Zeit für eine Tasse Kaffee.
Im Gartencafé des Hotels war jeder Tisch mit einem Ventilator ausgestattet, der den Gästen kühle Luft zuwehte. Gusin war davon ein wenig irritiert, behielt seine Jacke an, machte es sich bequem und rührte in seinem Kaffee. Dann setzte er sich die Brille auf und ging die zwei To-Do-Listen in seinem ledernen Notizbuch durch. Die eine war problemlos zu bewältigen, davon konnte er viele Punkte delegieren. Die andere war ungleich schwieriger.
An erster Position stand der Kauf einer Partie Aluminium. Da musste er sich vorsichtig verhalten. Ihm fiel es ausgesprochen leicht, als Geschäftsführer mehrere tausend Tonnen in alle Welt zu verkaufen, aber als Einkäufer musste er bedächtiger vorgehen. Um die Transaktion musste sich seine Firma auf den Cayman-Inseln kümmern. Das Unternehmen gehörte ihm über eine Strohfirma, seine Beteiligung daran war so nicht nachzuweisen. Dennoch gab es viel zu bedenken. Schnell wurde mal ein praktisches Detail übersehen, das den Kauf einer so spezifischen Menge als zu ungewöhnlich aussehen ließ. Und das könnte wiederum einen seiner Mitarbeiter veranlassen, sich diesen Vorgang etwas genauer anzusehen. Gusin klopfte mit dem Stift gegen seine Zähne und schrieb einige abstrakte Symbole in sein Notizbuch, die er mit Datum versah und mit Pfeilen verband.
Dann klappte er den Planer zu, unterdrückte ein Gefühl von Unbehagen und versuchte, sich auf seine Firmenpräsentation zu konzentrieren. Bankiers und PR-Leute waren sich ausnahmsweise einmal einig gewesen: Er solle nicht versuchen, die geographischen Bedingungen zu verschweigen. Trotz der künstlichen Palmengärten und Inseln hatte die Wüstenkultur auch heute noch einen starken Einfluss. Es bestand keine Veranlassung zu verheimlichen, dass die Hauptanlage von LesAl in Lesojansk nahe der unbewohnten sibirischen Küste an der eisigen Karasee lag. Seine These würde sein, dass dies der ideale Standort für ein Aluminiumschmelzwerk sei. Er experimentierte mit verschiedenen Formulierungen, mit denen er Lesojansk und dessen Lage auf der Jamal-Halbinsel ansprechend beschreiben könnte ... den Hafen in Lesinka in der Nähe der Ob-Mündung sowie die karge Küste in der Umgebung. Er fand Parallelen zwischen der Tundra und der Sandwüste Dubais, hob beispielsweise die Gemeinsamkeit fehlender Infrastruktur hervor, betonte aber auch deren Vorteile und suchte Begriffe für die menschlichen Qualitäten, die durch so extreme Kälte und Hitze hervorgebracht würden. Die brauchbarsten Vergleiche notierte er in kyrillischen Buchstaben in sein Buch und versah sie mit der Überschrift »Triviales Gelaber (das niemand überprüfen kann)«.
Trivial, Gusin erhob sich, das kann man wohl laut sagen. Er verließ seinen Platz und spürte augenblicklich den Temperaturanstieg. Sobald das Dach keinen Schatten mehr spendete, übermannte ihn die Hitze, aber er ließ sich nicht beirren und lief den Kiesweg des Hotelgartens entlang, der von Büschen gesäumt war. Bestimmt gab es Menschen, die den Winter mochten, der sich wie ein eisiges Gespenst bis weit in den Juni hinein im Nacken festkrallte. Oder diese Dunkelheit, die schon im Oktober schwer auf Körper und Seele drückte und dann fünf lange Monate herrschte. Oder die Mückenplage ... Warum gab es überhaupt Verrückte, die das Leben dort liebten?, fragte er sich und strich vorsichtig mit der Hand über die harten Blätter der Büsche. Ein paar Schmetterlinge wurden durch die Bewegung des Zweiges aufgeschreckt und flatterten davon. Er wusste genau, was er wollte. Und was Lilja wollte. Was sie verdiente.
Lilja, meine Lilja, du bist nicht geschaffen für die eisige Tundra. Unter deinen Zehen solltest du Grashalme spüren, umgeben von Rosenduft und Geißblättern solltest du sein. Du hast es verdient, bei offenem Fenster zu schlafen und von den Gesängen der Nachtigall und Amsel geweckt zu werden. Anders, als es jetzt ist. Du wohnst an einem Ort, wo das Thermometer kaum eine Plusskala benötigt, wo man nichts anpflanzen kann und wo kaum einer weiß, was eine Parkbank ist, wo niemand in einer Hängematte liegen kann, die zwischen uralten Eichen hin und her schaukelt.
Gusin betrachtete die riesigen Palmen.
Zwergbirken! Was sind das überhaupt für Bäume? Missgebilde sind das, und wenn wir nicht bald nach Süden ziehen, sehen wir auch bald so knorrig und verkrüppelt aus. Unsere Kinder ertrinken in Spielsachen, aber sie haben noch nie einen Schmetterling gesehen, dachte Gusin traurig, als die zwei Falter, die er aufgeschreckt hatte, wieder an ihm vorbeiflatterten. Sie waren orange mit einer schwarzen Umrandung. Unsere Kinder haben noch nie Schmetterlinge gesehen!
»Das muss sich ändern!«, rief Michail Alexandrowitsch Gusin und verließ den kleinen Garten, um eine Handvoll jener Investoren zu treffen, die ihm diese Veränderung ermöglichen sollten.
Kapitel 4
In fünfundzwanzig Kilometern Höhe fegte der Wind unverändert mit achtzig Stundenkilometern Richtung Nordost durch die Atmosphäre, teilte der Meteorologe aus Oslo in seinem täglichen Faxbericht mit. Es war ungewiss, wann der Jetstrom abnehmen und schließlich seine Richtung ändern würde. Ebenso ungewiss war, wann der Wetterballon aufsteigen konnte. In einer Woche, in zwei, vielleicht auch früher.
Das Fax hing am Schwarzen Brett in der Sverdrupsbase, der norwegischen Forschungsstation von Ny-Ålesund. Von den etwa zwei Dutzend Holzhäusern unterschiedlicher Baujahre war es eines der neueren Gebäude. Zwei kleine zusätzliche Experimente sollte Plancks Ballon mit in die Atmosphäre nehmen: Das eine bezog sich auf die ultraviolette Strahlung, das andere konnte Kimi nicht zuordnen. Er sah nur, dass es offenbar die Befestigung von langen Antennen erforderlich machte, die wie Stacheln aus dem Korb herausragten. Wahrscheinlich hatte der für das Antennenprojekt zuständige Forscher, Professor Legernes, das Fax ans Brett gehängt. Er war es auch, der Kimi indirekt dazu veranlasst hatte, die Station aufzusuchen, um das Telefon zu benutzen.
Der Blick, mit dem ihn Legernes während seines Vortrags gemustert hatte, ging ihm nicht mehr aus dem Kopf. Es war keine große Geste, wirkte noch nicht einmal künstlich herablassend, lediglich eine Augenbraue hatte er gehoben. Die Skepsis und das Mitleid der Welt gefangen in einer einzigen Sekunde. Kimi machte den Umweg über die Station, um eben diesem Blick nicht erneut begegnen zu müssen. Er hatte ihm bedeutet, dass seine Anstrengungen, Emil Planck aufzuspüren, bei weitem nicht ausreichten.
Ein kurzbeiniges Spitzbergen-Rentier hatte sich zwischen den Gebäuden verlaufen und glotzte blöde durch das Fenster, als er die Nummer der Universität Uppsala wählte. Kennet Wilhelmsson war einer von Plancks engeren Kollegen, und als Verantwortlicher für die fünf Forscher der Atmosphärendynamikgruppe musste er auch etwas mit Plancks Klimaveränderungsgruppe zu tun haben. Na ja, Gruppe war hier nicht gleich Gruppe, Plancks Einheit wurde auf der Website so bezeichnet, allerdings war Emil Planck deren einziges Mitglied.
»Wilhelmsson!«, rief es am anderen Ende der Leitung. Leider wusste er aber auch nicht, wo Planck sich aufhielt. »Nein, wie soll ich sagen, unsere ›Wechselwirkung‹ zeichnet sich nicht durch eine hohe ›Frequenz‹ aus. Ja, viele Reisen, sogar nach Las Vegas, ich weiß, das klingt immer ein bisschen komisch, aber die Konferenzhotels sind billig da. Nein, meines Wissens betreut er im Augenblick keinen Studenten als Doktorvater. Ich hatte den Eindruck, dass er an vielen internationalen Kooperationen arbeitete. Natürlich werde ich ihn grüßen, wenn ich ihn sehe. Kimmy, war das, oder? Ach so, ja. Hier ist es noch ein bisschen früh am Morgen!«
Das Rentier trottete davon. Ein Paar Seeschwalben attackierten es in Sturzflügen und wirbelten um seine Geweihspitzen herum, als wäre es dabei, ihr Nest zu zertrampeln. Doch das Rentier ließ sich nicht beirren, blieb stehen, scharrte mit dem Huf, rupfte Flechten aus und kaute genüsslich darauf herum.
Die Institutssekretärin war zwar gesprächiger als der Universitätskollege, wusste aber ebenso wenig. »Nein. Keine Ahnung. Leider, leider. Ich weiß nur selten, wo er hinfährt, und – unter uns gesagt – auch nicht, wo er gewesen ist. Dabei mache ich sogar seine Reisekostenabrechnung. Früher konnte man das ja an der Währung erkennen, aber jetzt mit dem Euro ... Es gibt schließlich länderspezifische Aufwandsentschädigungen, nicht wahr! Wenn er zu viel bekommt, gilt das als ein steuerpflichtiges Einkommen, und das betrifft ihn dann ja wohl auch?« Dabei hatte Kimi lediglich gefragt, ob sie wisse, wann Planck zurückkomme ... Einfach zu raten, wo er als Nächstes hinfahren könnte, wäre schließlich auch eine Zumutung ... »Nach Spitzbergen? Hieß das so? Nördlich von Norwegen, Richtung Nordpol, ach so! Herr Professor Planck ist sehr erfolgreich, er wird oft zu Konferenzen eingeladen, auf denen er Vorträge halten soll. Allerdings tauchen die Hotelkosten nie auf einer der Spesenabrechnungen auf, das spricht doch für sich!«
Emil Planck hatte doch bestimmt eine Familie und ein Zuhause. In Schweden gab es ein paar Dutzend mit dem Namen Planck, aber Kimi wusste genau, dass es keinen Sinn hatte, auch nur einen davon anzurufen. Noch bevor er erstmals von den viel gerühmten Artikeln in der Nature gehört hatte, war ihm eine Geschichte über den Dozenten an der Universität Uppsala zu Ohren gekommen, die ihn noch heute staunen ließ: Plancks Schönheits-OP seines Namens. Ein kleines zusätzliches ›c‹ befreite ihn von den Assoziationen ›Sägespäne und Holzkopf‹ und stellte ihn in eine Namenslinie mit dem Erfinder der Quantenmechanik.
Auch er war nicht als Kimi Hoorn auf die Welt gekommen, sondern als Kjell-Åke Sjöström. Er sei ein show-stopper, ein richtiger Knüller, wie ihn sein Agent und Entdecker nannte. Er hatte ihn damals auf Las Palmas am Strand angesprochen, wo er als Student seinen Urlaub verbracht hatte. Kjell-Åke würde keiner aussprechen können, redete ihm sein Agent ein. Kimi hingegen würde androgyn und modern klingen, Hoorn sogar irgendwie adlig, ohne dabei dem echten Adel zu nahe zu treten. Keiner aber hatte sich darüber Gedanken gemacht, wie oft seine Modelkollegen ihn »Kimi’s horny« nennen würden.
Kimi legte den Hörer auf. Während er dem weidenden Rentier zusah, dachte er einen Augenblick lang daran, alle Planks ohne ›c‹ anzurufen. Doch er ließ die Idee sofort wieder fallen. Die Liste wäre zu lang.
Planck und er waren sich nur ein einziges Mal begegnet. Der Forscher aus Uppsala hatte sich anlässlich eines Seminars über Klimaveränderungen in Göteborg aufgehalten, um dort einer Reihe von Vertretern aus Gemeinden und Landtagen Hintergrundwissen zur Umsetzung neuer Richtlinien zu vermitteln. Kimi hatte Planck als einen zurückhaltenden, fast scheuen Menschen wahrgenommen. Seine Kleidung war so dezent gewesen, dass Kimi sich überhaupt nicht mehr daran erinnern konnte. Eine Seltenheit für sein ehemals auf Oberflächlichkeit trainiertes Gedächtnis. Aber an das dünne Haar, das nicht den gesamten Kopf bedeckte, daran konnte er sich sehr gut erinnern, ebenso an die weit auseinander stehenden Augen, die hellblau strahlten, wenn er ein seltenes Mal den Blick hob. Auch Plancks geschmeidigen Gang hatte er noch vor Augen, der ihn sofort an einen Judomeister oder Mönch denken ließ.
Kimis Doktorvater, Professor Händler-Bös, hatte sich kurz vor dem Vortrag für höchstens eine Viertelstunde mit Planck hinter verschlossenen Türen unterhalten, als Kimi hereingerufen und gefragt wurde, ob er sich eine Mitarbeit bei dem Experiment auf Spitzbergen vorstellen könnte. Die Professoren hatten Kimis Antwort gar nicht abgewartet, so als sei seine Zustimmung vorausgesetzt worden. Planck hatte noch etwas über Details gemurmelt, die es folglich zu besprechen gäbe, und dann seine Unterlagen zusammengesammelt.
Nach dem dritten Dia der Planckschen Vorlesung begriff Kimi, dass es zwei Seiten an dem Professor gab. Der einen war er soeben begegnet, wortkarg und rätselhaft, sie warf viele Fragen und Spekulationen auf und verunsicherte das Gegenüber mit seltsamen Bemerkungen. Die andere erlebte er in der Vorlesung. Planck hatte sich zu einem rhetorischen Genie entfaltet, kaum dass er seinen Auftritt haben und seine wohldurchdachte Nummer aufführen durfte. Der Mann war auf der Bühne eindeutig besser aufgehoben, dort war er in seinem Element.
Auch bei der Beantragung von Fördermitteln war Planck brillant. Kimi kannte seine Anträge zur Finanzierung des kostspieligen Ballonexperiments in- und auswendig. Er kannte den Auftakt mit den großen Koordinaten, die dem Leser eine zerstörte Welt vor Augen führten, ohne dass ein einziges Wort darüber im Text stand. Vermehrtes Wissen über Fluormethan würde jedoch zu einem äußerst wichtigen Rädchen in der großen Maschinerie zur Bestandsaufnahme der Erde werden. Und Kimi wusste auch, dass noch nicht einmal im Anhang das tatsächliche Ziel des Experiments erläutert wurde.
Zögerlich erhob er sich, um, wie schon so viele Tage zuvor, zum Atmosphärenlabor auf dem Zeppelinberg zu fahren und in den Unterlagen und Dateien von Planck nach brauchbaren Informationen zu suchen. Er war unaufhörlich auf der Jagd nach dem eigentlichen Ziel des Experiments, nach einem Hinweis, was er als einziger verbleibender Fluormethan-Forscher zu tun, welche notwendigen Vorbereitungen er zu treffen hatte und welche Maßnahmen er unbedingt ergreifen musste, damit nicht alles umsonst gewesen war.
Die kleine Gondel der Seilbahn schaukelte auf ihrem Weg zum Labor der Zeppelinstation zaghaft hin und her. Die Sicht auf Ny-Ålesund, die Landebahn, den Fjord und die Berggipfel auf der anderen Fjordseite war durch einen Schneeschauer versperrt, der vom Meer im Westen über den Sund zog. Der Wind war böig. An den Fensterscheiben der Gondel lief Schmelzwasser herunter. Kimi ertappte sich dabei, wie er sein Spiegelbild betrachtete und keinen einzigen negativen Gedanken über die ihm bevorstehende Arbeit empfand. Im Gegenteil, er war so zuversichtlich wie schon lange nicht mehr.
Anstatt sich auf Plancks Vorhaben zu konzentrieren, wollte er vielmehr die bereits vorliegenden Messdaten studieren und zu begreifen versuchen. Besonders ein Ergebnis, das Kimi bis dahin als Messfehler abgetan hatte. Planck hatte sich jedes Jahr drei, manchmal vier Wochen in Ny-Ålesund aufgehalten und diese Zeit damit verbracht, die Fluormethankonzentration der direkten Umgebung zu messen. Dafür hatte er die Luftproben verwendet, die durch das Rohr auf dem Dach der Zeppelinstation eingesogen wurden. Die Messergebnisse befanden sich in Form von unzähligen Dateien auf der großen externen Festplatte neben Plancks Computer. Die Dateien waren jedoch mit einem Code geschützt, den Kimi bislang nicht hatte knacken können.
Der Computer war so, wie er ihn zurückgelassen hatte. Er blätterte am Bildschirm durch die einzelnen Ordner und öffnete ein paar ungeschützte Dateien mit einer neuen Software, mit der Planck in letzter Zeit offensichtlich häufiger gearbeitet hatte, die Kimi aber vollkommen unbekannt war. Auf dem Monitor erschienen erneut nur die alten Messkurven, die er schon so oft betrachtet hatte, da war nichts Neues zu entdecken. Na gut, murmelte er vor sich hin, da hatte er wenigstens eine stabile Ausgangssituation. Dann öffnete er die Datei mit dem Namen »606-34-FTR«, die offensichtlich beschädigt war, denn es erschien statt einer Kurve nur eine schwarze Linie.
Er mühte sich ab, um die richtigen Eingabefelder zu finden und die Zahlen zu überprüfen, wollte die Koordinatenachsen mit korrigierten Parametern normalisieren. Aber auch viele Tasten- und Mausklicks später war die Linie noch immer nicht aus dem Diagramm verschwunden. Neue Zahlen an einer anderen Stelle, doch der Strich blieb unverändert. Dann fragte ihn das Programm plötzlich, ob er die alte Skalierung wiederherstellen wolle. Kimi bejahte per Mausklick, und der Rechner begann eine Zeichnung aufzubauen. Auf dem Bildschirm erschien eine Messkurve.
»Shit!«, schnaubte er. Die nächste Enttäuschung. Die Zahlen auf der y-Achse, an der man die Fluormethankonzentration ablesen konnte, waren bedeutungslos niedrig. Er folgte dem Kurvenverlauf, stutzte, las den Wert ab. Die höchste Konzentration lag bei sechshundert Billionstel, das war sechsmal höher als ein realistischer Wert. Ja, klar. Er begann andere Kurven umzurechnen, die Messungen anderer Tage zu überprüfen.
Der Gehalt an Fluormethan war in der Regel ziemlich stabil. Hundert Jahre Aluminiumproduktion hatten ihn auf ein relativ unveränderliches Mittel von etwa achtzig Billionstel angehoben. Dieser Wert war Kimi so häufig in den Daten begegnet, dass ihn das nicht weiter erstaunte. Eine Kurve sah aus wie die andere, fand er, als er mit den endlosen Zahlenreihen ebenso vertraut war wie mit den Messinstrumenten, mit denen er sich in der ersten Woche beschäftigt hatte. Die Messung für »606-34-FTR« vom 12. Februar war die einzige Abweichung, die er entdecken konnte. Und die schien vollkommen aus dem Zusammenhang gerissen zu sein.
Und wenn jetzt aber ...? Kimi öffnete die Ursprungsdatei erneut, er klickte, drückte und murmelte vor sich hin, dann hatte er alle Daten der Kurve aufgerufen. Eine Wand aus Einsen und Nullen. Er beugte sich vor und versuchte den Zahlenreihen zu folgen. Zur Rechten stiegen die Zahlen tatsächlich an, er rechnete sie ins Dezimalsystem um. Zuerst zogen sie an der Vierundsechzig vorbei, dann weiter an der Zweihundertsechsundfünfzig bis hinauf in die Gegend um die Sechshundert, dort verweilte die Kurve einen Augenblick und sank dann wieder auf den Normalwert ab. Kimi kopierte die Zahlenwerte in ein anderes Grafikprogramm, druckte die Kurve aus und betrachtete das Ergebnis. Hier konnte es sich nicht nur um einen einfachen Messfehler handeln.
Ein so markanter Anstieg des Fluormethangehalts war äußerst ungewöhnlich. Von einem natürlichen Wert um die Achtzig auf einen Wert von über Sechshundert. Zwar ging es hier um Billionstel, aber dennoch.
»Das ist ja unglaublich!«, rief er laut, aber es hörte ihm keiner zu.
Kimi hörte nur, wie die anderen Stationsangehörigen ihre Arbeitsräume und Versuchsanordnungen verließen, um in der Kantine zu Abend zu essen. Er ging meistens sehr spät, hatte keine Lust, die Fragen nach dem »schwedischen Kollegen« oder allgemein nach seinem Wohlbefinden zu beantworten. Heute Abend lief er sogar Gefahr, das Essen ganz zu verpassen.
Etwas später betrachtete er den dreiseitigen Text, den er soeben verfasst hatte, schüttelte den Kopf, drückte auf ›Löschen‹ und loggte sich aus.
Das Telefon stand in der Ecke. Sie müsste heute Abend eigentlich zu Hause sein.
Kimi starrte lange auf den elfenbeinfarbenen Apparat, dann wählte er ihre Nummer.
»Ulrika Malmsten.«
Ihre tiefe Stimme erregte ihn, wie immer, wenn er sie ein paar Tage nicht gehört hatte. Wie bei ihrer ersten Begegnung im Junggrens Café in Göteborg. Er hatte sich einen Cappuccino bestellt und im Herald Tribune gelesen, sie hatte sich mit einer Freundin an den Nachbartisch gesetzt. Ulrika meinte Kimi beim Lesen eines Artikels über den abstrakten Künstler Olle Bærtling beobachtet zu haben. Als sie das Café verließ, hatte sie ihm ihre Visitenkarte gegeben und ihn mit dieser tiefen Stimme auf die aktuelle Ausstellung in ihrer Galerie hingewiesen.
Kimi konnte sich gut daran erinnern, wie er mühsam ein paar Plattheiten hervorgestammelt hatte. Er wollte nicht zugeben, dass er eigentlich den Nachbarartikel über die Entlarvung von gefälschter Kunst mithilfe von Lumineszenz und ultraviolettem Licht gelesen hatte. Tags darauf besuchte er sie in der Galerie, und während sie ihn durch die Ausstellung führte, punktete er mit seinem Wissen aus Unizeiten. Er hatte die chemischen Bestandteile der Temperafarben noch parat und konnte Ulrikas Interesse mit einer kurzen Zusammenfassung der neuesten Erkenntnisse über Olle Bærtling gewinnen. Man hatte herausbekommen, dass die Seitenlinien der berühmten Bærtling’schen Dreiecke leicht gekrümmt waren, damit Dreiecke aus dunkleren Farben nicht die optische Täuschung einer gebogenen Linie verursachten. Kimi hatte sich sicher gefühlt, sich aus der Deckung gewagt, entspannte sich. Eine Frau, die sich die Galerie mit Dreiecken vollhängte, konnte unmöglich nur an Äußerlichkeiten interessiert sein. Diese Ulrika schien ihn richtig ernst zu nehmen. Als er ihr ein paar Tage später gestand, dass er Fotomodell sei, hatte sie lediglich »Ich weiß« erwidert.
»Hallo? Bist du es, mein Liebling?« Ihre Stimme wurde eine Spur heller, auch das klang schön, fand Kimi.
»Natürlich geht es mir gut. Nein, nicht nur so lala? Ich meine, so richtig gut, gut! Ja, auch morgens und mittags und auch abends.«
Ihre Verfassung war stabil, er machte sich aber trotzdem Sorgen um sie. Es war schließlich ihr erstes Mal, viele Frauen mussten sich anfangs häufig übergeben.
»Ob ich schon eine Bewegung spüre? Nicht wirklich. So schnell geht das bei den Primaten nicht, du Naturwissenschaftler!«
Und dann plätscherte ihr Gespräch fröhlich weiter. Über alle möglichen Themen unterhielten sie sich, als wollten beide den jeweils anderen in die eigene Welt einladen, zu all ihren großen und kleinen Begebenheiten, zu Wichtigem und Unwichtigem, Schönem und Traurigem. Die Verhandlungen mit dem Museum of Modern Art über eine Leihgabe gingen nur schleppend voran. Versicherungsquatsch. Hallins Wiederwahl zum Vorsitzenden der Wohnungsbaugenossenschaft. Wie zu erwarten. Es regnete. Typisch Göteborg. Und so weiter, von beiden Seiten. Ausführlich und fröhlich. Er begriff nicht, warum er überhaupt gezögert hatte, sie anzurufen.





























