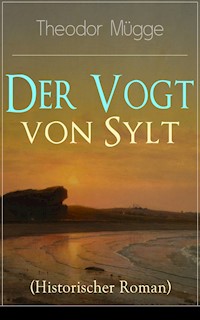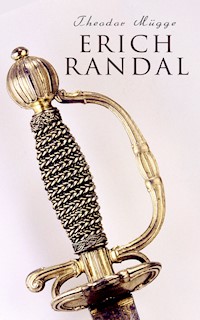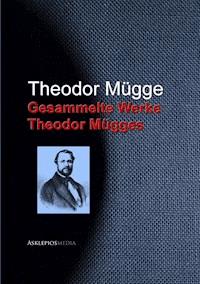Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Kriminalerzählung aus dem hohen Norden. Die Serie "Meisterwerke der Literatur" beinhaltet die Klassiker der deutschen und weltweiten Literatur in einer Sammlung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 252
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Schritt für Schritt
Theodor Mügge
Inhalt:
Theodor Mügge – Biografie und Bibliografie
Schritt für Schritt
Schritt für Schritt, T. Mügge
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN:9783849632274
www.jazzybee-verlag.de
www.facebook.com/jazzybeeverlag
Theodor Mügge – Biografie und Bibliografie
Schritt für Schritt
I.
Nicht weit vom altertümlichen Tore einer lebhaften Kreisstadt machte die Landstraße, statt geradeaus darauf los zu gehen, einen Bogen, denn ihr im Wege lag ein ziemlich ansehnliches Haus mit seinen Nebengebäuden. Ein Gartengebäude lief weit dahinter fort, und wo es aufhörte, begannen Waldhügel mit hohen Bäumen besetzt, an deren Gipfeln der rote Abendschein glühte. Abendlich still dämmerten auch Luft und Land und ließen sich von den Heimchen und Heuschrecken in den Schlaf singen.
Auf der Landstraße klapperte eine Postkalesche der Stadt zu und wirbelte eine Staubwolke auf. Ein paar Koffer waren hinten aufgeschnürt, und unter dem weit überhängenden Halbdeck saßen zwei Reisende in Mäntel gehüllt und in die Ecken gelehnt. Bei der Dämmerung ließ sich nichts weiter von ihnen erkennen, als aber der Wagen dem Landhause näher kam, richtete der eine sich auf und streckte den Kopf vor. Die Stadt lag vor ihm mit ihren alten spitzen und zackigen Türmen, welche sie in den Hussitenkriegen uneinnehmbar gemacht hatten, jetzt aber mit ihren Efeugewinden als ein malerisches Stück Mittelalter allein von der alten trotzigen Wehrhaftigkeit übriggeblieben waren. Blauer Dunst vermischte sich mit Nacht und Rauch und umdunkelte den Wohnplatz der friedlichen Bürger; grünende Felder und Matten, der Wald jenseits auf der Höhe und ein Fluß, dessen helles Bett in manchen Windungen sich verfolgen ließ, bildeten einen artigen Rahmen dazu.
Der Reisende tat einen raschen Blick darauf, dann heftete sich seine Aufmerksamkeit auf das nahe Haus. Er hatte ein wohlgeformtes schmales Gesicht und klare scharfe Augen.
»Schläfst du?« rief er seinen Gefährten an.
»Ich wache eben auf«, war dessen Antwort. »Wo sind wir denn?«
»Dicht bei der Stadt. Und dies hier muß das Haus sein.«
»So«, sagte der andere Reisende, indem er gähnte, seine Augen rieb und dann ebenfalls hinausschaute, »glaubst du es?«
»Nach dem, was man uns berichtete, scheint es mir gewiß zu sein. Wir wollen uns gleich davon überzeugen. Heda, Schwager, weißt du, wer hier wohnt?«
Der Postillon wandte sich um, nahm die kurze Pfeife aus dem Mund und sagte: »Hier wohnt der Herr Major von Brand, und das ist sein Gut. Der ganze Wald gehört dazu, der Acker da drüben auch und die große Wassermühle vor der Stadt ebenfalls. Er hat aber alles verpachtet.«
»Er ist also wohl nicht hier?«
»Ja freilich ist er hier, in dem Hause wohnt er ja.«
»Hat er keinen Sohn?«
»Einen Sohn hat er, der ist aber weit fort. Er ist beim Obersten Gericht.«
»Töchter hat er auch?«
»Zwei hat er. Ein Fräulein ist schon groß, und eins, das ist noch klein und bekommt Unterricht von einem Lehrer, den sie im Hause haben.«
»Du weißt ja sehr gut Bescheid, wie's da zugeht!« Der Reisende lachte.
»Warum sollt ich nicht?« erwiderte der Postillon. »Ich bin ein paar Jahre bei ihm gewesen, darauf bin ich Postillon geworden. Aber ich wollte, daß ich es nicht getan hätte.«
»Schäme dich«, scherzte der Fremde, »man muß niemals bereuen, was man getan hat.«
»Das ist wohl wahr«, meinte der Postillon, »geschehene Dinge sind nicht zu ändern, und gefallen kann man sich auch nicht alles lassen.«
»Es ist also wohl ein böser Herr?«
»Böse ist er eigentlich nicht, das kann man nicht sagen, aber hitzig. Alle Donnerwetter kriegt man auf den Hals, sowie das geringste los ist.«
»Da muß mit ihm schlecht Kirschen essen sein.«
»Wenn's Fräulein nicht wäre, so wär's noch schlimmer«, sagte der Postillon. »Im Grunde ist er auch gut, denn nach Geld fragt er nicht, und wo was zu geben ist, ist er allemal da.«
»Hat er denn so viel zu geben?« fragte der Fremde.
»Na, er nimmt schönes Geld ein, aber übrig wird wohl nichts bleiben. Wie er im vorigen Jahre die Mühle neu baute, hat er borgen müssen. Es geht alles drauf. Wer da kommt, ist gut aufgenommen, und früher ging's noch größer her, aber das Fräulein ist jetzt an der Spitze und hält's besser zusammen.«
»Wohnt er schon lange hier?«
»An die zehn, zwölf Jahre. Er hat alles geerbt.«
»Den Acker hat er verpachtet?«
»Den hat er verpachtet, bloß die Jagd hat er behalten, denn das Jagen ist seine Sache, und darin versteht er keinen Spaß. Wenn sie ihm Holz stehlen, das kann er leichter ertragen, aber mit Wilddieben hat er kein Erbarmen. Einen hat er lahm geschossen, es ist noch nicht zwei Jahre her. Der Fuß wird dem Mathis nicht wieder grade.«
»Das ist ja ein alter Sakermenter, der Herr von Brand!«
»Er ist lange Offizier gewesen unter dem Napoleon, hat den spanischen Krieg mitgemacht und war auch in Rußland. Der fragt wenig danach, wenn er in Wut ist, hinterher hat's ihm leid getan, obwohl er freigesprochen wurde in dem Prozeß, den sie ihm machten. Während Mathis im Gefängnis saß, hat er Frau und Kind von ihm erhalten, und jetzt, wo der Mathis wieder frei ist, gibt er immer noch. Es soll keiner wissen, aber es ist doch bekannt, wenn auch der Mathis schimpft. Ja, ja.«
Der Postillon nahm sein Horn an den Mund, denn der Wagen rumpelte jetzt über das Pflaster an der Torbrücke, und somit hörte das Gespräch auf, während dessen Dauer die beiden Reisenden verschiedene Blicke gewechselt hatten. Jetzt lachten sie zusammen und sprachen dabei, aber der Postillon hörte nichts davon, auch kümmerte es ihn nicht. Er fuhr zwischen den beiden alten Tortürmen die schmale krumme Straße hinauf, an der Kirche vorüber auf den Marktplatz, wo sowohl die Post wie der Gasthof »Zum roten Bären« standen, und da dieser der anerkannt beste von den dreien war, unter denen die Auswahl offenstand und die Reisenden expreß nach dem besten verlangt hatten, fuhr er sie dahin und blies aus Leibeskräften, sowie er um die Ecke bog.
Der Wirt kannte das Zeichen. Der Kellner lief vor die Tür, er selbst kam hinterher. Es langten nicht viele Fremde hier an, um zu übernachten, die meisten fuhren weiter, eine Extrapost wie heute war aber immer ein wichtiges Ereignis. Ein Dutzend barfüßige Jungen rannten von allen Seiten herbei, am Brunnen blieben die Mädchen stehen, und hinter den Scheiben der Fenster zeigten sich neugierige Gesichter. Vor dem Wirtshaus standen eine Menge Bauernwagen, mit Kornsäcken beladen, denn am nächsten Tage war Markt, und zur linken Seite im Hause befand sich in üblicher Weise die Schenkstube, rechts dagegen ging es in die Gastzimmer für die vornehmere Gesellschaft.
Der Wirt half den beiden Reisenden beim Aussteigen. Es war ein gemütlicher dicker Wirt von der alten Art, ohne übermäßige Höflichkeit, aber mit einem zutraulichen und herzlichen Wesen. Er sah gleich, daß er es mit Leuten zu tun hatte, die ihn in Atem setzen würden.
»Zwei Zimmer!« sagte der schlanke Herr, welcher mit dem Postillon gesprochen hatte.
»Sehr wohl, mein Herr«, erwiderte der Wirt.
»Die besten«, fuhr der Reisende fort.
»Werden nicht ermangeln!« sagte der Wirt.
»Sie haben doch gute Betten?«
»Ganz neue Betten.«
»Lassen Sie uns sehen«, sagte der Reisende, indem er einen mißtrauischen Blick auf das Haus warf. In der Überzeugung aber, daß auf jeden Fall nichts übrigbleibe, als anzunehmen, was geboten werde, fügte er hinzu: »Lassen Sie die Koffer abschnallen und den Wagen räumen.«
»Es soll alles geschehen«, versicherte der Wirt.
»Halt! Noch einen Augenblick!« rief der Begleiter des Reisenden, der indessen ebenfalls aus dem Wagen gestiegen war. Der Wirt blieb stehen, der Fremde griff in den Wagen und brachte einen polierten Kasten mit Messinggriff zum Vorschein, an welchem er diesen trug. Der diensteifrige Kellner wollte ihm den Kasten abnehmen, allein der Reisende wies seinen Beistand zurück. »Ich kann ihn selbst tragen!« sagte er mit einer keineswegs angenehmen hohen Kehlstimme, und daß dies der Wahrheit gemäß sei, ließ sich allerdings nicht bezweifeln, denn der Fremde war groß und stark, ein gutes Stück größer als sein Gefährte. Sein Gesicht war bei weitem nicht so angenehm wie das seines Begleiters. Es war blaß und dick und hatte leblose, harte wasserblaue Augen.
Sie gingen nun alle in das Haus. Die Tür nach der Schenkstube stand offen, dicker Tabaksnebel und schallendes Gelächter drangen daraus hervor. Auf den langen Holztischen brannten ein paar Talglichter und beleuchteten Bierkrüge und schäumige Gläser, die Bänke und Schemel standen aber meist leer. Der allergrößte Teil der Gäste, in Kitteln oder Jacken, kurze Tabakpfeifen zwischen den Zähnen, hatte sich in der Mitte der Diele versammelt und bildete beinahe einen Kreis. In diesem stampfte ein Kerl auf einer Krücke umher und schrie allerlei Worte, von denen die Vorübergehenden nichts verstanden. Der dicke Reisende wandte sich unwillig davon ab, sein Begleiter aber fragte den Wirt, was das zu bedeuten habe.
»Es ist ein armer Kerl«, erwiderte dieser, »der Mäuse und Vögel abgerichtet hat, die er marschieren und exerzieren läßt.«
»Solche Vagabunden sollte man nicht dulden«, fiel der dicke Reisende ein.
Der Wirt zuckte die Achseln. »Es will doch ein jeder leben«, meinte er und setzte dann hinzu: »Einen Augenblick noch, meine Herren, gleich sollen Licht und Schlüssel bereit sein.« Mit diesen Worten lief er in die Gaststube.
»Da sind wir in eine schöne Höhle geraten«, bemerkte der dicke Reisende.
»Es bleibt nichts anderes übrig«, entgegnete sein Gefährte. »Dergleichen alte Häuser sind oft besser, als sie aussehen.«
»Das ganze Ding ist von Holz und Fachwerk«, fuhr der Dicke bedenklich fort, »wenn Feuer entsteht, sind wir verloren.«
»Um so vorsichtiger müssen wir sein«, antwortete der andere, indem er seine Augen schelmisch blitzen ließ.
Der Wirt kam mit Schlüsseln und Licht zurück und ersuchte seine Gäste, die Treppe hinaufzusteigen. Sie war breit und von altertümlicher Form.
»Die ist noch aus der alten Zeit«, sagte der Schmale.
»An hundert Jahre alt«, versicherte der Wirt. »Jetzt machte man drei Treppen davon.«
»Aber solch altes Haus kann plötzlich einstürzen.«
»Das steht fest wie Eisen«, beteuerte der Wirt. »Ich will Ihnen jedoch lieber Zimmer in dem neuen Anbau geben, den habe ich im vorigen Jahre massiv gebaut.«
»Das ist gut!« rief der Dicke.
»Dann bitte ich noch eine Treppe höher zu steigen.«
»Zwei Treppen hoch wohne ich niemals!« rief der dicke Reisende mit Entschiedenheit.
»Es sind hohe geräumige Zimmer«, versicherte der Wirt, »auch sind sie ganz neu tapeziert und ausgestattet.«
Der Fremde nahm darauf keine Rücksicht, er wiederholte, daß er niemals zwei Treppen hoch wohnen würde, der Wirt mußte somit die Zimmer im alten Hause aufschließen, allein er hatte auch hier noch Einsprüche in Empfang zu nehmen. Der Fremde wollte kein Zimmer nehmen, welches nach beiden Seiten Türen besaß, die in Nebenzimmer führten. Er verlangte eines mit festen Wänden oder doch höchstens mit einer Seitentür, und ein solches wurde zuletzt auch von ihm gewählt, obwohl es die wenigsten Bequemlichkeiten bot.
Die Koffer, Mäntel und alles Reisegerät aus dem Wagen wurden nun herbeigebracht, und der Dicke untersuchte vorsichtig, ob nichts fehle oder beschädigt sei, während sein Reisegefährte das große Nebenzimmer in Besitz nahm, das Bett einer kurzen Betrachtung würdigte, sich dann aber gleichgültig auf dem Sofa ausstreckte und eine Zigarre anzündete. In dieser Lage hörte er zu, wie sein Freund allerlei Fragen über die Sicherheit des Hauses und der Gegend an den Wirt richtete und wie dieser darauf in bestimmter Weise beteuerte, daß keinem seiner Gäste jemals etwas gestohlen, auch niemals Feuer ausgebrochen sei, von Gewalttaten aber überhaupt selten einmal etwas vernommen werde.
Als der Wirt hinaus war, nahm der dicke Fremde das Licht, leuchtete unter das Bett, dann in die beiden Schränke und in verschiedene Winkel, und als er diese Musterung beendet, trat er zufriedengestellt zu seinem Begleiter herein, der ihn durchaus nicht gestört hatte. »Ich finde, daß du recht hast«, sagte er, »wir sind hier besser aufgehoben, als ich dachte. Es sieht reinlich aus, die Betten sind gut und die Preise, nach denen ich mich erkundigt habe, mäßig.«
»Gestohlen wird auch nicht, gemordet noch weniger, und an Verbrennen ist kein Gedanke«, lachte sein Freund.
Der Dicke schien erschrocken. »Male den Teufel nicht an die Wand«, sagte er, »ich kann dergleichen nicht hören.«
»Dieser Wirt sieht wie die Ehrlichkeit selbst aus.«
»Man kann keinem Menschen ins Herz blicken«, versetzte der dicke Reisende, »und gerade diejenigen, die so aussehen, als könnten sie kein Wasser trüben, sind die allerschlimmsten.«
»Aber dann kann man niemand trauen!«
»Was das anbelangt, so traue ich auch niemandem, das heißt«, fügte der Dicke hinzu, »wo ich nicht bestimmt weiß, daß ich sicher bin, ganz sicher wie bei dir.«
»Um so größere Ehre für mich.«
»Du bist mein Freund, das weiß ich, und du bist ein gescheiter Kerl, das weiß ich auch. Ich bin froh, daß ich dich mitgenommen habe, und wenn alles gut geht, so –«
»So wirst du noch viel mehr mein Freund sein.«
»Darauf kannst du dich verlassen. Aber was fangen wir jetzt an?«
»Zunächst werden wir Erfahrungen sammeln, womit dieser ehrliche Wirt uns vor dem Verhungern retten kann.«
»Richtig – wir wollen essen!«
Nach einigen Unterhandlungen und nachdem der dicke Reisende noch einmal alle Schlösser untersucht, auch seine Kassette in den Schrank gesetzt und diesen doppelt verschlossen hatte, gingen sie beide in das Speisezimmer hinunter, wo der Wirt inzwischen längst angelangt war. Im vorderen Teil des großen Gastzimmers brannte eine Hängelampe mit breitem Schirm über einem runden Tisch, auf welchem verschiedene Tagesblätter und mehrere Zeitungen lagen; im Hintergrund stand eine gedeckte Tafel.
Es war im Augenblick niemand in dem großen Zimmer als ein Herr, der an dem Zeitungstische lesend saß, und der Wirt, der seinen Meerschaumkopf rauchte, auf und ab ging und dabei plauderte und lachte.
»Ich möchte bloß wissen, was er in dem Kasten hat«, sagte er. »Es muß viel Geld darin sein.«
»Ist er denn schwer?« fragte der Herr am Tische.
»Wie Karl ihn nehmen wollte, hat er sich ganz leicht angefühlt.«
»Es mögen wertvolle Papiere darin sein.«
»Es ist überhaupt ein sonderbarer Herr.« Der Wirt lachte. »Er sieht aus wie ein Riese, aber der Zwerg, den er bei sich hat, hat sicherlich zehnmal mehr Courage!«
»Einen Zwerg hat er bei sich?«
»Ein Zwerg ist es natürlich nicht, ich meinte nur so«, sagte der Wirt, »wenn ich sie beide vergleiche. Es ist ein hübscher schlanker Mann. Hände hat er so weiß wie ein Mädchen, aber bei alledem –«
Hier hielt er inne, denn eben traten die beiden Männer herein, über welche er sein Urteil gefällt hatte, und der dienstfertige Wirt eilte sogleich zur Stelle, um nach ihren Wünschen zu fragen. Er pries ihnen Entenbraten und Rebhühner an und lächelte wohlgefällig, als der Schlanke beides zu versuchen gelobte und in einem Atem hinterher Salat, Eier, Brot und Wein forderte. Der Riese dagegen begehrte zunächst nur eine Suppe, und der Wirt nickte beim Hinausgehen dem Herrn am Zeitungstische zu mit einer Miene, in welcher deutlich zu lesen war, was sie bedeuten sollte. Der Herr hatte den Kopf aufgehoben, die beiden Fremden angesehen und seine Augen wieder auf das Zeitungsblatt gesenkt. Dann sah er noch einmal hin, und es schien ihm wahr, was der Wirt sagte, er mußte es zugeben. Der jüngere, schlanke Reisende gefiel auch ihm ungleich besser als der schwerfällig Gebaute mit dem groben Gesicht, das nach ihm hinstarrte. Dieses Angaffen verdroß ihn, seine Stirn zog sich mit einer unangenehmen Empfindung zusammen. Er machte eine Bewegung auf seinem Stuhl nach der anderen Seite und blickte sich nicht mehr um.
Die beiden Fremden unterhielten sich inzwischen laut und ungezwungen. Der Schlanke hatte sich an den Tisch gesetzt, ein Stück Brot abgeschnitten und machte lustige Bemerkungen über seinen Hunger und seine Eßlust. Der Große ging auf und ab und mit knarrenden Stiefeln dicht bei dem Herrn am Tische vorbei, so daß auf dessen Zeitungsblatt mehrmals sein Schatten fiel, der ihn am Lesen hinderte. Der Herr sagte nichts dazu, aber man sah ihm an, wie wenig es ihm gefiel. Es war ein kräftig gebauter Mann mit mächtigem Kopf über breiten Schultern; feste, markige Züge, bewegliche Augen und ein stark gebräuntes Gesicht kündigten kein besonders sanftes Gemüt an. Das grauende Haar stand kurz abgeschnitten auf seiner hohen Stirne.
Als er zum drittenmal am Lesen behindert wurde, verlor er die Geduld. »Das ist nicht auszuhalten!« sagte er aufblickend.
Der Fremde blieb stehen. »Wie meinen Sie?« fragte er mit seiner Fistelstimme.
»Ich meine, Sie sind mir im Wege«, antwortete der Herr, und sein Blick war derartig streng, daß der Fremde davor erschrak.
Er machte Platz, sagte aber, indem er fortging: »Dies ist eine Gaststube, wie ich denke. Ich weiß nicht, ob es hier Vorrechte gibt?«
»Vorrechte gibt's nicht«, erwiderte der Herr am Tische, »doch wer mir im Wege steht, den schaffe ich fort –« Hiermit brach er ab und wandte den Kopf nach der Tür, die soeben geöffnet wurde.
Derselbe Mensch mit der Krücke, welcher die Bauern in der Schenkstube vergnüglich unterhalten hatte, stampfte herein. Er hielt seine Mütze demütig in der Hand, mit der anderen trug er einen Kasten.
Sobald der Zeitung lesende Herr am Tische ihn erblickte, streckte er seinen Arm befehlend aus und lieferte für seinen eben ausgesprochenen Grundsatz sofort den Beweis. »Hinaus!« rief er rauh und laut dem Krüppel zu. »Packe dich auf der Stelle!«
Der Bursche schien überrascht, doch nicht so eingeschüchtert, um ohne Widerrede sich zu fügen. Es ging ihm beinahe wie dem Fremden, der von dem heftigen Herrn angefahren wurde. Seinem langen hageren Gesicht fehlte es nicht an einem Ausdruck von Verstand und Schlauheit, und in seinen Augen blitzte etwas, das noch schlimmer aussah. Indem er an seinen Rückzug dachte, weil er sich nicht offen zu widersetzen wagte, lag in seinen Mienen doch jedenfalls die Lust dazu, und seine trotzigen Blicke richteten sich jetzt hilfefordernd auf die beiden Fremden.
»Hätte ich das gewußt«, sprach er dabei wie zu sich selbst, »so wäre ich sicherlich nicht hereingekommen, aber ich dachte, es könnte hier wohl jemand sein, der einem verkrüppelten Menschen sein Stückchen Brot gönnte.«
Diese Aufforderung war nicht vergebens. Die beiden Reisenden hatten ganz natürlich diesem Auftritt ihr volles Interesse zugewandt, und sicher um sich an dem unhöflichen Herrn zu rächen, erhob der Große seine dünne Stimme und fragte den Krüppel: »Was habt Ihr in dem Kasten, Freund?«
»Zahme, abgerichtete Vögel, lieber Herr«, antwortete der Lahme erfreut. »Meisen und Hänflinge, lieber Herr, die sich ihr Futter heraufziehen. Dabei habe ich auch weiße Mäuse, die auf den Hinterbeinen stehen können und mit einem Stöckchen exerzieren.«
»Also ein Künstler!« lachte der Schlanke von der Tafel her. »Die Kunst muß in Ehren gehalten werden, wenn sie auch nach Brot geht!«
»Komm her und zeige uns, was du hast«, winkte der Dicke, »wir wollen deine Künstler beschauen!«
Der Lahme setzte seine Krücke in Bewegung, allein sowie er sich anschickte, dem Rufe Folge zu leisten, war der Herr vom Zeitungstische auch bei der Hand. »Wenn du nicht sofort dich von hinnen packst«, sagte er mit gewaltsamer Ruhe, »so soll's dich reuen!«
»Ich tue nichts Unrechtes«, erwiderte der Lahme. »Die Herren rufen mich. Es ist mein ehrliches Gewerbe.«
»Spitzbube!« murmelte der Herr verständlich genug.
»Wer mich zum Krüppel gemacht hat, der hat's zu verantworten, was ich bin!« rief der Lahme.
Der gewaltige Kopf seines Widersachers wurde noch röter und schien im Zorn anzuschwellen. »Wirst du gehen?« fragte er, indem er die Zeitung fortwarf.
Der Lahme schwankte in seinen Entschlüssen und blieb stehen. Er war schlau genug, um abzuwarten, was diejenigen tun würden, welche die Sache ebenfalls anging, und darin täuschte er sich nicht.
»Aber ich sehe doch wirklich nicht ein«, wandte sich der Grobschlächtige an seinen Freund, »mit welchem Recht uns hier befohlen wird, Vögel und Mäuse nicht ansehen zu dürfen?«
»Vielleicht ist es eine zärtliche Fürsorge des verehrten Herrn für unsere Gesundheit, weil wir sie in unserem Hunger verschlingen könnten!« lachte der Schlanke.
»Lassen Sie sich von dem Kerl zeigen, was Sie Lust haben«, sprach der Herr am Zeitungstische, »aber nicht hier. Hier soll er nicht sein!«
»Das ist ja sonderbar!« schrie der mit der dünnen Stimme.
»Es ist wahrscheinlich ein Verbot der allergnädigsten hohen Obrigkeit!« spottete sein Begleiter.
»Das mag sein«, versetzte der Herr, indem er aufstand und seine hohe stattliche Gestalt aufrichtete. »Die Obrigkeit duldet keine solchen Subjekte, und hierher gehören sie nicht.« Indem er dabei dem Lahmen näher trat, warf er ein Geldstück in dessen Mütze.
Diese Großmut hatte jedoch nicht den Erfolg, welcher davon zu erwarten war. Mit einem raschen Griff packte der Krüppel das Geld und warf es mit einem höhnischen »Verflucht!« von sich, daß es weit durch das Zimmer rollte.
»Bestie!« schrie der Herr, voller Zorn nach dem schweren Stock fassend, der an seinem Stuhl lehnte. Doch ehe er die gewalttätige Handlung, welche er beabsichtigte, ausführen konnte, trat ein Mann herein, der sie verhinderte. Er schien sofort zu begreifen, was hier vorging, und indem er zwischen den Lahmen und den Angreifer trat, schützte er jenen und hinderte zugleich diesen. Sein Erscheinen und seine Einmischung hatte jedoch die Folge, daß der Herr selbst den Stock sinken ließ und sich ruhig verhielt.
»Was hast du wieder getan?« fragte den Lahmen sein Beschützer.
»Ich habe nichts getan.«
»Aber du hast vergessen, was du mir versprochen hattest.«
»Ich will mich nicht wie ein Hund treten lassen!« schrie der Vogelfänger mit einem wilden erbitterten Blick auf den Herrn am Tische.
»Geh«, erwiderte der andere in mildem Ton, »sei verständig und denke –« er setzte ein paar geflüsterte Worte hinzu, nach welchen der Lahme sich umwandte, seinen Kasten ergriff und das Zimmer verließ.
Der Friedensstifter sah die beiden Fremden an und machte ein paar Schritte nach deren Tische zu. Er trug einen dunklen Oberrock, in dem er lang und schmal aussah, und den Hut auf dem Kopf, unter welchem ein Gesicht mit scharf geprägten Zügen hervorschaute. Die Nase herrschte darin vor. Die Ruhe in seinen Augen und Mienen und der biegsame Klang seiner Stimme bildeten einen vollständigen Gegensatz zu der rauhen Heftigkeit, welche der Herr am Zeitungstische zur Schau getragen hatte.
»Es ist spät geworden«, wandte er sich nun an diesen, »ich wurde verschiedentlich aufgehalten.«
»Wir können gehen«, antwortete der Herr. Sein Hut hing am Riegel, er mußte dicht an der Tafel vorbei, an welcher die beiden Fremden saßen. Als er sich ihnen gegenüber befand, wandte er seinen erhitzten Kopf ihnen zu und nach einem augenblicklichen Bedenken blieb er stehen und sagte höflich: »Ich bitte um Entschuldigung, meine Herren, wenn ich Sie belästigt habe.«
Als er keine Antwort darauf erhielt, fügte er hinzu: »Ich habe einige Gründe, diesen Kerl nicht in meiner Nähe zu dulden.«
»Und Sie verstehen das«, erwiderte der Dicke. »Aber man muß nicht allzu unduldsam sein.«
»Jeder nach seiner Weise«, antwortete der Herr, dem, was er hörte, nicht zu gefallen schien. »Im übrigen kann mich jeder finden, der mich sucht. Ich heiße Brand. Leben Sie wohl!«
Seine herausfordernden Worte paßten zu der stolzen Haltung, in welcher er sich entfernte.
»Und ich heiße Wilkens!« schrie der Fremde mit der dünnen Stimme hinter ihm her.
Der Herr war schon an der Tür, aber er hielt inne und schien von dem Namen betroffen zu sein. Er sah den Fremden scharf und starr an. Einen Augenblick lang war es, als wolle er umkehren, aber er tat es nicht, wandte sich ab und ging hinaus.
»Was zum Henker!« rief Herr Wilkens, als er mit seinem Freunde allein war, »das war er also!«
»Ich habe es mir gedacht«, nickte der andere, indem er sich ein neues Stück Brot absäbelte.
»Das ist ein wirklicher Höllenbrand, wie mein Vater ihn nannte«, sagte Herr Wilkens.
»Wir wollen schon mit ihm fertig werden«, versetzte sein Freund, behaglich weiter schneidend. »Wenn unser Rebhuhn mit unserem liebenswürdigen Wirt nur erst kommen wollte!«
»Ich habe einen Widerwillen gegen ihn gefaßt, sowie ich ihn sah«, murmelte Wilkens, »und obenein«, er nahm das Licht vom Tische und leuchtete durch die Stube bis in eine Ecke, wo er sich bückte und das Geldstück aufnahm, das der Lahme fortgeworfen hatte, »obenein ist er ein Verschwender. Ein Achtgroschenstück hat er dem Vagabunden gegeben. Wahrhaftig, es ist ein Achtgroschenstück!«
»Wir wollen ihm manches andere dafür abnehmen, teurer Freund. Aber wenn wir nicht bald unsere bescheidene Nahrung erhalten, werden wir vorher verhungern.«
»Umstände werde ich nicht mit ihm machen, Rachau«, sagte Wilkens, indem er das Geldstück in seine Westentasche steckte.
»Es ist mir so vorgekommen, als ob er auch kein Freund von Umständen wäre.«
»Aber ist es nicht sonderbar, wie er uns unerwartet in den Weg laufen muß?«
»Es ist höhere Fügung, mein lieber Freund Wilkens. Der Himmel ist sichtbar mit uns. Er segnet deine gerechte Sache. Ich bin vollkommen überzeugt, daß dieser göttliche Segen dich begleiten wird.«
Das blasse schlaffe Gesicht des Herrn Wilkens hob sich höhnisch auf: »Hast du gesehen, wie er mich anglotzte, als er meinen Namen hörte? Es ist mir jetzt leid, daß ich ihn nicht verschwiegen habe, morgen wäre seine Überraschung um so größer gewesen.« Er stützte den Arm auf den Tisch und fing an zu lachen.
»Morgen ist er – oder wir machen ihn – höflich«, sagte Rachau.
»Und was war das für ein Mensch, der hereinkam und ihn fortführte?«
»Das war der Lehrer, der Schulmeister, von dem der Postillon sprach«, antwortete Rachau. »Jeder Zoll ein Schulmeister! Vor dem haben wir uns in acht zu nehmen!«
»Wieso?«
»Ich habe so eine Ahnung, als ob dieser Bursche Gras wachsen hört und Kamele verschluckt und als ob er – Holla! da kommt unser verehrter Wirt und bringt uns, was wir nötig haben!«
Der Wirt trat mit Wein und Speisen herein und beendete damit das Gespräch des ungleichen Freundespaares.
Am Morgen darauf ging Herr von Brand in seinem Zimmer auf und ab. Die Pfeife wollte ihm nicht schmecken, sie war ihm mehrmals schon ausgegangen, und die große Kaffeetasse stand noch halb gefüllt auf dem Tisch, was sonst selten der Fall war. Es bewegten ihn Gedanken, die er nicht loswerden konnte, und angenehme schienen es nicht zu sein, das war aus seiner düstren Miene zu schließen. Von Zeit zu Zeit blieb er am Fenster stehen und blickte nach der Stadt hinaus auf die Landstraße. Er konnte nicht weit blicken, denn das Haus lag hinter einem Vorhof, den eine Mauer umgab. Es schien jedoch, als ob er jemand erwartete und als ob seine Unruhe sich vermehrte, je länger er nichts entdecken konnte.
Die Zimmertür öffnete sich, und ein großes schlankes Mädchen trat ein, das ihm freundlich einen Guten Morgen bot.
»Guten Morgen, Luise«, erwiderte der Vater. »Wo ist der Doktor?«
»Er sitzt mit Toni am Klavier. Soll ich ihn rufen?«
»Laß ihn sitzen«, sagte Herr von Brand.
»Er gibt sich viel Mühe mit ihr«, fuhr die Tochter fort, »und sie macht recht gute Fortschritte.«
»Er gibt sich überhaupt viele Mühe«, antwortete er übelgelaunt. »Wie lange ist er jetzt hier?«
»Es wird fast ein Jahr sein. Aber du hast deinen Kaffee noch nicht ausgetrunken, lieber Vater!«
»Er schmeckt mir nicht, er taugt nichts.«
»Aber ich habe ihn selbst zubereitet«, erwiderte sie lächelnd.
Herr von Brand ging auf diesen Gegenstand nicht weiter ein. Er ging weiter unruhig auf und ab. »Wann denkt der Doktor uns zu verlassen?« fragte er plötzlich unvermittelt.
»Will er uns denn verlassen?« entgegnete Luise überrascht.
»Ich weiß es nicht«, rief er in gereiztem Ton, »warum bleibt er überhaupt bei uns?« Er blieb vor seiner Tochter stehen und sah sie an. »Er ist deines Bruders Freund«, fuhr er fort, »er hat ihn zu uns gebracht, damit er sich nach seiner Krankheit auskuriere. Jetzt fehlt ihm nichts mehr. Ein Mann von seinen Kenntnissen gehört an eine Schule, an eine Universität. Ein Mädchen von zwölf Jahren zu unterrichten und mit einem von zwanzig Jahren Musik zu machen, Bücher zu lesen und spazierenzugehen, dazu ist er nicht bestimmt.«
»Würdest du ihn nicht auch sehr vermissen, wenn er uns verläßt?« fragte Luise, deren Gesicht sich allmählich immer deutlicher gerötet hatte.
»Allerdings, wir würden ihn alle vermissen«, sagte Herr von Brand, »aber es muß sein. Was hast du schon bei ihm gelernt?«
»Französisch und Englisch«, antwortete Luise, der jetzt die helle Röte ins Gesicht gestiegen war.
»Und andere Torheiten«, rief der Vater rauh und laut.
»Lieber Vater«, sagte Luise freundlich, aber nicht ohne Nachdruck, »Doktor Gottberg ist, soweit ich ihn kenne, ein sehr achtenswerter Mann, der keinen Torheiten anhängt. Wir haben ihn stets verständig und gut gefunden, und du selbst hast mir erst gestern gesagt, wie du dich freust, ihn im Haus zu haben. Wie kommt es denn nun –«