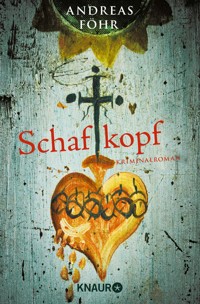9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Wallner & Kreuthner Krimi
- Sprache: Deutsch
Der vierte Fall des sympathisch-schrulligen Ermittler-Duos Wallner & Kreuthner aus Oberbayern vom Kultautor mit Bestseller-Garantie Andreas Föhr: Onkel Simmerl ist tot. Seine Asche verstreut Polizeiobermeister Kreuthner auf dem Wallberg - einer jungen Skifahrerin mitten ins Gesicht. Als Wiedergutmachung fährt Kreuthner mit ihr die berüchtigte schwarze Piste ab, die er angeblich bestens kennt. Nur wenig später stapfen sie in der Dunkelheit durch den Schnee und stolpern fast über die gefrorene Leiche einer Frau. Denn was zunächst wie ein Schneemann aussieht, entpuppt sich als eine gefrorene Leiche ... Turbulent, unterhaltsam, spannend: Ein neuer Fall für die beiden Kult-Kommissare Wallner und Polizeiobermeister Leonhardt Kreuthner. Auch für Nicht-Bayern absolut lesenswert! "Krimiautor Andreas Föhr hat mit Kreuthner einen der vitalsten Ermittler erfunden, die es gerade in der Spannungsliteratur gibt. Sein Partner und Gegenspieler ist der feinsinnige Kommissar Wallner, der wiederum mit seinem äußerst lebendigen Großvater zusammen lebt. Schon diese Konstellation sorgt in jedem der bisher vier Romane für hinreißend komische Situationen. [...] Man muss die anderen Bücher nicht kennen, um "Schwarze Piste" genießen zu können. Föhrs direkte Art, Menschen und Orte zu beschreiben, ziehen einen sofort hinein." WDR 4 »(…) das macht den Charme des Krimis aus, dass die Charaktere gut geerdet und meist mit trockenem Humor ausgestattet sind. Föhr verschafft seinen Protagonisten mit wenigen Merkmalen eigene Persönlichkeiten.« Süddeutsche Zeitung Unterhaltsame und spannende Regionalkrimikost, die humorvoll ist, ohne in peinliche Klischees abzudriften – empfehlenswert! Büchertreff.de Seine Dialoge sitzen, die Szenen sind geschickt gebaut, er hat ein untrügliches Gefühl für Cliffhanger, sein Sinn für Humor und allzu Menschliches ist nicht von der Hand zu weisen. Heilbronner Stimme Online Auch der dritte Krimi von Andreas Föhr besticht durch die Kombination aus Spannung und Humor. Pures Lesevergnügen! Super TV Feinster Lokalkolorit, herrlicher Humor und zwei Kultkommissare, die auf der ganzen Linie überzeugen. Auch für Nichtbayern absolut lesenswert! Bremen Magazin Alle Bände der Wallner & Kreuthner-Krimis aus Oberbayern von Andreas Föhr – als Taschenbuch oder eBook: Band 1: Prinzessinnenmörder Band 2: Schafkopf Band 3: Karwoche Band 4: Schwarze Piste Band 5: Totensonntag Band 6: Wolfsschlucht Band 7: Schwarzwasser Band 8: Tote Hand
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 448
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Andreas Föhr
Schwarze Piste
Kriminalroman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Onkel Simon ist tot. Seine Asche verstreut Polizeiobermeister Kreuthner auf dem Wallberg – einer jungen Skifahrerin mitten ins Gesicht. Als Wiedergutmachung fährt Kreuthner mit ihr die berüchtigte schwarze Piste ab, die er angeblich bestens kennt. Nur wenig später stapfen sie in der Dunkelheit durch den Schnee und stolpern fast über die Leiche einer Frau …
Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de
Inhaltsübersicht
Widmung
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
68. Kapitel
69. Kapitel
70. Kapitel
71. Kapitel
72. Kapitel
73. Kapitel
Danksagung
Für die Menschen und Tiere des Gnadenhofs Chiemgau
1
Der Himmel am Morgen des vierundzwanzigsten September 2008 war grau, die Luft kalt und feucht. Der Monat hatte ungewöhnlich warm begonnen. Doch in der zweiten Hälfte waren die Temperaturen gefallen. Um sieben Uhr dreißig zeigten die Thermometer sechs Grad über null in Miesbach. Baptist Krugger verabschiedete sich von seiner Mutter, die ihm wie jeden Morgen in Stanniol eingeschlagene Wurstbrote mitgab, und bestieg einen alten VW Golf, um nach München in die Universität zu fahren. Jedenfalls nahmen seine Eltern das an. Baptist Krugger fuhr aber nicht nach München. Wie an fast jedem Morgen fuhr er zu einem neun Kilometer entfernten, einsam gelegenen Haus, um dort den Tag zu verbringen. Das wussten seine Eltern nicht, und auch sonst wusste so gut wie niemand von dem Haus. Der Golf nahm die Straße Richtung Norden, und alles war wie immer – nur dass heute ein dunkelblauer BMW Baptist Krugger in einigem Abstand folgte.
Sophie Kramm hatte unruhig geschlafen und war kurz nach fünf aufgewacht. Ihr war schlecht, und sie musste sich zwei Mal übergeben. Auch zitterten ihr die Knie. Sie zog sich an und ging zum Stall hinüber, um die kalte Luft zu atmen und sich zu beruhigen. Die Pferde und Esel waren nervös an diesem Morgen und scharrten und schnaubten in ihren Boxen. Zurück im Wohnhaus, kochte sie eine Kanne Kaffee, trank aber nur wenig, denn sie fürchtete, dass der Kaffee ihrem Magen den Rest geben würde.
Um sechs war sie zu der kleinen Straße gefahren, die durch den Wald führte, und hatte Jörg und Annette geholfen, die mobile Verkehrsampel aufzubauen. Die feuchte Kälte durchdrang ihre Kleidung, aber sie schwitzte vor Anstrengung. Als die Ampel installiert war, leuchtete sie zwar, aber nur grün. Jörg hatte geflucht und gegen die Ampel getreten, wie es Männer oft taten, wenn technische Apparate nicht funktionierten. Annette hatte vorgeschlagen, die Ampel aus- und wieder einzuschalten. Nach dem Neustart leuchtete sie – allerdings nur rot. Aber das war in Ordnung.
Ab sieben Uhr wartete Sophie Kramm in einem dunkelblauen BMW mit falschem Kennzeichen achtzig Meter vom Haus der Familie Krugger entfernt und beobachtete die Ausfahrt. Um sieben Uhr achtundzwanzig gab sie Kruggers Abfahrt per Handy durch, folgte dem Wagen in großem Abstand und verlor bald den Sichtkontakt. Doch war das ohne Belang. Sie wusste, welchen Weg Krugger nehmen würde.
Baptist Krugger war ein unscheinbarer junger Mann von vierundzwanzig Jahren, übergewichtig, aschblond, fahle Gesichtshaut, braune Augen, fliehende Stirn, wulstige Lippen und auch sonst Gesichtszüge, die nahelegten, dass eine seiner Urahninnen von Neanderthalern entführt worden war. Seine Eltern betrieben eine kleine Kerzenfabrik, die von Aufträgen der Diözese lebte, trotz dieser potenten Kundschaft aber in wirtschaftliche Schieflage geraten war; die Banken hatten gerade entdeckt, dass sie auf einem Haufen wertloser Papiere saßen, und verliehen kein Geld mehr. Baptist studierte Betriebswirtschaftslehre und war dazu ausersehen, eines Tages die Leitung der Kerzenfabrik zu übernehmen. Neben der Liebe zu Kerzen wurde im Haus Krugger auch die Liebe zu Gott praktiziert, was im Kerzengewerbe gewissermaßen Hand in Hand ging. Baptist gedachte übrigens nicht, den elterlichen Betrieb zu übernehmen. Er besaß, was ihm niemand ansah, ein Vermögen von elf Millionen Euro. Niemand ahnte etwas davon, und niemand ahnte etwas von dem Haus, das er vor einem halben Jahr einem Freund abgekauft hatte. Baptist hütete noch andere Geheimnisse und war sicher, dass niemand außer ihm selbst von ihnen wusste.
Wenige Minuten, nachdem er Miesbach in Richtung Weyarn verlassen hatte, bog Baptist Krugger linker Hand in eine kleine Seitenstraße ab. Kurz darauf bog auch der dunkelblaue BMW in die Straße ein.
Wenig später folgte ein Streifenwagen. Darin Polizeiobermeister Leonhardt Kreuthner mit dunklen Ringen um die Augen und zerschrammtem Gesicht.
2
Kreuthner hatte eine bewegte Schafkopfnacht im Gasthaus Zur Mangfallmühle hinter sich. Seine Mitspieler waren der alte und der junge Lintinger gewesen, von Beruf Schrottplatzbesitzer und Kleinkriminelle, sowie Stanislaus Kummeder, ein für seine Gewalttätigkeit berüchtigter Provinzganove. Gegen eins war Kreuthner vierhundert Euro im Plus gewesen. Dann hielten sich Gewinn und Verlust lange Zeit die Waage. Erst ab fünf kam wieder Bewegung in die Schafkopfrunde. Und das lag an einer Regel, die besagte, dass jeder Spieler fünf Euro in einen Topf, die sogenannte »Henn«, einzahlen musste, wenn kein Spiel zustande kam. Beim nächsten Spiel konnte die Partei, die das Spiel angemeldet und gewonnen hatte, den Inhalt der Henn an sich nehmen. Sollte sie das Spiel aber verlieren, musste die Henn verdoppelt werden. Da konnte, wie man seit der Geschichte mit dem Schachbrett und den Reiskörnern weiß, einiges zusammenkommen. Gegen halb sechs lagen über dreihundert Euro im Topf, und Kreuthners Barbestände waren auf zehn Euro zusammengeschrumpft. In dieser Situation bekam er ein Blatt mit sechs Trümpfen auf die Hand. Das Spiel war aber unerwartet verzwickt, und Kreuthners Partner Harry Lintinger gehörte nicht gerade zu den Kandidaten für den Mensa-Club. Um es kurz zu machen: Die Partie rauschte furios gegen die Wand. Harry warf seinen Anteil von einhundertfünfzig Euro mürrisch auf den Tisch. Kreuthner legte seinen Zehneuroschein dazu.
»Und?«, fragte Kummeder.
»Ja, da fehlen hundertvierzig. Seh ich selber. Ich zahl’s später.«
»Er zahlt später!« Ironie paarte sich in Kummeders Ton mit Missfallen. Er sah auffordernd zum alten Lintinger, damit der auch was sagte.
»Da schau her«, sagte Johann Lintinger dienstfertig. »Des san fei ganz neue Sitten. Normal wird gleich zahlt.«
»Ich hab aber nix mehr«, maulte Kreuthner.
»Was tust dann hier am Kartentisch?« Kummeder nahm noch einen Schluck Bier, was bei ihm bedeutete, dass er das Bierglas zu zwei Dritteln leerte.
»Ihr habt’s doch gesehen, dass ich nur noch an Zehner daliegen hab.«
»Was weiß ich, was du noch im Geldbeutel hast. Is mir auch wurscht. Du tust jetzt die Henn aufdoppeln, und zwar a bissl hastig.«
Kummeders Kiefer mahlten. Das war ein schlechtes Zeichen. Wenn Kummeder mahlte, war es meist nicht mehr weit, bis er zuschlug. Und dann war man besser nicht in der Nähe. Kummeder maß, wie sein momentan in der JVA Bernau einsitzender Freund Peter Zimbeck, über einen Meter neunzig und wog einhundertzwanzig Kilo, und das war in der Hauptsache Muskelmasse. Beim letzten Enterrottacher Waldfest hatte er mit einem Biertisch um sich geschlagen wie mit einer Fliegenpatsche und sechs junge Burschen mit einem einzigen wuchtigen Hieb ins Krankenhaus befördert, um anschließend mit dem Hau-den-Lukas-Hammer grölend über das Festgelände zu ziehen und Angst und Schrecken zu verbreiten. In der ausbrechenden Panik stürzte die mit Holzkohle betriebene Hendlbraterei auf den Tanzboden, der vollständig abbrannte. Drei Waldfestbesucher zogen sich Verbrennungen zu, als sie versuchten, einige der Grillhendl aus dem Feuer zu retten. Später konnte nicht mehr ermittelt werden, wer die Schlägerei angezettelt hatte. Beziehungsweise wussten diejenigen, die es mitbekommen hatten, Besseres zu tun, als Stanislaus Kummeders Zorn auf sich zu ziehen.
»Was soll ich jetzt machen?«, fragte Kreuthner.
»Ja, was mach ma denn jetzt«, wandte sich Kummeder wieder an seinen Mitspieler Johann Lintinger.
»Was sollst da sagen. Des hat’s ja noch nia net geben, dass einer net zahlt. Und ich bin schon lang in dem G’schäft.«
»Du sollst keine Volksreden halten, du sollst an Vorschlag machen.«
»Ja wenn er kein Geld hat, dann muss er halt mit was anderm zahlen. Wie schaut’s aus? Deine Uhr zum Beispiel.«
Kreuthner streifte seine Rolex ab und legte sie auf den Haufen Geldscheine. Von dort nahm Kummeder sie, ohne sich das Stück überhaupt anzusehen, und warf sie vor Kreuthner auf den Tisch zurück. »Spinnst jetzt, oder was? Die hab ich dir verkauft. Dreiß’g Otten. Wert is keine fünf. Was hast noch?«
Kreuthner zuckte die Schultern. »Nix. Nur was ich anhab.«
»Guter Vorschlag.«
»Guter … was?«
»Deine Klamotten.«
»Die Uniform?«
»Da krieg ich zweihundert für.«
»Für a gebrauchte Uniform? Des zahlt dir keiner«, wandte der alte Lintinger ein.
»Doch. Er da.« Kummeder deutete auf Kreuthner. »Wenn er sie wiederhaben will.«
»Jetzt spinn dich aus. Ich kann dir doch net die Uniform geben.«
Kummeder sagte nichts mehr. Aber in seinem von Alkohol getrübten Blick war zu lesen, dass er nicht vorhatte weiterzudiskutieren. Kreuthner war, mit anderen Worten, kurz davor, eine zu kassieren.
»Wie jetzt … alles? Hemd, Jacke, Hose …?« Kreuthner deutete an sich hinab.
»Die g’stinkerten Stiefel kannst behalten. Der Rest kommt zu mir umme.«
»Jetzt?«
»Jetzt.«
Kreuthner wartete einen Augenblick. Vielleicht hatte Kummeder sich einen Scherz erlaubt und würde gleich loslachen und ihm auf die Schulter hauen (auch keine schöne Aussicht). Aber Kummeder hatte keinen Scherz gemacht. Kreuthner zog also Uniformjacke, Hemd und Hose samt Gürtel aus und musste auch seine Dienstmütze abliefern. Die Schuhe zog er wieder an und spielte im Unterhemd weiter.
Beim nächsten Spiel sah Kreuthner die Gelegenheit gekommen, den Topf und damit seine Uniform wiederzubekommen.
»Tät spielen«, sagte er.
»Überleg dir des gut«, sagte der alte Lintinger. »Net, dass du noch einen mit ins Elend reißt.«
Aber Kreuthner war nicht von seinem Vorhaben abzubringen und spielte erneut mit der Gras-Sau. Die hatte diesmal der alte Lintinger. Und weil er Kreuthners riskantes Spiel kannte und keine Lust hatte, zusammen mit Kreuthner die Henn aufzudoppeln – inzwischen dreihundert Euro für jeden –, hatte er Kreuthner noch einmal dringlich ermahnt, keinen Scheiß zu machen. Es half nichts. Wie befürchtet, ging es auch mit diesem Spiel steil bergab. Bis Kreuthner beim letzten Stich überraschend dreißig Punkte mit dem Herz-Zehner einkassierte und die Partie gewann. Dem alten Lintinger leuchteten die Augen, als er sich anschickte, den Berg Geldscheine zusammenzuraffen. Doch Kummeder ließ seine mächtige Pranke auf Lintingers ebenfalls nicht zarten Hände niederfahren und gebot dem Gegrabsche Einhalt. Dann deckte Kummeder die Stiche vor sich auf und suchte einen davon heraus, den er Richtung Tischmitte schob. »Wer hat denn da auf den Schellen-Ober den Gras-Siebener rein, ha?«
Kreuthner sah suchend in die Runde. »Keine Ahnung. Weiß des noch wer?«
»Ja. Ich«, dröhnte Kummeder. »Des warst du.«
»Ich?« Kreuthner klang ungewohnt kleinlaut.
»Hätt ma da net den Herz-Zehner zugeben sollen?«
Ja, hätte man. Kreuthner hatte beschissen und sich erwischen lassen. Blieb nur die Frage, was ihn als Strafe erwartete. Kummeder machte einen äußerst verstimmten Eindruck auf Kreuthner. Das konnte bitter werden.
3
Kreuthner hing im Beifahrersitz, den Kopf an die Seitenscheibe gelehnt, dünstete Alkohol aus und blickte mit müden Augen auf die Straße. Selbst in diesem Zustand arbeitete sein Verstand erstaunlich präzise. »Da vorn – der hat nur ein Rücklicht.« Etwa einen halben Kilometer voraus bewegte sich ein dunkelblaues Fahrzeug die Bundesstraße entlang. Man brauchte gute Augen, um zu erkennen, was Kreuthner gesehen hatte.
»Der is aber ziemlich weit weg.«, sagte Kreuthners Kollege Schartauer.
»Und deswegen darf er ohne Rücklicht fahren? Gib Gas!«
Die Temperaturanzeige sank um drei Grad, als Baptist Krugger in das Waldstück fuhr, am Boden mochte es noch kälter sein. Um vereiste Stellen rechtzeitig zu sehen, heftete Krugger seinen Blick auf den Asphalt. Deswegen entging ihm, dass am Eingang des Waldes jemand stand, der ein Handy am Ohr hatte und trotz der schlechten Lichtverhältnisse eine Sonnenbrille trug. Hinter der Abzweigung eines Forstweges sah Krugger mit einem Mal ein rotes Licht zwischen den Baumstämmen, und unmittelbar darauf, nach einer sanften Kurve, tauchte eine Ampel vor ihm auf. Vor der Ampel wies ein Schild darauf hin, dass Straßenbauarbeiten im Gang waren. Was hier gebaut wurde, war nicht ersichtlich. Weder gab es eine aufgerissene Straße noch Erdaufschüttungen noch Baugerät am Straßenrand. Die Baustelle würde wohl heute erst eingerichtet werden, dachte sich Krugger und hielt an. Einige Sekunden vergingen, dann näherte sich ein weiterer Wagen von hinten. Es war ein blauer BMW.
Krugger wartete eine Weile, aber nichts geschah. Vor allem schaltete die Ampel nicht auf Grün um. Plötzlich tauchte wie aus dem Nichts ein Arbeiter aus dem Wald auf. Er hatte eine orangefarbene Warnweste an und trug eine tief ins Gesicht gezogene Wollmütze sowie einen Schal, der die untere Hälfte des Gesichts verdeckte. Krugger kam die Aufmachung für einen Septembertag etwas übertrieben vor. Der Arbeiter ging zur Ampel, winkte Krugger zu und machte Anstalten, zum Wagen zu kommen. In diesem Moment blieb er am Fuß der Ampel hängen und stolperte, wobei sein Schal nach unten rutschte. Mit unangebrachter Hektik, so schien es Krugger, drehte sich der Mann vom Wagen weg und schob den Schal wieder ins Gesicht. Krugger hatte mit einem Mal das Gefühl, dass irgendetwas nicht stimmte. Eine Unruhe erfasste ihn. Er suchte den Wald ab, ob sich zwischen den Bäumen noch andere Menschen befanden, die bedrohlich werden konnten. Doch im Wald war alles ruhig. Nur der Mann mit der orangefarbenen Weste bewegte sich auf Krugger zu, sorgsam darauf bedacht, dass sein Schal nicht noch einmal verrutschte. Er trat neben die Fahrertür und klopfte an die Scheibe.
»Was kann ich für Sie tun?«, fragte Krugger den vermummten Arbeiter, nachdem er die Scheibe halb heruntergekurbelt hatte.
»Grüß Gott. Es ist mir sehr unangenehm, aber mein Kollege ist heute Morgen nicht gekommen und ich habe mein Handy zu Hause vergessen. Könnten Sie mir Ihr Handy kurz leihen?« Der Mann klang nicht wie ein Arbeiter. Eine leichte Färbung der Aussprache zeigte an, dass er aus Bayern kam, gleichzeitig aber auch, dass er seinen Lebensunterhalt wohl kaum mit dem Reparieren von Straßen verdiente. Es war jene Sprachfärbung, die man in den gebildeteren Kreisen des Münchner Bürgertums hörte. Das beruhigte Krugger etwas. Andererseits fragte er sich, wer die Ampel aufgebaut hatte, wenn der Mann allein war. Gestern Abend war sie noch nicht da gewesen. Aber Krugger fragte nicht, sondern gab dem Mann sein Handy. Der bedankte sich und steckte das Handy in seine Jackentasche.
»Entschuldigung«, sagte Krugger. »Sie wollten doch telefonieren?«
»Ja, natürlich«, sagte der Mann. Sein Atem ging schnell, die Stimme zitterte wie bei jemandem, der unter großem Stress stand. »Später vielleicht.«
»Könnte ich dann vielleicht mein Handy wiederhaben?«
»Nein, das geht nicht. Ich muss Sie bitten auszusteigen.«
»Warum?«
»Sie sollten jetzt keine Fragen stellen. Es ist besser für Sie, wenn Sie aussteigen.«
Krugger bemerkte, dass die Fahrerin des blauen BMWs hinter ihm ihren Wagen verlassen hatte und auf ihn zukam. Sie trug eine Sonnenbrille, die nahezu ihr halbes Gesicht verdeckte, und einen breitkrempigen Hut.
»Was soll das?«, fragte Krugger.
Der Mann mit der Signalweste hatte mit einem Mal eine Pistole in der Hand und richtete sie auf Krugger. »Steigen Sie aus, verdammt!«, schrie er unvermittelt. Krugger drückte den Verriegelungsknopf, tastete hektisch nach der Kurbel für die Seitenscheiben und ließ sie hochfahren, aber der Lauf der Pistole steckte schon im Fenster und stoppte die Scheibe.
»Lass den Scheiß, du Idiot! Steig endlich aus!«
Krugger öffnete mit zitternden Händen die Tür. Sein Herz raste, in seinem Schädel breitete sich Adrenalin aus, das ein Gefühl verursachte, als habe man ihm eine Dornenkrone aufgesetzt. Nur mit Mühe gelang es Krugger, sein Wasser zu halten. Er hatte keine Ahnung, was der Mann von ihm wollte. Vielleicht war er nur in einen Raubüberfall geraten. Er würde dem Kerl sein Bargeld geben und vielleicht die EC-Karte und könnte weiterfahren. Aber sein Instinkt sagte ihm, dass sich hier etwas anderes abspielte. Dass der Mann, der gerade eine Pistole auf ihn richtete, nicht auf tausend Euro aus war. Und dass er, Krugger, nicht zufällig in diese Falle geraten war.
»Hände auf den Rücken«, befahl der Mann. Krugger tat, was von ihm verlangt wurde. Hinter dem Rücken wurden seine Hände von der Frau gepackt, die aus dem blauen BMW gestiegen war. Er spürte etwas Dünnes, Elastisches, das um seine Handgelenke gelegt wurde. Es war nicht kalt, also nicht aus Metall. Ein Handy klingelte. Es gehörte der Frau aus dem BMW, die den Anruf entgegennahm und einige Schritte zu ihrem Fahrzeug zurückging. Sie sprach leise mit dem Anrufer. Nur den gepressten Ausruf »Scheiße« konnte Krugger deutlich verstehen. Als sie zurückkam, war sie aufgebracht.
»Er muss in den Kofferraum.«
»Wieso das denn?«
»Es gibt gleich Probleme.« Die Frau deutete mit dem Kopf in die Richtung, aus der sie gekommen war.
»Was heißt Probleme?«
»Das heißt, dass wir nicht mehr viel Zeit haben, Herrgott!« Sie nahm Krugger am Arm und führte ihn zum Kofferraum des blauen Wagens. Es war ein relativ neuer 7er-BMW. Die Frau drückte einen Knopf, und der Kofferraumdeckel fuhr mit einem summenden Geräusch langsam nach oben. »Los, rein. Wenn du dich rührst, bist du tot, ist das klar?«
Krugger schielte ängstlich zum Heck des Wagens, als ihn ein heftiger Schlag ins Gesicht traf. »Ob das klar ist?!«, schrie ihn der Mann mit der orangefarbenen Weste an und schlug ihm die Pistole ins Gesicht. Rasender Schmerz durchzuckte ihn. Krugger stieg benommen und mit blutender Augenbraue in den Kofferraum, so schnell sich das mit auf den Rücken gefesselten Händen bewerkstelligen ließ. Der Mann und die Frau schoben ihn bis zur Lehne der Rückbank, breiteten eine Umzugsdecke über ihn und stellten zwei Reisetaschen davor. Dann erneut ein Summen, der Kofferraumdeckel senkte sich, es wurde dunkel um Krugger. Bevor sich sein Gefängnis endgültig schloss, hörte er das Geräusch eines herannahenden Wagens.
»Jetzt lernst mal was fürs Leben«, sagte Kreuthner.
»Wieso? Was hast vor?« Schartauer ahnte Ungemach.
»Die Kohle liegt auf der Straße, sag ich immer. Sperr die Augen auf, dann kannst was lernen. Wennst amal schnell an Cash brauchst.« Kreuthner zwinkerte seinem jungen Kollegen verschwörerisch zu. Schartauer war ganz und gar nicht wohl bei der Sache.
»Ich versteh’s net ganz, was du vorhast. Du willst ja wohl net irgendwie …?«
»Als Polizist musst praktisch denken. Es gibt zum Beispiel Leut, die wollen net, dass des amtlich wird, dass sie an Scheiß baut ham. Verstehst?«
Schartauer fürchtete das Schlimmste.
»Is ja auch net angenehm, wenn a Schreiben von der Polizei kommt. Vielleicht wollen s’ net, dass es der Ehemann mitkriegt oder die Nachbarn. Aber du kannst die Leut auch net einfach davonkommen lassen. Also – was machst als Polizist?«
Schartauer schwieg und starrte auf die Straße.
»Dann machst es halt inoffiziell. Cash auf die Kralle, verstehst? Kein Papierkram, nix.«
»Und was machst du mit dem Bußgeld? Das muss man doch abliefern.«
»Scherzkeks. Das kannst doch nur abliefern, wennst an schriftlichen Vorgang dazu hast. Wie sollen die das denn sonst verbuchen?«
»Das heißt …«
»Die Kohle musst halt selber behalten. Geht eben net anders. Wichtig ist doch, dass der Bürger, der wo an Gesetzesverstoß begeht, dass der bestraft wird und das nächste Mal sagt: Das machen mir nimmer, weil sonst gibt’s wieder eine Strafe. Wo dem sein Pulver hingeht, ist doch letztlich wurscht. A Bußgeld ist zur Abschreckung da. Das heißt: Wichtig ist, dass das Geld wegkommt vom Verkehrssünder, net wo’s hingeht.«
»Ich hab denkt, das geht an wohltätige Zwecke.«
»Tut’s ja auch.«
»Ah so – ich hab schon gedacht, du willst es behalten.«
»Nein. Da hast mich missverstanden. Ich geb’s dann natürlich für wohltätige Zwecke. Das ist doch selbstverständlich.«
Schartauer hatte Zweifel, ob die Begleichung der Spielschulden von Staatsbediensteten unter wohltätige Zwecke fiel. Aber da Kreuthner zusehends verärgert darauf reagierte, dass der junge Kollege mit seinen praxisnahen Überlegungen so wenig anfangen konnte, fragte Schartauer nicht weiter nach und hoffte, dass er nicht Mittäter eines allzu schweren Dienstvergehens werden würde. Kreuthner stand unter Zeitdruck, Geld zu beschaffen. Er hatte zwar eine andere Uniform besorgt und war zum Geldautomaten gefahren. Da es aber aufs Monatsende zuging, hatte der nichts mehr hergegeben; Kreuthner hatte wie häufig sein Dispolimit bereits erreicht.
Der blaue BMW stand an der roten Ampel. Vor dem BMW wartete ein alter Golf. Kreuthner wies Schartauer an, hinter dem BMW zu halten. Am Steuer des BMWs saß eine Frau von etwa fünfundvierzig Jahren, die das Seitenfenster herunterließ, als Kreuthner neben den Wagen trat.
4
Kummeder blickte in die Runde, sein Unterkiefer mahlte wieder. »Also? Was mach ma?«
»Ja aufdoppeln muss er. Is doch klar«, beeilte sich der junge Lintinger zu sagen.
»Aber er allein.« Der alte Lintinger zeigte mit seinem Bierglas auf Kreuthner. »Ich hab ja net b’schissen.«
»Verloren hätt ma’s so oder so.«
»Weil du unbedingt hast spielen müssen. Ich sag noch: Lass bleiben!«
»Schluss mit dem Gequatsche. Er doppelt die Henn auf, und mir teilen s’ uns.«
»Geht des überhaupts durch drei?«, warf Harry Lintinger ein.
»Ja. Weil ich krieg die Hälfte und ihr an Rest.«
»Ah so?! Ja, des is ja für an jeden von uns …«, Harry Lintinger deutete auf sich und seinen Vater. »Is des ja praktisch … weniger.«
»Richtig. Weil du Pfeifenkopf hättst es gar net g’spannt, dass er b’schissen hat.«
»Schon, aber …«, der alte Lintinger wiegte bedenklich seinen rotgesichtigen Schädel hin und her.
»Was – aber?« Kummeder brachte seinen Kopf dicht vor Lintingers Gesicht. Der wollte zurückweichen, aber Kummeder hatte ihn am Arm gepackt und zog ihn zu sich. Lintinger wurde unwohl, denn Kummeder war offenbar kurz davor, handgreiflich zu werden.
»Nix aber. Guter Vorschlag.« Lintinger schluckte. »Sehr guter Vorschlag.«
Kummeder tätschelte mit seiner Pranke Lintingers Backe, wie es die Paten in den Mafia-Filmen mit ihren Gefolgsleuten taten.
»Sechshundert fehlen noch«, sagte Kummeder in Richtung Kreuthner und schob das Geld, das schon auf dem Tisch lag, in die Mitte. »Plus hundertvierzig.«
»Da brauch ich a bissl Zeit.«
»Drei Stund. Dann ruf ich bei deinem Chef an und frag, wo das Geld bleibt.«
»Jetzt mach keinen Scheiß. Kriegst die Kohle ja. Was is mit der Uniform?«
»Die bleibt hier.«
»Dann gib mir wenigstens den Autoschlüssel. Is in der Jacke.«
»Die Uniform bleibt da. Und zwar vollständig.«
»Soll ich vielleicht laufen oder was?«
Kummeder gab keine Antwort.
»Krieg ich wenigstens mein Handy? Dass ich wen anrufen kann, dass er mich abholt.«
»Dafür, dass du beschissen hast, stellst ganz schön viel Forderungen. Mach dich vom Acker. Du hast noch zwei Stunden achtundfünfzig.«
»Und die EC-Karte? Krieg ich die auch net? Herrschaft! Jetzt kannst mich langsam.«
»Du, Obacht, gell! Nicht so eine ordinäre Sprache. Da bin ich fei empfindlich.« Kummeder untersuchte Kreuthners Jacke, fand die EC-Karte und schnippte sie zu ihrem Eigentümer über den Tisch. »Noch zwei Stunden siebenundfünfzig.«
Dreihundert Meter vom Wirtshaus Zur Mangfallmühle entfernt stand ein altes Haus, das einmal einem Waldarbeiter als Unterkunft gediente hatte. Jetzt wohnten darin Norbert und Heidrun Jankowitsch, beide Anfang sechzig und nach einem entbehrungsreichen Arbeitsleben in der Papierfabrik frühpensioniert. Heidrun Jankowitsch war ein wenig erstaunt, als ein Mann in seltsam buntem Umhang frühmorgens vor ihrer Gartentür stand und läutete. Unter dem Umhang schauten nackte Beine in Schnürstiefeln hervor.
»Grüß Gott«, sagte Frau Jankowitsch zögernd und mit einigem Argwohn.
»An wunderschönen guten Morgen wünsch ich, Frau …«, Kreuthner schielte auf das Klingelschild, »… Jankowitsch. Ich weiß, es is a bissl früh. Aber ich müsst mal telefonieren. Ich hab a Autopanne, und mein Handy geht nimmer.«
»Aha.« Heidrun Jankowitsch erinnerte sich jetzt daran, dass es in den letzten Tagen im Landkreis wiederholt Zwischenfälle gegeben hatte, bei denen junge Frauen von einem Unbekannten belästigt worden waren. Die Polizei suchte nach dem Mann. »Haben Sie da gar nix unter dem Dings … was is des überhaupts?«
»Des? Des is … a Poncho. So a südamerikanischer Umhang. Is ganz praktisch bei dem Wetter.«
»Echt? Schaut aus wie a Tischdecken.«
»Ja mei!« Kreuthner lachte. »Die ham oft ganz verrückte Muster.«
»Des is doch a Tischdecken von der Mangfallmühle.«
Kreuthner überlegte, ob er die Ponchodiskussion weiterführen sollte, entschied sich aber, die Sache abzukürzen. »Sie, ich müsst nur ganz schnell telefonieren. Zwei Minuten. Dann bin ich wieder weg.«
Kreuthner machte Anstalten, das Gartentor zu öffnen. Aber Heidrun Jankowitsch gab ihm per Handzeichen zu verstehen, dass sie das nicht wünschte. »Moment. Ich frag grad meinen Mann.«
Sie ging ins Haus und zog die Tür sorgfältig hinter sich zu. Durch ein offenes Fenster hörte Kreuthner Bruchstücke des Dialogs zwischen den Eheleuten Jankowitsch. Unter anderem den Satz: »Was! Die Drecksau steht bei uns vorm Haus?« Da er nach diesen Worten nicht mehr damit rechnete, dass sich irgendeine Tür öffnete, geschweige denn ihm ein Telefon angeboten würde, wollte sich Kreuthner wieder auf den Weg machen und sein Glück woanders versuchen. Doch da trat unverhofft Norbert Jankowitsch vor die Tür. Er trug ein Unterhemd, das sich über einen enormen Bauch spannte, Flanellhosen mit Hosenträgern, die an den Seiten herabhingen (die Hose hielt auch so), und schwere Arbeitsstiefel. »Sie wollen telefonieren?«, fragte Herr Jankowitsch mit finsterem Blick und winkte Kreuthner mit der linken Hand herbei. Als er sich dem Haus näherte, dachte Kreuthner darüber nach, warum der Mann die Linke zum Winken genommen hatte und gleichzeitig die Rechte hinter seinem Rücken verborgen hielt. Die Antwort kam, als Kreuthner vor Jankowitsch stand. In dessen rechter Hand, die jetzt hervorschnellte, befand sich ein Pfefferspray, das Jankowitsch auf Kreuthners Gesicht abfeuerte. Wie von einer Keule getroffen sank Kreuthner zu Boden und wurde dort mit Stiefeltritten attackiert, begleitet von unflätigsten Beschimpfungen und der Empfehlung, Leuten wie Kreuthner und seinesgleichen die Eier abzuschneiden.
Als Kreuthner wenig später an der Tür des Neubauerhofs klopfte, der ein paar hundert Meter weiter lag, sah er noch weniger vertrauenerweckend aus als zuvor. Die Tischdecke um seine Schultern war verschmutzt und an einer Stelle eingerissen, seine Augen waren feuerrot geschwollen. Die Bäuerin des Hofes hieß Margit Unterlechner, eine dralle, rotwangige Frau mit großen, dickfingerigen Händen und stechend blauen Augen. Als sie die Tür öffnete, sagte sie: »Ja der Leo – was machst denn du da?« Ein Lächeln huschte über ihr Gesicht.
»Servus, Margit. Ich müsst mal telefonieren.« Kreuthner bemühte sich um einen geschäftsmäßigen Ton und tat, als stehe er nicht in Unterhosen und Tischdecke vor der Tür.
»Komm rein«, sagte Margit, musterte Kreuthner von oben bis unten und nahm die Tischdecke zwischen zwei Finger. »Was ganz was Eigenes. Is des wieder fürn Fasching?«
Kreuthner hatte Margit vor zwei Jahren auf dem Lumpenball kennengelernt, dem orgiastischen Höhepunkt des Faschingstreibens am Tegernsee. Wolfgang, Margits Mann, hatte keine Lust gehabt, seine Frau auf das Fest zu begleiten, und war auf dem Hof geblieben. Das hatte niemanden gewundert, denn Wolfgang war allgemein als »fade Nocken« bekannt, den nichts anderes als seine Rinderzucht interessierte, und man munkelte, das Intimleben der Unterlechners liege seit Jahren im Argen. Zumindest, was den ehelichen Verkehr betraf. Außerehelich, das wusste jeder, vögelte sich die Unterlechnerin fröhlich durchs Tegernseer Tal, was bei ihrem eher unvorteilhaften Aussehen erstaunlich war. Doch was an äußeren Reizen fehlte, machte sie durch ihr entgegenkommendes Wesen mehr als wett. Kreuthner hatte an jenem Abend eigentlich vorgehabt, die Hundsgeiger Michaela, Friseurin in Rottach, abzuschleppen. Aber die war mit Glitzerbustier, Netzstrümpfen und Stringtanga aufgelaufen und konnte sich vor Verehrern nicht retten. Hinzu kam, dass Kreuthner schon gegen elf nach dem Genuss etlicher Gläser B52 kaum noch aus den Augen schauen konnte. Als Alternative bot sich daher Margit Unterlechner an, die als Schulmädchen mit kariertem Minirock, offener weißer Bluse und blonder Zöpfchenperücke gekommen war. Der Schottenrock spannte bedenklich, als sie sich neben Kreuthner auf eine Couch sinken ließ. Daran erinnerte sich Kreuthner noch heute, denn es war gleichzeitig das Letzte, woran er sich erinnern konnte. Am nächsten Tag wachte er auf der Ladefläche seines alten Passats auf und hatte keine Hosen an. Hinfort hatte Kreuthner um den Neubauerhof einen großen Bogen gemacht. Jetzt freilich war er in einer akuten Notlage und musste befürchten, dass sich keine andere Tür für ihn auftun würde.
»Magst erst mal unter die Dusche«, sagte Margit und strich Kreuthner zart über den Arm. Der fragte sich, wie es möglich war, dass Margits Bluse auf den drei Metern von der Tür zur Küche um zwei Knöpfe aufgegangen war, und hatte wenig Lust, in ihrem Haus auch noch seine verbliebenen Kleidungsstücke abzulegen. Aber die Augen brannten von dem Pfefferspray und mussten unter fließendem Wasser ausgespült werden, wie Kreuthner gelernt hatte.
»Ist der Wolfgang gar net da?« Kreuthner spähte durch die halboffene Küchentür in der Hoffnung, Wolfgang Unterlechner zu erblicken.
»Der is auf Tölz g’fahren, an neuen Häcksler kaufen. Da is das Bad. Brauchst frische Sachen?«
»A Hos’n wär super.«
Kreuthner ließ unter der Dusche das Wasser in seine Augen laufen und wusch den Dreck der Nacht vom Körper. Hinter dem Rauschen des Wassers hörte er, wie die Badezimmertür geöffnet wurde. Durch einen Spalt zwischen Duschvorhang und Wand sah Kreuthner, wie Margit im Morgenmantel vor dem Spiegel stand und Lippenstift auflegte. Unter dem Morgenmantel schauten zwei stämmige, bleiche Waden hervor, die ebenfalls bleichen Füße steckten in geblümten Badelatschen. Margit zog den Haargummi ab, schüttelte ihre blonde, von Dauerwellen verdorbene Mähne, legte den Kopf in den Nacken und schob den Morgenmantel auseinander, so dass der Blick frei wurde auf das, was sich darunter befand. Und das war keine Unterwäsche.
»Alles klar unter der Dusche?« Margit versuchte, einen Blick auf Kreuthner zu erhaschen.
»Alles wunderbar. Wie schaut’s mit der Hose aus?«
»So schnell brauchen mir die doch nicht?«, flötete Margit.
Kreuthner stockte der Atem. »Äääh ja, ich meine … es wär nur gut, wenn sie schon mal da wär, weil … weil … geh komm, sei so gut und hol sie.«
Margit schwebte mit der Grazie, die korpulenten Menschen oft zu eigen ist, zur Badezimmertür und rief Kreuthner ein »Nicht weglaufen« zu, bevor sie die Tür schloss. Kreuthner meinte zu hören, wie sie den Schlüssel von außen umdrehte. Als er aus der Dusche stieg, musste er feststellen, dass Margit seine Unterwäsche und die Socken mitgenommen hatte. Nur die Stiefel waren noch da. Und so kam es, dass sich Kreuthner ein Badehandtuch um den Leib schlang, hastig seine Stiefel überstreifte und aus dem Badezimmerfenster kletterte. Draußen fand er sich auf einer matschigen Wiese wieder, die von einem Stacheldrahtzaun umgeben war. Nach kurzer Orientierung wusste Kreuthner, wo es zur Straße ging. Allerdings meinte er, im Augenwinkel eine Bewegung wahrgenommen zu haben. Er verharrte einen Augenblick reglos, in der richtigen Vermutung, dass es jetzt besser sei, sich möglichst unauffällig zu verhalten. Ihm trat der Schweiß auf die Stirn.
Dann hörte er es. Zaghaft zunächst, wie um sich einzustimmen, dann kräftig, unmissverständlich und animalisch: ein Schnauben. Hinter Kreuthner stand Hannibal, einer der besten Zuchtstiere im Landkreis, neunhundertsiebzig Kilogramm fleischgewordene Urgewalt. Man hätte meinen können, das Tier würde sich freuen, dass in sein eintöniges Leben ein wenig Abwechslung geraten war. Aber das lag wohl nicht im Wesen eines Bullen. Nein, Hannibal war ganz und gar nicht erfreut, Kreuthner zu sehen. Solange der sich nicht bewegte, tat auch der Stier nichts. Aber Kreuthner wollte irgendwann heraus aus dieser Stierweide, und zwar möglichst ohne die Hilfe von Margit Unterlechner. Der Plan war nicht so schlecht: Nach einer Minute reglosen Harrens lief Kreuthner auf einmal los wie der Teufel. Das Überraschungsmoment sollte ihm den nötigen Vorsprung verschaffen, um den Zaun vor Hannibal zu erreichen. Das wäre auch gelungen, hätte sich nicht just in dem Moment, als er losrennen wollte, das Badehandtuch von Kreuthners Hüften gelöst und in seinen Beinen verheddert. Der Stier, ohnehin nicht bester Laune, war äußerst erbost darüber, dass Kreuthner ihn hatte übertölpeln wollen. Ohne ins Detail zu gehen, sei so viel gesagt: Die Geschichte hätte schlimmer ausgehen können – aber nicht viel. Die Bilanz waren vier geprellte Rippen, zahlreiche Hautabschürfungen, die sich Kreuthner zuzog, als Hannibal ihn mit den Hörnern quer über die Wiese vor sich herschob, und unzählige kleine Einstiche, die entstanden, als sie schließlich den Stacheldrahtzaun erreichten. Außerdem ein furchterregend großes und ausgesprochen schmerzhaftes Hämatom auf der rechten Gesäßhälfte, das nur deshalb keine scheußliche Fleischwunde geworden war, weil Wolfgang Unterlechner so umsichtig gewesen war, seinem Stier die Hornenden rund zu feilen. Irgendwie schaffte es Kreuthner mit der Kraft der Verzweiflung, auf die andere Seite des Zauns zu gelangen und dabei auch noch das ramponierte Badehandtuch zu retten. Kurz darauf hatte Kreuthner das erste Mal an diesem Morgen Glück: Er begegnete einem blinden Spaziergänger, der mit seinem Hund unterwegs war und sich nicht an Kreuthners Aufmachung störte, sondern ihm bereitwillig einen Anruf mit seinem Handy gestattete.
5
Guten Morgen«, sagte Kreuthner und betrachtete interessiert das Innere des Wagens. Es enthielt nichts Verdächtiges, soweit Kreuthner sehen konnte. Genauer gesagt: Es enthielt gar nichts. Keine Decke auf der Rückbank, keine Straßenkarte in der Tür, keine Kaugummidose oder Sonnenbrille auf der Mittelkonsole. Nichts. Nur eine voluminöse Handtasche auf dem Beifahrersitz.
»Guten Morgen.« Die schwarzhaarige Frau lächelte Kreuthner bemüht freundlich an, konnte aber nicht verhindern, dass ihr Blick an den großflächigen Hautabschürfungen im Gesicht des Polizisten hängenblieb. Kreuthner ließ eine Pause folgen. Während dieser Pause überlegte die Frau anscheinend, ob sie etwas sagen sollte – »Was kann ich für Sie tun?« oder »Stimmt irgendwas nicht?« Ein Satz dieser Art lag ihr offensichtlich auf der Zunge. Die meisten Menschen hätten etwas gesagt. Natürlich verunsicherte es, wenn ein Polizist neben dem Wagenfenster stand. Genau aus diesem Grund wollten die meisten möglichst schnell wissen, woran sie waren. Diese Frau hingegen fragte nicht. Sie hatte Angst, so schien es Kreuthner, sich verdächtig zu verhalten oder etwas Falsches zu sagen.
»Ich würde gern Ihre Papiere sehen.«
»Ja, natürlich.« Die Antwort kam schnell, eilfertig. Hektisch der Griff zur Handtasche auf dem Beifahrersitz. Sie enthielt allerhand Dinge. Lippenstift, Pfefferminz, Lidschatten, Sonnenbrille, Schlüsselbund. Aber auch eine achtlos in die Tasche gestopfte Arztrechnung mit Überweisungsvordruck und eine Dose Katzenfutter. Es dauerte, bis die Frau in dem Chaos die Wagenpapiere gefunden hatte. Das stand für Kreuthner in auffallendem Widerspruch zum aufgeräumten Fahrgastraum. Wenn dieser Wagen auch nur zwei Stunden im Besitz der Frau gewesen wäre, hätte es darin ausgesehen wie auf einer Müllhalde. Etwas stimmte hier nicht.
Schartauer ging mit dem Fahrzeugschein zum Streifenwagen zurück. »Ihr linkes Rücklicht geht nicht«, sagte Kreuthner.
»Das tut mir leid. Ich fahr gleich zu einer Werkstatt. Versprochen.«
»Ist eigentlich a Ordnungswidrigkeit.«
»Ja, natürlich«, sagte die Frau. Kreuthner ging einmal um den Wagen herum in der Hoffnung, noch andere Mängel zu finden, doch das Fahrzeug war in einem hervorragenden Zustand. Es machte einen fast neuen Eindruck.
Als Kreuthner zur Ampel blickte, stand sie immer noch auf Rot. Seit ihrem Eintreffen waren mindestens zwei Minuten vergangen. Kreuthner stellte sich vor die Ampel und sah die Straße entlang. Man konnte grob dreihundert Meter weit sehen, und es wäre zu erwarten gewesen, dass dort hinten irgendwo eine zweite Ampel stand. Aber da war nichts. Die Sache kam Kreuthner immer verdächtiger vor. Er ging zu dem direkt vor der Ampel stehenden VW Golf, der im Gegensatz zu dem BMW einen äußerst unordentlichen Anblick bot. Die Rückbank war mit Papieren übersät, auf denen Charts, Kurven und Tabellen ausgedruckt waren. Kreuthner hatte wenig Ahnung von diesen Dingen, konnte aber an den Überschriften erkennen, dass einige der Papiere Finanz- oder Börsendaten enthielten. Hinter dem Fahrersitz stand ein Attaché-Köfferchen in teuer aussehendem Leder. Die Papiere und das Köfferchen passten weder zu dem alten Kleinwagen noch zu seinem Fahrer. Er war etwa so alt wie die Frau im BMW und gekleidet wie ein Waldarbeiter. Auf dem Beifahrersitz lag eine orangefarbene Sicherheitsweste. Der Mann sagte wenig, als er Führerschein und Fahrzeugschein aushändigte. Kreuthner gab die Papiere an Schartauer weiter, der ihm das Ergebnis der Überprüfung des BMWs mitteilte. Es liege nichts vor. Der Wagen gehöre allerdings nicht der Dame, sondern einem gewissen Diego Waldleitner. Unter normalen Umständen hätte Kreuthner die Frau einfach gefragt, wie sie an den Wagen komme. Wenn sie gesagt hätte, der Halter sei ihr Schwager, und keine Diebstahlsanzeige vorlag, wäre die Sache erledigt gewesen. Kreuthner blickte zur Ampel. Sie stand immer noch auf Rot. Er wies Schartauer an, Herrn Waldleitners Telefonnummer ausfindig zu machen, und ging zum BMW zurück.
»Ich würde gern Warndreieck und Verbandskasten sehen.« Die Frau sah ihn an, als hätte er sie gebeten, sich auszuziehen. »Is was?«, fragte Kreuthner und schlug einen etwas strengeren Ton an.
»Nein. Ich hatte nur überlegt, wie der Kofferraum aufgeht. Ich … ich hab den Wagen noch nicht so lang.«
»Hinten am Kofferraumdeckel gibt’s einen Knopf.«
Die Frau stieg aus, ging mit eiligen Schritten zum Kofferraum und starrte anscheinend ratlos auf den Kofferraumdeckel. »Da, rechts«, sagte Kreuthner.
»Ach da«, sagte die Frau. Ihre Hand bewegte sich zögerlich in Richtung des Knopfes. Unmittelbar bevor sie ihn drückte, rief Schartauer aus dem Streifenwagen, dass er Herrn Waldleitners Telefonnummer habe. Kreuthner ließ die Frau stehen und ging zum Streifenwagen.
Diego Waldleitner war mit dem Auto unterwegs, als Kreuthner ihn auf dem Handy erreichte.
»Wie viele Autos besitzen Sie?«
»Eins. Und eins ist auf meine Frau zugelassen. Warum?«
»Sie fahren gerade in Ihrem dunkelblauen BMW745i?«
»Richtig. Warum wollen Sie das wissen?«
»Eine Routineüberprüfung. Sagen Sie mir bitte noch Ihr Kennzeichen?«
Waldleitner nannte sein Kennzeichen. Es war ebenjenes Münchner Kennzeichen, das Kreuthner an dem blauen BMW sehen konnte, der fünf Meter vor ihnen stand. Er bedankte sich bei Waldleitner und dachte nach. Schartauer hingegen war verwirrt. Wie konnte es sein, dass der Wagen gleichzeitig hier und auf dem Mittleren Ring in München war? Kreuthner kannte die Antwort. Mit dem gleichen Trick war es der RAF in den siebziger Jahren über lange Zeit gelungen, die Polizei zum Narren zu halten. Man hatte ein Auto eines bestimmten Modells in einer bestimmten Farbe ausgespäht. Dann wurde ein identischer Wagen gestohlen und mit einem gefälschten Nummernschild versehen, das dem des ausgespähten Wagens entsprach. Wenn man in eine Polizeikontrolle geriet und Kennzeichen und Fahrzeugtyp abgefragt wurden, war das Fahrzeug nicht als gestohlen gemeldet.
Die Frau hatte Warndreieck und Verbandskasten in der Hand, als Kreuthner zum BMW zurückkam. Der Kofferraum des Wagens war wieder geschlossen. »Ist gut«, sagte Kreuthner mit Blick auf die beiden Gegenstände. »Ich hab ein ganz anderes Problem.«
»Was denn?«, fragte die Frau besorgt und verstaute Warndreieck und Verbandskasten auf dem Rücksitz.
»Warum tun Sie’s nicht in den Kofferraum zurück?«
»Wenn ich noch mal kontrolliert werde, hab ich’s gleich bei der Hand.« Sie schloss die Tür. »War’s das?«
»Nein«, sagte Kreuthner. »Es gibt da, wie gesagt, ein Problem.«
Die Frau schwieg angespannt.
»Der Wagen gehört nicht Ihnen?«
»Nein.«
»Wem dann?«
»Einem Freund. Herrn Waldleitner.« Sie lachte. »Ich hab ihn nicht gestohlen. Dann wäre er ja als gestohlen gemeldet, und Sie wüssten das jetzt.«
»Nein. Er ist nicht als gestohlen gemeldet.«
»Was … ist dann das Problem?«
»Das Problem ist, dass es einen blauen BMW mit diesem Kennzeichen zu viel gibt.«
Schweigen. Die Frau kaute auf ihrer Unterlippe. Kreuthner sah zur Ampel. »Die Ampel ist immer noch rot. Komisch, oder?«
»Wahrscheinlich defekt.«
»Glaub ich nicht.«
»Ich weiß es auch nicht.«
»Doch. Das wissen Sie besser wie ich. Hab ich recht?«
Die Blicke der Frau flatterten über Kreuthners Uniformjacke, an dieser vorbei auf den Waldboden links von ihm, rechts von ihm, nur nicht zu Kreuthners Augen.
»Wissen S’ was? Hier stinkt’s. Und zwar gewaltig.« Der Fahrer des Golfs stand jetzt neben seinem Wagen und wandte den Blick ab, als Kreuthner hinsah. »Kennen Sie den Herrn?«
Sie zögerte, überlegte eine Sekunde. »Nein, warum?«
»Weil Sie sich angeschaut haben, wie ich am Streifenwagen war. Ich seh vielleicht müd aus. Aber ich hab alles im Blick.«
Die Frau starrte eine Weile stumm in das Gesicht des Polizisten und schluckte. Man konnte sehen, dass ihr das Herz bis zum Hals schlug. Kreuthner studierte mit sadistischer Ruhe, wie sie versuchte, ihre Gesichtszüge nicht entgleisen zu lassen. »Was …«, sie überlegte, was sie eigentlich sagen wollte. »Was wollen Sie jetzt von mir?«
6
Simon Kreuthner war im Dezember des Jahres 2011, seinem dreiundsiebzigsten Lebensjahr, heimgegangen. In eine bessere Welt, wie der Pfarrer sagte. Es wurde allerdings allgemein angenommen, dass er vor dem Einzug ins Paradies noch einige Zeit im Fegefeuer verbringen würde. Denn er hatte sich zu seinen Lebzeiten der Schwarzbrennerei und zahlreicher anderer Vergehen schuldig gemacht. Nie hatte er Reue gezeigt noch auch nur den Versuch unternommen, ein ehrbares Leben zu führen.
Jetzt war er tot, und sein baufälliges Anwesen, ein zwischen Gmund und Hausham gelegenes Bauernhaus, hatte er seinem Neffen, Polizeiobermeister Leonhardt Kreuthner, vererbt. Der Grund war schuldenfrei, und im Haus war zwar keine Landwirtschaft mehr, aber eine seit fünfzig Jahren eingesessene Schwarzbrennerei. Manch einen nahm es Wunder, dass der Onkel ausgerechnet Kreuthner bedacht hatte. Das Verhältnis der beiden war durchaus nicht herzlich gewesen. Aber Simon hatte seine Entscheidung sorgfältig abgewogen. An das Erbe war nämlich eine Bedingung geknüpft, die heikel und juristisch besehen unwirksam war. Simon musste sich also bei seinem Erben darauf verlassen, dass er die Bedingung nicht einfach unter den Tisch fallen ließ. Außer einem Rest Anstand musste der Bedachte ein gerüttelt Maß kriminelle Energie mitbringen, um seiner Aufgabe nachzukommen. Zwar gab es in der Familie nicht wenige, die die zweite Bedingung erfüllten. Aber wer von all den Gaunern und Spitzbuben würde sich in die Nesseln setzen, nur um dem Onkel posthum einen Gefallen zu tun? Fast jeder von denen hatte eine Bewährung laufen, sofern er überhaupt auf freiem Fuß war. Da riskierte keiner, wieder einzufahren, wenn man draußen eine schöne Erbschaft verprassen konnte. Einzig und allein seinem Neffen Leonhardt traute Simon den erforderlichen Anstand zu. Das mochte im Angesicht des Lebenswandels, den Leonhardt Kreuthner pflegte, verwundern. Doch in Familiendingen war Kreuthner ungewohnt sentimental.
In Erfüllung des Auftrags, den Simon ihm auf dem Sterbebett in einem verschlossenen Briefumschlag zugesteckt hatte, begab sich Kreuthner an einem Tag Anfang Dezember mit einem Rucksack auf den Wallberg. Den Rucksack hinterlegte er zunächst im Restaurant der Bergstation und bat, vorsichtig damit umzugehen. Anschließend ging Kreuthner Ski fahren. Die schwarze Piste der ehemaligen Herrenabfahrt war bei durchschnittlichen Skifahrern gefürchtet, bei den guten aber ein Geheimtipp. Man konnte sie nur befahren, wenn es frisch geschneit hatte. Denn sie wurde nicht gewalzt, und bereits nach wenigen Tagen war sie so ramponiert, dass sie auch besseren Fahrern kaum noch Freude bereitete.
An diesem Tag fiel die meiste Zeit flockiger Schnee vom Himmel. Nur mittags tat sich für zwei Stunden ein Wolkenloch auf, und Kreuthner konnte auf der Terrasse des Wallberghauses das eine oder andere Weißbier genießen. Und wie er in der Sonne saß und über die Berge nach Süden schaute, hinüber zum Blankenstein und weiter hinten zur Halserspitze und links davon zum Felsmassiv des Guffert und ganz weit hinten zu den Gletschern der Zillertaler Alpen – da hörte er eine dünne weibliche Stimme. »Ist da noch frei?«
Am Tisch stand eine Frau von etwa fünfunddreißig Jahren. Ihr Skioverall war vor vielen Jahren in Mode gewesen, jetzt aber alt und abgetragen, die Skischuhe ebenso. Die Haare hellblond, mittellang und dünn, das Gesicht war weiß mit vollen Lippen, nicht ins Auge springend schön, doch auf den zweiten Blick ansprechend. Sie schien in sich gekehrt und sah Kreuthner an, als fürchte sie ernsthaft, dass er sie nicht Platz nehmen ließe. In der Hand hielt sie ein Tablett, darauf ein Teller Pommes frites, eine Plastikflasche Wasser ohne Kohlensäure und eine Gabel.
»Hock dich her. Is noch alles frei«, sagte Kreuthner und zog sein Weißbier an sich, denn die Frau machte einen ungeschickten Eindruck. Die Vorsicht erwies sich als berechtigt. Beim Hinsetzen verhakte sich ein Skischuh der Frau zwischen Tisch und Bank, und das Tablett fiel ihr aus der Hand, woraufhin sich die Pommes über den Tisch verteilten. Die Frau entschuldigte sich hektisch und begann, die Kartoffelstreifen aufzusammeln. Sorgsam reihte sie sie nebeneinander auf dem Teller auf. Als die verfügbare Fläche belegt war, legte sie die nächste Schicht gitterförmig auf die untere.
»Machst du des immer mit deinen Pommes«, erkundigte sich Kreuthner, nachdem er ihr eine Weile zugesehen hatte.
»Ich hab’s gern ordentlich«, sagte die Frau und steckte sich nachdenklich ein Pommes-Stäbchen in den Mund. Dann stapelte sie weiter.
»Okay …« Kreuthner nahm einen Schluck Weißbier und wandte seinen Blick nach Süden zum Horizont. »Die Bratwurst hier is auch net schlecht. Da musst net so viel ordnen.«
»Das mag sein. Nur … ich bin Vegetarierin.«
Kreuthner betrachtete die Frau mit einer Mischung aus Neugier und Erstaunen. Noch nie in seinem Leben hatte Kreuthner einen leibhaftigen Vegetarier getroffen, jedenfalls keinen, der es zugegeben hätte. »Echt? Gar kein Fleisch?«
Die Frau hatte drei Pommes frites sorgfältig nebeneinander auf die Gabel gespießt und biss von allen gleichzeitig ab. »Ist das schlimm?«, fragte sie.
»Nein, nein. Ich denk mir nur …« Kreuthner sah sie an, als würde ihr Gras aus den Ohren wachsen. »Aber Hendl schon, oder?«
»Ist auch Fleisch.«
Kreuthner nickte und dachte über das eigenartige Weltbild der Vegetarier nach, während die Frau ihre Pommes in Dreierreihen verspeiste. So vergingen einige Minuten in Stille.
»Super Tag heut, oder?«, sagte Kreuthner schließlich, um irgendetwas zu sagen.
»Ja, super«, sagte die Frau und mühte sich mit dem Verschluss der Wasserflasche ab. Kreuthner fragte, ob er behilflich sein könne. Doch die Frau schüttelte den Kopf.
»Ich bin der Leo«, sagte Kreuthner.
»Ich heiße Daniela.« Die Frau lächelte verdruckst und trank mit hochgezogenen Schultern aus der Wasserflasche, die sie endlich aufbekommen hatte.
»Da drüben in der Wolfsschlucht«, Kreuthner deutete nach Süden auf die Blauberge, die im Gegenlicht als dunkler Schattenriss erkennbar waren, »da ist mein Opa umgekommen.«
»Im Gewitter?« Daniela dachte vielleicht an die Stelle im Brandner Kaspar, wo Marei auf der Suche nach ihrem Liebsten in der Wolfsschlucht den Tod findet.
»Na, war a schöner, sonniger Tag. Aber er hat an gewilderten Hirsch am Buckel g’habt. Der hat ihn in die Tiefe gerissen. Mein Opa hat einfach net auslassen wollen, verstehst?«
»Ja, so was passiert, wenn man grundlos Tiere tötet.« Sie stocherte die letzten Pommes auf ihre Gabel. »Entschuldigung. Ich wollte damit nichts gegen deinen Großvater sagen.«
»Des war a Sechzehnender. Der is dem Opa direkt vor die Flinte g’laufen. Was hätt er denn machen sollen? Warten, bis ihn der Jäger schießt?«
»Ah, verstehe. Das war so eine Art Notlage.« Die Frau legte irgendwie indigniert die Gabel auf den leeren Teller, wandte sich ab, hielt ihr Gesicht in die Sonne und sagte nichts mehr.
Kreuthner war irritiert. »Bist jetzt beleidigt?«
»Nein. Wieso?«
»Weil das genau so ausschaut, wenn Frauen beleidigt sind.«
»Ich bin nicht beleidigt. Ich bin nur nicht an Jagdgeschichten interessiert.«
Kreuthner blickte genervt zum weiß-blauen Himmel auf. »Des muss scheint’s so sein. Da hast einmal an schönen Tag zum Skifahren, dann hockt sich natürlich eine her und fangt’s Zicken an.«
Die Frau drehte ihr Gesicht aus der Sonne und sah Kreuthner böse an. »Hast du zicken gesagt?«
»Ja, ich hab zicken gesagt. Fällt dir a besseres Wort ein?«
»Warum wirst du so gemein? Ich hab dir gar nichts getan.« Daniela sah Kreuthner mit einer Mischung aus Wut und Enttäuschung an. Kreuthner stellte zu seiner Überraschung fest, dass sie weinte.
»Da musst doch net gleich zum Heulen anfangen. Ich hab des ja net so gemeint.«
»Ich heule nicht. Mir ist was ins Auge geflogen, und das sitzt unter meiner Kontaktlinse.«
Tatsächlich weinte die Frau nur aus einem Auge, wie Kreuthner jetzt erkennen konnte. Sie versuchte, die Linse herauszufischen, was anscheinend Probleme bereitete. Kreuthner wusste nicht, was er tun sollte. Dass er beim Bergen der Kontaktlinse kaum von Nutzen sein würde, war klar. Er sah sich auf der Terrasse um und erblickte zu seiner Erleichterung an einem anderen Tisch einen Bekannten.
»Tja, ich pack’s dann wieder«, sagte Kreuthner, nahm sein Weißbierglas und stand auf. Beim Weggehen streifte der Anorak, den Kreuthner in der Hand hielt, das Gesicht der Frau. Sie zuckte zusammen und sagte hörbar angespannt: »Vielen Dank, jetzt ist sie auch noch runtergefallen.« Kreuthner sah zu, dass er wegkam.
7
Gegen vier holte Kreuthner seinen Rucksack aus dem Restaurant und stapfte etwa hundert Meter in Richtung Gipfel. Es waren keine Skiläufer mehr zu sehen, denn in Kürze würde es dunkel werden. Kreuthner konnte keine Zeugen gebrauchen für das, was er vorhatte. Er stellte sich auf eine Stelle mit guter Aussicht und holte das Blechbehältnis aus dem Rucksack. Das Tal lag weiß und friedlich tausend Meter unter ihm, in dessen Mitte ein großer schwarzer Fleck, der aussah wie eine Zipfelmütze mit Beinen – der Tegernsee. Im Norden verschwamm die Landschaft im grauen Dunst der hereinziehenden Nacht, von Südwest kamen letzte Sonnenstrahlen und erleuchteten das große Kreuz auf dem Gipfel des Wallbergs. Simon hatte, obwohl zeit seines Lebens einigermaßen katholisch, verbrannt werden wollen. Die Vorstellung, in der Erde zu verfaulen, war ihm unerträglich gewesen. Verstreuen sollten sie ihn respektive seine Asche. Und zwar auf dem höchsten Berg am Tegernsee, dem Wallberg. Das war in Deutschland nicht erlaubt. Deshalb hatte Kreuthner den Onkel nachts heimlich aus dem Grab holen müssen.
Der Himmel war teils blau, teils von grauen Wolken bedeckt, und ein kalter Wind blies Schneeflocken vorbei, als Kreuthner die den Onkel enthaltende Urne öffnete. Er überlegte kurz, ob er etwas Feierliches sagen sollte, aber es wollte ihm nichts einfallen. Schließlich sagte er die Worte, die er so ähnlich im Fernsehen gehört hatte: »Simmerl – es war mir eine Ehre, dich gekannt zu haben.« Dabei wurden ihm die Augen feucht, und er musste schlucken. Eine Erinnerung wurde wach, wie ihn Onkel Simmerl einst in die Geheimnisse des Schwarzbrennens eingeweiht hatte und sie zusammen den ersten von Kreuthner gebrannten Obstler verkostet hatten. Da war er elf Jahre alt gewesen. Mit diesem bewegenden Gedanken im Herzen drehte er die Urne um und übergab Simon Kreuthners Asche dem Bergwind. Der blies sie mit böiger Wucht in Richtung Setzberg, und genau aus dieser Richtung hörte Kreuthner kurz darauf jemanden rufen: »He! Was soll das?!«
Zwanzig Meter unterhalb stand eine graue Gestalt auf Skiern, die hustete und sich die Asche vom Skianzug klopfte. Wie es aussah, hatte sie den ganzen Onkel abbekommen. Als Kreuthner bei ihr ankam und sich für sein Missgeschick entschuldigte, sah er, dass es Daniela war, die Frau, die er mittags auf der Terrasse getroffen hatte.
»Verdammt! Was war denn das?«, fragte sie hüstelnd und wischte sich die Augen aus.
»Nur a bissl Asche. Wart, des hamma gleich.« Kreuthner klopfte sie ab.
»Lass, das geht schon. Ich mach es mit Schnee weg. Sonst wird das nicht richtig sauber.« Nachdem sie das gesagt hatte, stand Daniela still auf der Stelle und blickte blinzelnd in den Himmel.
»Was ist los?«
»Ich habe Asche in den Augen.«
»Tut mir echt leid. Aber ich hab nicht gedacht, dass noch wer da ist. Was machst denn hier um die Zeit?«
»Ich wollte die Einsamkeit genießen. Ich hab ja nicht gewusst, dass jemand hier Asche verstreut. Was ist das überhaupt für Asche? Ich hoffe, nicht dein Hund oder deine Katze oder so was.«
»Mein Hund? Ja so a Schmarrn. Wie kommst denn da drauf?«
»Ist auch egal«, sagte Daniela und stakste durch den Schnee.
»Kann ich helfen?«
»Danke, ich komm klar.«
Die Frau verschwand hinter einer großen Latschenkiefer und Kreuthner sah, wie sie mit Schnee die Asche von ihrem Skianzug rieb und sich das Gesicht säuberte. Die Sonne war im Südwesten untergegangen, und die Nacht zog herauf. Kreuthner sah hin und wieder zu der Frau. Sie brauchte lang, denn sie war gründlich. Unglaublich gründlich. Im Osten wurde es jetzt finster.
»Du musst a bissl hinmachen. Es is gleich dunkel.«
»Du musst auch nicht auf mich warten.«
Kreuthner überlegte, ob er das Angebot annehmen sollte. Aber das brachte er nicht über sich, dass er eine Frau nachts im Winter allein auf dem Wallberg zurückließ. Also wartete er. Lang. Sehr lang. Als Daniela hinter den Latschen hervorkam, standen die Sterne am Himmel. Zum Glück auch der Mond, so dass man die Piste erkennen konnte.
»Geht’s wieder?«
Daniela nickte. »Wo fahren wir runter?«
»Herrnabfahrt. Die kenn ich wie meine Westentasche. Bei dem Mond kein Problem.«
Daniela sah zweifelnd den dunklen Berg hinab.
8
Wo sind wir denn?« Danielas Stimme klang gereizt, aber auch brüchig, als kämpfe sie mit den Tränen.
»Wir müssten gleich auf die Rodelbahn stoßen. Das kann nimmer weit sein. Obacht!« Der zurückschnalzende Fichtenzweig schlug Daniela heftig und unerwartet ins Gesicht. Sie schrie auf und fluchte. »Ich hab doch Obacht gesagt«, rechtfertigte sich Kreuthner.
»So ein Mist! Meine Kontaktlinsen sind rausgefallen.«
»In den Schnee?«
»Ja wohin denn sonst?«
Kreuthner blickte zurück, konnte Daniela aber nur erahnen, obwohl sie keine drei Meter entfernt war. Hier mitten im Nadelwald war es – wie Onkel Simon (berühmt auch für seine treffenden Vergleiche) sagen würde – dunkel wie im Bärenarsch. »Wie willst denn hier Kontaktlinsen finden?«
»Ich seh aber nichts ohne Kontaktlinsen.«
»Macht im Augenblick net viel Unterschied, oder?« Kreuthner stapfte mit seinen Skiern durch den knietiefen Schnee zu Daniela zurück.