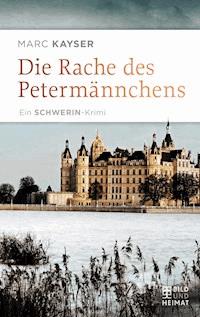Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hinstorff
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Vor 25 Jahren raste ein Unbekannter in Kühlungsborn über die Seebrücke, versank in den Fluten und galt seitdem als verschollen. Doch dann meldet sich eine verwirrt klingende Person über die Notrufnummer der Polizei und behauptet, nicht nur sich, son- dern auch drei weitere Menschen umgebracht zu haben. David Lux, ein ruheloser, pensionierter Polizeireporter mit besten Verbindungen zur Mord- kommission, nimmt die Verfolgung auf. Der Anrufer entpuppt sich als ein Wesen, das sich tarnen kann wie ein Chamäleon. Lux ahnt nicht, dass sowohl er als auch sein bester Freund, Hauptkommissar Karl Delgado, selbst auf der Todesliste des "Schwarzen Falters" stehen ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 326
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Marc Kayser
Schwarzer
FALTER
Tatort: Weststrand
Der Inhalt dieses Buches ist ein Produkt meiner Fantasie. Jede noch so winzige Ähnlichkeit mit lebenden oder verstorbenen Personen ist unbeabsichtigt und wäre rein spekulativ. Spekulationen sind irrational und führen demzufolge ins Nichts.
Die Erwähnungen der Marken und Produkte in diesem Buch dienen nicht etwa der Werbung. Sie illustrieren lediglich das persönliche Umfeld des Autoren und ihren normalen Gebrauch.
Für Loui.
Man muss es töten, um es loszuwerden. T. P.
Teil I
1
30. April, vor 25 Jahren
Die Sonne stand an diesem Abend schon tief über dem Meer und ihre Strahlen glitzerten wie Goldstaub auf den von einem kräftigen Wind aufgewühlten Wellen. Es war ein Licht wie gemacht für lange Schatten. Und so beeindruckte das schlanke, etwa 240 Meter lange Tragwerk der noch jungen Seebrücke nicht nur mit seiner Weite, die hinaus aufs Meer führte. Auch die Lichterspiele um die Pfeiler, Balken und Geländer mit ihren Spiegelungen im unruhigen Wasser waren hübsch anzusehen. Die gesamte Seebrücke war, bis auf den Laufsteg, aus festem Holz gebaut. Statt der typischen weißen Farbe maritimer Bauten, hatte sie nur einen farblosen Schutzanstrich erhalten. Sie war erst vor wenigen Wochen mit kleinstädtischem Pomp und unter Anwesenheit vieler Schaulustiger und Honoratioren für die Öffentlichkeit freigegeben worden. Jedes Teil war neu verschraubt und frisch gewachst. Rettungsringe hingen noch unbenutzt an ihrem Platz und das Brückenende zierte ein besonders massives Geländer aus Balken, die so stark schienen wie die Oberarme eines Karatekämpfers. Ihre Querverstrebungen waren allerdings sehr schmal geraten und machten den Eindruck, als haute sie der gleiche Kämpfer beim ersten Mal entzwei.
Es war der letzte Abend im April. Kaum jemand war unterwegs. Vielleicht, weil der 1. Mai auf einen Samstag fiel und daher unattraktiv für Arbeiter und Angestellte war oder weil niemand in diesen Tagen dem Frühling traute. So kurz nach den turbulenten Monaten der deutschen Wiedervereinigung hatten sich nur wenige Touristen in den spärlichen Quartieren entlang des Kühlungsborner Ost- und Weststrands eingebucht. Nur vereinzelt leuchteten in der Abenddämmerung die gelben Tupfer der Regencapes auf, die einen vor der Gischt schützten, die der scharfe Westwind in die Luft trieb. Es würde eine kühle Frühlingsnacht werden, wolkenlos mit Sternen, mit einem tosenden Meer und dem harten Rauschen eines unerbittlichen Windes.
Aus dem Schutz des Halbdunkels tauchte ein Motorrad auf, das ohne Licht fuhr und von dem beinahe kein Motorengeheul zu hören war. Die Geräusche des Meeres lagen über den Tönen der Stadt. Die Maschine schlich die angrenzende Straße zur Meerespromenade entlang, hielt in Sichtweite zur Brücke und wurde von ihrem Fahrer in eine der engen Parklücken direkt neben einen leeren Baucontainer gelotst. Er stieg vom Krad, spazierte mit seinem dunklen Anglerrucksack zur Brücke und schlenderte über die frischen Planken bis an ihr Ende.
Er entnahm dem Rucksack einen faltbaren Hocker, einen Schreibblatt großen Spiegel, einen simplen Handfeger, eine schmale Säge und eine Thors Hammer-Meeresangel mit Pilker und Rolle. Er steckte die Teleskoprute zusammen, warf Haken und Blei aufs Wasser hinaus und arretierte ihren Schaft zwischen zwei Planken des Holzbodens. Dann ließ er sich auf dem Hocker nieder, platzierte den Spiegel so, dass er den Eingang zur Brücke im Visier hatte und fuhr leicht mit dem Daumen über das Blatt der Säge. Er schnalzte leise mit der Zunge und trieb das Werkzeug dann horizontal in die Querstreben des Geländers. Vorsichtig und mit ruhigen Bewegungen zerteilte er das Holz von oben nach unten, wobei er es nicht vollständig zerschnitt, damit es nicht auseinanderfiel. Währenddessen sah er immer wieder in den Spiegel, ob sich ihm irgendwer näherte. Doch die Luft war rein. Und so sollte es auch bleiben.
Nach nicht einmal einer Viertelstunde legte der Kradfahrer die Säge aus der Hand und säuberte mit dem Handfeger verräterische Holzspäne vom Brückenboden, verpackte Spiegel und Säge, holte die Rute ein, schob sie zusammen und verstaute alles wieder in seinem Rucksack.
Ruhig und ohne hektische Bewegungen spazierte er gemächlich über die Brücke zurück zu seinem Krad. Im Schatten des Baucontainers entledigte er sich mit einer schnellen Bewegung seines Rucksacks. Danach zog er seine schwarze Jacke, die schwarze Hose und die schwarzen Schuhe aus und warf sie in den Container. Barfuß, in Shorts und T-Shirt entriegelte er das Krad und schob es beinahe geräuschlos bis kurz vor den Brückenanfang. Er warf sich, fröstelnd und so dünn bekleidet wie er war, auf die Maschine und startete sie. Fast wie in Zeitlupe schlich das Motorrad über die 240 Meter lange Brücke und heulte dann an ihrem Ende laut auf. Mit einem schnellen Satz durchbrach sie mit ihrem Vorderrad und dem metallenen Schutzblech scheinbar mühelos die zuvor angesägten Querstreben des Brückengeländers. Maschine und Fahrer segelten, begleitet von zerborstenen Holzteilen, durch die Luft und stürzten ins gurgelnde Wasser.
Während das Krad versank, tauchte der Fahrer nach wenigen Sekunden wieder auf und drückte sich wie eine Amphibie mit kräftigen Beinstößen durchs Wasser. Nach wenigen Minuten erreichte er den Strand und schlich gebückt über den weichen Sand hinauf zur Uferpromenade.
Vorsichtig und das Dunkel suchend, erreichte der Motorradfahrer den Container, schlüpfte nass in seine Kleidung und verschwand schließlich zwischen den Bäumen des an die Strandstraße angrenzenden kleinen Parks.
2
Am nächsten, frühen Morgen
»Dort«, zeigte der Jogger auf die Spuren eines Reifens im Sand vor dem Zugang zur Kühlungsborner Seebrücke, »dort hat er sicher Anlauf genommen und ist dann hinübergerast.« Er war ein langer, dünner Mann mit Halbglatze, so an die sechzig oder darüber, trug lächerlich eng anliegende Thermohosen aus einer schwarzen Kunstfaser und ein graublau verwaschenes T-Shirt. Sein Schnurrbart hüpfte bei jedem Wort.
Die beiden Beamten der Polizeiwache Kühlungsborn blickten mit einer Mischung aus Skepsis und Unmut über die Brücke hinaus aufs Meer. Schließlich bückte sich einer von ihnen, begutachtete zuerst die deutlichen Reifenspuren im Sand, dann die schwarzen Ölflecken auf den Bohlen und sagte: »Teufel noch eins! Das muss ein Höllenritt gewesen sein.«
»Hab schon ein paar Leute gefragt, aber niemand will irgendwas gesehen oder gehört haben«, informierte ihn der Jogger.
»Wie sind Sie drauf gekommen?«, fragte ihn der zweite Polizist. Er trug einen grauen Vollbart und seine wenigen Haare waren schon sehr weiß. Seine Hände hatte er lässig in die Hosentaschen geschoben.
»Gehe frühmorgens immer laufen. Und als Krönung renne ich jetzt immer die neue Brücke rauf und wieder runter. Hab das Loch vorn am Schiffsanleger und die vielen zerstörten Holzteile gesehen.« Der Jogger machte ein besorgtes Gesicht.
Der Wind hatte in den frühen Morgenstunden an Kraft verloren, und so gingen die drei Männer gemächlich bis ans Ende der Brücke. Sie blickten unisono fassungslos auf die stattliche Bruchstelle in den oberarmdicken Holzverstrebungen. Sie tat sich vor ihnen auf wie das hungrige Maul eines Wales. Dort, wo der Ponton und die Eisendüker für die Schiffstaue im Wasser verankert waren, schwammen dünne, durchsichtige Ölschwaden auf der Wasseroberfläche, die in der Sonne bunt schillerten. Von den Holzsplittern und den zerschlagenen Resten des Brückenkopfes war nichts mehr zu sehen. Sie waren vom Wind und den Wellen davongetragen worden.
Die beiden Polizisten und der Jogger sahen mit konzentrierten Blicken auf die Wasseroberfläche.
»Siehst du was, Uwe?«, fragte der Beamte mit dem Vollbart seinen sehr viel jüngeren Kollegen. Uwe schien nicht älter als Mitte zwanzig zu sein und hatte noch das Gesicht eines Milchbubis, an dem die Zeit vorbeigegangen war. Doch beide trugen ihre Polizeimützen so schief auf dem Kopf wie Pariser Clochards ihre Schiebermützen.
»Nein, nichts«, antwortete er.
»Aber hier hat zweifellos eine Sache stattgefunden«, beharrte der Jogger. Sein Gesicht zeigte einen wichtigtuerischen Ausdruck. Er kratzte sich am Kinn und schaute ebenfalls auf das Wasser vor ihnen.
Die Polizisten nickten stumm.
»Von einem Fahrzeug keine Spur, von einem Fahrer keine Spur, nur gesplittertes Holz.«
»Das sehen wir, Kumpel«, brummte Uwe jetzt genervt. Er nahm seine Mütze ab, streichelte sich den dichten Haarschopf und wandte sich seinem Kollegen zu: »Machst du Meldung A 1?«
»Ja, ist ein Fall für die Taucher«, bekam er zur Antwort. Der ältere Polizist nickte eher abwesend als dienstbeflissen mit dem Kopf. Ihm schwante, dass es ein langer, nervenaufreibender Tag werden würde. Er hatte nur noch fünf Jahre bis zur Rente. Und Uwe würde ihn als Leiter der kleinen Kühlungsborner Wache sicher einmal ablösen. »Gehen wir in die Dienststelle«, sagte er.
»Ja, gehen wir«, antwortete Uwe, »aber vorher noch eine Currywurst. Musste ja heute das Frühstück stehen lassen. – Und Sie«, wandte er sich an den Mann mit den eng anliegenden Hosen aus Chemie, »halten sich für eine Zeugenaussage bereit. Ich benötige noch Ihre Daten.«
Der Jogger zog ein dünnes Portemonnaie unter seinem T-Shirt hervor, aus dem er seinen Personalausweis nestelte. Der jüngere Polizist notierte seinen Namen und Anschrift. Der Zeuge brummte noch irgendetwas, wackelte dabei eindrucksvoll mit seinem Schnauzbart und trabte dann davon.
Die dünne Beweislage hielt zwei weitere Tage. Schließlich fanden Beamte der Spurensicherung heraus, dass die schwarzen Flecken auf den Brückenplanken vom Öl eines Zweitaktmotors stammten. Polizeitaucher fischten beinahe zeitgleich ein Motorrad der Marke MZ 150 ohne Kennzeichen aus dem Meer. Vom Fahrer fehlte jede Spur. Nach drei weiteren Versuchen stellten die Taucher ihre Arbeit ein. Man nahm an, dass der Körper im Meer verschwunden war. Sie konnten nicht ahnen, dass die Ostsee an dieser Stelle auch in Zukunft ihr Geheimnis behalten und keine Leiche freigeben würde.
3
Polizeipräsidium Rostock, Zentrale, heute
Das Klingeln des Telefons riss den diensthabenden Beamten, einen älteren Herrn mit langen Koteletten und kurz geschorenem Haar, aus seinem Ruhemodus. Seine Halbbrille saß ihm schief auf der Nase. Er hatte es sich in seinem zerschlissenen Lederstuhl bequem gemacht, die Füße auf den Schreibtisch gelegt und stocherte mit einem Holzstäbchen in seinen Zähnen. Es war bislang ein friedlicher Vorabend zum 1. Mai gewesen, auch wenn in der Dienstbesprechung am Morgen vor spontanen Demonstrationen gegen die Flüchtlingspolitik der Regierung und vor möglichen Gefährdungssituationen durch vagabundierende Terroristen gewarnt worden war. Der Beamte versuchte gerade seinen hinteren Backenzahn zu malträtieren, als er dem unaufhörlichen Klingeln des Telefons nachgab und den Hörer abnahm.
»Polizeipräsidium Rostock. Wer ist am Apparat?« Der Polizist lauschte angestrengt. Die Miene seines Gesichts wirkte nun so angespannt wie die eines Richters vor einem Urteilsspruch. Er hörte nichts als ein Hintergrundrauschen, durchbrochen von einem merkwürdigen Pfeifen, das so ähnlich klang wie eine Polizeisirene. »Hallo?«, fragte er jetzt in barschem Ton. Er schwang seine Füße auf den Boden und setzte sich aufrecht in seinen Stuhl. Den weißen Telefonhörer hielt er eng an sein Ohr gepresst. »Hallo, wer ist denn dort?«, fragte er nochmals, die Stimme weiter erhoben.
»Ich möchte einen Mord melden«, sagte eine Stimme am anderen Ende. Sie klang fest, ihre Farbe ließ eher auf einen Mann als auf eine Frau schließen.
Die Augen des Beamten schnellten auf den Monitor vor sich. Die Sprachaufzeichnung und die Nachverfolgung des Anrufers liefen. Es würde allerdings mehr als dreißig Sekunden dauern, bis das Programm herausgefunden hatte, woher der Anruf kam. »Werden Sie mal konkreter!«, rief der Polizist in den Hörer. Er versuchte Zeit zu gewinnen. Seine Brille war ihm jetzt noch weiter die Nase heruntergerutscht.
»Es ist beinahe auf den Tag 25 Jahre her.« Es knackte mehrfach in der Leitung, technische Geräusche wie bei einer Stimmenüberlagerung waren zu hören. Außerdem glaubte der Beamte, weitere Stimmen im Hintergrund zu vernehmen. »Eine Frau, sie hieß Christine. Ich habe sie umgebracht. Mehr ist dazu nicht zu sagen. Vielleicht ein Tipp: Sie war, wie ich nie sein wollte …«
Die Verbindung wurde getrennt. Der Beamte sah mit fassungslosem Gesichtsausdruck erst auf seinen Hörer, dann auf das Holzstäbchen zwischen seinen Fingern. Es klebte ein winziger Speiserest daran. ›Sie war, wie ich nie sein wollte?‹, der Beamte zog seine Stirn kraus. Was sollte das heißen?
Das Programm auf seinem Monitor öffnete ein Fenster von der Größe einer Streichholzschachtel. Ein Kartenausschnitt mit einem Pfeil und ein schmales Textfeld wurden sichtbar. Gebannt starrte der Beamte auf die Nachricht: Übertragung Datenleitung. Keine Verifizierung möglich. Mit der Maus dirigierte er die Sprachaufzeichnung auf Anfang. Er dachte angestrengt nach.
»Scheiß Internet«, fluchte der Polizist, wuchtete sich aus seinem Stuhl und verließ das Zimmer. Er kam nicht weit. Das Telefon schrillte erneut. Der Beamte bellte ein »Ja?« in den Hörer. Ein wütender Autofahrer meldete sich, um sich darüber zu beschweren, dass die rechte Notfahrspur der Autobahn nach Rostock trotz eines Staus nicht freigegeben war.
»Verschwinden Sie aus meiner Leitung«, keifte der Beamte böse, »sonst schicke ich Ihnen eine Rechnung wegen Zeitverschwendung von Beamten.« Dessen Handynummer sah er, könnte sie sogar zurückverfolgen lassen.
Doch der mysteriöse Anrufer hingegen blieb im Dunkeln. Der Polizist eilte aus dem Raum. Der Mord, den der Unbekannte gestanden hatte, klang nach einem unheimlichen Vorgang, den er dringend melden und mit seinem Vorgesetzten besprechen musste.
4
Jede Nacht war anders, doch die Träume blieben gleich. Nur in winzigen Nuancen verändert kamen sie immer wieder über ihn. David Lux, ein leicht adipöser, recht großer Mann, lag im Bett seiner Wohnung in der Goethestraße im norddeutschen Städtchen Bad Doberan und träumte schwer. Sein schon silbrig scheinendes, blondes Haar schimmerte feucht von Schweiß. Die Flügel seiner auffallend gerade gewachsenen Nase hoben und senkten sich bei jedem seiner schnellen und unregelmäßig klingenden Atemzüge hektisch mit. Als er sich jetzt in seinem Bett auf die andere Seite warf, ächzten die Holzlatten unter der Matratze, als wäre es deren letzte Nacht. Heute träumte Lux von einer gefährlichen Gefängnismeuterei, die brutal und blutig ablief …
Er ist in einem Gefängnis für Schwerverbrecher inhaftiert.Er leidet wie auch seine Mitgefangenen unter schlechten hygienischen Bedingungen, sexuellen Übergriffen und Gewalt unter den Arretierten. Er lebt wie ein gefangenes Tier in einer miesen vergitterten Unterkunft, die aus nicht mehr, als einer Pritsche, einem harten Stuhl und einem von Holzwürmern zerfressenen Tisch besteht.
Und dann fallen sie über einen Gefängniswärter her. Lux mittendrin. Erst schlagen die Häftlinge dem Mann mit Fäusten ins Gesicht, dann haut ihm einer das stumpfe Ende eines Beils über den Kopf. Zwei weitere Gefangene stürzen sich auf einen anderen Wärter, schleppen ihn in das vergitterte Dienstzimmer, das die Justizangestellten kurz zuvorverlassen hatten, um die auf den Gängen lungernden Gefangenen für die Nacht wegzusperren. Ein dritter Beamter, ältlich und schmächtig, kann nur noch einen Notruf absetzen, dann fallen Lux und Kumpane auch über ihn her. Mit Messern, die sie im Dienstzimmer der Wachmänner finden, zerschneiden sie ihren Opfern Gesichter und Rücken. Dann reißen sie den blutenden Wärtern die Kleider vom Oberkörper und schleppen sie vor das Gefängnistor. Dort drohen sie, die Männer zu erstechen, falls ihnen nicht geöffnet und ein Fluchtauto bereitgestellt werde.
Die Meuterei wird nach Stunden von einem Sondereinsatzkommando der Polizei beendet. Als die Streifenwagen abgefahren sind, bleibt eine abgeschlagene Hand auf dem Asphalt vor dem Gefängnis liegen. Sie spiegelt sich in den Pfützen der Straße.
5
Der Mann erwachte, setzte sich mit einem Ruck auf und sah benommen von diesem Albtraum, der wie ein schweres Unwetter über ihn gekommen war, auf die Bettdecke vor sich. Er wirkte abwesend, stark verschwitzt und atmete schwer. Strähnen seiner Haare klebten an der schweißnassen Stirn. Sein Mund war trocken, seine Hände kalt wie Eis. Er sprach mit sich selbst, er monologisierte darüber, was es mal wieder gewesen war, das da an ihm zerrte, während seine Augen geschlossen waren. Wer war er, während er träumte? War er es, der da schlief oder war es nur seine Hülle? Und wo wäre seine Seele dann, wenn nicht in seinem Körper in diesem verdammten Bett? Er stellte sich vor, dass sie nachts um die Häuser schlich. Immer auf der Suche nach einem Ereignis, das dem Alltag Farbe verlieh. Die Nacht zuvor hatte er gefesselt im Zentrum eines Feuerkreises gelegen, aus dem es kein Entrinnen gab. Vor einer Woche war er im Schlaf durch ein Weizenfeld gerannt, doch er kam nirgends an. Und immer wieder berührten ihn die Hände fremder Menschen, die ihn drückten, nach ihm griffen, ihn packten, an sich zogen, liebkosten und wieder von sich stießen – doch sie hatten keine Gesichter. Zumeist wachte er erst am Morgen auf und konnte sich nur noch vage an seine Träume erinnern, die ihm wie Horrorfilme erschienen.
Doch heute war es noch finster vor seinen Fenstern. Lux hatte gerade mal zwei Stunden geschlafen. Es war 2:35 Uhr. Er torkelte schlaftrunken in sein Bad, entzündete wegen einer defekten Glühlampe eine Kerze, öffnete das Kippfenster einen Spalt und sah im Spiegel ein verzerrtes Gesicht, in dem noch immer die Furcht stand. Falten, wie von einem Messer gezogen, hatten auf seiner Stirn und den Wangen die Vergangenheit für immer dokumentiert. »Schnaps wär jetzt nicht schlecht«, murmelte er und sah seine Mundwinkel zittern. In der Küche griff er nach einer Flasche Irish Whiskey. Er bediente sich ohne Glas.
Vor dem Fenster tauchte ein fahles Mondlicht die Straße in kalte Grautöne. Der Himmel war fast wolkenlos und voller glitzernder Sterne. Doch das imposante, stille Leuchten hatte eine mächtige Begleitung. Starker Wind aus West durchwühlte die Kronen der Bäume auf dem Hof vor seinem Haus, einer alten Villa, die sich Lux mit zwei weiteren Parteien teilte.
Es war inzwischen drei Uhr am Morgen. Lux ließ sich in einen der zwei Clubsessel fallen, die er vor Jahren von einer alten Tante geerbt hatte. Ihm gefiel, dass das Leder noch immer so frisch war, als sei es erst kürzlich aufgezogen worden. Lux pflegte die Dinge, die ihn umgaben, mehr noch: Er war ein Ordnungspedant, der sofort beseitigte, was ihm als Störung vorkam.
Plötzlich krachte etwas gegen das Fenster seines Wohnzimmers. Er zuckte zusammen. Dann sprang er wie eine Stahlfeder aus seinem Sessel hoch und sah angestrengt durch die Scheiben nach außen. Vielleicht ein Ast, der wegen des starken Windes vom Baum gebrochen war? Aber da war nichts, außer im Wind schaukelnde Wipfel und ein Mond, von dem nur noch ein kleiner Rest durch eine einsame Wolke ragte.
Lux wollte sich soeben abwenden, als er das Licht einer Taschenlampe aufblitzen sah. Er öffnete das Fenster. Die kühle Nachtluft, die ihm entgegenschlug, machte seinen Atem kalt. Fröstelnd spähte er über den Hof, doch der Mond war nicht hell genug, als dass aus dem Geräusch auch Bilder wurden. Er verharrte einen weiteren Moment, schloss aber dann, noch immer leicht benommen, das Fenster, knipste die Lichter in seiner Küche aus, durchquerte seine Wohnung, warf sich in seinem Schlafzimmer aufs Bett und verschränkte die Arme hinter dem Kopf. Der Schweiß auf seiner Stirn war getrocknet, sein Atem klang wieder gleichmäßig und ruhig. Die Whiskeyflasche blieb neben einem der Sessel stehen und im Bad tanzten Mücken im Schein der Kerze. Er hatte vergessen, sie zu löschen.
Der Mond stand jetzt wieder strahlend am Himmel. Sein Licht spiegelte sich auf dem nassen Asphalt vor dem Haus. Er beleuchtete eine große, offenbar weibliche Person, die nicht weit von hier auf der gegenüberliegenden Straßenseite stand und zu den Fenstern von Lux emporblickte. Ihren auffälligen Ohrschmuck sah man nicht.
6
Montag, 1. Mai
Als Lux neuerlich erwachte, war es kurz nach zehn Uhr am nächsten Morgen. Wegen seines unruhigen Schlafs wirkte sein Gesicht gerade mal so frisch wie ein fünf Tage altes Salatblatt. Noch immer missgestimmt von dem turbulenten Traum der Nacht, schlug er mit zu viel Kraft vier Eier in die Pfanne, wovon ihm zwei zuvor in der Hand zerbrachen. Fluchend gab er Milch dazu, würzte die breiige Masse mit Salz, Pfeffer und Thymian und gabelte das Gemisch nach der Garung direkt aus der Pfanne auf. Später duschte er, rasierte sich und wählte aus seinem Kleiderschrank ein weiß-blau gestreiftes Hemd, Jeans und ein Sakko, dazu graue Strümpfe und schwarze Schuhe, die an den Hacken leicht abgetreten waren. Die Espressomaschine gurgelte, während ihm Spiegel Online auf seinem Laptop die frischesten Nachrichten zeigte, die sich nun schon seit Monaten mit dem Ansturm von Kriegs- und Balkanflüchtlingen und ihrer Eingliederung nach Deutschland und Europa sowie den Terroranschlägen in Westeuropa beschäftigten. Lux atmete diese Meldungen oberflächlich und mit einer gewissen Abwehr ein, wie es Millionen anderer Menschen möglicherweise auch taten, weil in der Flut der Meldungen das gleiche Chaos herrschte wie unter den Flüchtlingen, freiwilligen Helfern und Sicherheitsbehörden. Und Chaos machte in einer Welt voller Nachrichten die Menschen erst neugierig, dann wütend und schließlich gleichgültig.
Mit einem Espresso in der Hand stellte er sich an ein geöffnetes Fenster und sah von seiner Position im ersten Stock hinunter auf die Straße. Es war ein friedlicher und heller Vormittag, ein freundlicher Bote des angebrochenen Frühlings. Auf der Fensterbank neben ihm lag eine Fernbedienung. Er drückte auf einen Knopf. Die Musik setzte irgendwo in der Mitte eines Liedes ein, das er am Tag zuvor gehört hatte. Eine kraftvolle Ballade von Bob Dylan: Like A Rolling Stone.
Lux lebte in einer Eigentumswohnung mit hohen Decken, schönen Holzfußböden und restaurierten Kastenfenstern, vor denen eine schmale, beinahe die gesamte Wohnung umlaufende Terrasse angebaut war. Sie war zur Straße hin ausgerichtet, sodass er von ihr aus einen weiten Blick in das Zentrum von Bad Doberan und zur anderen Richtung nach Heiligendamm hatte. Unweit der alten Villa verliefen die Gleise einer Schmalspurbahn, die alle hier nur Molli nannten. Seine Wohnung hatte er nach mehr als zehn Jahren der Verschuldung abbezahlt, ihre Einrichtung seither kaum verändert. Lux lebte in einer Möbelmischung aus modern und vintage. Die Sessel und das Sofa waren zwar alt, aber gut erhalten; auffällig der große, alte Esstisch aus hellem Eichenholz, an den sechs Stühle passten und der einmal im Besitz eines Bauern gewesen war, der seine Landidylle vor Jahren gegen eine Stadtwohnung eingetauscht hatte. Auch die Bücherregale und ein imposantes Schreibtischungetüm, das in seiner Länge zwei und in der Breite eineinhalb Meter maß, hatte er aus der bäuerlichen Haushaltsauflösung übernommen und restaurieren lassen.
Fast wie ein Fremdkörper stach seine Musikanlage aus dem wilden Stilmix heraus, die mit ihrem Internetempfang, USB-Anschlüssen für einen iPod und der Festplatte für die Speicherung von Musik der letzte Schrei war. Auch die Küchengeräte, Kühlschrank, Backofen und Mikrowelle waren nicht mehr von gestern. Lux telefonierte und schrieb Nachrichten mit einem iPhone der neuesten Generation, hatte aber seinen Fernseher schon vor Jahren abgeschafft. Dort, wo ein Flachbildschirm hingepasst hätte, prangte stattdessen ein riesiger Spiegel, der das Licht des Hofes, die Bäume und die Farbe des Himmels wiedergab und so die Wohnung optisch reichlich illustrierte. Sämtliche Wände waren in der Farbe von hellem Sand gestrichen und nicht tapeziert. Die Küche hatte Lux in den Wohnraum integrieren lassen, das Schlafzimmer wirkte eng und schmal, das Arbeitszimmer hingegen war großzügig geschnitten. Es wurde von einer Unzahl an Büchern und eben jenem Schreibtisch dominiert, auf dem sich ein Apple-Rechner seinen Platz mit einer ziemlich unübersichtlichen Anzahl an Zeitschriften, Magazinen und Papieren teilen musste.
Lux hatte, außer in seinem Arbeitszimmer und neben dem Esstisch, keine Fotos an den Wänden hängen. Jene, auf denen er aß, trank und mit seinen Gästen redete, zeigten ihn in sehr persönlichen Posen. Der junge David als Teenager mit langen, blonden Haaren, nur spärlich bekleidet am Strand von Heiligendamm. Daneben Fotos von Ausflügen mit Freunden ans Meer, mit seinen Eltern im Urlaub, mit einer Freundin beim Angeln. Andere Abbildungen zeigten ihn zum Beispiel mit einer Urkunde, auf der das Wort Diplom zu erkennen war, Lux im Anzug als frisch gebackener Absolvent der Uni, oder als Journalistenschüler. Auf diesen Bildern zog er oft ein Gesicht, als sei der Ernst des Lebens ein böses Tier. Ein Foto stach besonders heraus: Zu sehen war Lux als Mann von Mitte dreißig oder kurz darüber mit einem Anstellungsvertrag eines Hamburger Medienhauses in den Händen. Hier war er nach 1990 als Polizeireporter bei einer auflagenstarken Zeitung untergekommen, die eine Redaktion in Rostock betrieb. Ihre Nachrichten, Berichte und Reportagen entnahm sie dem bunten Boulevard des Lebens und genau dorthin platzierte sie diese auch wieder.
Andere Fotos, auf denen er mit Freundinnen zu sehen war, hatten ihre letzte Ruhe in den Schubladen einer klobigen Anrichte gefunden, die zu nichts anderem taugte, als nur schwer und braun ein Stück Wand zu verdecken. Es war die Art, mit der sich Lux gegen seine intime Vergangenheit wehrte, vor allem wenn er als Verlierer aus dem Rennen um Zuneigung und Liebe gegangen war. Und von solchen Ereignissen hatte es einige gegeben. Seiner Ansicht nach war es besser, sich die daran beteiligten Gesichter nicht wieder als Fotogalerie ins Gedächtnis zurückzurufen. Einen eher lieblosen Platz, nämlich an der rückwärtigen Seite der Wohnzimmertür, hatte ein respektabel großer Jahreskalender, der im Vergleich zu seiner aktiven Reporterzeit nur noch mit einem Bruchteil der Menge an Terminen und Hinweisen vollgeschrieben war. Allerdings signalisierte ein fetter roter Punkt, wie in den Jahren zuvor auch, dass er am 24. Mai Geburtstag haben würde. Wenn er gesund blieb und niemand nach seinem Leben trachtete, würde er dann 66 Jahre alt werden. Das war in etwas mehr als drei Wochen. An diesem 24. Mai würde er auch auf den Tag genau ein Jahr lang Pensionär sein. David Lux, Polizeireporter außer Dienst.
Ein anderer Termin war mit einem blauen Punkt und der Ortsangabe Hamburg markiert. Das war heute.
Lux stellte seine Espressotasse in den Geschirrspüler, wischte sorgsam den Ausguss seiner Küche trocken, trennte die Kaffeemaschine vom Strom und wusch sich dann die Hände. Er sah auf die Uhr. Zeit, sich auf den Weg zu machen. Er griff nach seiner schmalen abgewetzten Ledertasche, die ihm schon seit Jahren ein verlässlicher Begleiter war, blickte sich nochmals kurz in seiner Wohnung um und verschloss dann die Wohnungstür.
Auf der Straße vor dem Haus begegnete er seiner Nachbarin. Obwohl sie beide schon sehr lange Tür an Tür wohnten, kannte er noch immer nicht ihren Namen. Und so murmelte er etwas von einem »Schönen Tag!« und schob sich dann schnell an ihr vorbei. Sie war eine Frau von Mitte 50 oder kurz darüber, mit blonden, hübsch frisierten Haaren, Grübchen in den Wangen und einem gepflegten Teint. »Regnen soll’s«, hörte er sie noch zu einem ihm unbekannten, älteren Herrn sagen, der so dicht vor ihr stand, als wäre er ihr sehr vertraut. Mit ihren Worten im Ohr und der kurzen Überlegung, wer der Mann wohl gewesen sei, entriegelte er sein Cabriolet, plumpste auf den Sitz und brauste davon. Der Wind, der durch sein geöffnetes Fahrerfenster kam, verwirbelte ihm das Haar. Die Luft war mild und klar und die noch junge Maisonne zeigte bereits Muskeln. Sein Mobiltelefon gab einen Laut von sich. Eine Nachricht: Treffen 16 Uhr im Café Leander. Bis später. Lux lächelte zufrieden in sich hinein. Er mochte Verlässlichkeit. Wenn Lux zu seiner Verabredung mit einem Redakteur des Stern am Hamburger Baumwall wollte, musste er von der A 1 aus Lübeck kommend, durch die Innenstadt fahren.
Das drohende Unheil kündigte sich schon wenige Kilometer hinter der Autobahnabfahrt an. Er hatte kaum den Stadtteil St. Georg erreicht, als er die massive Polizeipräsenz bemerkte. Er schaltete das Radio an – und landete inmitten einer Live-Reportage über Ausschreitungen in der Innenstadt. Der Maifeiertag war auch in Hamburg der Tag der Demonstrationen. Aber für Arbeit, Gerechtigkeit oder gute Löhne ging auch hier in diesem Jahr niemand auf die Straße. Vielmehr trieb die Menschen die Flüchtlingspolitik der Regierung und die Wanderungsbewegungen von Millionen Menschen aus der Dritten in die Erste Welt um. Der überwiegende Teil der Demonstranten enthüllte auf Plakaten und Transparenten Wortkaskaden der Solidarität und der Hilfegefühle für die Asylsuchenden. Für Nervosität sorgten bei Polizei und Staatsschutz Provokateure, die eine angebliche Überfremdung Deutschlands durch die nicht enden wollenden Flüchtlingsströme aus den Kriegsgebieten in Syrien, Afghanistan und Somalia fürchteten und mit markigen Parolen deren Abschiebung forderten. Lux sah Transparente mit der Aufschrift Deutschland erwache! und Schiebt die Bundeskanzlerin endlich ab. Molotow-Cocktails flogen, und nur ein paar hundert Meter weiter hatte die Polizei das Hamburger Rathaus, den Fischmarkt und die Hafencity abgeriegelt. Vor dem SPIEGEL-Hochhaus stand eine Hundertschaft schwer bewaffneter Beamter. Sondereinsatzwagen johlten mit Blaulicht durch die Straßen, zwei Wasserwerfer bezogen Stellung.
Lux zuckelte wegen diverser Vollsperrungen ganzer Straßenzüge von einem Umweg zum anderen und hoffte, dass der Spuk am Nachmittag, wenn er Hamburg wieder in Richtung Rostock verlassen würde, vorbei war.
7
Zur selben Zeit saß ein Mann mit dunklem, kurzen Haar, dunklen Augen, weich geschnittenem Gesicht mit kräftigem Bartwuchs und auffällig schmalen, kleinen Händen vor einem Spiegel im Zimmer eines Hamburger Hotels. Augen- und Stirnpartie wirkten stark umschattet und müde, als habe er viel gefeiert, aber wenig geschlafen. In seinem rechten Ohr steckte ein auffällig türkisfarben leuchtender Schmuckstein mit einem Muster wie auf einem Leopardenfell von der Größe eines Ein-Cent-Stücks.
Auch er hörte durch die Fenster seiner Herberge die grellen Geräusche der Demonstranten und die schrillen Warntöne der Polizeisirenen, warf einen kurzen Blick aus dem Fenster, wandte sich aber scheinbar desinteressiert wieder ab. Heute würde er abreisen. Er war bereits am Freitagabend hier im Alsterhotel Heidehof untergekommen, das sich wegen seiner Küche und den passablen Zimmern einen guten Ruf erworben hatte. Mit ein bisschen Fortune erwischte man einen Tag, an dem die wenigen Zimmer mit Blick auf die Binnenalster noch nicht vergeben waren. Die Möblierung war zeitlos und mutmaßlich des besseren Rechnens wegen funktional eingerichtet. Doppelbett, Flachbildschirm, Telefon, Tisch, Schrank und Internetzugang. Das Bad verführte nicht zu Wellness, aber immerhin zur behaglichen Dusche.
Der Mann war als Heilpraktiker auf eine Veranstaltung kanadischer Sportärzte eingeladen gewesen, die vorgeblich neue Therapien für Reha-Patienten mit gebrochenen Fußgelenken vortragen wollten. Aber am Gesellschaftsabend, der nun mittlerweile zwei Tage zurücklag, fuhren die Ärzte zu seinem Ende hin ein gänzlich anderes Programm auf. Angefangen hatte es ganz harmlos. Es gab die üblichen Fachplänkeleien über physiotherapeutische Methoden und psychotherapeutische Gespräche, gefolgt von einem Drei-Gänge-Menü und einer Menge Bier und Weißwein. Doch dann überraschten die Kanadier ihre dreißig Seminarteilnehmer mit einem therapeutischen Drogenexperiment. Unter Mithilfe des Psychedelikums 2 C-E mit Namen Aquarust sollten alle Heilpraktiker eine sogenannte Psycholyse, eine Art drogenunterstützte Bewusstseinserweiterung, erreichen. Die Substanz zeigte augenblicklich Wirkung. Der Abend eskalierte zu einer Massenhysterie. Jeder aus der Gruppe torkelte, fiel um, halluzinierte. Litt unter schweren Wahnvorstellungen, Krämpfen, Schmerzen, Luftnot und Herzrasen. Auch der Mann, der vor dem Spiegel in seinem Hamburger Hotel saß, hatte vor dem starken Halluzinogen kapituliert. Zwar war es nicht sein erster Trip gewesen, den er auf diese Weise erlebte, es war jedoch der heftigste. Nur mit Mühe und unter erheblichem physischen Einsatz hatte er sich zurück in sein Hotel geschleppt.
Was aus den anderen Seminarteilnehmern wurde, erfuhr er erst aus den Zeitungen des nächsten Tages. Die Hamburger Presse überschlug sich vor diffusen Vermutungen darüber, welchen Grund es für die Drogenorgie gegeben haben könnte. Es war die Rede von medizinischen Einsatzkräften, die in buchstäblich letzter Minute einige der vergifteten Teilnehmer aus einer Lebensgefahr retteten. Einig schienen sich die Journalisten darüber zu sein, dass Sex nicht im Spiel war, wobei ein Redakteur der taz Hamburg daran erinnerte, dass es in den frühen 1970er-Jahren Exzesse ähnlicher Couleur gegeben habe und dabei jeder über jeden hergefallen sei.
Der Mann fand das amüsant.
Er riss sich den betreffenden Artikel aus und verstaute ihn in seiner Aktentasche. Er las weiter, dass die Veranstaltung ein juristisches Nachspiel sowohl für die Kanadier als auch für die Seminarteilnehmer haben würde. Doch den Mann kümmerte das wenig. Bevor ihn die Polizei oder Rettungssanitäter namentlich identifizieren konnten, hatte er, wenn auch gefährlich betäubt, aus dem Tagungszentrum entwischen können.
Er sah auf die Uhr. In weniger als zwei Stunden würde er am Hamburger Hauptbahnhof von einem Mann in dessen Auto nach Rostock mitgenommen werden. Das Handy des Heilpraktikers surrte. »Ah du«, sprach der Mann in den Hörer, »wie ist es gelaufen? Haben sie dich gekriegt?« Er lauschte auf die Worte in seinem Telefon. »Oh Gott ja, streite alles ab. Sag, du wurdest dazu gezwungen.« Der Mann tippte mit einem Finger auf die Tischoberfläche. »Nein. Mir geht es wieder ganz gut. Ich kenne das Zeug ja aus meiner Zeit in Melbourne. Da habe ich es aber besser vertragen. Aber da war ich auch noch sehr viel jünger. Sag mal, wann fährst du ab?« Er hörte zu. »Dann sehen wir uns nicht mehr«, sprach er in den Hörer. »Ich werde bald mit zurück nach Rostock genommen. Ich melde mich später mal wieder. Mach’s gut.«
Er verstaute sein Handy, trat an das Hotelfenster und blickte hinunter auf die Straße, auf der sich ein Demonstrationszug entlangbewegte. Er hörte das grelle Trillern von Pfeifen. Der Mann verzog angewidert sein Gesicht. Er griff nach einem Ordner mit Papieren und verstaute ihn in seinem Rollkoffer. Mit einem letzten Blick zurück verließ er das Hotelzimmer und hinterließ eine Wolke aus Parfüm. Sie hatte eine Note aus Sandelholz und Zitrone.
8
Nur mit Mühe und einigen Umwegen hatte Lux es geschafft, den vereinbarten Treffpunkt zu erreichen, einigermaßen pünktlich zu sein und an dem Tisch Platz zu nehmen, den er mit seinem Mitfahrer vorher verabredet hatte. Der Mann, der soeben das Lokal betrat, sah sich zunächst etwas unsicher um, steuerte dann auf Lux zu, der augenscheinlich lustlos in einer Illustrierten blätterte.
Der sah zu dem Mann auf. »Draußen ist der Teufel los«, brummte Lux.
»Ja, man sieht und hört es. Ich bin Steve, Ihr Mitfahrer.« Steve blies sich theatralisch eine Strähne aus der Stirn.
Lux’ Augen blieben auf dessen türkisfarbenem Ohrstecker mit dem Leopardenmotiv hängen. »Gut, Steve. Lassen Sie uns fahren.«
Wegen der Demonstrationen staute sich der Verkehr dicht an dicht.
»Bis wohin soll ich Sie bringen?«, fragte Lux, als sie im Cabriolet saßen. Er kratzte sich mit einem Finger an der Nase. Das Parfüm von Steve war für ihn ungewohnt. Er sah jetzt verdrießlich auf die Straße und die Autoschlangen vor sich. Er mochte es nicht, wenn Männer aufdringlicher rochen als Frauen. Und er mochte Staus nicht. In der Stadt nicht, auf dem Land nicht, nirgendwo. Seine Stimmung war sowieso nicht gut. Wegen der schlechten Ertragslage des Medienhauses Gruner + Jahr hatte der Verlag ausgerechnet jenen Zeitschriftentitel eingestellt, für den er seit wenigen Monaten als Kolumnist tätig gewesen war. Unter dem Titel Ein Lux packt zu hatte er berühmte Kriminalfälle der Vergangenheit nacherzählt und ihre Aufklärung mit seinem Fachwissen kommentiert. Doch heute war er unerwartet entlassen worden – und mit ihm mehr als dreißig weitere Redakteure.
»Wenn Sie mich in Rostock am Hauptbahnhof aussteigen lassen …«, riss ihn Steve aus seinen Gedanken. Steve bemühte sich, seiner Stimme einen festen Klang zu geben. Er wusste, dass sie nicht tief und bärig-männlich klang, eher wie die Stimme eines pubertierenden Jungen. »Ich fahre dann weiter nach Kühlungsborn.«
Obwohl Lux seinen Mitfahrer nach Bad Doberan hätte mitnehmen können, der Weg von dort nach Kühlungsborn war sehr viel näher, bot er ihm das nicht an. Steve gefiel ihm nicht. Es war aber nur ein sehr fernes Gefühl, aber immerhin doch so stark, dass er stattdessen rau fragte: »Haben Sie das Geld passend? Sonst halten wir an einer Tankstelle.« Es würde zwölf Euro kosten, die sich sein Mitfahrer aber offenbar bereits zurechtgelegt hatte.
»Nicht nötig. Passt bei mir«, sagte der mit gleichgültiger Stimme.
Lux hielt jetzt seinen Kopf so, dass er sowohl den Verkehr, als auch Steve im Blick hatte. Ihm fielen dessen lange, gebogene Wimpern und der feminine Gesichtsschnitt auf. Eigentlich hatte er keine Lust auf Smalltalk, andererseits wäre es höflich, wenigstens ein paar Worte miteinander zu wechseln. Immerhin würden sie beinahe zwei Stunden unterwegs sein. Wenn er nur nicht in so mieser Stimmung wäre. Er entschloss sich zu einer guten Miene, denn schließlich konnte sein Gegenüber nicht wissen, dass er, Lux, vor gerade einmal zwei Stunden als Autor abserviert worden war. »Was haben Sie in Hamburg gemacht, wenn ich fragen darf?« Lux mühte sich um einen herzlichen Tonfall.
»Eine Weiterbildung für Heilpraktiker«, antwortete Steve. »Es war – interessant.« Sein Tonfall klang verschlagen.
Lux entging die unüberhörbare Unaufrichtigkeit seines Mitfahrers nicht. Er schwieg einen Moment. Dann sagte er: »Ich las heute morgen von einer Drogenorgie einer Truppe von wild gewordenen Heilpraktikern. Da waren Sie aber sicher nicht dabei, oder?«
Der suggestive Unterton stimulierte Steve zu einer beinahe ehrlichen Antwort: »Vor Ihnen sitzt der lebende Beweis, dass Amphetamine trockenen Therapien viel Würze verleihen können.«
Unisono fingen beide an zu lachen, doch Lux wechselte das Thema. »Ich bin raus aus dem alltäglichen Berufskram, man hat mich in Rente geschickt. Ich bilde mich jetzt mit Whiskey und meinem Fernseher weiter.« Das war nur die halbe Wahrheit. Ihm ging seine frühere Arbeit als Polizeireporter so wenig aus dem Kopf wie einem Bienenzüchter der Honig. Er war geradezu versessen darauf, tagtäglich bei seiner früheren Sekretärin anzurufen, um zu erfahren, was es aus dem Ressort Stadtkriminalität Neues zu berichten gab.
»Das tut mir leid. Allerdings klingt Ihre neue Beschäftigung auch nicht uncharmant. Whiskey und Fernseher als neue beste Kollegen? Warum nicht?« Steve ordnete seine Beine neu.
Lux griente, brummte irgendwas, schaltete in den nächsten Gang und fluchte leise. Der stockende Verkehr ging ihm auf die Nerven.
Steve schielte aus den Augenwinkeln zu Lux hinüber. Alt war der Reporter geworden, dachte er. Als er ihm das letzte Mal begegnet war, hatte Lux noch volles Haar und kaum Falten im Gesicht. Aber Lux schien ihn nicht erkannt zu haben. Auch wenn er einen sympathischen Eindruck machte, dachte Steve, so hatte er dennoch mit ihm abzurechnen. Doch er durfte nichts überstürzen, durfte nicht riskieren, dass Lux ihn vielleicht doch erkannte und sich fragte, was er, Steve, in seinem Auto verloren hatte. Er musste ihn in ein Gespräch verwickeln, um herauszufinden, wie Lux über eine bestimmte Sache dachte. Aber eigentlich war es egal. Früher oder später würde Lux für seine Schandtat büßen müssen.
»Ich beneide Sie«, unterbrach Steve die Stille. »Sie können sich entspannt zurücklehnen. Ich hingegen mache gute Miene zu einem Job, der mich derzeit nicht befriedigt.«
Lux sah verstohlen zu ihm hinüber. Sein Mitfahrer machte jetzt einen ehrlichen Eindruck. Aber wollte er ein Gespräch über etwas, was ihn nicht interessierte? Andererseits lagen noch gut 150 Kilometer vor ihnen. »Nichts füllt einen ewig aus«, brummte er.
»Kann ja sein, aber hätten Sie Spaß daran, Tag für Tag Gliedmaßen zu mobilisieren oder sich mit anderen Physiotraumata zu beschäftigen? Ich träume eher …«
»… Träume«, unterbrach ihn David Lux in spöttischem Tonfall. »Wer in seinem Job von etwas träumt, soll zum Arzt gehen.«
»So kann man es natürlich auch sehen«, sagte Steve und lächelte fein. »Aber wer sich nur der Routine hingibt, landet irgendwann auch beim Psychologen. Oder?«
Lux bremste kurz scharf. Steve wippte in Richtung Frontscheibe. Beinahe wären sie beim Umschalten der Ampel von gelb auf rot noch über die Kreuzung gebrettert. »Sorry«, murmelte Lux.
»Gut gemacht.« Steve blickte anerkennend zu ihm hinüber.
»Und welche Alternativen zur Langeweile haben Sie?«, fragte Lux nach einem Moment.
»Ich träume von einer Spezialisierung auf Menschen, die ein neues Leben beginnen wollen. Meinetwegen auch nach schweren Operationen.«
»Klingt vage, was meinen Sie genau?«
»Jenseits von konventionellen Operationen bei Knochenbrüchen oder kaputten Gelenken und Bändern gibt es eine Vielzahl anderer Eingriffe. Nehmen Sie Krebsoperationen, Geschlechtsangleichungen, et cetera.«
»Geschlechtsangleichungen?«, fragte Lux, als habe er sich verhört.
»Ja, Geschlechtsangleichungen. Es gibt mehr als sie glauben.«
»Und was hat ein Heilpraktiker damit zu tun?«
»Heilpraktiker arbeiten auch psychotherapeutisch.« Steve machte eine kurze Pause, Lux sah auf den Verkehr vor sich. Ihn interessierte das Gespräch nicht. Er schnaufte leise vor sich hin. Steve nahm keine Notiz davon. »Ist es nicht viel spannender«, nahm Steve den Faden wieder auf, »als Therapeut einen Mann vor sich zu haben, der im Körper einer Frau steckte, oder eine Frau, die im Körper eines Mannes unglücklich war? Die Gesellschaft steht diesem Phänomen heute viel offener gegenüber, als das früher der Fall war.«