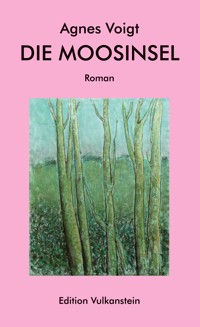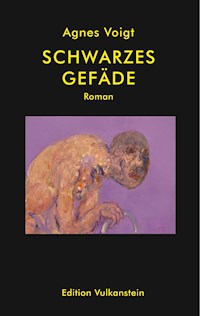
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein alter, hinfälliger Mann am Gehwagen hadert mit der Gegenwart im Altenheim. Während er sich in verstockter Reuelosigkeit die Schreckensbilder seiner Vergangenheit vor Augen führt, bedrängen ihn unerhörte Begierden, denen er in Tagträumen nachhängt. Unfähig, sich von dem schwarzen Gefäde, das sinnbildlich für das Verschweigen seiner Schuld steht, zu befreien, wird er selbst im Sterben von zerstörerischem Hass übermannt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 133
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INHALT
Greisenland
Lust
Blut
Genuss
Druckschmerz
Heimsuchung
Finsternis
Hitze
Gefäde
mit schwarzem Faden hab ich meinen Mund vernäht wenn du ihn öffnest werde ich verbluten
GREISENLAND
Nicht mehr als nutzloses Strandgut bin ich.
Zurückverschlagen an den Ort, den ich aus gutem Grund verlassen habe.
Ich bin in der Gewissheit zurückgekehrt, dass sich niemand mehr an meinen Auftritt vor Gericht erinnert, der unangenehm, doch folgenlos war. Auch nehme ich an, dass diejenigen, die die Verhandlung in der Presse verfolgten, ihr Interesse an mir verloren haben. Überhaupt habe ich den Eindruck, dass schnell Gras über die Sache gewachsen ist, denn meine Geschichte verhält sich nicht anders als ein Stück umgegrabene Erde, das sich wie von selbst begrünt.
Und deshalb kann ich hier ganz unbehelligt wohnen.
Ungestört von lästigen Befragungen.
Man hat mich in dieses Haus verbracht.
Nicht gebracht.
Verbracht.
Und ich lebe noch immer.
Zugegeben, ich bin über die Zeit hinaus.
Man kann sogar sagen, überdurchschnittlich bejahrt.
Überzählig.
Ein Überlebender.
Fast ein Unsterblicher.
Trotzdem.
Ich möchte meinen Zustand nicht beschönigen, denn bald werde auch ich unter dem Rasen zu liegen kommen. Wie die anderen, die es vor mir geschafft haben.
Ich weiß es.
Schließlich kann ich zählen, und zähle ich meine Lebensjahre, so sind es immer zu viele. Nur allzu oft denke ich: Das kann doch einfach nicht wahr sein. Wann kommt denn endlich das Ende?
Und doch.
Ich kann auch fröhlich sein, sogar schadenfreudig fröhlich, denn der Umstand, dass ich bald dran bin, schenkt mir die Freiheit, mich keinen Deut mehr darum scheren zu müssen, was andere Leute von mir denken. Außerdem, wer interessiert sich schon für einen alten Mann, der nur noch froh ist, durch den Tag zu kommen, hinter seinem Gehwagen hertrottet und kaum noch seinen Mund aufmacht.
Manchmal fühle ich mich wie eine Mumie, deren Mund Präparatoren mit schwarzem Gefäde vernäht haben. Mumien können nicht sprechen.
Wie auch?
Mit schwarzem Gefäde?
Sie sind sprachlos.
Ich dagegen bin trotz des Mumiengefühls nicht ohne Sprache, könnte sogar flüssig sprechen, wenn ich wollte, auch in Versen.
Ich aber schweige.
Besser gesagt, ich verschweige.
Schon von Berufs wegen wäre es mir ein Leichtes zu erklären, in welche Richtung die unscheinbare Vorsilbe „ver“ den Sinn eines Verbs ver-schiebt. Deshalb meine ich, dass das Ver-bringen präziser das beschreibt, was man mit mir gemacht hat, als man mich ins Heim brachte. Ich meine auch, dass das Wort Ver-schweigen mein Verhalten besser beschreibt, als wenn es heißen würde, ich wolle einfach nicht mehr reden. Endlos könnte ich mich über solche kleinen sprachlichen Details auslassen. Aber wen interessiert schon der feine Unterschied zwischen Schweigen und Ver-schweigen. Mir ist nur noch wichtig, dass ich es kann, das Verschweigen.
Darin bin ich Meister.
Meister des Verschweigens.
Das war eine Frage des Überlebens.
Man kann sich kaum vorstellen, wie anstrengend das ist. Immer wieder kommt es vor, dass mein wahres, tief in mir vergrabenes Ich nach außen drängt, so dass ich das unaufschiebbare Verlangen verspüre, mich jemandem mitzuteilen.
Nach einer Weile erzeugt dieser Wunsch unweigerlich Überdruck, was mich dazu zwingt, Dampf abzulassen.
Um mich in solchen Momenten nicht etwa unvorsichtig geschwätzig zu zeigen, habe ich lernen müssen, mich passgenau zu verhalten. Die Leute haben ja keine Ahnung, kein Vorstellungsvermögen, welches Vergnügen es mir bereitet, sie mit meiner Strategie aufs Glatteis zu führen.
Die sind ja nicht im Feld gewesen.
Die wissen nichts.
Gar nichts.
Keine Ahnung haben die.
Begriffsstutzig wie sie sind, fragen sie einfach nur drauflos. Richtig ungeschickt sind die. Das ist auch der Grund, warum ihre Fragen wie Regentropfen von einem Kleppermantel abprallen. Eine kleine Unterrichtsstunde in der Technik des Befragens, damit wäre ihnen gut gedient.
Selbstredend, dass sie von meinen Erfahrungen nichts wissen wollen, denn sie mögen ihre eigene Ahnungslosigkeit nicht offenbaren. Würden sie aber über ihren eigenen Schatten springen und den Willen aufbringen, von meinem Wissen zu profitieren, würde ich ihnen als erstes empfehlen herauszufinden, was ich als ihr Gegner vorhabe. Vielleicht fiele ihnen dann meine weiche Flanke auf, meine Schwachstelle, sozusagen jung Siegfrieds Lindenblatt. Mit diesem Wissen in der Hand, könnten sie mich dann in aller Ruhe weichklopfen.
Oder.
Mich gnadenlos attackieren.
Meine weiche Flanke.
Sie ist zwischen dem Licht und der Finsternis verortet.
Zwischen der Liebe und dem Bösen.
In schwierigen Momenten hat es sich bewährt, nur noch unverständliches Zeug zu nuscheln. Wenn ich eines kann, dann perfektes Brabbelgenuschel, und das sogar tadellos. Das halte ich locker durch, und zwar nicht nur vor Gericht. Längst hat sich meine Brabbelei zu so etwas wie einer zweiten Sprache entwickelt, deren Ursprungsland ich am liebsten paese di vecchi nennen möchte. Das Italienische ist aber viel zu wohlklingend und mildert die Bedeutung zu sehr ab, um das auszudrücken, was ich meinem Wohnsitz gegenüber empfinde. Ich ziehe deshalb meine eigene Worterfindung vor: Greisenland. Schon morgens, wenn ich aufwache, sage ich mir: Junge, man hat dich ins Land der Greise verbracht, was wörtlich genommen bedeutet, unter Grauen oder schlimmer noch, im Grauen zu leben.
Grauland.
Grauenland.
Greisenland.
Das passt.
Und im Greisenland brabbelt man natürlich Greisisch. Oder sollte man es lieber Greisenländisch nennen? Ganz gleichgültig, wie man die Sprache nennen möchte, ich spreche sie fließend und gebe vor meinen Prüfern nur grammatikalisch korrektes Gebrabbel zum Besten. Schließlich habe ich schon von Berufs wegen meine Hausaufgaben gemacht. Gefällt mir eine Frage nicht, antworte ich mit wütendem Brabbelstakkato. Signalisiere ich Nicht-Verstehen, ist nöhliges Brabbeln in schleppendem Largo dran. An diese Art der Kommunikation habe ich mich fast schon gewöhnt, wobei ich mir natürlich bewusst bin, welche Wirkung ich mit dieser Tour auf meine Umgebung habe.
„Der hat nicht mehr alle Tassen im Schrank“, das ist es, was die Leute denken. Meist lassen sie einen belustigtabschätzigen Blick über mich gleiten, der sich gleich darauf in einen fast schmerzhaft berührten Ausdruck wandelt. Es ist sichtbar, wie mein Gehabe als blöder Alter sie ihr eigenes bedrohlich näher rückendes Alter fürchten lässt. Wenn die wüssten, dass alles nur Taktik ist, dass ich diese Debilenrolle nur spiele und mit Fleiß brabble, es sogar vor dem Spiegel geübt habe, das Brabbel-Sabber-Brabbel. Ich weiß genau, je kindischer ich wirke, desto eher lässt man mich in Ruhe.
Das ist es, was ich will.
Ich will meine Ruhe haben und nichts mehr wissen.
Gar nichts.
Von nichts.
Es ist nicht gerade angenehm, für senil gehalten zu werden. Immerhin habe ich damit aber erreicht, dass meine Umgebung mich in Ruhe lässt. Sogar der Staatsanwalt hat aufgegeben, mich zu befragen. Er konnte das Brabbel-Sabber-Brabbel nicht mehr ertragen und war froh, als im psychiatrischen Gutachten festgestellt wurde, dass ich nicht mehr vernehmungsfähig sei.
Diese Psychiater und Psychologen!
Sie bilden sich ein, sie hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen, dabei sind sie nur vollgepumpt mit Wissen und völlig verstudiert. Sie schwafeln blödsinniges Zeug vom Ich und Über-Ich daher.
Meiner Meinung nach sollten sie sich erst einmal selbst zuhören, bevor sie sich daran machen herauszubekommen, wer ich bin.
Ich.
Der einzige, dem ich noch erlaube, mich zu befragen, bin ich selbst.
Ich.
Wenn auch nur innerlich, nicht laut und vernehmbar. Es ist immer die gleiche Frage, die mich quält, die Frage, warum ich überhaupt noch existiere, so rein körperlich, mit Essen und Trinken und dann und wann ein wenig Verdauung. Auch frage ich mich ständig, warum ich ausgerechnet in dieser Stadt lebe, in der mich alles an sie erinnert.
An sie.
Erinnerungen.
Fragen.
Gedanken.
Sie gehen mir im Kopf um und um.
Sie sind nicht immer schön, meine Gedanken, nicht schön, aber frei, und kein Mensch kann sie erraten.
Genau wie in dem Lied. Kaum zu glauben, wie oft ich es gesungen habe.
Ich mit den Kindern.
Gedanken.
Die meinen kreisen ständig um sie und um das Andere.
Um sie.
Mein Mädchen.
Meine kleine Meerprinzessin.
Und um die Finsternis.
In mir.
Die Finsternis, die mich nachts packt, an der ich noch versticken werde.
Nicht ersticken.
Das ginge ganz schnell.
Ver-sticken.
Quälend langsam.
Schon wieder erscheint mir die Vorsilbe „ver“ zwingend. Ich liebe es, mir solche kleinen Wortfindungen zu erlauben. Wie soll ich auch sonst das beschreiben, was mir die Luft zum Atmen nimmt? Es ist seltsam. Je älter ich werde, desto mehr treten Lebensereignisse, die schon Jahrzehnte zurückliegen, in den Vordergrund. Sie verstopfen mein Inneres, ja, sie wachsen sogar, werden schwerer und blähen sich auf, bis in mir kein Raum mehr vorhanden ist.
Innen.
Kein Raum.
Keine Luft.
Nur Enge.
Ich fand die Welt schon immer rätselhaft. Obwohl ich mir viele Fragen gestellt habe, konnte ich keine klaren Antworten finden. Die aber, die in meiner Jugend mit einfachen Lösungen zunächst so viel Erfolg zu haben schienen, brachten eigentlich das ganze Gefüge nur durcheinander.
Wir rieben uns jedenfalls die Augen, als alles zusammenkrachte und in der totalen Katastrophe endete.
Das haben wir uns in der Begeisterung, von der wir wie besoffen waren, nicht vorstellen können.
Die Tage sind lang und lassen mir viel Zeit zum Nachdenken. Die Frage, die mich in diesen endlosen Stunden umtreibt, ist, warum ich ausgerechnet an diesen Ort zurückgekehrt bin, an dem mich auf Schritt und Tritt alte Erinnerungen überfallen. Ganz abgesehen davon, dass es mein Sohn war, der die Sache letztlich entschieden hat, beantworte ich mir die Sache gerne so: Es ist die Beständigkeit des Flüsschens, welches das Schloss in einem Graben umschließt, bevor es unter der Brücke als Wasserfall durch die Mühle stürzt und von dort weiterwandert. Und natürlich die Linden, die Jahr um Jahr grün werden, und selbst die Krähennester in ihren Wipfeln.
Obwohl, und da ergreift mich Verunsicherung, es sind nicht mehr die Bäume von damals. Gärtner haben sie irgendwann nachgepflanzt, nachdem die alten abgeholzt worden waren. Im Sägen ist man hier ganz groß.
Man kann schon froh sein, dass sie beim Fällen das Schloss nicht gleich mit abgerissen haben. Das klingt abwegig, hätte aber durchaus geschehen können. Die Bäume aber, die stehen geblieben sind, scheinen ewig zu wachsen. So wie die Allee, zu der mich, wenn es mir gut geht, mein Begleiter führt.
Mit den alten Häusern gingen die Stadtoberen noch radikaler um.
Sie sind abgerissen.
Wie nie dagewesen.
Weggewischt.
Einfach nicht mehr da.
Wie verstorbene Menschen.
Weg.
Verstorbene Menschen.
Tote.
Wer denkt schon an sie? Die meisten liegen ordentlich im Sarg unter einem Grabstein bestattet, auf dem ihr Name und das Jahr ihrer Geburt und ihres Todes eingemeißelt sind. Manchmal finden sich auch fromme Sprüche oder die betenden Hände von Dürer.
Viele wurden jedoch nur verscharrt.
Ab in die Grube.
Ungelöschter Kalk drauf.
Fertig.
Hab ich selbst gesehen. Es bleibt nichts übrig. Das ist auch gut so. Man könnte sonst auf den Gedanken kommen, jeden einzelnen beerdigen zu wollen.
Für diesen Aufwand gab es ihrer zu viele.
Ehrlich, da hilft nur Verbrennen.
Das geht, doch das sprengt die Vorstellungskraft.
Mit den Häusern ging das natürlich einfacher. Abreißen, die Steine abtransportieren, einebnen, sich ein Gewirr von Straßen ausdenken und auf die frei gewordenen Grundstücke neue Gebäude setzen. Da sag mir mal einer, wie ich mich da noch zurechtfinden soll? Brauche ich auch nicht, denn ich habe ja jemanden, der mich führt.
Dass auch das Gästehaus dran glauben musste, in dem „Der Mond ist aufgegangen“ geschrieben worden sein soll, hat mich ganz durcheinander gebracht. Das Lied war fester Bestandteil meines Unterrichts. Erstaunlich, wie schnell die Kinder die sieben Strophen gelernt haben. Und jetzt ist der Ort seiner Entstehung unauffindbar.
Weg.
Total.
Stein für Stein.
Wem mag das nur eingefallen sein. Haben die nicht bemerkt, dass das Gebäude zur gut durchdachten Stadtanlage gehörte und genau so weiß getüncht war wie das Schloss?
Ja, schön war es.
Und anmutig.
Hätte sich nur nicht dieses Gesocks darin breit gemacht. Mir wird immer noch übel, wenn ich daran denke. Vielleicht war die Entscheidung, das Haus abzureißen, aber auch richtig, denn das Ungeziefer, das darin hauste, wurde dadurch vertrieben. Beileibe nicht nur ich fand sie unerträglich, die Zigeuner.
Als ich noch Lehrer war, hat es mir immer Spaß gemacht, mit der Klasse durch die Baumanlage zu gehen und den Kindern die Geschichte von der Prinzessin zu erzählen, die sie einst pflanzen ließ.
Gerne ging ich mit ihnen auch in den Park, wo zu damaliger Zeit ein gewaltiger Baum stand, eine Buche oder war es eine Eiche? Ich kann mich nicht mehr genau entsinnen. Ihre Besonderheit waren die unterschiedlichen Blätter. Kaum zu glauben, wie die Kleinen an meinen Lippen hingen, wie ich sie verblüffen konnte.
Ich fühlte mich wie ein Zauberer, wenn ich ihre Augen durch die Äste von den runden zu den gezackten Blättern lenkte.
Ich kann es drehen und wenden, wie ich will. Ich fühle mich in diesem Städtchen heimisch, und das ist es, was in meinem Alter zählt, dass man sich heimisch fühlt.
Sonst ist mir eigentlich alles ziemlich gleichgültig, auch die Frage, ob man sich an die Zeitungsartikel erinnert oder mich sogar wiedererkennt. Ich für meinen Teil halte es fast für ausgeschlossen. Schließlich weiß ich manchmal selbst nicht, wer mir da im Spiegel entgegenblickt.
Die Haare sind schütter, die Zähne alle weg. Da hilft auch kein Zahnersatz. Die Gaumenplatte der Prothese empfinde ich als Fremdkörper. Lasse ich sie aber weg, so stört mich das Gefühl der nackten Kauleiste und der nach innen gezogenen Lippen.
Manchmal stelle ich mich nackt vor den Ganzkörperspiegel, der an der Innenseite der Kleiderschranktür angebracht ist.
Das mache ich natürlich nur, wenn ich allein bin.
Ich betrachte mich dann von oben bis unten, alles, auch mein Geschlecht. Hebe es ein wenig an, wiege es, stelle fest, dass es immer kleiner wird. Nur die Vorhaut deckt die Eichel vorschriftsmäßig ab. Schließlich bin ich ja nicht beschnitten. Das Häutchen hängt ziemlich müde herunter. Aus alter Gewohnheit betaste, ziehe und schiebe ich an ihm herum. Ich schnuppere wie zur Kontrolle an meinen Fingerspitzen und stelle fest, dass sie von der Zwirbelei den Geruch von Smegma angenommen haben. Der Geruch erinnert mich in fataler Weise an modrigen Hechtschleim und veranlasst mich, den mühseligen Weg ins Bad zu nehmen. Mühevoll auch, weil mir die heruntergelassene Hose über den Fußboden hinterher schleift und ich noch kleinere Schritte machen muss als sonst. Im Bad seife und spüle ich dann mein Glied unter fließendem Wasser ab, was nur geht, wenn ich mich auf die Zehenspitzen stelle. Bei der ganzen Rummacherei empfinde ich gar nichts.
Absolut nichts.
Im Gegenteil.
Das Dingelchen fühlt sich nur noch wie ein toter Hühnerhals an.
In solchen Momenten wird mir mein Alter bewusst.
Das anschließende Hochziehen der Hose ist eine Prozedur, die mir ohne fremde Hilfe jedes Mal schwerer fällt. Unfähig, mit meinen steifen Knien eine Beuge zu machen, bin ich gezwungen, mich weit hinunterzustrecken.
Schwierig ist das.
Habe ich das geschafft, fühle ich die Hose um meine Beine schlottern. Sie werden immer magerer. Spindeldürr könnte man sie nennen. Wenn ich in früheren Zeiten ein mittelalterlicher Heiliger, gar ein Märtyrer gewesen wäre, hätten die Inquisitoren das reinste Vergnügen daran haben können, mich häuten zu lassen, denn meine Haut rutscht am Knochen runter wie ein ausgeleierter Strumpf. Und ihre Farbe? Na, ein graublasses Uringelb, das kommt hin. Unansehnlich ist noch geschmeichelt.
Genau wie die blau marmorierten Füße mit den pilzigen Nägeln.
Bald ist es soweit.
Dann können mich diese Beine und Füße nicht mehr tragen.
Es ist eine Schande.
Was soll ich sagen.
Es ist das Alter.
Der Verstand scheint noch da zu sein. Der Rest jedoch gestaltet sich höchst unerfreulich.
Die Stadt dagegen ist jünger geworden. Neue Häuserzeilen haben die alten ersetzt. Das ist wie mit meinen Zähnen. Die sind auch neu und schlossweiß. Allerdings liegen sie über Nacht im Glas.
Während ich mit meinem Begleiter, einem Zivildienstleistenden, der nicht dienen will, keine Lust zum Kämpfen hat, einem Weichei, das lieber alten Leuten den Hintern abputzt, als sich den Herausforderungen dieser Welt zu stellen, also, während ich mit diesem jungen Kerl Schritt für Schritt vorankomme, befinde ich mich viel eher in der Vergangenheit als in der Gegenwart, in der ich schon mal das eine oder andere vergesse.