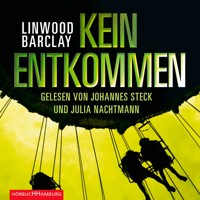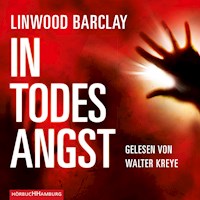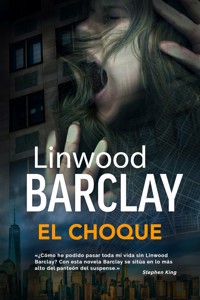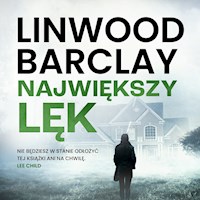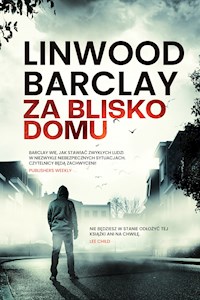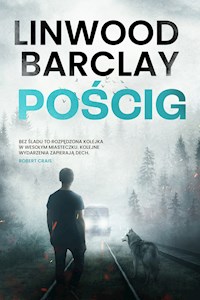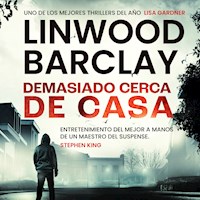9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Familie Archer, vor sieben Jahren knapp mit dem Leben davongekommen, trägt schwer an ihrer Vergangenheit. Cynthia, die Mutter, hat das Trauma einfach nicht überwunden und beschließt, eine Weile getrennt von ihrer Familie zu leben, um wieder ins Lot zu kommen. Der Grund ist nicht zuletzt die vierzehnjährige Grace, die gegen die überbeschützende Haltung ihrer Eltern rebelliert. Terry, der Vater, versucht, seine Familie gegen diese Fliehkräfte zusammenzuhalten. Doch die Zeichen stehen auf Sturm: Die ganze Stadt ist in Aufruhr, weil sich in der Nachbarschaft der Archers ein brutaler Mord ereignet hat. Und Grace ist nicht ganz unschuldig an den Ereignissen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 611
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Linwood Barclay
Schweig für immer
Thriller
Aus dem Englischen von Silvia Visintini
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Familie Archer, vor sieben Jahren knapp mit dem Leben davongekommen, trägt schwer an ihrer Vergangenheit. Cynthia, die Mutter, hat das Trauma einfach nicht überwunden und beschließt, eine Weile getrennt von ihrer Familie zu leben, um wieder ins Lot zu kommen. Der Grund ist nicht zuletzt die vierzehnjährige Grace, die gegen die überbeschützende Haltung ihrer Eltern rebelliert. Terry, der Vater, versucht, seine Familie gegen diese Fliehkräfte zusammenzuhalten. Doch die Zeichen stehen auf Sturm: Die ganze Stadt ist in Aufruhr, weil sich in der Nachbarschaft der Archers ein brutaler Mord ereignet hat. Und Grace ist nicht ganz unschuldig an den Ereignissen.
Inhaltsübersicht
Widmung
PROLOG
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
68. Kapitel
69. Kapitel
70. Kapitel
71. Kapitel
72. Kapitel
73. Kapitel
74. Kapitel
EPILOG
DANK
Für Neetha
PROLOG
Richard Bradley neigte nicht zur Gewalttätigkeit, doch genau in diesem Moment hätte er jemanden umbringen können.
Er saß im Schlafanzug auf der Bettkante. »Ich halte das nicht mehr aus«, sagte er.
»Du gehst da jetzt nicht raus«, sagte seine Frau Esther. »Nicht schon wieder. Finde dich einfach damit ab.«
Sie konnten die Musik von nebenan nicht nur hören, sie spürten sie. Der tiefe Bass wummerte in den Wänden ihres Hauses wie ein Herzschlag.
»Himmelherrgott, es ist elf«, sagte Richard und schaltete seine Nachttischlampe ein. »Und es ist Mittwoch. Nicht Freitagabend oder Samstagabend, sondern Mittwoch.«
Die Bradleys wohnten schon fast dreißig Jahre in diesem bescheidenen Haus in Milford, in dieser hundert Jahre alten Straße mit ihren stattlichen Bäumen. Sie hatten Nachbarn kommen und gehen sehen. Nette und grässliche. Aber so grässlich wie diese war noch nie jemand gewesen. Seit zwei Jahren vermietete der Eigentümer des Nachbarhauses an Studenten des Housatonic Community College drüben in Bridgeport. Seither, und Richard Bradley versäumte nicht, täglich darauf hinzuweisen, ging die Gegend immer mehr vor die Hunde.
Es hatte schlimme und weniger schlimme Studenten gegeben. Doch die, die jetzt hier hausten, schossen den Vogel ab. Laute Musik, fast jede Nacht. Marihuanaschwaden, die durch die Fenster hereinwehten. Zerbrochene Bierflaschen auf dem Gehsteig.
Früher war das ein angenehmes Viertel gewesen. Junge Paare in ihrem ersten eigenen Heim, manche mit kleinen Kindern. Natürlich gab es auch ältere Kinder, Teenager, die hier lebten, doch wenn die es krachen ließen, sobald sie allein zu Hause waren, konnte man sie wenigstens am nächsten Tag bei ihren Eltern verpfeifen, und dann kam es nicht mehr vor. Zumindest eine Zeitlang. Auch ältere Leute wohnten hier, viele davon Rentner. Wie die Bradleys, die seit den siebziger Jahren an Schulen in und um Milford unterrichtet hatten, ehe sie in den Ruhestand gingen.
»Haben wir dafür unser Leben lang geschuftet?«, fragte Richard seine Frau Esther. »Damit wir eines Tages Tür an Tür mit einem Haufen gottverdammter Krawallmacher wohnen können?«
»Ich bin sicher, die machen bald Schluss«, sagte sie und setzte sich im Bett auf. »Irgendwann ist doch immer Schluss. Wir waren doch auch mal jung.« Sie verzog das Gesicht. »Vor langer Zeit.«
»Das ist wie ein Erdbeben, das überhaupt nicht mehr aufhört«, sagte Richard. »Und ich hab nicht mal eine Ahnung, was das für eine Musik sein soll. Was ist das, verdammt noch mal?«
Er stand auf, nahm den Bademantel, der über einem Stuhl hing, schlüpfte hinein und knotete sich den Gürtel zu.
»Du kriegst noch einen Herzinfarkt, wenn du so weitermachst«, sagte Esther. »Du kannst doch nicht jedes Mal rüberrennen, wenn so was passiert.«
»In zwei Minuten bin ich wieder da.«
»Herrgott noch mal«, sagte sie, als er das Schlafzimmer verließ. Esther Bradley schlug die Decke zurück, zog sich auch den Bademantel an, schlüpfte in die Hausschuhe, die neben dem Bett standen, und rannte hinter ihrem Mann die Treppe hinunter.
»Richard«, sagte sie flehentlich.
Sie würde ihn nicht allein da hinübergehen lassen. Sie hielt die Wahrscheinlichkeit, dass diese jungen Männer auf ihn losgingen, für geringer, wenn diese sie da stehen sahen. Würden sie einen alten Mann niederschlagen, wenn seine Frau zusah?
Von Sendungsbewusstsein erfüllt, stapfte Richard die Stufen zur Haustür des dreigeschossigen viktorianischen Hauses hoch. Die meisten Lichter im Haus waren an, viele der Fenster geöffnet, die Musik plärrte so laut, dass die ganze Nachbarschaft sie hören konnte, doch noch immer nicht laut genug, um die lärmenden Stimmen und das Gelächter der Anwesenden zu übertönen.
Richard schlug mit der Faust an die Tür. Seine Frau war auf der untersten Stufe stehen geblieben und behielt ihren Mann besorgt im Auge.
»Was willst du denn sagen?«, fragte sie.
Er ignorierte sie und hämmerte erneut gegen die Tür. Als er die Faust zum dritten Mal erhob, ging die Tür auf. Ein dünner Mann um die zwanzig stand vor ihm. Er war etwa einsachtzig groß, trug Jeans und ein unifarbenes dunkelblaues T-Shirt. In der Hand hielt er eine Dose Coors.
»Hey«, sagte er. Er blinzelte ein paar Mal benommen und musterte seinen Besuch. Bradleys dünne graue Haarbüschel standen in alle Richtungen ab, sein Bademantel war vorne ein wenig aufgegangen, und seine Augen traten ihm fast aus den Höhlen.
»Sind Sie noch bei Sinnen?«, brüllte Richard.
»Wie bitte?«, fragte der Mann verwundert zurück.
»Sie halten die ganze Nachbarschaft wach, verdammt noch mal!«
Die Lippen des Mannes formten sich zu einem O, als bemühe er sich zu verstehen, was Richard von ihm wollte. Jetzt bemerkte er Esther Bradley, die ihre Hände fast wie zum Gebet gefaltet hatte.
»Die Musik ist ein bisschen laut«, sagte sie, und es klang beinahe wie eine Bitte um Entschuldigung.
»Ach ja, Mist«, sagte der junge Mann. »Sie wohnen nebenan, stimmt’s?«
»Herrgott«, sagte Richard und schüttelte den Kopf. »Ich war letzte Woche da, und die Woche davor auch. Ist von Ihrem Hirn überhaupt noch was übrig?«
Der Mann blinzelte noch ein paar Mal, dann drehte er sich um und brüllte ins Haus hinein: »Hey, mach leiser. Carter! Hey, Carter! Mach – ja, Scheiße, mach halt leiser!«
Drei Sekunden später hörte die Musik auf. Die Stille war ohrenbetäubend.
Der junge Mann entschuldigte sich mit einem Achselzucken. »Tut mir leid.« Er streckte Richard seine freie Hand entgegen. »Ich bin Brian. Oder hab ich das schon gesagt?«
Richard Bradley übersah die Hand.
»Wollen Sie vielleicht auf ’n Bier reinkommen?«, fragte Brian und schwang die Bierdose. »Pizza ham wir auch.«
»Nein«, sagte Richard.
»Danke für die Einladung«, sagte Esther fröhlich.
»Sie – Sie wohnen da drüben, stimmt’s?«, fragte Brian und wies mit dem Finger auf das Haus.
»Ja«, sagte Esther.
»Gut. Also, tut mir echt leid wegen dem Krach. Wir hatten heute alle Klausur, ja, und jetzt feiern wir halt ein bisschen ab. Wenn’s Ihnen wieder zu viel wird, dann kommen Sie einfach rüber und haun an die Tür. Dann schalten wir wieder ’nen Gang zurück.«
»Genau das habe ich gemacht«, sagte Richard.
Brian zuckte wieder die Achseln, trat ins Haus zurück und schloss die Tür.
»Ist doch ein ganz netter Junge«, sagte Esther.
Richard knurrte.
Sie kehrten in ihr Haus zurück, das sie vorhin so eilig verlassen hatten. Die Tür stand noch einen Spaltbreit offen. Erst als sie beide im Haus waren und die Tür geschlossen und verriegelt hatten, stellten sie fest, dass sie nicht alleine waren. Zwei Personen saßen im Wohnzimmer.
Ein Mann und eine Frau. Ende dreißig, Anfang vierzig. Beide mit lässigem Schick gekleidet. Jeans – hatte die der Frau tatsächlich eine Bügelfalte? – und leichte Jacken.
Esther schrie vor Schreck auf, als sie die beiden bemerkte.
»Herrgott!«, sagte Richard. »Wie zum Teufel sind Sie –?«
»Sie sollten die Tür nicht einfach offen stehen lassen«, sagte die Frau und erhob sich von der Couch. Sie konnte nicht größer als eins sechzig sein. Schwarzes Haar, zu einem kurzen Bob geschnitten. »Ist nicht sehr schlau«, sagte sie. »Auch nicht in einer netten Gegend wie der hier.«
»Ruf die Polizei«, sagte Richard Bradley zu seiner Frau.
Der Befehl kam mit einer gewissen Verzögerung bei Esther an. Dann machte sie sich auf den Weg in die Küche. Doch kaum hatte sie den ersten Schritt getan, sprang der Mann auf und stellte sich ihr in den Weg. Er war gut einen Kopf größer als die Frau und stämmig. Flink war er auch.
Er packte Esther unsanft an ihrer knochigen Schulter, wirbelte sie herum und stieß sie grob in einen der Wohnzimmersessel.
Sie jaulte auf.
»Sie elendes Schwein!«, sagte Richard Bradley und stürzte auf den Mann zu, während der ihm den Rücken zuwandte. Er ballte eine Hand zur Faust und drosch sie dem Eindringling zwischen die Schulterblätter. Der drehte sich blitzschnell um, fegte Richard wie ein Kind zur Seite, bemerkte, als dieser rückwärts auf die Couch zutaumelte, dessen nackten Fuß und bohrte ihm seinen Absatz hinein.
Bradley schrie vor Schmerz auf, wollte sich an der Couch festhalten, ging aber zu Boden.
»Es reicht«, sagte die Frau. »Schatz, magst du vielleicht ein paar von den Lampen ausmachen? Es ist schrecklich hell hier drin.«
»Klar«, sagte er, ging zum Schalter und löschte das Licht.
»Mein Fuß«, wimmerte Richard. »Verdammt, Sie haben mir den Fuß gebrochen.«
»Ich muss ihm helfen«, sagte Esther. »Lassen Sie mich einen Eisbeutel für ihn holen.«
»Bleiben Sie, wo Sie sind«, sagte der Mann.
Die Frau setzte sich auf die Kante des Couchtisches, von wo aus sie Esther im Sessel und Richard auf dem Boden gleichermaßen gut im Blick hatte.
»Ich werde Ihnen beiden jetzt eine Frage stellen«, sagte sie. »Und ich werde sie nur einmal stellen. Deshalb möchte ich, dass Sie mir sehr aufmerksam zuhören und sehr gründlich überlegen, bevor Sie mir antworten. Was Sie nicht tun sollten, ist, meine Frage mit einer Gegenfrage zu beantworten. Das wäre sehr, sehr unproduktiv. Verstehen Sie?«
Die Bradleys sahen einander verängstigt an. Dann richteten sie ihre Blicke wieder auf die Frau.
Ein mattes Auf und Ab ihrer Köpfe signalisierte, dass sie verstanden hatten.
»Das ist sehr gut«, sagte die Frau. »Also, passen Sie auf. Es ist eine sehr einfache Frage.«
Die Bradleys warteten.
»Wo ist es?«, fragte die Frau.
Die Worte hingen in der Luft. Niemand gab ein Geräusch von sich.
Nach ein paar Sekunden sagte Richard: »Wo ist w–?«
Er bemerkte den Blick der Frau und brach ab.
Sie lächelte und drohte ihm mit dem Finger. »Na, na. Was habe ich gerade gesagt? Fast wär’s Ihnen rausgerutscht, nicht wahr?«
Richard schluckte. »Aber –«
»Können Sie die Frage beantworten? Eines sollten Sie wissen: Eli sagt, es ist hier.«
Richards Lippen zitterten. Er schüttelte den Kopf und stammelte: »Ich – ich weiß – ich weiß nicht –«
Die Frau streckte die Hand aus und brachte ihn damit zum Schweigen. Sie wandte sich an Esther. »Möchten Sie die Frage beantworten?«
Esther wählte ihre Worte sehr sorgfältig. »Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie ein bisschen konkreter werden könnten. Ich – ich muss Ihnen sagen, dass mir der Name – Eli? –, ich kenne niemanden, der so heißt. Was immer Sie wollen, wenn wir es haben, dann bekommen Sie es.«
Die Frau seufzte und sah ihren Partner an, der ein paar Schritte von ihr entfernt stand.
»Sie hatten Ihre Chance«, sagte sie. »Ich habe Ihnen gesagt, dass ich die Frage nur einmal stellen werde.« Genau in diesem Augenblick begann im Nachbarhaus die Musik wieder so laut zu dröhnen, dass die Fensterscheiben im Haus der Bradleys vibrierten. Die Frau lächelte. »Das ist Drake. Den mag ich.« Sie blickte zu ihrem Begleiter hoch und sagte: »Erschieß den Mann.«
»Nein! Nein!«, schrie Esther.
»Herrgott!«, rief Richard. »Sagen Sie uns doch –«
Der pensionierte Lehrer kam nicht mehr dazu, den Satz zu beenden. Denn der Mann hatte bereits eine Pistole aus der Jacke gezogen, sie nach unten gerichtet und abgedrückt.
Wieder wollte Esther schreien. Doch sie brachte nichts weiter hervor als ein Piepsen, als wäre jemand auf eine Maus gestiegen.
»Wahrscheinlich wissen Sie’s wirklich nicht«, sagte die Frau zu ihr. Sie nickte ihrem Kompagnon zu, und dieser feuerte einen zweiten Schuss ab.
»Muss aber nicht heißen, dass es nicht hier ist«, sagte sie matt. »Das wird eine lange Nacht, Schatz. Es sei denn, es ist in der Keksdose.«
»Das glaubst du ja selbst nicht«, sagte er.
1
Wie war ich eigentlich auf die Idee gekommen, dass nach einer Zeit großer Finsternis, in der man mit den schlimmsten Dämonen gerungen und sie besiegt hat, alles wieder gut wird?
Reines Wunschdenken.
Ja, eine Zeitlang lief es schon recht gut. Vor sieben Jahren hatte nämlich alles auf Messers Schneide gestanden. Buchstäblich. Es gab Tote. Viel hatte nicht gefehlt, und meine Frau, meine Tochter und ich wären darunter gewesen. Aber dann war alles vorbei, wir waren wieder zur Ruhe gekommen – und noch immer eine Familie.
Und wie es in diesem Lied heißt, rappelten wir uns wieder auf, bürsteten uns den Staub ab und fingen wieder von vorn an.
Mehr oder weniger.
Denn die Narben blieben. Wir durchlebten unsere Variante einer posttraumatischen Belastungssituation. Meine Frau Cynthia auf jeden Fall. Sie hatte ihre gesamte Familie verloren, als sie vierzehn war. Und mit verloren meine ich wirklich verloren. Eines Nachts verschwanden ihre Eltern und ihr Bruder auf Nimmerwiedersehen. Erst fünfundzwanzig Jahre später erfuhr Cynthia, was aus ihnen geworden war. Ein glückliches Wiedersehen gab es allerdings nicht.
Und das war noch nicht alles. Cynthias Tante bezahlte den Höchstpreis für ihren Versuch, Licht in ein jahrzehntealtes Geheimnis zu bringen.
Und dann war da noch Vince Fleming, ein Jugendfreund von Cynthia, der in jener verhängnisvollen Nacht, als ihre Familie verschwand, mit ihr zusammen gewesen war.
Mit seiner Hilfe fanden wir fünfundzwanzig Jahre später heraus, was sich wirklich ereignet hatte. Vince hatte inzwischen die Verbrecherlaufbahn eingeschlagen, und dieser völlig untypische Anfall von Altruismus hätte beinahe auch ihn das Leben gekostet.
Die Geschichte hatte damals ein Riesenaufsehen erregt. Sogar zu einem Film wollten sie sie verwursten, aber daraus wurde dann doch nichts, und meiner Meinung nach war das auch besser so.
Wir dachten, wir könnten dieses Kapitel im Buch unseres Lebens endlich schließen. Fragen waren beantwortet, Rätsel gelöst. Die Bösen starben oder landeten hinter Gittern.
Fall abgeschlossen, wie es so schön heißt.
Aber es ist wie ein verheerender Tsunami. Man glaubt, es sei vorbei, doch Jahre später werden an einer weit entfernten Küste Trümmer angespült.
Für Cynthia hatte das Trauma kein Ende. Jeden Tag lebte sie mit der Angst, die Geschichte könne sich mit ihrer heutigen Familie wiederholen. Mit mir. Und unserer Tochter Grace. Leider führten die Schritte, die sie unternahm, damit das nicht geschah, in jenen Bereich, der als das Gesetz der unbeabsichtigten Folgen bekannt wurde: Handlungen, die man begeht, um etwas zu erreichen, erzielen oft genau den gegenteiligen Effekt.
Cynthias Bemühungen, unsere vierzehnjährige Tochter vor der bösen weiten Welt zu beschützen, trieben Grace regelrecht dazu, so schnell wie möglich Bekanntschaft mit ihr zu machen.
Trotzdem gab ich die Hoffnung nicht auf, dass es uns letzten Endes gelingen würde, uns aus der Finsternis wieder ans Licht zu kämpfen. Allem Anschein nach sollte das aber noch eine ganze Weile dauern.
Grace und ihre Mutter lieferten sich beinahe täglich erbitterte Wortgefechte.
Und es ging immer um das Gleiche.
Grace kam nicht zur vereinbarten Zeit nach Hause. Grace rief nicht an, sobald sie dort ankam, wo sie hinwollte. Grace sagte, sie gehe zu einer Freundin, ging dann aber zu einer anderen und sagte ihrer Mutter nicht Bescheid. Grace wollte zu einem Konzert in New York, würde von dort aber erst um zwei Uhr morgens zurück sein.
Mom sagte nein.
Ich versuchte mich als Friedensstifter bei diesen Auseinandersetzungen. Gewöhnlich ohne großen Erfolg. Unter vier Augen sagte ich Cynthia, ich verstünde ihre Beweggründe und wolle auch nicht, dass Grace etwas zustieß. Doch wie sollte unsere Tochter lernen, auf eigenen Beinen zu stehen, wenn sie nie Gelegenheit bekam, Dinge selbständig zu entscheiden?
Im Allgemeinen endeten diese Streitigkeiten damit, dass jemand Türen knallend davonstürmte. Grace ließ ihre Mutter wissen, dass sie sie hasste, rannte aus der Küche und stieß dabei einen Stuhl um.
»O Gott, sie ist genau wie ich«, sagte Cynthia oft. »Ich war in dem Alter ein Alptraum. Ich will nur nicht, dass sie dieselben Fehler macht wie ich.«
Selbst jetzt, zweiunddreißig Jahre danach, plagten Cynthia die schlimmsten Schuldgefühle wegen der Nacht, in der ihr Vater, ihre Mutter und ihr großer Bruder Todd verschwanden. Irgendwie glaubte sie noch immer, alles wäre anders gekommen, wenn sie damals nicht ohne Wissen und Erlaubnis ihrer Eltern mit einem Jungen namens Vince ausgegangen wäre. Wäre sie damals nicht so betrunken nach Hause gekommen und hätte ihren Rausch ausschlafen müssen, hätte sie von den Vorgängen im Haus vielleicht etwas mitbekommen und ihre Familie retten können.
Obwohl nichts in diese Richtung deutete, war Cynthia überzeugt, dass das Verschwinden ihrer Angehörigen die Strafe für ihr ungebührliches Verhalten war.
Sie wollte Grace davor bewahren, sich eines Tages ähnliche Vorwürfe machen zu müssen. Sie impfte Grace förmlich ein, wie wichtig es war, sich dem Druck ihrer Altersgenossen zu widersetzen, sich nie in eine heikle Lage bringen zu lassen, stets auf die leise Stimme im Kopf zu hören, wenn diese flüsterte: Das ist verkehrt. Nichts wie weg von hier.
Oder, wie Grace es formulierte: »Bla, bla, bla, bla.«
Es nützte nicht viel, dass ich Cynthia sagte, so gut wie jeder Jugendliche mache so eine Phase durch. Selbst wenn Grace den einen oder anderen Fehler machte, hieße das noch nicht, dass die Folgen so dramatisch sein würden wie Cynthia sie erlebt hatte. Meine Güte, Grace war ein Teenager. In sechs Jahren, wenn Cyn und ich uns bis dahin noch nicht umgebracht hatten, würden wir unsere Tochter zu einer vernünftigen jungen Frau heranreifen sehen.
Trotzdem konnten wir uns nur schwer vorstellen, dass diese Zeit jemals kommen würde.
Da war zum Beispiel der Abend, an dem Cynthia in der Post Mall auf der Suche nach Schuhen war. Wen entdeckte sie dort? Grace, die mit Freundinnen rauchend vor einem Kaufhaus stand. Cynthia stellte sie vor ihren Klassenkameradinnen zur Rede und befahl ihr, auf der Stelle mit ihr nach Hause zu fahren. Cynthia war außer sich. Sie war so damit beschäftigt, Grace zusammenzustauchen, dass sie ein Stoppschild übersah.
Beinahe wären sie in einen Müllwagen gefahren.
»Wir hätten tot sein können«, erzählte Cynthia mir. »Ich habe die Beherrschung verloren, Terry. Ich war total durch den Wind.«
Nach diesem Vorfall beschloss sie zum ersten Mal, sich eine Auszeit zu nehmen. Nur eine Woche. Uns – oder genauer gesagt, Grace – zuliebe. Eine Verschnaufpause nannte Cynthia es. Sie sprach mit Naomi Kinzler darüber, ihrer Therapeutin, bei der sie schon seit Jahren in Behandlung war. Kinzler bestärkte sie in ihrem Entschluss.
»Verlassen Sie die Konfliktsituation«, sagte die Therapeutin. »Sie laufen nicht davon. Sie drücken sich nicht vor Ihrer Verantwortung. Sie brauchen nur Zeit zum Nachdenken. Sie müssen sich sammeln. Das dürfen Sie sich zugestehen. Damit geben Sie auch Grace Zeit zum Nachdenken. Dass Sie das tun, wird ihr möglicherweise nicht gefallen, aber mit der Zeit wird sie es vielleicht verstehen. Der Verlust Ihrer Familie hat Ihnen eine fürchterliche Wunde geschlagen, und diese Wunde wird vielleicht nie ganz verheilen. Selbst wenn Ihre Tochter das jetzt noch nicht ermessen kann, der Tag wird kommen, davon bin ich überzeugt.«
Cynthia bekam ein Zimmer im Hilton Garden Inn gleich hinter der Post Mall. Eigentlich hatte sie ins preisgünstigere Just Inn Time gehen wollen, aber das kam gar nicht in Frage. Das Haus war nicht nur eine schäbige Absteige, sondern vor einigen Jahren hatte von dort aus auch ein Mädchenhändlerring operiert.
Sie war nur eine Woche weg, aber es kam mir vor wie ein Jahr. Was mich am meisten überraschte, war, wie sehr Grace ihre Mutter vermisste.
»Sie hat uns nicht mehr lieb«, sagte Grace eines Abends, während wir Lasagne aus der Mikrowelle aßen.
»Das ist nicht wahr«, sagte ich.
»Stimmt. Sie hat mich nicht mehr lieb.«
»Deine Mutter hat sich eine Auszeit genommen, gerade weil sie dich so liebhat. Sie weiß, dass sie zu weit gegangen ist, dass sie überreagiert hat, und sie braucht ein bisschen Zeit, um wieder einen klaren Kopf zu bekommen.«
»Sag ihr, sie soll sich beeilen.«
Als Cynthia zurückkam, lief alles besser. Einen Monat lang. Sechs Wochen vielleicht.
Doch der Friede erwies sich als brüchig. Anfangs gab es nur kleinere Scharmützel, den einen oder anderen Schuss vor den Bug vielleicht.
Dann das richtige Gemetzel.
Während ihrer Schlachten verletzten sie einander so sehr, dass es jedes Mal Tage dauerte, bis unser Leben wieder in normalen Bahnen verlief – was immer das ist. Ich bemühte mich zu vermitteln, aber die Dinge nahmen ihren eigenen Lauf. Wenn Cynthia Grace etwas Wichtiges mitzuteilen hatte, legte sie ihr Zettel hin, gezeichnet: K.M. Genauso wie ihre eigene Mutter, wenn sie sauer auf Cynthia gewesen war und sich nicht hatte überwinden können, Küsschen, Mom hinzuschreiben.
Aber mit der Zeit wurde aus K.M. Küsschen, Mom, und Tauwetter zwischen Mutter und Tochter setzte ein. Grace bat ihre Mutter um einen Rat. Passte dieses Oberteil zu dieser Hose? Konnte sie ihr bei dieser Hausaufgabe helfen? Allmählich entspann sich wieder ein zaghafter Dialog.
Alles wurde gut.
Und dann wurde wieder alles schlecht.
Vor ein paar Tagen wurde es richtig schlecht.
Grace wollte mit zwei Freundinnen nach New Haven fahren, wo unter der Woche ein riesiger Second-Hand-Kleiderbasar stattfand. Sie hatten Schule, deshalb konnten sie nur am Abend hin. Wie bei diesem Konzert in New York bedeutete der Ausflug eine späte Rückkehr mit dem Zug. Ich bot ihnen an, sie hinzufahren, mir dort ein bisschen die Zeit zu vertreiben und sie dann wieder heimzubringen. Doch davon wollte Grace nichts wissen. Sie und ihre Freundinnen waren keine Kleinkinder mehr. Sie wollten alleine fahren.
»Kommt nicht in Frage«, sagte Cynthia, die gerade am Herd stand und Abendessen machte. Panierte Schweineschnitzel mit Wildreis, wenn ich mich recht entsinne. »Terry, sag, dass du das genauso siehst. Dass das gar nicht in Frage kommt.«
Doch Grace ließ mich erst gar nicht zu Wort kommen. »Das ist nicht dein Ernst! Ich fahr doch nicht nach Budapest, sondern nach New Haven. Verdammte Scheiße.«
Das war eine relativ neue Entwicklung. Kraftausdrücke. Und die hatten wir wahrscheinlich selbst provoziert. Es kam nicht gerade selten vor, dass Cynthia oder ich die S-Bombe fallen ließen, wenn wir wütend oder frustriert waren. Hätten wir eine dieser Dosen gehabt, in die jeder einen Vierteldollar einwerfen muss, der ein Schimpfwort verwendet, hätten wir uns mit dem gesammelten Geld jedes Jahr eine Reise nach Rom leisten können.
Trotzdem ermahnte ich Grace deswegen.
»So redest du nicht mit deiner Mutter«, sagte ich streng.
Cynthia war offenbar der Meinung, mit einer Rüge sei es nicht getan. »Du hast zwei Wochen Hausarrest«, sagte sie.
Grace, die nicht wusste, wie ihr geschah, schoss zurück: »Wie lange willst du es eigentlich noch an mir auslassen, dass du deine Familie nicht retten konntest? Ich war da noch nicht mal geboren, klar? Ich kann nichts dafür.«
Wenn Worte töten könnten …
Grace bereute sie, kaum dass sie sie ausgesprochen hatte. Doch das war nicht alles, was in ihrer Miene zu lesen war.
Da war noch etwas. Furcht.
Sie hatte eine Grenze überschritten, und sie wusste es. Hätte sie Gelegenheit dazu gehabt, sie hätte ihre Worte zurückgenommen, hätte ihre Mutter um Verzeihung gebeten. Doch sie kam nicht mehr dazu. Cynthias Hand war schneller.
Sie traf Grace mitten ins Gesicht.
Eine Ohrfeige, so kräftig, dass ich sie auf meiner eigenen Wange spürte.
»Cyn!«, rief ich.
Im selben Augenblick taumelte Grace zur Seite und streckte instinktiv die Hand aus, um einen eventuellen Sturz abfangen zu können.
Sie erwischte den Topf, in dem der Reis kochte. Stieß ihn zur Seite. Die Hand rutschte ab. Landete auf der Kochplatte.
Der Schrei. Himmel, der Schrei.
»O Gott!«, sagte Cynthia. »Oh, mein Gott!«
Sie packte Grace am Arm, drehte sie zur Spüle herum, machte das kalte Wasser an und hielt Grace’ Hand unter den kräftigen Strahl. Sie hatte mit dem Handrücken den heißen Topf und mit der Handkante die Kochplatte berührt, jeweils nicht länger als eine Millisekunde, doch das hatte genügt, um das Fleisch zu versengen.
Tränen strömten Grace übers Gesicht. Ich nahm sie fest in den Arm, während Cynthia ihr das Wasser über die Hand laufen ließ.
Wir brachten sie ins Krankenhaus Milford.
»Du kannst ihnen ruhig die Wahrheit sagen«, sagte Cynthia zu Grace. »Du kannst ihnen sagen, was ich getan habe. Wenn sie die Polizei rufen, sollen sie’s tun. Geschieht mir recht, wenn ich bestraft werde. Ich werde nicht von dir verlangen, für mich zu lügen.«
Grace erzählte dem Arzt, sie habe Wasser aufgesetzt, um sich Nudeln zu kochen. Sie habe ihre Kopfhörer in den Ohren gehabt, Adeles »Rolling in the Deep« gehört, dazu getanzt und wie eine Verrückte mit den Armen um sich geschlagen. Dabei habe sie den Griff erwischt und den Topf vom Herd gerissen.
Wir brachten Grace mit ihrer sorgfältig verbundenen Hand nach Hause.
Am nächsten Tag zog Cynthia zum zweiten Mal aus.
Sie ist noch nicht zurückgekommen.
2
Reggie, Reggie, komm rein, komm rein.«
»Hi, Unk.«
»Hast du sie gefunden?«
»Himmel, lass mich doch erst meinen Mantel ausziehen.«
»Tut mir leid. Ich bin nur –«
»Nein. Ich habe … sie nicht gefunden. Noch nicht. Und Geld hab ich auch keins gefunden.«
»Aber ich dachte – Du hast doch gesagt, du hast das Haus gefunden, und –«
»Es hat nicht geklappt. Es war eine falsche Spur. Eli hat uns angelogen, Unk. Und zurückfahren und ihn noch mal fragen können wir nicht.«
»Oh. Aber du hast doch gesagt –«
»Ich weiß, was ich gesagt habe. Aber du hörst doch, es ist schiefgegangen.«
»Tut mir leid. Ich habe mir so große Hoffnungen gemacht. Als wir das letzte Mal telefoniert haben, hatte ich den Eindruck, du bist dir ganz sicher. Ich bin halt enttäuscht. Es gibt fertigen Kaffee, wenn du welchen möchtest.«
»Danke.«
»Trotzdem, ich bin dir dankbar für alles, was du für mich tust.«
»Schon gut, Unk.«
»Ich meine, was ich sage. Ich weiß, du kannst es schon nicht mehr hören. Aber ich meine es wirklich so. Du bist alles, was ich habe. Du bist das Kind, das ich nie hatte, Reggie.«
»Ein Kind bin ich nicht mehr.«
»Nein, nein – du bist jetzt richtig erwachsen. Du bist schnell groß geworden.«
»Konnte mir’s nicht aussuchen. Der Kaffee ist gut.«
»Tut mir nur leid, dass ich nicht früher für dich da war.«
»Ich habe dir nie Vorwürfe gemacht. Das weißt du. Wir müssen das nicht noch mal durchkauen. Hast du das Gefühl, dass ich mich da reinsteigere? Hm? Und ich bin diejenige, der das alles passiert ist. Also wenn ich damit leben kann, dann solltest du’s auch können.«
»Es fällt mir schwer.«
»Du lebst in der Vergangenheit. Das ist dein Problem, Unk. Mein Gott, damit hat dieser ganze Scheiß hier überhaupt erst angefangen. Weil es dir so schwerfällt, loszulassen.«
»Ich … ich habe halt gehofft, dass du sie findest.«
»Ich gebe nicht auf.«
»Aber ich seh’s dir an. Du hältst das alles für Schwachsinn. Für dich ist das alles eine Lappalie.«
»Das habe ich nicht gesagt. Nicht den letzten Teil. Hör mal, ich verstehe schon, warum dir das wichtig ist, warum sie dir so viel bedeutet. Und du bist mir wichtig. Es gibt nur zwei Menschen, die mir etwas bedeuten. Und du bist einer davon, Unk. Alle anderen sind mir scheißegal.«
»Aus dir werd ich nicht schlau. Und weißt du, warum?«
»Nein. Warum?«
»Du verstehst die Menschen, du kapierst, wie sie denken und wie sie fühlen. Du kannst dich richtig in sie hineinversetzen. Und trotzdem hast du keine … wie heißt das Wort?«
»Liebe?«
»Nein, das meine ich nicht.«
»Empathie?«
»Ja, ich glaube, so nennt man das.«
»Dich hab ich lieb, Unk. Sehr sogar. Aber Empathie? Ich glaube, ich verstehe, wie die Leute ticken. Ich weiß, was sie fühlen. Ich muss wissen, was sie fühlen. Ich muss wissen, wann sie Angst haben. Ich muss spüren, dass sie Angst haben. Aber leid tun sie mir deswegen nicht. Sonst könnte ich nicht tun, was ich tue.«
»Tja, ich täte mich sicher leichter, wenn ich mehr wie du wäre. Ich hatte wohl zu viel Empathie für diesen verdammten Eli. Er kam mir vor, wie ein Kind, das sich verlaufen hatte – zum Teufel, ein Kind war er wirklich nicht mehr. Einundzwanzig oder zweiundzwanzig war er schon. So um den Dreh rum. Ich hab ihn doch anständig behandelt, Reggie. Dachte ich wenigstens. Wirklich. Und dann fällt mir dieser Hurensohn in den Rücken.«
»Ich glaube, er hat sich bei dem anderen Interessenten gemeldet.«
»Mist. Das darf doch nicht wahr sein!«
»Nicht so schlimm. Nur ein erster Kontakt. Mit den Einzelheiten wollte er erst bei einem persönlichen Gespräch herausrücken. Zu dem es jetzt natürlich nicht mehr kommen wird. Ich glaube, er hat uns die Wahrheit darüber gesagt, was mit ihr geschehen ist, aber wo sie ist … da hat er uns angelogen. Und das Haus der Lehrer war ein Reinfall. Außerdem frage ich mich langsam, ob die Betroffenen überhaupt Bescheid wissen. Ob sie ihre Zustimmung gegeben haben.«
»Das verstehe ich nicht.«
»Nicht so schlimm. Aber was ich dir eigentlich sagen wollte: Ich werde mehr Leute brauchen. Und ein deutlich größeres Startkapital.«
»Eli hat alles genommen, was ich gespart habe, Reggie.«
»Nicht so schlimm. Ich kann was vorstrecken. Das mit der Steuerrückerstattung läuft gut. Ich habe Rücklagen. Und wenn alles vorbei ist, kriege ich nicht nur zurück, was ich reingesteckt habe, sondern auch dein Geld, und noch eine Menge darüber hinaus. Es wird sich noch alles zum Guten wenden.«
»Trotzdem versteh ich’s nicht.«
»Nicht so schlimm. Das musst du auch nicht. Lass mich einfach machen.«
»Ich kann’s gar nicht fassen … nach so vielen Jahren bekomme ich sie endlich zurück, und schon verliere ich sie wieder. Eli hatte kein Recht, weißt du. Er hatte kein Recht, sie mir wegzunehmen.«
»Wir kriegen sie zurück, Unk. Verlass dich auf mich.«
3
Cynthia wohnte zwar nicht mehr bei uns, das hieß aber nicht, dass wir nichts mehr voneinander hörten und sahen. Wir telefonierten jeden Tag miteinander. Manchmal trafen wir uns zum Mittagessen. In der ersten Woche nach ihrem Auszug gingen wir zu dritt zum Abendessen. Ins Bistro Basque in der River Street. Die beiden Damen bestellten Lachs, und ich entschied mich für das mit Spinat und Pilzen gefüllte Hähnchen.
Wir benahmen uns alle mustergültig. Kein Wort über den Abstecher ins Krankenhaus, obwohl Cynthias Blick ständig zu Grace’ verbundener Hand wanderte. Schon das Essen hatte etwas Surreales, doch die Krönung des Abends kam, als Grace und ich Cynthia danach vor ihrer zeitweiligen Bleibe absetzten und allein nach Hause fuhren.
Mit der Wohnung hatte sie wirklich Glück gehabt. Cynthia hatte eine Arbeitskollegin, die in der letzten Juniwoche zu einer Brasilienreise aufbrechen und nicht vor August, vielleicht sogar erst im September zurückkehren wollte. Cynthia hatte sich daran erinnert, dass die Kollegin ihre Wohnung für die Dauer ihrer Abwesenheit untervermieten wollte, aber keinen Interessenten gefunden hatte.
Einen Tag vor Beginn der Reise sagte Cynthia, sie werde die Wohnung übernehmen. Die Kollegin sprach mit dem Vermieter, einem alten Knaben namens Barney, und damit war die Sache geritzt.
Ich hatte damit gerechnet, dass Cynthia noch vor dem Labor Day wieder bei uns sein würde. Doch langsam kamen mir Zweifel. Die Tage vergingen, und sie zeigte nicht die geringste Neigung, zurückzukommen.
Vielleicht ging das ja so weiter. Vielleicht würde sie sich Anfang September, wenn die Kollegin zurückkehrte, nach einer neuen Bleibe umsehen. Das waren die Gedanken, die ich wälzte, wenn ich nachts wach lag, ein leeres Bett neben mir.
Etwa zehn Tage nach Cynthias Auszug fuhr ich gegen fünf zu ihr. Ich konnte damit rechnen, dass sie um diese Zeit schon zu Hause war. Sie arbeitete im Gesundheitsamt von Milford und kümmerte sich dort um alles: von der Inspektion von Restaurants bis hin zu Informationsveranstaltungen in Schulen über gesunde Ernährung.
Ich hatte recht. Als Erstes sah ich ihren Wagen. Er parkte zwischen einem sportlich aussehenden Cadillac und einem alten blauen Pick-up, der, wie ich wusste, Barney gehörte. Er mähte gerade den Rasen neben dem Haus und humpelte daher, als hätte er ein längeres und ein kürzeres Bein. Ich parkte vor dem Haus.
Cynthia saß auf der vorderen Veranda, die Füße auf dem Geländer, ein Bier in der Hand.
Ein hübsches Plätzchen, das sie da gefunden hatte. Es war ein altes Haus im Kolonialstil und stand an der North Street, gleich südlich der Boston Post Road. Zweifellos hatte es einmal einer der einflussreicheren Familien in Milford gehört, bevor Barney es gekauft und in vier Wohnungen unterteilt hatte. Zwei im Erdgeschoss und zwei im ersten Stock.
Noch ehe ich meine Frau begrüßen konnte, hatte Barney mich entdeckt und den Rasenmäher abgestellt.
»Hey, wie geht’s?«, rief er mir zu. Für Barney waren Cynthia und ich so was wie Promis, auch wenn die Berühmtheit, die wir erlangt hatten, etwas war, auf das man gut und gerne verzichten konnte. Jedenfalls fand er es anscheinend aufregend, auf Tuchfühlung mit uns zu sein.
»Gut«, sagte ich. »Lassen Sie sich bloß nicht von der Arbeit abhalten.«
»Nach dem hier muss ich noch zwei andere Häuser machen«, sagte er und wischte sich mit dem Handrücken über die Stirn. Barney besaß zwischen New Haven und Bridgeport mindestens ein Dutzend Häuser, die er zu Wohnungen umgebaut hatte. Das hier war allerdings eines der hübscheren, wie er mir in einem unserer früheren Gespräche anvertraut hatte, weshalb er sich mit dessen Instandhaltung mehr Mühe gab. Vielleicht hatte er ja vor, es in absehbarer Zeit zu verkaufen. »Ihre Frau Gemahlin sitzt hier unten auf der Veranda«, sagte er.
»Seh ich«, sagte ich. »Sie könnten wahrscheinlich auch eine Erfrischung gebrauchen.«
»Geht schon. Ich hoffe, es renkt sich wieder ein.«
»Wie bitte?«, fragte ich.
»Das zwischen Ihnen und Ihrer Frau.« Er zwinkerte mir zu und widmete sich dann wieder seinem Rasenmäher.
Cynthia stellte ihr Bier aufs Geländer und stand auf, als ich die Verandastufen hinaufstieg.
»Hey«, sagte sie. Ich erwartete, dass sie mir auch was zu trinken anbieten würde, doch sie tat es nicht, und ich fragte mich, ob ich vielleicht ungelegen kam. Sie machte ein sorgenvolles Gesicht. »Alles in Ordnung?«, fragte sie.
»Alles bestens.«
»Ist was mit Grace?«
»Ich sag doch, alles bestens.«
Beruhigt setzte sie sich wieder hin. Ihr Telefon lag mit der Tastatur nach unten auf einer Armlehne des Holzstuhls. Darunter lag ein Prospekt des Gesundheitsamts mit dem Titel: »Haben Sie Schimmel im Haus?«
»Darf ich mich setzen?«
Sie deutete mit dem Kopf auf den Stuhl neben sich.
Ich zeigte auf den Prospekt. »Probleme mit deiner neuen Wohnung? Den solltest du Barney zeigen. Der flippt aus.«
Cynthia warf einen Blick auf den Prospekt und schüttelte den Kopf. »Das ist eine Aufklärungskampagne, die wir neu gestartet haben. Ich habe in letzter Zeit so viel über Schimmelpilze in Häusern und Wohnungen geredet, dass die mich schon bis in meine Träume hinein verfolgen.«
»Wie in diesem Film«, sagte ich. »Der Blob.«
»War das ein Pilz?«
»Ein Pilz aus dem All.«
Sie lehnte den Kopf an die Stuhllehne. Die Beine hatte sie auf das Geländer gelegt. Sie seufzte. »Das habe ich zu Hause nie gemacht. Mich nach der Arbeit einfach hingesetzt und ein bisschen entspannt.«
»Kommt wahrscheinlich daher, dass wir keine Veranda mit Geländer haben«, sagte ich. »Ich bau dir eine, wenn du magst.«
Das entlockte ihr ein leises Lachen. »Du?«
Die Kunst des Hausbaus war keine der männlichen Stärken, deren ich mich rühmen konnte. »Na ja, ich könnte jemanden dafür engagieren. Mit dem Hammer bin ich vielleicht nicht so der Bringer, aber mit Scheck und Kugelschreiber bin ich echt der Hammer.«
»Was ich damit – zu Hause gibt’s immer was zu tun. Sofort, auf der Stelle. Aber hier, wenn ich von der Arbeit komme, setze ich mich her und schau mir die Autos an, die vorüberfahren. Das ist es. Hier hab ich Zeit zum Nachdenken, verstehst du?«
»Glaub schon.«
»Ich meine, du hast den ganzen Sommer zum Entspannen.« Da hatte sie recht. Als Lehrer konnte ich im Juli und August meinen Akku wieder aufladen. Cynthia arbeitete noch nicht so lange bei der Stadt und hatte daher nur Anspruch auf zwei Wochen Urlaub im Jahr. »Mein Urlaub ist die eine Stunde am Ende eines Tages, wo ich einfach hier sitze und nichts tue.«
»Schön«, sagte ich. »Wenn’s dir gut dabei geht, dann bin ich froh.«
Sie sah mich an. »Nein, bist du nicht.«
»Ich will nur, was gut für dich ist.«
»Ich weiß nicht mehr, was gut für mich ist. Ich sitze hier und denke, ich habe den Ursprung meiner Ängste und Sorgen hinter mir gelassen, die ewigen dummen Streitereien mit Grace, und dann wird mir klar, dass ich selbst der Ursprung meiner Ängste bin, und vor mir selbst kann ich nicht davonlaufen.«
»Es gibt da einen Witz von Garrison Keillor«, sagte ich, »über ein altes Ehepaar, das nicht miteinander auskommt. Sie überlegen, ob sie in Urlaub fahren sollen, und der Mann sagt: Warum Geld ausgeben, um mir das Leben woanders zu vermiesen, wenn ich’s mir auch zu Hause vermiesen kann?«
Sie runzelte die Stirn. »Siehst du uns als altes Ehepaar?«
»Das war nicht die Pointe.«
»Ich werde nicht ewig hierbleiben«, sagte Cynthia. Sie musste lauter sprechen, weil Barney seine gärtnerischen Aktivitäten jetzt vors Haus verlegt hatte. Der Duft von frischgemähtem Gras wehte uns entgegen. »Aber ich werde auch nichts überstürzen.«
So sehr ich mir auch wünschte, dass sie wieder nach Hause kam, anbetteln würde ich sie nicht. Sie musste es von sich aus tun, wenn sie so weit war.
»Was hast du Teresa gesagt?«, fragte Cynthia. Teresa Moretti, die Frau, die einmal die Woche zu uns zum Putzen kam. Vor vier, fünf Jahren, als Cynthia und ich so viel um die Ohren gehabt hatten, dass wir nicht einmal mehr das Allernötigste im Haushalt erledigen konnten, hatten wir uns nach einer Putzfrau umgehört und Teresa gefunden. Ich hatte zwar den Sommer über frei und verfügte auch über die nötigen Kenntnisse, ein Haus aufzuräumen, doch Cynthia hielt es für unfair, Teresa im Juli und im August nicht zu beschäftigen.
»Sie braucht das Geld«, hatte Cynthia damals argumentiert.
Normalerweise bekam ich Teresa gar nicht zu Gesicht, weil ich in der Schule war. Doch vor sechs Tagen war ich zu Hause, als sie mit dem Schlüssel, den sie von uns hatte, die Haustür aufsperrte. Sie sah sofort, dass was nicht stimmte. Cynthias Schminksachen standen nicht herum, auch andere persönliche Gegenstände fehlten, und Cynthias Morgenmantel lag nicht auf dem Sessel in unserem Schlafzimmer. Sie fragte, ob Cynthia verreist sei.
Jetzt, auf der Veranda, sagte ich zu meiner Frau: »Ich habe ihr gesagt, dass du dir eine kleine Pause gönnst. Dachte, das müsste genügen, doch dann wollte sie wissen, wo du hingefahren bist, ob ich dir nachfahre, ob Grace nachkommt, wie lange wir weg sind …«
»Sie macht sich Sorgen, dass wir sie womöglich nur mehr alle zwei Wochen oder sogar nur einmal im Monat brauchen.«
Ich nickte. »Sie kommt morgen. Ich werde sie beruhigen.«
Cynthia setzte die Flasche an die Lippen. »Kanntest du diese Lehrer?«
Die beiden Lehrer, die vor ein paar Tagen keine zwei Kilometer von hier in ihrem Haus umgebracht worden waren.
Nach dem, was ich gelesen und im Fernsehen gesehen hatte, stand die Polizei vor einem Rätsel. Rona Wedmore, die Kriminalpolizistin, die vor sieben Jahren in unserem Fall die Ermittlungen geleitet hatte, war für diese Sache zuständig. Sie hatte mehr oder weniger eingestanden, dass weit und breit kein Motiv zu erkennen war: Verdächtige gab es anscheinend auch keine. Zumindest keine, über die die Polizei von Milford sich auslassen wollte.
Die Vorstellung, dass ein Rentnerehepaar ohne jegliche bekannte Verbindung zu kriminellen Kreisen im eigenen Haus hingerichtet wurde, löste in der Stadt Unbehagen aus. Hier und da – insbesondere in den Nachrichtensendungen – war von einem »Sommer der Angst« in Milford die Rede.
»Wir sind uns nie über den Weg gelaufen«, sagte ich. »Wir haben nie an derselben Schule unterrichtet.«
»Es ist grauenhaft«, sagte sie. »Völlig sinnlos.«
»Es gibt immer einen Grund«, sagte ich. »Vielleicht keinen, der wirklich Sinn ergibt, aber irgendeinen Grund gibt es immer.«
Auf Cynthias Bierflasche waren Kondensperlen zu sehen. »Heiß ist es heute«, sagte ich. »Bin gespannt, wie das Wetter am Wochenende wird. Vielleicht könnten wir alle zusammen was unternehmen.«
Ich wollte ihr Handy nehmen, um mir mit ihrer Wetter-App die Vorhersage für die nächsten Tage anzusehen. Zu Hause tat ich das auch immer, wenn ich mein eigenes Handy gerade nicht zur Hand hatte. Doch Cynthia nahm es und legte es auf die andere Armlehne, außerhalb meiner Reichweite.
»Ich habe gehört, dass es schön werden soll«, sagte sie. »Telefonieren wir doch am Samstag.«
Barneys Benzinrasenmäher bearbeitete jetzt die andere Seite des Gartens.
»Er hat gesagt, er hofft, dass sich alles wieder einrenkt«, sagte ich.
Cynthia schloss sekundenlang die Augen und seufzte. »Ich habe kein Sterbenswörtchen gesagt, ich schwöre. Aber er macht sich halt seinen eigenen Reim darauf. Er sieht, dass du kommst, aber nicht bleibst. Bietet seinen Rat an. Carpe diem und so.«
»Was weißt du über ihn?«
»Nicht viel. Mitte sechzig, war nie verheiratet, lebt allein. Erzählt gern, wie er sich in den Siebzigern das Bein bei einem Autounfall geschrottet hat und seither nicht mehr richtig laufen kann. Eigentlich eine traurige Figur. Aber in Ordnung. Ich höre ihm zu, bemühe mich, seine Gefühle nicht zu verletzen. Kann ja sein, dass ich eines Abends mit einem verstopften Klo dastehe und ihn brauche.«
»Wohnt er hier?«
Cynthia schüttelte den Kopf. »Nein. Oben in der Wohnung gegenüber lebt ein junger Mann – das ist vielleicht eine Geschichte, ich erzähl sie dir mal. Und im Erdgeschoss wohnt Winnifred – ich schwöre bei Gott, Winnifred –, die arbeitet in der Bibliothek. Und gegenüber noch so ein trauriger alter Sack. Orland heißt er, und ist noch älter als Barney. Lebt ganz allein, kriegt so gut wie nie Besuch.« Sie rang sich ein Grinsen ab. »Das ist das Haus der Verdammten, glaub’s mir. Die leben hier alle allein. Haben niemanden auf der Welt.«
»Du schon«, sagte ich.
Cynthia sah weg. »Damit wollte ich nicht sagen, dass –«
Plötzlich war Lärm aus dem Haus zu hören. Jemand, der eine Treppe herunterkommt, herunterläuft.
Die Tür ging auf und ein Mann kam heraus. Er war vielleicht Ende zwanzig, Anfang dreißig, schlank und hatte dunkles Haar. Er sah zunächst nur Cynthia.
»Hallo, Schönheit«, sagte er. »Wie läuft’s so?«
»Hi, Nate«, sagte Cynthia mit einem verlegenen Lächeln. »Ich möchte dir jemanden vorstellen.«
»Oh, hey«, sagte er, als sein Blick auf mich fiel. »Noch ein Freund?«
»Das ist Terry. Mein Mann. Terry, das ist Nathaniel. Mein Nachbar von gegenüber.«
Sie sah mich an und zog kurz die Augenbrauen hoch. Das war also der Typ mit der Geschichte, die sie mir noch erzählen wollte.
Sofort schoss ihm das Blut ins Gesicht, und es dauerte vielleicht eine Zehntelsekunde, ehe er sich entschloss, mir die Hand zu geben. »Nett, Sie kennenzulernen. Hab schon viel von Ihnen gehört.«
Ich sah Cynthia an, doch sie sah weg.
»Wo willst du denn hin?«, fragte Cynthia. »So spät führst du doch keine Hunde mehr aus, oder? Jetzt sind die Leute bestimmt schon alle zu Hause.«
»Geh nur schnell was essen«, antwortete Nathaniel.
»Sie haben Hunde?«, fragte ich.
Er lächelte betreten. »Hier nicht, und es sind auch nicht meine. Das mach ich beruflich. Ich führe Hunde aus. Tagsüber gehe ich von Haus zu Haus und hole die Köter meiner Kunden zum Gassigehen ab, während die Leute arbeiten.« Er zuckte die Schultern. »Ein kleiner Branchenwechsel. Aber das hat Cyn… – Ihre Frau – Ihnen bestimmt schon erzählt.«
Wieder sah ich Cynthia an, diesmal erwartungsvoll.
»Hab ich nicht«, sagte Cynthia. »Aber lass dich nicht aufhalten.«
»War nett, Sie kennenzulernen«, sagte er zu mir, trabte die Stufen hinunter, setzte sich ans Steuer des Caddy und fuhr auf der North Street davon.
»Er führt Hunde aus und fährt einen Cadillac?«, sagte ich.
»Lange Geschichte. Die Kurzversion geht so: Hat eine Unmenge Geld mit Handy-Apps gemacht, dann ist der Markt vorübergehend eingebrochen, er hat alles verloren und einen Nervenzusammenbruch bekommen. Jetzt führt er jeden Tag anderer Leute Hunde aus und versucht, sein Leben wieder in den Griff zu kriegen.«
Ich nickte. Offenbar zog dieses Haus Leute an, die einen Neuanfang suchten.
»Tja«, sagte ich.
Eine Minute lang sprach keiner von uns ein Wort. Cynthia blickte die ganze Zeit auf die Straße.
Schließlich sagte sie: »Ich schäme mich.«
»Es war ein Unfall«, sagte ich. »Es war einfach ein dummer Unfall. Du hast das doch nicht mit Absicht gemacht.«
»Ich tu alles, um sie zu beschützen, und dann muss sie ausgerechnet meinetwegen ins Krankenhaus.«
Ich wusste nicht, was ich sagen sollte.
»Du musst wahrscheinlich nach Hause und Grace’ Abendessen machen«, sagte Cynthia. »Drück sie von mir.« Sie schwieg. »Sag ihr, ich hab sie lieb.«
»Das weiß sie«, sagte ich und stand auf. »Ich sag’s ihr aber trotzdem.«
Sie begleitete mich zum Wagen. Der Geruch von frisch gemähtem Gras stieg mir wieder in die Nase.
»Wenn was nicht in Ordnung wäre, wenn Grace was angestellt hätte, das würdest du mir doch sagen?«, fragte Cynthia. »Oder?«
»Natürlich.«
»Du musst mich nicht schonen. Ich halt das schon aus.«
»Alles läuft bestens.« Ich grinste. »Die meiste Zeit passt sie auf mich auf. Damit ich nichts anstelle. Wilde Partys feiern und so. Den Zahn zieht sie mir sofort.«
Cynthia legte mir die Hand auf die Brust. »Ich komme zurück. Aber ich brauch noch ein bisschen Zeit.«
»Ich weiß.«
»Behalt sie einfach im Auge. Diese Sache da mit den Lehrern, die umgebracht wurden, die hat mich auf Gedanken gebracht, die ich lieber nicht hätte.«
Ich zwang mich zu einem Lächeln. »Vielleicht war’s ein ehemaliger Schüler. Der wollte sich nach Jahren an den Lehrern rächen, die ihn immer auf dem Kieker hatten, weil er seine Hausaufgaben nicht gemacht hat. Ich muss die Augen offen halten.«
»Sag so was nicht mal zum Spaß.«
Mir verging das Lächeln gleich wieder. Das war wirklich nicht witzig gewesen. »Tut mir leid. Es geht uns gut. Wirklich. Noch besser wird es uns gehen, wenn du wieder da bist, aber wir kommen zurecht. Und ich bewache sie mit Argusaugen.«
»Das solltest du auch.«
Ich stieg in meinen Ford Escape und fuhr los. Unterwegs fielen mir immer wieder zwei Dinge ein, die Nathaniel gesagt hatte.
Hallo, Schönheit, war das erste.
Und das zweite: Noch ein Freund?
4
Willst du mal richtig Spaß haben?«, fragte der Junge.
Grace fand das beunruhigend. Vielleicht nicht sehr, aber doch ein wenig.
Sie hatte eine ziemlich genaue Vorstellung, worauf Stuart hinauswollte. Ein bisschen Spaß hatten sie nämlich schon gehabt. Aber alles nur über der Gürtellinie, hinter dem Walmart im alten Buick von Stuarts Vater. Dieser Wagen war ein Flugzeugträger. Motorhaube und Kofferraum meterlang. Und innen drin erst. Den Rücksitz brauchte man eigentlich gar nicht. Es gab nämlich einen durchgehenden Vordersitz – keine Konsole, kein Ganghebel im Weg – und der war so groß wie eine Parkbank, nur viel, viel weicher. Der Wagen stammte noch aus den Siebzigern, und wenn er in die Kurve ging, hatte sie das Gefühl, sie sitze in einem riesigen Boot draußen auf dem Atlantik oder so, und würde von den Wellen hinausgetragen.
Grace hatte nichts dagegen gehabt, so weit zu gehen, wie sie bisher gegangen waren – er hatte sie an einigen Stellen berühren dürfen –, aber noch weiter sollte es nicht gehen. Noch nicht jedenfalls. Immerhin war sie erst vierzehn. Und auch wenn sie sich absolut sicher war, dass man mit vierzehn kein Kind mehr war, musste sie sich doch eingestehen, dass Stuart mit seinen sechzehn Jahren vielleicht doch ein bisschen besser Bescheid wusste, wie das mit dem Sex funktionierte. Nicht dass sie Angst vor dem ersten Mal gehabt hätte. Wovor sie Angst hatte, war, sich total dämlich anzustellen. Alle wussten, oder dachten, dass Stuart schon eine Menge Mädchen gehabt hatte. Was wäre, wenn sie alles falsch machte? Am Ende wie der letzte Idiot dastand?
Also beschloss sie, die Sache langsam anzugehen. »Ich weiß nicht«, sagte sie und löste sich von ihm. Sie lehnte sich an die Beifahrertür. »Das war schon schön. Aber ich weiß nicht, ob ich schon, na ja, bereit bin für den nächsten Schritt.«
Stuart lachte. »Scheiße. Davon red ich doch gar nicht. Obwohl, wenn du meinst, dass du so weit bist, ich bin ausgestattet.« Er schob die Hand in die Vordertasche seiner Jeans.
Grace schlug ihm neckisch auf die Hand. »Und wovon redest du dann?«
»Es ist was total Cooles. Ich schwör dir, da machst du dir ins Höschen.«
Grace konnte sich schon denken, was das war. Ein bisschen Gras vielleicht, oder X. Da war doch nichts dabei. Probieren konnte sie so was doch mal. Und es machte ihr deutlich weniger Angst als die Vorstellung, unter die Gürtellinie zu gehen. »Und? Was soll das sein? Ein paar Sachen hab ich schon ausprobiert. Nicht nur Gras.« Das war gelogen, doch der Schein musste schließlich gewahrt werden.
»Nix in der Richtung«, sagte Stuart. »Bist du schon mal Porsche gefahren?«
Damit hatte sie nicht gerechnet. »Ich bin überhaupt noch nicht gefahren, du Blödian. Es dauert noch zwei Jahre, bis ich den Führerschein machen darf.«
»Ich meine, bist du schon mal in einem Porsche gefahren?«
»Ist das dieser Sportwagen?«
»Mensch, du weißt nicht, was ein Porsche ist?«
»Klar weiß ich das. Also. Warum fragst du, ob ich schon mal in einem Porsche gefahren bin?«
»Bist du oder nicht?«
»Nein«, sagte Grace. »Glaube ich wenigstens. Aber ich pass da nicht so auf. Vielleicht habe ich ja schon mal in einem gesessen und es nur nicht gewusst.«
»Ich glaube, wenn du schon mal in einem gesessen hättest, dann wüsstest du’s. Das ist nämlich kein Auto wie alle anderen. Es ist ganz flach und total cool und so schnell, da scheißt du dir in die Hosen.«
»Aha. Dann nicht.«
Rein äußerlich machte Stuart schon ziemlich was her, und er war auch einer von den Coolen, wenn auch nicht unbedingt im positiven Sinn. Ihm schien alles scheißegal zu sein. Auf ein Mädchen, dem es zum Hals heraushing, immer auf Nummer sicher gehen zu müssen, wirkte das zunächst recht anziehend. Aber nachdem sie sich dreimal getroffen hatten, kam ihr der Verdacht, dass er mit Geistesgaben deutlich weniger gesegnet war als mit gutem Aussehen.
Grace hatte ihrem Vater nicht erzählt, dass sie mit Stuart zusammen war, denn er kannte den Jungen nur zu gut. Sie erinnerte sich, dass sein Name nicht nur einmal gefallen war, damals, vor zwei Jahren, als Stuart bei ihrem Vater Englisch hatte. Wenn ihr Vater abends am Küchentisch Schulaufgaben korrigierte, entschlüpfte ihm gelegentlich eine Bemerkung über die gähnende Leere im Kopf dieses Jungen. Und so etwas kam äußerst selten vor, denn ihr Vater war der Meinung, das sei unprofessionell. Und es gehöre sich auch nicht, die Leistungen von Schülern zu kommentieren, die seine Tochter möglicherweise kannte. Aber hin und wieder, wenn ein Schüler arg dumm war, ließ er sich doch dazu hinreißen.
Ihr fiel wieder die sarkastische Bemerkung ein, die ihr Vater einmal beim Korrigieren gemacht hatte. In Anspielung auf ihren damaligen Wunsch, eines Tages Astronautin zu werden und zur internationalen Raumstation ISS zu fliegen, hatte ihr Vater gemeint, er könne sich Stuart gut als Raumstation vorstellen. Denn schon jetzt, in der Schule, stelle er täglich sein Talent unter Beweis, unnütz im Raum herumzuhängen.
Heute Abend tendierte Grace zur Ansicht, ihr Vater habe den Nagel damals auf einen tatsächlich sehr hohlen Kopf getroffen.
Einmal hatte Stuart sie gefragt, was sie nach der Schule machen wolle, und sie hatte es ihm gesagt.
»Im Ernst?«, hatte er gefragt. »Die schicken doch nur Männer in den Weltraum.«
»Hallo?«, hatte sie gekontert. »Und was ist mit Sally Ride? Svetlana Savitskaya? Roberta Bondar?«
Seine Antwort darauf: »Die hast du doch gerade alle erfunden.«
Na ja. Sie musste ihn ja schließlich nicht heiraten. Sie wollte doch nur ein bisschen … Spaß. Nur ein bisschen … mit dem Feuer spielen. Und genau das hatte er ihr doch gerade in Aussicht gestellt, nicht wahr?
»Ich bin definitiv noch nie in einem Porsche gefahren.«
Stuart grinste. »Hast du Lust?«
Ein Handy klingelte.
»Das ist deins«, sagte Stuart.
Grace kramte ihr Telefon aus der Handtasche und warf einen Blick auf die Anzeige. »Ah, nee.«
»Wer ist das?«
»Mein Dad. Ich sollte eigentlich schon zu Hause sein.« Es war gleich zehn.
Stuart verstellte seine Stimme zu einem tiefen Bariton. »Du kommst jetzt sofort nach Hause, mein Fräulein, und machst deine Hausaufgaben.«
»Hör auf.« Auch wenn ihr Vater ihr manchmal mächtig auf den Keks ging, andere hatten kein Recht, sich über ihn lustig zu machen. Sie konnte es nicht leiden, wenn sie in der Schule hörte, wie Mitschüler ihn heruntermachten. In dieselbe Schule zu gehen, in der der eigene Vater unterrichtete, war kein Zuckerschlecken. Diese Erwartungshaltung von allen Seiten. Musterschülerin sollte sie sein, in jeder Hinsicht. Schließlich war sie die Tochter eines Lehrers. Jeder hatte eben sein Päckchen zu tragen. Nicht, dass sie schlechte Noten nach Hause gebracht hätte. Nein, sie war ziemlich gut, besonders in den Naturwissenschaften. Aber gelegentlich schrieb sie was Falsches hin, damit sie nicht die volle Punktezahl bekam und die Jungs sie nicht wieder nach der verschrobenen Neurobiologin in dieser Fernsehserie Amy Farrah Fowler nannten.
Grace’ Handy klingelte und klingelte. »Gehst du jetzt ran oder nicht?«, fragte Stuart.
Sie starrte es in der Hoffnung an, es mit ihrem Blick zum Schweigen zu bringen. Was es nach dem zehnten Klingeln auch tat.
Doch gleich darauf kam eine SMS. »Scheiße«, sagte sie. »Er will, dass ich daheim anrufe.«
»Er hält dich ja ganz schön kurz. Ist deine Mutter auch so’n Kontrollfreak?«
Wenn sie daheim wäre, dachte Grace. Wenn sie nicht vor zwei Wochen abgehauen wäre, nach dieser Geschichte mit dem kochenden Wasser. Der Verband war erst seit drei Tagen ab.
Sie ignorierte die Frage und kehrte zu ihrem ursprünglichen Thema zurück. »Dein Dad hat dir also einen Porsche gekauft?«
»Meine Güte, nein. Glaubst du echt, dann würde ich in so ’nem Panzer rumgurken?«
»Was dann?«
»Ich weiß, wo einer steht, wir könnten damit eine Spritztour machen.«
»Was laberst du denn da?«
»Ich könnte einen beschaffen. Dauert keine zehn Minuten. Zum Ausprobieren.«
»Was? Von einem Händler?«, fragte Grace. »Die haben doch bestimmt schon alle zu. Wer lässt dich denn so spät noch Probe fahren?«
Stuart schüttelte den Kopf. »Nicht von ’nem Händler. Von jemand zu Hause.«
»Wen kennst du denn, der einen Porsche hat?« Sie grinste. »Außerdem müsste der ganz schön doof sein, wenn er dir seinen Porsche leiht.«
»So ist das ja auch nicht gedacht. Die Karre steht in einer Garage, wo grad niemand zu Hause ist. Stand auf der Liste.«
»Auf welcher Liste?«
»Auf einer Liste halt. Mein Dad hat die. Da steht drauf, wer wann nicht da ist, im Urlaub und so. Die ist immer auf dem neuesten Stand. Da kümmern die sich drum. Und ich seh da nach, wer grad weg ist, und was für eine Karre der hat. Einmal hab ich mir einen Mercedes ausgeliehen. Zwanzig Minuten bin ich damit rumgefahren, und niemand hat was gemerkt. Nicht einen Kratzer hat er abgekriegt. Hab ihn wieder so in die Garage gestellt wie ich ihn rausgeholt hab.«
»Wer führt denn solche Listen?«, fragte Grace. »Was macht denn dein Dad? Arbeitet er bei einer Sicherheitsfirma?« Ihr dämmerte, was der Vater dieses Jungen beruflich machte. Und sie wäre sehr verwundert gewesen, wenn dessen Tätigkeit dazu beitrug, dass Menschen sich in ihren Häusern sicherer fühlten.
»Ja«, sagte Stuart, ohne zu überlegen. »Genau das macht er.«
Grace gingen der Anruf und die SMS von ihrem Vater nicht aus dem Sinn. Beim Weggehen hatte sie ihm gesagt, sie wolle mit einer Klassenkameradin ins Kino. Deren Mutter würde sie fahren. Der Film beginne um sieben und sei gegen neun zu Ende. Danach würde die Mutter sie nach Hause bringen.
Was würde ihr Vater tun, wenn er feststellte, dass Grace ihn angelogen hatte? Und zwar ziemlich dreist. Weder war sie mit der besagten Freundin unterwegs, noch war sie im Kino. Und nicht die Mutter des Mädchens, sondern Stuart würde sie eine Querstraße vom Haus ihrer Eltern entfernt absetzen. Ihr Vater hätte sie nie mit einem Jungen ausgehen lassen, der schon den Führerschein hatte.
Und erst recht nicht mit diesem Jungen, diesem unterbelichteten ehemaligen Schüler ihres Vaters, der nur den Unterricht gestört hatte und aus einem ziemlich dubiosen familiären Umfeld stammte. Jedenfalls vermutete Grace, dass ihr Vater das wusste.
»So, wie du daherredest, klingt das ziemlich nach Klauen«, sagte sie.
Stuart schüttelte den Kopf. »Überhaupt nicht. Klauen ist, wenn du dir einen Wagen nimmst und ihn behältst. Oder ihn jemand vertickst, wo er dann in einen Riesencontainer geladen und irgendwohin verschifft wird, nach Arabien oder so. Aber wir borgen ihn uns nur. Und voll ausfahren werden wir ihn auch nicht, weil das ist nämlich das Letzte, was du brauchen kannst, wenn du dir einen Wagen ausborgst, dass du einen Strafzettel kriegst.«
Grace ließ sich lange Zeit, bevor sie sagte: »Macht vielleicht wirklich Spaß.«
Er startete den Straßenkreuzer und fuhr Richtung Westen.
5
Detective Rona Wedmore war bettreif. Doch gerade, als sie sich hinlegen wollte, kam der Anruf, eine Leiche sei gefunden worden.
Lamont lag schon im Bett und schlief, erwachte jedoch, als er spürte, dass seine Frau sich wieder anzog.
»Schatz?«, sagte er und drehte sich um.
Sie würde nie müde werden, ihn sprechen zu hören, und wenn es nur ein einziges Wort war, so wie jetzt. Was er sagte, war völlig egal. Es war nämlich noch nicht allzu lange her, da hatte er überhaupt nicht gesprochen. Er war traumatisiert aus dem Irak zurückgekommen und hatte monatelang völlig teilnahmslos zu Hause herumgesessen. Erst in jener Nacht vor drei Jahren, als sie mit einem Schulterschuss im Krankenhaus gelandet war und er in die Notaufnahme kam, sagte er plötzlich: »Alles in Ordnung?«
Für diese drei Worte hatte es sich fast gelohnt, eine Kugel abzubekommen. Nein, es hatte sich gelohnt.
»Ich muss raus«, sagte sie. »Tut mir leid, dass ich dich geweckt habe.«
»Macht nix«, sagte er, ohne den Kopf vom Kissen zu heben. Er wusste, dass es keinen Zweck hatte, sie zu fragen, wie lange sie weg sein würde. Sie wäre so lange weg wie es notwendig war.
Sie sperrte die Haustür ab, stieg in ihren Wagen und machte sich auf den Weg zum Tatort. Das hatte Milford gerade noch gefehlt. Ein weiterer Mord. Als ob die Menschen hier nicht ohnehin schon verunsichert genug waren. Wedmore hoffte, dass es ein einfacher Fall war, irgendjemand, der bei einer Kneipenschlägerei ein Messer zwischen die Rippen bekommen hatte. Wenn es bei solchen Auseinandersetzungen Tote gab, wenn ein Idiot einem anderen im Suff den Garaus machte, regte das niemanden groß auf. Die Leute zuckten die Achseln und dachten: »So was passiert halt, wenn zwei Schläger mehr trinken, als sie vertragen.« Todesfälle in Kneipen jagten den braven Bürgern von Milford in der Geborgenheit der eigenen vier Wände keine Angst ein.
Aber ein toter Randalierer und ein ermordetes Rentnerehepaar, das waren zwei Paar Stiefel, wie Wedmores verstorbener Vater gesagt hätte. Zwei alte Leute erschossen in ihrem eigenen Haus? Ohne ersichtlichen Grund?
Das ging den Leuten an die Nieren.
Und Wedmore hatte nicht den kleinsten Anhaltspunkt für ihre Ermittlungen. Weder Richard noch Esther Bradley waren jemals polizeilich aktenkundig geworden. Nicht einmal ein unbezahlter Strafzettel konnte einem von beiden zur Last gelegt werden. Sie hatten eine verheiratete Tochter in Cleveland, die, das hatten die Nachforschungen ergeben, genauso unbescholten war. Die Bradleys hatten keine Marihuana-Plantage im Keller und kein Crystal-Meth-Labor in einem ausrangierten Großraumwohnwagen hinter dem Haus.