
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Die Seasons-Reihe
- Sprache: Deutsch
Wenn sie leben will, muss sie ihn töten In einer frostigen Winternacht auf einer vereisten Skipiste wird Jack Sommers nach einer missglückten Abfahrt vor die Wahl gestellt: ein ewiges Leben nach den uralten, magischen Regeln der Göttin Gaia, Herrin der Jahreszeiten, – oder der Tod, hier und jetzt. Jack wählt das Leben, der Winter wird seine Jahreszeit. Ab sofort wird er als Krieger seiner Saison von Fleur, der Vertreterin des Frühlings, gejagt und getötet, jedes Jahr aufs Neue. Trotzdem verlieben sich Jack und Fleur – eine Liebe, die nicht sein darf. Wenn sie diesen grausamen Kreislauf durchbrechen wollen, brauchen sie die Hilfe von Sommer und Herbst, ihren Todfeinden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 660
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über das Buch
Ihre Liebe ist verboten – und entfesselt den perfekten Sturm
Die Regeln der Jahreszeitengöttin Gaia sind simpel: Winter tötet Herbst, Herbst tötet Sommer, Sommer tötet Frühling und Frühling tötet Winter. In Jacks Welt heißt das: In einem ewigen Kreislauf jagt Jack Amber, Amber jagt Julio, Julio jagt Fleur und Fleur jagt Jack. Sie sterben, sie werden wiedergeboren, sie trainieren, sie jagen. Trotzdem verlieben Jack und Fleur sich ineinander – Winter und Frühling.
Fleur widerstrebt es zunehmend, ihrer mörderischen Bestimmung nachzukommen, und so zögert sie Jacks Tod immer weiter hinaus. Und läuft dadurch Gefahr, wegen ihrer schlechten Performance auf ewig eliminiert zu werden. Jack und Fleur müssen einen Weg finden, Gaia und ihren Gesetzen zu entkommen. Doch dazu benötigen sie die Hilfe ihrer Todfeinde: Amber und Julio – Herbst und Sommer.
Von Elle Cosimano ist bei dtv außerdem lieferbar:
Seasons of the Storm – Chronos’ Krieger (Band 2)
Elle Cosimano
Seasons of the Storm
Gaias Gefangene
Band 1
Roman
Aus dem amerikanischen Englisch von Michelle Gyo
Für Sarah Davies,
meine furchtlose Administratorin,
die den Weg im Blick hat und mir immer den Rücken stärkt
Anmerkung der Autorin:
Dieses Buch nimmt Bezug auf Suizid und selbstverletzendes Verhalten.
VORSPANN
PROLOG
Wintergreen, Virginia 21. Dezember 1988
Fleur
Mit einem Haus, in das man leicht hineinkommen, aus dem man jedoch kaum ausbrechen kann, stimmt etwas grundlegend nicht. Für die Winter Ridge Academy für Jungen gilt beides. Vier der fünf Stifte im Schloss habe ich bereits zurückgeschoben, und jetzt kann ich die Luft draußen praktisch schmecken, kalt und süß dringt sie durch den Spalt unter der Tür hindurch.
Meine Mitbewohner aus dem Wohnheim randalieren hinter mir, sie sind aufgepeitscht von dem billigen eingeschmuggelten Rum, und wir alle zusammen sind praktisch high von der Aussicht, eine Nacht außerhalb dieser Mauern zu verbringen und der Gefahr, dabei erwischt zu werden.
Doch das wird nicht passieren. Seit einem Monat plane ich das hier – ich habe die Wachwechsel der Sicherheitsleute abgepasst, ihre Patrouillen jede Nacht nach dem Zapfenstreich erfasst, habe mir gut überlegt, wie ich uns alle raus- und dann vor dem morgendlichen Durchzählen wieder reinbringen kann. Wenn jemand ein paar Stunden Freiheit verdient, dann wir.
Wir sind die, die zurückgelassen wurden – die übelsten unter den Versagern, denn unsere Eltern wollen uns über die Feiertage nicht zu Hause haben. Die letzte Bettenkontrolle hat vor einer Stunde stattgefunden. Die Lehrer haben sich zu Weihnachten alle freigenommen, und die Security ist auf eine Stammbesetzung ausgedünnt. Wenn ich es schaffe, uns außerhalb der Reichweite der Sicherheitsbeleuchtungen nach draußen zu schleusen, sollte uns niemand suchen kommen.
»Beeil dich, Sullivan. Wieso dauert das so lange?«
»Seid leise. Ich bin fast so weit.«
Ihr Blaffen, das raue Getuschel und das erstickte Lachen erinnern an Hundewelpen, die sich in wattierten Winterjacken hinter mir balgen. Einer stößt gegen mich, und ich fluche. Doch als ich nach vorn gegen die Tür stolpere, löst sich der letzte Stift.
Das Schloss springt auf.
Die Tür öffnet sich mit einem Knarren, scharrt einen Engelsflügel in den Schnee, und die Jungs lösen sich voneinander, drängen vor, sehen mir über die Schulter, ihr Atem beißend vom Schnaps. Ich halte sie zurück, blicke hinaus. Die stummen Wälder dämpfen jedes Geräusch.
An diesem Ort sind die Ausgänge mit Kameras und Alarmsystemen versehen, nur dieser nicht. Halb verborgen im hinteren Teil eines alten, staubigen Kesselraums, haben sich die eingedellte Tür und das rostige Vorhängeschloss kaum gewehrt. Dieser Bereich des Schlaftrakts liegt nah am Wald und ist vom Rest des Campus aus nicht einzusehen. Im Sommer ist er mit Unkraut überwuchert, und die ungemähten Grasbüschel stehen hier im Schatten der hohen Eichen- und Kastanienbäume, die um die Schule herum wachsen, und es scheint, als hätten die Angestellten die Existenz dieser Tür vergessen. Die Security macht sich nicht die Mühe, hier auch zu patrouillieren. Wenn sie uns für die Pause morgens rauslassen, ist hier der einzige unberührte Flecken Schnee auf dem Gelände.
»Los«, flüstere ich und halte die Tür für die anderen auf. Ich ziehe meine Skijacke und die Mütze an. Der Schnee ist hoch, und ihren vom Mond beschienenen Spuren kann ich leicht folgen. Ich laufe hinter ihnen her, die Kälte beißt mir in die Wangen, und ich grinse so breit, dass es fast wehtut, während die Lichter der Schule hinter mir verblassen.
Meine Lunge brennt und mein Herz steht in Flammen. Es fühlt sich an wie der erste tiefe Atemzug seit Jahren, seit ich zum ersten Mal hier abgeladen wurde. Ich bin versucht, mich von der Gruppe abzusetzen und einfach immer weiterzulaufen, aber ich habe nur noch sechs Monate vor mir, bis meine Bewährungsauflagen erfüllt sind.
Und was dann? Wo zur Hölle soll ich nach dem Abschluss hin?
Ich krame in meiner Tasche nach dem geschmuggelten Whiskey, den ich mitgenommen habe, aber er ist weg. Vor mir blinkt die leere Flasche im Mondlicht auf, baumelt von einem Handschuh herab.
Mein Zimmergenosse wirft mir eine Dose billiges Bier zu, und ich fange es vor meiner Brust auf. Es ist warm von irgendeinem der Schlafräume im Wohnheim, in dem es versteckt war, und jetzt ist es noch dazu gut durchgeschüttelt.
»Happy birthday, Jack«, murmle ich vor mich hin.
Ich öffne die Dose und kippe den Inhalt runter, bevor der Schaum herausquillt. Das Abendessen ist Stunden her. Das Bier steigt mir direkt zu Kopf, und mein Magen fühlt sich immer noch leer an, sogar nachdem ich ein zweites gekippt habe.
Wir laufen weiter, bis mein Gesicht taub wird. Bis wir an den hohen Maschendrahtzaun kommen, der uns vom Skiressort auf der anderen Seite trennt.
»Hier ist es«, sage ich zu ihnen. Vor einem Monat habe ich eine Karte von dieser Stelle gezeichnet. Der ältere Bruder meines Zimmergenossen arbeitet in seinen Collegeferien im Skiverleih, und jemand hatte erzählt, dass er Geld für ein Auto spare. Ich hab die Jungs auf meinem Flur überredet, Geld zusammenzulegen, die Schuhgrößen von allen auf einen Zettel geschrieben und diesen zusammen mit dem Geld und einer Karte dem Bruder des Typen übergeben, als der vor zwei Wochen sonntags zu Besuch da war. Die Gelegenheit, hier auf diesen Hängen Ski zu fahren – Hänge, die manche von uns von ihrem Schlafzimmerfenster aus sehen können, an die wir aber nie herankommen –, war einfach zu gut, um sie sich entgehen zu lassen.
Der Fels liegt hier nah an einem Pinienwäldchen, und seine Nase ragt aus dem Schnee heraus, genau da, wo ich es auf der Karte eingezeichnet habe.
Wir sinken um den Hügel auf die Knie, wühlen unter dem Schnee herum. Jubelrufe und Oh yeahs ertönen, als wir sechs Paar Ski und Stöcke ausgraben. Wir fischen auch sechs vergrabene Müllbeutel heraus und reißen sie auf, darin ist je ein Paar Stiefel für jeden von uns.
»Jack, du bist ein verfluchtes Genie!« Einer meiner Mitbewohner drückt mir einen besoffenen Kuss auf die Stirn und schubst mich dabei rückwärts in den Schnee. Der Metallzaun klirrt, als wir unsere Ausrüstung durch die Öffnung schieben, und die scharfen Kanten des Zauns schnippen so lange zurück, bis wir alle das »Betreten verboten«-Schild hinter uns gelassen haben.
Wir schleppen die Ausrüstung durch eine Schneise zwischen den Bäumen und bleiben dann staunend stehen, Stille senkt sich über uns.
Die Hänge sind bedeckt mit vom Wind verwehtem Pulverschnee. In der Dunkelheit glitzert er wie Sterne, erstreckt sich in die Nacht hinein, die sich plötzlich endlos anfühlt und so, als gehöre sie uns allein.
Ich steige in meine Ski. Sie ragen über den Grat, wo der Hang auf den Pfad trifft, und ich sehe zu, wie einer nach dem anderen sich mit wildem Geheul hinabstürzt, wie ihre Ski nach links und rechts wedeln, wie ihre Kanten den härtesten schwarzen Diamanten des Bergs polieren.
Der Hügel fällt ab, wenn ich ihn direkt ansehe. Aus dem Augenwinkel erkenne ich Bewegung. Ein Schatten, wie ein Wirbel aus dunklem Nebel, umwabert die Bäume in Bodenhöhe.
»Alles klar, Jack?«, fragt mein Zimmergenosse.
»Ja, mir geht’s super«, sage ich, heiser von der Kälte und vom Lachen. Ich reiße den Blick von den Bäumen los, beiße mir innerlich in den Arsch, weil ich die beiden Biere auf leeren Magen runtergekippt habe. »Hab mich nie lebendiger gefühlt.«
»Schade, dass wir nur eine Abfahrt haben«, sagt er.
Eine Abfahrt. Mehr bekommen wir nicht. Die Hänge sind geschlossen. Die Lifte sind abgeschaltet. Nach unserem Marsch den Berg hinauf zurück zur Schule wird es beinahe Morgen sein, und dann bin ich für die nächsten sechs Monate wieder ein Gefangener an diesem Ort. Ich möchte nur eine perfekte Abfahrt, ein paar flüchtige Momente, in denen mich nichts aufhält.
»Hau rein, Jack. Wir leben nur einmal.« In seinen Augen blitzt es verwegen, dann stößt er sich ab. »Wir sehen uns unten.« Seine Skier zischen leise, verschwinden aus meinem Sichtfeld. Mein Blick wandert zu dem Wäldchen, und ich eise ihn wieder los, ignoriere den Zweifel, der in meine Gedanken eindringt.
Das hier ist die eine Nacht, in der du nicht an diesem Ort angekettet bist. Die eine Nacht, in der du dich niemandem gegenüber verantworten musst. Flipp jetzt nicht aus.
Ich ziehe mir die Mütze tief über die Ohren und folge ihm. Der Wind verbrennt mein Gesicht, raubt mir den Atem. Die Nacht rauscht schneller vorbei, als ich vor mir etwas erkennen kann. Ich nehme die ersten paar Kurven vorsichtig – zu vorsichtig –, lasse die ersten beiden Buckel ganz aus.
Wir haben nur eine Abfahrt … wir leben nur einmal.
Ich lockere die Knie und lege mich in die Kurven, nutze den Wind und nehme den nächsten Buckel in Angriff. Plötzlich fliege ich. Mein Herz macht einen Satz in meiner Brust. Meine Skier treffen wieder auf Grund, schlittern über eine Eiskruste. Ich ramme die Stöcke in den Boden, aber der Schwung zerrt mich wie an einem Schleppseil durch die Dunkelheit.
Der Hügel verschwimmt. Der Rausch verwandelt sich in Panik, als Bäume auf mich zurasen.
Mit einem Knacken zersplittert mein Inneres, Holz drischt auf Knochen ein. Der Aufprall reißt mich von meinen Skiern und wirft mich rücklings in den Schnee.
Ich liege da, mit geschlossenen Augen und einem alles übertönenden Klingeln in den Ohren. Die Sterne flimmern, während ich blinzelnd wieder zu mir komme, und mein warmer Atem kräuselt sich in der Luft wie Rauch, der aus Trümmerteilen aufsteigt.
Da ist kein Schmerz. Nicht gleich. Nur ein leises Stöhnen. Das beunruhigende Gefühl, dass etwas gebrochen ist. Meine Mütze ist weg, und die Rückseite meines Kopfs fühlt sich nass und kalt an. Die letzten Rufe meiner Freunde verklingen den Hügel hinab.
Ich muss sie einholen. Ich muss aufstehen.
Ich bewege meine …
Meine Beine reagieren nicht. Kein Schmerz, keine Kälte, nichts … Ich spüre nichts unterhalb meiner Taille. Nichts außer der Angst, die mich packt.
Shit, Jack. Was zur Hölle hast du gemacht?
Ich öffne den Mund, will um Hilfe rufen, aber es kommen keine Worte raus. Ich bekomme nicht genug Luft. Der Schmerz wird heftiger an meinen Rippen. Er schwillt an, bis kein Platz mehr ist für Atem oder Gedanken oder irgendwas.
Bitte, nicht! Lasst mich nicht hier zurück!
Die Nacht verschwimmt, wird wieder schärfer, immer wieder, der Schmerz überkommt mich in Wellen. Schnee dringt durch den Kragen meiner Jacke. In meine Handschuhe. Mein Herz wird langsamer, meine Hände zittern, und meine Zähne … Gott, meine Zähne hören einfach nicht auf zu klappern.
Du hast es versaut, Jack. Du wirst sterben.
»Nur, wenn du dich dafür entscheidest.«
Mein Atem beruhigt sich. Meine Augen öffnen sich mühsam beim Klang einer Frauenstimme. Mein Blick geht zum Wald, suchend, kann sich kaum scharf stellen.
Bitte … hilf mir! Bitte, ich kann nicht …
Die Wurzeln der Bäume scheinen sich aus dem Boden zu erheben wie Schlangen, winden sich über den Schnee, als wären sie lebendig. Langsam schließen sich meine Augen wieder. Ich bilde mir das ein. Halluziniere. Muss mir den Kopf angeschlagen haben. Doch als ich meine Lider mühsam dazu zwinge, sich wieder zu öffnen, bewegen sich die Wurzeln immer noch, verknoten sich miteinander, bilden einen Pfad über den Schnee hinweg.
Eine Frau taucht an seinem Ende auf.
Mom? Das Wort verhakt sich schmerzhaft in meiner Kehle.
»Du darfst mich Gaia nennen«, erwidert sie.
Nein. Nicht meine Mutter. Meine Mutter würde niemals zu mir kommen. Ist nie gekommen.
Das lange weiße Gewand der Frau leuchtet in der Dunkelheit, ihre Gestalt wird deutlicher, während sie näher herankommt. Der Steg unter ihren Füßen wächst, streckt sich mit jedem ihrer Schritte auf mich zu. Die verwobenen Wurzeln winden sich und bilden eine Treppe, auf der sie herabsteigt, dann lösen sie sich hinter ihr wieder voneinander, verschwinden im Schnee.
Sie kniet neben mir nieder, das silberne Haar fällt ihr ums Gesicht, das ich langsam klarer erkennen kann. Nur nicht ihre Augen. Sie schimmern wie Diamanten. Vielleicht weine ich auch. Mein Atem stottert. Ich schmecke Blut. Ersticke am Geruch nach Kupfer und Eisen, strecke in blinder Panik die Hände nach ihr aus.
Bin ich tot?
Ihre Hand ist warm an meiner Wange. Sie riecht nach Blumen. Wie die Berge im Frühling.
»Noch nicht. Aber bald«, sagt sie. »Deine Milz ist gerissen. Eine Rippe hat deine Lunge durchbohrt. Du wirst deinen Verletzungen erliegen, bevor dein Körper geborgen werden kann.«
Aber meine Freunde …
»Sie werden nicht nach dir suchen.«
Nein. Das bilde ich mir ein. So etwas kann sie gar nicht wissen. Aber im Grunde meines Herzens weiß ich, dass das hier real ist. Und ich weiß, dass sie recht hat. Jedes Wort zerschneidet mich. Jeder Atemzug fetzt durch mich hindurch.
»Ich biete dir eine Wahl, Jacob Matthew Sullivan«, sagt sie. »Komm mit mir nach Hause und lebe für immer – nach meinen Regeln. Oder stirb heute Nacht.«
Nach Hause. Eine Welle aus Schmerz schwillt in mir an. Ich packe ihr Handgelenk, während das erdrückende Gewicht meines letzten Atemzugs mich nach unten zieht.
Bitte, flehe ich sie an. Bitte, lass mich nicht sterben!
TEIL EINS
1 WINTER ADE
12. März 2020
Jack
»Halt still!«, blafft Fleur. »Sonst schlitz ich dich noch auf.«
»Ich dachte, das wäre Sinn der Sache.« Zumindest hatten wir uns darauf geeinigt. Fleur wollte eine weniger grausame Methode als letztes Jahr. Ich wollte etwas, das schnell und sauber geht. Nach einer langwierigen Debatte über die Vielzahl der Möglichkeiten, wie sie mich töten könnte, hatten wir uns schließlich auf das Messer geeinigt.
Mir schwirrt der Kopf. Ich starre über ihre Schulter zum Horizont, damit ich nicht falle. Ich verglühe schon allein, weil ich so nah vor ihr stehe, und es fällt mir zu schwer, ihr in die Augen zu sehen. Ihr rosafarbenes Haar wird von einem Lufthauch hochgeweht, ganz wirr im roten Licht des Transmitters in ihrem Ohr und dem blutorangefarbenen Glühen über den Gebirgsausläufern Virginias. Wunderschön. Wie etwas aus einem Fiebertraum.
»Was zur Hölle tust du da, Jack?«
Ich schüttle die Stimme ab, die in meinem Kopf erklingt, bin so benebelt von dem Fieber, dass ich sie fast mit meiner eigenen verwechsle. Chill weiß ganz genau, was ich da tue. Wenn ich in drei Monaten aufwache, werde ich dafür schwer was aufs Dach kriegen, aber für den Moment habe ich keine Energie mehr übrig für die Standpauke, die er mir ins Ohr speit. Es stimmt, ich habe mich von Fleur einholen lassen. Habe mich von ihr hier in die Enge treiben lassen, weil ich müde war, wegzulaufen, und weil ich einfach nur mehr Zeit wollte. Einfach nur ein paar Minuten mehr mit ihr, bevor ich gehe. Und wählen, wie wir uns diesmal voneinander verabschieden.
Fleur nagt an ihrer Lippe, die Spitze ihres Messers bohrt sich direkt unter meinen Rippen in meine Haut, zerrt mich zurück in die Gegenwart. Der Frühling ist hier, und meine Jahreszeit ist vorbei. Unsere Zeit ist vorbei, und jetzt ist es ihre Aufgabe, mich nach Hause zu schicken.
Schon beim Gedanken daran fühle ich mich ein wenig verloren. Das Observatorium wird niemals zu Hause sein. In der Sekunde, in der ich sterbe, werde ich von ihr getrennt, werde entlang der Ley-Linien über die Welt hinweggezerrt wie ein leerer Luftballon und dann unter der Erde eingesperrt, im Winterschlaf isoliert bis zum nächsten Winter. Ich wanke, die scharfe Spitze der Klinge sorgt dafür, dass ich mich losgelöst fühle von allem.
Tiefe Sorgenfalten furchen ihre Brauen, und sie packt das Messer anders.
Ich kann nicht aufhören, ihre gerunzelte Stirn anzustarren, wie sie sich über die Lippen leckt, wenn sie sich konzentriert.
Eine Armeslänge Abstand ist zwischen uns. Sie ist zu weit weg.
Meine Stimme wird rau. »Meine Leber liegt etwas höher.« Chill flucht. »Die sitzt tief. Zwischen der dritten und vierten Rippe. Du solltest vermutlich näher herankommen.« Durch den Transmitter höre ich Chills Kopf auf den Schreibtisch aufschlagen.
Die Luft wird dünner, als Fleur vortritt. Nah genug, dass ich die Lilien in ihrem Atem riechen kann. Die Hitze in ihrem zittrigen Seufzer auf meinem Gesicht spüre. Ich hatte geglaubt, die Höhenlage würde mir mehr Zeit verschaffen – das Eis, das Gelände, die Bäume, die ihre Schatten über die verschlungenen Pfade des Nationalparkwalds werfen –, aber sie ist so warm, ich kann nicht …
»Besser?«, fragt sie. Ich zucke zusammen, mir ist schwindlig, die Spitze des Messers dringt tiefer ein, und der Blick ihrer dunklen Augen huscht zu meinen.
Ich nicke, nicht in der Lage, die Worte zu formen, weil sie mir so nahe ist. Ich starre die Konturen ihres Mundes an, frage mich, wie er schmecken würde. Mir fällt nichts ein, wie ich lieber sterben würde. »Wenn dir schlecht wird, können wir etwas anderes probieren.«
Sie erstarrt. »Zum Beispiel?«
»Jack?« Chills Stimme wird lauter. »Das gefällt mir überhaupt nicht.«
Sie weicht nicht zurück. Sagt nicht Nein. In einer Sekunde wird alles vorbei sein. Nur ein Aufblitzen von Schmerz und Licht und dann bin ich tot. Doch nur ein einziges Mal möchte ich wissen, wie es ist, sie zu küssen, bevor ich sterbe. Ich neige meinen Kopf weiter vor. Nah genug, dass sie die Entfernung überbrücken kann, wenn sie das möchte.
Zittrig atmet sie aus. Mein Puls beschleunigt, als ihr Mund sich meinem nähert. In dem Augenblick, bevor sich unsere Lippen berühren, zuckt sie heftig zurück. Über die kurze Distanz zwischen uns höre ich, wie Poppy ihr ins Ohr schreit. Fleurs Wangen färben sich rot, passen sich den Blüten des Baums hinter ihr an – Blüten, von denen ich schwören könnte, dass sie eine Minute zuvor noch nicht da waren. »Das können wir nicht machen«, sagt sie zu mir. »Das ist eine ganz blöde Idee.«
»Warum?«, fauche ich. »Weil Poppy das sagt?«
»Weil wir Schwierigkeiten bekommen. Du kennst die Regeln.«
Ja, die kenne ich. Ein Kuss ist schmerzhaft für die schwächere Jahreszeit, die Überholspur direkt zurück ins Observatorium, inklusive Bewährungsauflagen und Sanktionen, an die ich lieber gar nicht denken möchte. Ich hätte sie trotzdem geküsst. »Für dich hat es ja richtig gut funktioniert, dich an die Regeln zu halten«, sage ich mit einer ordentlichen Portion Sarkasmus.
Sie zuckt zusammen, und ich hasse mich für meine Worte. Chill hat erwähnt, dass Fleur und Poppy in der Rangordnung nach unten gerutscht sind. Vermutlich, weil sie mich zu sehr schont.
Idiot. Würde sie sich nur um die Regeln scheren, hätte sie mich schon vor einer Woche umgebracht.
»Vergiss es«, grummle ich. »Du hast recht. Das ist eine dumme Art, zu sterben.«
»Gut«, sagt sie mühsam. Die Präzision, mit der sie das Messer fester packt, zeigt, dass sie die ganze Zeit schon wusste, wo es hinmuss. »Also bei drei.«
»Sei kein Idiot«, warnt Chill mich.
Zu spät.
Ich wappne mich. Mein Atem geht schnell. In einer Sekunde wird meine Jahreszeit vorbei sein. Ich werde weggesperrt, werde dreißig Stockwerke unter der Erde für den Rest von Fleurs Jahreszeit in einem Plastikkäfig schlafen …
»Geh von dem Mädchen weg, Jack.«
Danach wird es weitere sechs Monate dauern, bis ich im Herbst meinen nächsten Atemzug an der frischen Luft machen werde, wenn ich gezwungen sein werde, Amber zu jagen, die mich nicht ausstehen kann …
»Ich bin dein Administrator, und ich befehle dir, abzuhauen, Jack!«
Danach werden noch mal drei Monate vergehen, bevor Fleur mich suchen wird. Ein ganzes Jahr, bis ich sie wiedersehe …
»Warte …«, sage ich. Ich bekomme keine Luft.
Chill brüllt mich an, ich solle abhauen.
»Nein, nein, warte! Ich bin nicht …« Wir taumeln gleichzeitig voneinander weg, die Klinge kratzt über meine Rippe, Fleur gerät aus dem Gleichgewicht. Sie reißt die Augen auf. Lässt das Messer zu Boden fallen, schüttelt ihre Hand aus, als wäre es besessen.
»Um Chronos’ willen, Fleur! Du hast mich erwischt!«, schreie ich auf, meine Stimme bricht.
»Du hast doch gesagt, dass ich es machen soll!«
»Und dann habe ich meine Meinung geändert!« Der Schmerz ist blendend grell. Ich winde mich, die Wunde tut höllisch weh, und ich rolle mein T-Shirt hoch und verdrehe den Kopf, um sie sehen zu können.
»Keine Panik«, sagt Chill. »Bleib ruhig. Das ist nicht tief. Deine lebenswichtigen Organe sind in Ordnung.« Er lügt. Meine Seite sieht aus wie eine miese Aufnahme von einem Slasherfilm aus den 1980ern. »Hau da ab, während sie abgelenkt ist. Bleib in Bewegung.«
Fleur schaudert, Blut sickert zwischen meinen Fingern hindurch. »Ich schwöre bei Gaia, dass ich das nicht wollte.« Sie streckt die Hände nach mir aus. »Komm, lass mich mal sehen.«
»Nein, nein, nein. Nicht …« Ich weiche zurück bis zu einem Baum, zu langsam, um sie aufzuhalten. Ihre Hand streift meine entblößte Haut an der Seite, und plötzlich bin ich ein lebendiges Stromkabel. Jeder Muskel in meinem Körper verkrampft sich, und das heiße Anschwellen von Magie lässt meine Zähne klappern. Ich schreie wieder auf, und sie springt von mir weg.
»Tut mir leid!«, sagt sie. »Ich wollte nur helfen.«
Ich sinke auf die Knie, die Welt dreht sich, als hätte ich die Finger in eine Steckdose gesteckt.
»Weißt du noch, was ich vorhin über deine lebenswichtigen Organe gesagt habe?«, fragt Chill. »Ich nehm’s zurück.«
»Ich weiß!«, brülle ich ihm zu, wünsche mir, er würde die Klappe halten und uns in Ruhe lassen.
Fleur zuckt zusammen.
»Ich habe nicht dich angeschrien. Tut mir leid.« Mühsam komme ich auf die Füße, fühle mich wie ein Arsch. Von all den Hunderten Frühlingen, die Gaia in meine winzige Ecke des Globus hätte stecken können, um mich zu töten, warum hat sie da ausgerechnet eine aussuchen müssen, die es geschafft hat, sich in jede noch so winzige Lücke meines Geistes zu drängen? Eine, die interessant ist und wunderschön und die es mir unmöglich macht, nicht an sie zu denken? Warum hat sie eine aussuchen müssen, die vielleicht das Gleiche für mich empfindet? Das macht alles nur noch schlimmer.
»Berührung ist scheiße«, sage ich zu ihr und halte mich am Baum fest. »Und wir sollten das definitiv, wirklich definitiv, nicht noch mal machen.« Das Messer würde ich dem langsamen Tod durch einen Stromschlag jederzeit vorziehen.
Fleur schlingt die Arme um sich. »Ich wollte dich nicht erwischen. Hätte ich gewusst, dass du einen Rückzieher machst …«
»Ich habe keinen Rückzieher gemacht!«
»Warum hast du überhaupt so eine Angst davor, zu sterben?« Sie beugt sich hinab und hebt das Messer auf, und ich stolpere weg, weil sie wild damit herumfuchtelt. »Ich meine, wie oft haben wir das hier durch? Ich habe dich schon, wie oft, zwanzig Mal getötet.«
»Siebenundzwanzig Mal.« Sie zieht die Augenbrauen hoch. Dann senkt sie die Klinge. »Und ich habe keine Angst davor, zu sterben«, lüge ich. »Ich war nur noch nicht bereit, schon zurückzugehen.« Ich klinge theatralisch und übermüdet, wie ein Kindergartenkind, das sich gegen seinen Nachmittagsschlaf wehrt. Sie hat recht. Hätte ich Eier in der Hose, würde ich es hinter mich bringen. Sie rennt vermutlich nicht vor Julio weg, wenn er jeden Sommer zu ihr kommt. Laut Chill scheint es ihr nicht einmal etwas auszumachen. Und ich bin nicht sicher, was schlimmer ist: dass sie keine Angst hat vorm Sterben, oder dass sie Julio tatsächlich mag. »Weißt du was? Ich werde einfach …« Ich presse mir die Handballen gegen die Augen. Es ist zu warm. Alles tut weh. »Ich kann dir jetzt nicht so nahe sein.«
Ich drehe mich um und steige den unbefestigten Pfad hinter mir den Hügel hinauf.
Chill feuert mich an. Ich höre über den Transmitter, wie seine Hand auf den Schreibtisch klatscht, gefolgt von hektischem Tastaturgeklapper im Hintergrund, während er meinen Fortschritt von unserem Wohnheimzimmer aus verfolgt, wo er wahrscheinlich jede demütigende Sekunde hiervon aufzeichnet. »Das ist es, Jack! Los!«
Fleur ruft meinen Namen, und ich zwinge mich, schneller zu werden. Die Wunde in meiner Seite fühlt sich an, als würde sie mit jedem Schritt weiter aufreißen. Meine Stiefel rutschen auf dem weichen nassen Grund aus, und Chill verflucht mich, weil ich ihr so deutliche Spuren für die Verfolgung hinterlasse.
Höher. Ich muss nur höher hinauf. Schaffe ich es an einen kälteren Ort, kann ich mir Zeit verschaffen. Meine Seite schmerzt, als ich meine Jacke ausziehe und sie für Fleur über einen Ast hänge. Die Kälte ist hart für sie. Sie zehrt an ihrer Magie und macht sie langsamer.
Ich steige weiter, keuchend und benommen, bis ich endlich auf einem Schneefleck zusammensacke, der am Fuß einer Tanne übrig geblieben bist. Ich lausche auf Fleurs Schritte, während die letzten Tropfen des Winters von den Nadeln des Baums gleiten. Das rhythmische Tröpfeln riecht völlig falsch, und ich sehe hinab und erblicke erstaunt eine Pfütze aus scharlachrotem Matsch. Ein lähmender Husten packt mich. Ich stemme mich gegen den Baumstamm, drücke die Haut um die Wunde herum zusammen, aber es hilft nichts. Ich zögere das Unvermeidliche nur heraus.
Es macht keinen Sinn, mich vor ihr zu verstecken. Ihre Magie wird von meiner angezogen wie ein Magnet. Sie wird ganz genau wissen, wo sie mich finden kann.
»Ich weiß, dass du da bist, Jack«, sagt sie und seufzt müde. »Ich kann dich riechen.«
Ich stinke nach Fieberschweiß und Blut. Mein Haltbarkeitsdatum ist längst überschritten.
»Bleib ruhig«, flüstert Chill mir ins Ohr. »Ich finde einen Weg, um dich da rauszubringen. Du hast genug Saft übrig, um locker noch einen Tag zu schaffen.«
Meine Kraft leert sich wie bei einer sterbenden Batterie. Meine Zeit ist geliehen, das wissen wir beide. Ich könnte weiter weglaufen, aber was soll das bringen? Einen langsamen Tod allein zu erleiden ist schlimmer, als von Fleur getötet zu werden.
Ich spähe um den Stamm des Baums herum, sie schiebt die Arme in die Ärmel meiner Jacke und zieht sie um sich, ganz fest. Auf einer Lichtung ein paar Meter entfernt sinkt sie zu Boden, scheucht eine Explosion aus Schmetterlingen von den Wildblumen auf, die um sie herum erblüht sind. Ich wühle die Finger in meine schrumpfende Schneeinsel, will sie zum Bleiben zwingen. Sie einfrieren lassen. Damit sie mich hier verankert.
»Es ist Ende März, Jack. Der Winter ist vorüber«, sagt sie missmutig. Sie wischt mein Blut von ihrem Messer und sinkt zurück auf das Gras, ihre Stiefel prallen mit einem dumpfen Geräusch auf den Boden auf und der lange, lockere Stoff ihres Rocks sammelt sich um ihre Knie. Ein hellorangefarbener Schmetterling landet in ihrem Haar, und sie stößt irritiert den Atem aus. Eine lange rosa Strähne hebt sich von ihren Augen, aber der Schmetterling schüttelt sich nur und landet dann wieder.
»Hör auf, sie anzustarren«, setzt Chill mir zu. »Du solltest nach einem Ausweg suchen.«
Genervt stelle ich meinen Transmitter aus.
Ich lecke mir über die trockenen Lippen und puste einen eisigen Luftzug über die Lichtung, lasse den Stoff ihres Rocks rascheln und sie sich tiefer in meine Jacke zusammenkauern. Der Schmetterling schlägt einmal … zweimal … mit den Flügeln … bevor er erstarrt auf ihre Wange fällt. Ich drücke mich wieder gegen den Baumstamm, mir ist schwindlig von der Anstrengung und ich möchte mir selbst für meine eigene Dummheit in den Hintern treten. Ich weiß nicht, warum ich das getan habe. Vielleicht nur, um zu zeigen, dass ich es kann.
Sie setzt sich auf und stupst den Schmetterling mit dem Finger an. Ihre Wangen werden blass, als wären sie von etwas Kaltem berührt worden, und sie dreht sich um und sieht wütend in meine Richtung. Sie nimmt den Schmetterling in die Hand und bläst darauf. Zwischen ihren Fingern glüht ein Licht auf, so schwach, dass ich mich frage, ob es einfach mein rasendes Fieber ist, ob ich es mir einbilde, doch dann öffnet sie die Hand, und der Schmetterling taumelt auf einer Brise davon.
»Du kannst nicht weiter weglaufen. Du weißt, wie das hier endet.« Ihre Stimme hallt, hoch und klar und ärgerlich, aus jeder Richtung. »Du hast das hier lange genug hinausgezögert. Wenn ich dich nicht bald zurückschicke, bemerkt es jemand.«
»Was?«
Sie sinkt zurück ins Gras, legt einen Arm über das Gesicht. »Dass ich nicht möchte, dass du gehst.«
Es tut weh, zu atmen. Das hat sie noch nie laut ausgesprochen. »Was willst du denn?«
»Ist das wichtig?«, fragt sie ohne Hoffnung. »Nichts wird sich ändern.«
»Für mich ist es wichtig.« Ich bin überrascht, wie sehr ich es dieses Mal meine. Ich habe ihr diese Frage schon einmal gestellt, vor Jahren, in einem verzweifelten Versuch, sie aufzuhalten, während sie mich tötete. Sie hat nur dagestanden, mit offenem Mund, und geblinzelt, als hätte sie noch nie innegehalten und über die Antwort nachgedacht.
Mit einer schwungvollen Bewegung nimmt sie den Arm vom Gesicht und sieht mit einem Stirnrunzeln zum Himmel auf. »Du kennst mich nicht einmal.«
Könnte sie sehen, wie dick die Akte ist, die Chill über sie führt, würde sie das wahrscheinlich nicht denken. »Dann erzähl mir was über dich.« Ein weiterer Hustenanfall packt mich. Ich drücke die Handfläche gegen meine Seite, um die Blutung zu verlangsamen, aber meine Finger sind taub und der Boden ist rot durchtränkt.
Sie antwortet nicht sofort, als wöge sie ab, wie viel sie bereit ist, mir von sich preiszugeben. »Was möchtest du wissen?«
Alles. Ich presse die Augen zu, bemühe mich, fokussiert zu bleiben. Es gibt so vieles, das ich sie fragen will. Warum sie zum Beispiel am Ende jeden Frühlings meine Initialen in einen Baum ritzt. Doch für einen Tag habe ich Poppy schon genug verärgert.
»Was isst du am liebsten?«, frage ich, auch wenn ich die Antwort schon kenne.
Sie zögert. »Pizza«, sagt sie schließlich, dann schlägt sie gegen das rote Licht in ihrem Ohr.
»Welcher Belag?«, frage ich rau.
»Pilze, Paprika, Zwiebeln und Salami.« Ich warte. »… und extra Käse.«
»Lieblingsband?«
»U2.«
»Lieblingsfilm?«
»Thelma and Louise.«
»Sag bitte, dass das ein Scherz ist.« Mein Lachen wird zu einem Husten. Von den Jahreszeiten abgesehen, denke ich manchmal, dass Fleur und ich nicht unterschiedlicher sein könnten. Ich sacke am Baum zusammen, zu schwach, um mich noch aufrecht zu halten. »Warum liest du eigentlich die ganzen Bücher?«
»Welche Bücher?«
»Die ganzen Bücher mit den tragischen Enden?« Ihre Ausleihliste aus der Bücherei ist einfach nur deprimierend. Ich habe mir jedes Jahr alle ausgeliehen, nachdem sie sie zurückgebracht hatte, und die meisten habe ich am Ende gegen die Wand geknallt.
»Du liest sie?«
»Vielleicht«, sage ich und bin wütend auf mich selbst, weil ich zu viel rede. Ich fühle mich wagemutig – taumelig und ein wenig wie im Delirium. »Ich habe vielleicht ein paar davon gelesen«, gestehe ich. »Aber bei den Gedichten war Schluss.« Die Lyrikbände, die sie aus der Bibliothek ausleiht, sind alt – richtig alt, siebzehntes Jahrhundert und so. Und egal, wie oft ich versuche, zu verstehen, was sie daran findet, gelingt es mir einfach nicht. Mein Kopf ist schwer. Ich lehne mich gegen den Baum zurück, die Welt verschwimmt. »1984 war nicht so übel, aber Orpheus und Eurydike, Anna Karenina und Sturmhöhe waren grauenhaft. Und Romeo und Julia waren einfach Idioten. Ich meine, wer trinkt Gift und gibt einfach so auf?«
»Für sie gab es keine Hoffnung«, sagt sie und reißt einen Grashalm ab. »Man nennt das nicht ohne Grund Tragödie.«
»Natürlich gab es da Hoffnung! Sie hatten bloß einen bekackten Plan.«
»Und deiner wäre besser?« Sie setzt sich auf, reißt eine Handvoll Gras aus dem Boden. »Nein, ernsthaft, Jack! Was hättest du denn getan?«
Ihre Stimme ist scharf. Schneidend. Das rückt die Welt wieder in den Fokus. »Ich hätte sie genommen und wäre abgehauen!«
»Es gibt keinen Ort zum Abhauen!«
»Aber würdest du … wenn es einen gäbe?« Halt den Mund, Jack. Ich vergrabe den Kopf in meinen Händen. Fleur schweigt lange. Zu lange.
»Vielleicht«, sagt sie, »aber das ist nicht wichtig. Das ist nur eine Geschichte. Ein Traum. Das könnte niemals wirklich geschehen.«
Ich hasse, wie resigniert sie klingt, dass dies einfach ihr Leben ist. Unser Leben. Doch noch mehr hasse ich, dass sie recht hat. Wir sind mit unseren Transmittern an das Observatorium gebunden. Wenn wir sie abnähmen und versuchten, zu fliehen, würden wir außerhalb der Ley-Linien niemals überleben. Aber das bedeutet nicht, dass ich nicht die letzten dreißig Jahre damit verbracht hätte, nach einem Ausweg zu suchen. Das habe ich immer schon getan.
Und sieh nur, wohin es dich gebracht hat, rufe ich mir wieder ins Gedächtnis. »Romeo und Julia haben nur auf die falschen Leute vertraut, die ihnen helfen sollten. Das ist alles.«
»Es ist eine Tragödie«, erwidert sie störrisch. »Die sollen kein glückliches Ende haben.«
Etwas brodelt in mir auf. Ich weiß nicht, ob ich wütender bin auf sie, weil sie aufgibt, oder auf mich selbst, weil ich sterbe. »Ja? Na, wenn die beiden sowieso sterben, dann hätten sie vielleicht kämpfend untergehen sollen!«
Erst als sie mit einem Schrei auf die Füße kommt, begreife ich, was ich da getan habe.
Fleur
»Das denkst du also? Dass wir kämpfend untergehen sollten?« Ich schnappe mir das Messer und gehe auf die Bäume zu. Das Aufblitzen von Rot auf Schnee verrät ihn, und er kriecht tiefer in das Wäldchen hinein, weg von mir. »Gut, dann liefern wir Chronos und Gaia doch genau das, was sie wollen!«
Poppy feuert mich an. »Du hast ihn, Fleur. Tu’s jetzt!«
»Nein«, keucht er, sein schwarzes Haar klebt ihm an der blassen Stirn, und seine Brust hebt und senkt sich mühsam. »Nein, nein, nein, das meine ich nicht …«
Ich peitsche mit meinen Gedanken um mich, mein Bewusstsein gräbt sich durch die weiche Erde in die Wurzeln eines schmalen Schösslings. Mein Geist gleitet in ihn hinein, und der Baum schmiegt sich in meine Absichten wie ein Handschuh an meine Finger, die Wurzeln strecken sich in die Richtung von Jacks Stimme, bis sie sich um sein Fußgelenk schlingen.
Seine Finger kämpfen um Halt, sein T-Shirt rutscht hoch, während ich ihn brutal über den Boden zerre. Er tritt nach meiner Schlinge. Seine Kraft treibt mich einen Schritt zurück. Das Gras unter seinem Körper ist rot verschmiert, während er hektisch nach dem Flecken blutgetränktem Schneematsch hinter sich greift. Ich zerre ihn zu mir, aber es gelingt ihm, sich eine Handvoll Schnee zu schnappen, ihn zu einer Klinge zu gefrieren, während er mit einem Ruck vor meinen Füßen stoppt.
Er zeigt mit der provisorischen Klinge auf mich. Sie zittert in seiner Hand, das rosafarbene Eis schmilzt von der gezackten Spitze und tropft seine Knöchel herab. Er könnte meine Wurzeln durchtrennen, um sich zu befreien, mir eine fiese Wunde verpassen. Ich würde ihn nicht aufhalten – bei Gaia, ich verdiene das und noch mehr –, aber er tut es nicht. So etwas würde er nicht tun.
»Meinst du das, wenn du sagst, wir sollen kämpfend untergehen?« Tränen steigen heiß hinter meinen Augenlidern auf, lassen sein Gesicht verschwimmen. »Denn das ist es, was sie wollen, Jack.« Das wollen Poppy und Chill. Das wollen Chronos und Gaia. Aber Jack ist der Einzige, den es je gekümmert hat, was ich will. Und ich will nicht mehr kämpfen.
Ich möchte nicht den Jungen umbringen, den es kümmert, ob mir schlecht wird, wenn ich ihn töte, der mir in kalten Nächten seine Jacke dalässt, der lieber sterben würde, als Hand an mich zu legen.
Ich lasse meine Wurzeln los.
Jacks Kopf sinkt sanft zu Boden, und seine Faust öffnet sich, seine dezembergrauen Augen blicken glasig und können sich nur langsam fokussieren, die Klinge rollt aus seiner Hand und hinterlässt eine Blutspur im Gras. Er dreht sich von mir weg, krümmt sich mit einem heftigen Schaudern zusammen, als ihn ein Hustenanfall packt.
»Tu es, Fleur!«
»Halt den Mund, Poppy!« Meine Stimme quäkt, ich stehe über ihm, die Fäuste um das Messer geklammert, suche nach dem richtigen Halt. Dem richtigen Winkel. Dem richtigen Moment. Er schwitzt, zittert wie ein verletztes Tier, und meine Kehle zieht sich zu. Er hat das Messer gewählt, weil es schneller schien, irgendwie weniger schmerzhaft. Vielleicht wäre es das gewesen, wenn ich nicht zuvor gezaudert hätte.
»Hör auf, es rauszuzögern! Wenn du ihn jetzt erledigst, können wir vielleicht etwas Boden gutmachen.«
»Ich sagte, halt den Mund, Poppy!«
»Es wird Zeit, Fleur …«
Ich schlage nach dem Transmitter, unterbreche sie, obwohl ich weiß, dass sie recht hat. Es gibt nichts, was ich für ihn tun kann. Je stärker ich bin, desto schwächer wird er. Wenn ich ihn berühre, dann macht es das nur schlimmer. Schon allein durch meine Nähe foltere ich ihn vermutlich ganz langsam mit meiner Körpertemperatur. Und wenn ich ihn küsse – oh Gaia, wenn ihn zu küssen das hier nur wieder richten könnte –, würden wir alle in riesigen Schwierigkeiten stecken. Ich stehe bereits unter strengster Beobachtung, und ich glaube nicht, dass Poppy und ich viel mehr überleben könnten. Wir sind weit unten in der Rangordnung, gefährlich nahe an der Grenze zur Eliminierung. Weil meine Jahreszeiten zu kurz sind und die Winter in den Mittelatlantik-Staaten sich hinziehen. Weil ich zu lange warte, zu lange zögere, bevor ich ihn nach Hause schicke. Weil ich Jack manchmal davonkommen lasse, nur damit ich ihn noch ein paar Tage länger jagen kann, und Chronos verleiht einem keine Punkte für Mitgefühl. Seine Regeln sehen keine Liebe vor. Das ganze System wurzelt im Gegenteil. In Furcht und Feindseligkeit. Ich überlebe nur, indem ich Jack töte, aber das möchte ich nicht mehr.
Das wollte ich noch nie.
Schwer senken sich seine Lider über seine Augen. Glitschiges Blut überzieht seine Rippen, wo sein T-Shirt hochgerutscht ist, und ich kann den Gedanken nicht ertragen, ihm noch mehr Schmerz zuzufügen.
Ich falle neben ihm auf die Knie. Seine Augen schließen sich flatternd ganz, sein kühler Atem ist erstarrt und abwartend, seine blauen Lippen so verdammt nah, als ich mich über ihn beuge, meine Klinge in seine Seite drücke. Für einen Moment sieht es aus, als würde er schlafen. Als wäre meine Aufgabe bereits erledigt.
»Worauf wartest du?«, flüstert er da. »Wir beide wissen, wie das hier endet.«
2 FÜNFUNDFÜNFZIG TAGE SPÄTER
Jack
Der erstickend süße Duft von Wildblumen klebt mir in der Kehle. Ich blinzle, will wach werden, und das grelle Licht, das durch das Fenster meiner Stasiskammer fällt, lässt mich beinahe erblinden. Ich starre hinauf zu der abgehängten weiß gefliesten Decke und den Postern an der Wand, habe Mühe, mich daran zu erinnern, wie ich hierherkam.
»Willkommen zu Hause, Jack.« Chills Stimme krächzt aus den Lautsprechern neben meinem Kopf. Ich zucke zusammen, alles ist zu hell, zu laut, zu früh überall um mich herum. Meine Finger und Arme kribbeln. In meiner Brust schmerzt es, und ich berühre die Stelle unter meinen Rippen, wo Fleur mich erstochen hat.
Ein paar Blumen – winzige weiße Lilien – fallen aus meiner Hand. Auf der anderen Seite des Zimmers sitzt Chill an seinem Schreibtisch, er tippt Daten in sein Tablet: Datum, Uhrzeit und »Umstände meiner Erweckung«. Er kehrt mir den Rücken zu, und ich halte mir einen der schlaffen Stängel an die Nase. Die Blumen riechen ein wenig wie Fleur, eine störrische Süße, die an den blassen, zerquetschten Blütenblättern haftet.
Ganz plötzlich fällt mir etwas ein, das mir Professor Lyon einmal erzählt hat. Als er mich zum ersten Mal dabei erwischte, wie ich ein Schloss an den Katakomben unter den Flügeln für die Winter knackte auf der Suche nach einem Weg aus dem Observatorium, habe ich ihm gesagt, dass ich hier nicht mehr länger leben wolle, gefangen in diesem bescheuerten Kreislauf. Er hat etwas von Physik erzählt, darauf beharrt, dass es unmöglich wäre. Die Energie in einem geschlossenen System kann weder geschaffen noch zerstört werden, hat er gesagt. Wie Wasser, das vom Meer zum Himmel aufsteigt, wechseln wir nur von der einen Form in die andere und wieder zurück.
Fleur muss die Lilien in meine Hand gelegt haben, bevor ich starb. Und irgendwie haben es die Blumen den ganzen Weg bis hierher zurückgeschafft, ihre Materie und Energie mit meiner verschränkt, und wurden so zu einem Teil desselben hoffnungslosen Kreislaufs.
Chills Stuhl dreht sich, und ich schließe die Finger um die Blütenblätter.
»Wie lange war ich weg?« Mein Hals ist trocken, meine Stimme rau, weil ich so lange nicht gesprochen habe.
»War nur ein Nickerchen.« Ich verfolge seine Bewegungen durch den Deckel des Plexiglaszylinders, der mich wie ein Kokon umgibt. Er dimmt das Licht des künstlichen Fensters, dann dreht er das Thermostat runter, zieht noch einen Pulli an, um nicht zu frieren. »Fünfundfünfzig Tage. Deine Stasiszeiten werden kürzer. Deine Zeiten außerhalb des Campus werden länger. Du wirst jedes Jahr stärker, Jack. Super Sache, du steigst auf in der Rangordnung.«
Nur weil Fleur immer mehr zögert, mich zu töten, und ich immer zögerlicher sterbe. Ich hebe den Kopf, so weit der beengte Raum es mir erlaubt, und fluche, als ich ihn mir am Deckel anstoße. Ich taste nach dem Riegel, aber die Kammer ist noch von außen verschlossen.
»Mach langsam, Dornröschen«, sagt Chill. »Es waren nur fünfundfünfzig Tage. Lass deinem Hirn ein bisschen Zeit, sich einzustellen, bevor du da rausstolperst.« Er stellt eine Flasche mit Pillen und ein Glas Wasser auf den Stahlwagen am Fußende der Kammer.
Ich lasse den Kopf zurücksinken auf die Liegefläche, fühle mich eingesperrt und vom Schlaf benebelt, warte ungeduldig auf das Geräusch, mit dem sich das Schloss öffnet.
»Sei nicht zu hart zu dir. Du hast Fleur die letzten Tage in Atem gehalten, und wir sind ein paar Prozentpunkte in den Rängen raufgeklettert. Wenn wir so weitermachen, haben wir Anspruch auf Versetzung.« Die Wand hinter Chill ist mit Karten unserer uns zugewiesenen Region tapeziert, blaue Stecknadeln markieren jeden Ort, an dem ich Amber getötet habe, und rote Stecknadeln markieren jeden GPS-Punkt im Bereich der Mittelatlantik-Staaten der USA, wo Fleur mich je getötet hat. Mit einem großspurigen Grinsen lehnt sich Chill auf seinem Stuhl zurück, aber mir ist nicht besonders nach Feiern zumute.
Chill öffnet das Schloss mit einem Tippen auf seinem Tablet-Bildschirm. Der Deckel der Kammer gleitet zurück und die darin zirkulierende kalte Luft strömt mit einem Zischen heraus, während der vertraute Geruch unserer Räume zu mir hereinweht. Ich atme nur flach wegen des penetranten, stechenden Geruchs nach dem Reiniger mit Pinienduft, den die Hausmeister für die Industriefliesenböden benutzen, und dem Pfefferminzlufterfrischer, der durch die Lüftungskanäle in der Decke gepumpt wird. Das künstliche Aroma, das in den gestärkten Laken in unserem Etagenbett im anderen Zimmer haftet, macht mir die Zunge schwer, und da ist noch ein scharfer, käsiger Geruch von der geöffneten Doritos-Tüte, die irgendwo in Chills Schreibtisch verborgen ist. Ich möchte kotzen.
Ich setze mich auf und schwinge die Beine über die Seite der Kammer, achte darauf, mich nicht in dem Kabelgewirr zu verheddern, das von den Klebepads an meiner Brust baumelt. Ich sitze da, den Kopf über die Knie gebeugt, und die Einzelheiten meines letzten Todes stürzen auf mich ein wie ein schlechter Traum.
Das Letzte, woran ich mich erinnere, ist Fleurs Messer zwischen meinen Rippen und der Ausdruck auf ihrem Gesicht, als sie mich zurückschickt. Ich werfe die Lilien auf das Plastikbett, bevor Chill sie sieht. Dann reibe ich mir die Erinnerung an Fleurs Gesicht aus den Augen und setze langsam die Füße auf den Boden. Ich bin hungrig. Leer. Alles tut weh. Das ist der Preis der Unsterblichkeit, wie Gaia uns gerne in Erinnerung ruft.
Als ich die Augen wieder öffne, steht Chill vor mir. »Hab dich vermisst, Mann.« Er hält eine Faust hoch. Wir stoßen die Knöchel aneinander, aber ich bin nicht voll dabei. »Ich bin fast durchgedreht vor Langeweile. Während du ausgeknockt bist, ist es hier einfach nicht dasselbe.«
Ich versuche, um seinetwillen zu lächeln. Das ist das Mindeste, was ich tun kann, da es mehr oder weniger meine Schuld ist, dass er hier festsitzt, dreißig Stockwerke unter dem Royal Observatory in Greenwich und dem Nullmeridian. Solange er mein Administrator ist, wird Chill diesen Ort nicht verlassen. Sein einziger Daseinszweck in dieser Welt ist es, die Dauer meiner Jahreszeit hinauszuzögern – meinen Körper da draußen am Leben zu erhalten, so lange er kann, um dann meine Materie mithilfe eines unterirdischen Netzwerks aus elektromagnetischen Energielinien zurückzuholen und mich während meiner Erholungsphase zu babysitten.
Es klingt kompliziert, doch es ist nur ein einfacher Kreislauf. Mein Fernbedienungstransmitter ist die Antenne, die mich mit Chill verbindet. Chill ist der drahtlose Router, der mich mit den Ley-Linien verbindet. Wenn meine Jahreszeit vorbei ist, löst sich mein physischer Körper zu einem glühenden Ball aus Partikeln auf, und Chill leitet meine ganze Materie, Magie und Energie nach Hause. Der Kreislauf endet in meiner Stasiskammer – ein Kondensator, der meine Energie speichert, während sie sich zurück in meine physikalische Form wandelt, genau so, wie sie mich in Erinnerung hat. Die nächsten paar Monate fungiert mein Plastiksarg als riesiges Ladegerät. Und ich hüpfe so gut wie neu daraus hervor – meine Magie ist vollständig wieder aufgeladen und mein Körper unvergänglich jung, mit einem ewig jugendlichen Nervensystem, das einzigartig reaktionsschnell auf Risiken und Belohnungen reagiert, genau wie Gaia und Chronos es von uns erwarten.
Chill klopft mir auf die Schulter. Er ist mein GPS, meine Putzkolonne, mein Roadie und mein Leichenträger – der Einzige, dem ich in dieser Welt vertraue, was ihn (automatisch) zu meinem einzigen Freund macht. 1988 habe ich mich für Ari »Chill« Berkowicz entschieden. Und was Entscheidungen angeht, so gewährt uns Gaia nur drei.
Entscheidung Nummer eins: Lebe oder sterbe. Aber das ist keine richtige Entscheidung, während man an den Eiern über dem Abgrund baumelt. Steht man dem Tod Auge in Auge gegenüber, entscheidet sich jeder für das Leben. Bietet einem Gaia also ihre glatte, trügerische Hand mit dem Versprechen auf eine zweite Chance, hält man nicht inne und denkt über die Konsequenzen nach. Man ergreift sie einfach.
Entscheidung Nummer zwei: unsere Administratoren. Wir retten damit einen anderen jungen Menschen von der Schwelle des Todes und stellen sein Leben auf ewig in unsere Schuld. Jemanden, bei dem es uns nichts ausmacht, mit ihm oder ihr den Rest der Zeit zu verbringen, denn sobald diese Entscheidung gefallen ist, sitzen wir damit fest. Für immer. Ironischerweise blieb nicht viel Zeit, darüber nachzudenken, wie lange für immer wirklich ist.
Und Entscheidung Nummer drei: eine neue Identität, irgendeinen Namen unserer Wahl, um zu verhindern, dass unser altes Leben uns aufspürt. Für die meisten Jahreszeiten ist diese Entscheidung die einzige, die wirklich unsere ist.
Ich habe mich für Jack entschieden.
Ich bin nicht ganz sicher, ob ich mich für Chill entschieden habe.
Er runzelt die Stirn hinter seiner Brille, während er sich meine Vitalfunktionen ansieht. Sie hat keine echten Gläser, sondern besteht nur aus einem leeren schwarzen Rahmen. Er braucht keine Brille mehr. Solange wir im Programm sind, garantiert Gaia uns beste Gesundheit. Trotzdem hat Chill sie mich vor dreißig Jahren vom Grund des gefrorenen Sees angeln lassen, aus dem ich ihn gezogen hatte, und darauf beharrt, dass er sich ohne sie nackt fühle. Sogar Götter tragen Lendenschurze. Das ist meiner, hat er gesagt, tropfnass und zitternd, und sie sich wieder auf die Nase geschoben. Ich bin Ari. Er hat die Hand ausgestreckt, um meine zu schütteln, und ich habe zu ihm gesagt: Jetzt nicht mehr.
Chill schien sein Leben hier nie so zu stören wie mich. Ihm schien es nie etwas auszumachen, mit mir festzuhängen. Ich bin wahrscheinlich der beste Freund, den Chill je hatte, was traurig ist, da ich mir ziemlich sicher bin, dass ich ihn nicht verdiene. An den meisten Tagen fühle ich mich nicht besser als die Arschlöcher von unserer Schule, die ihn als Mutprobe auf den See geschickt haben und dann abgehauen sind, als er einbrach. Manchmal frage ich mich, ob er besser dran gewesen wäre, wenn ich ihn gar nicht erst gefunden hätte. In den dreißig Jahren ist er das Einzige, was ich je gerettet habe, und wenn er mich durch seine fehlenden Brillengläser ansieht, als wäre ich sein persönlicher Held, ist es schwer, seinem Blick standzuhalten. Chills Leben zu retten hat sich für mich nie nach einer bewussten Entscheidung angefühlt. Und doch entscheidet er sich, aus Gründen, die ich nie verstehen werde, trotzdem immer wieder dafür, mich zu retten.
Chill wirft mir ein Paar Boxershorts zu. »Jetzt hört Poppy vielleicht endlich damit auf, mich zu nerven. Sie ist mir jeden Tag auf den Keks gegangen, hat darauf gelauert, dass du aufwachst, und mich mit Fragen genervt. Wo wir gerade davon reden, erzählst du mir, was los war?« Chill schiebt die Brille hoch und starrt mich durch den leeren Rahmen an.
»Was?« Ich zucke zusammen, achte sorgfältig darauf, nicht mit der Kanüle am Stoff hängen zu bleiben, während ich die Boxershorts anziehe. Ich kopple den Katheder ab und bewege die Schultern, schüttle mir fünfundfünfzig Tage Schlaf aus den Knochen.
»Du. Du hast mich auf dem Bergpass abgeschaltet.« Er wirft mir ein Fläschchen Vitamine zu, und ich fange es vor der Brust auf, lasse es fast fallen.
»Wovon redest du da?« Ich nehme den Becher Wasser, den er mir hinhält, schüttle ein paar Pillen in die Hand und schlucke sie langsam.
»Hast du eine Ahnung, wie lange ich gebraucht habe, um dich zu finden und zurückzubringen? So ein Scheiß ist nicht so einfach durchzuziehen in den Bergen, selbst mit einem Transmitter.« Meine Kehle verengt sich beim letzten Schluck Wasser. Ich ersticke beinahe daran.
Mein Transmitter war aus.
Meine Erinnerungen an den Tag sind immer noch verschwommen, gehüllt in den Fiebernebel. Ich erinnere mich an den Streit mit Fleur … wie ich mich verzweifelt nach einem Moment mit ihr gesehnt habe. Ich erinnere mich daran, den Transmitter abgeschaltet zu haben, weil ich wütend war auf Chill, aber ich erinnere mich nicht daran, ihn wieder angeschaltet zu haben.
Ich sinke auf den Rand des Stasisbetts. Wie zur Hölle kann ich gerade hier sein? Chill muss Fleurs Signal genutzt haben, um mich aufzuspüren und nach Hause zu leiten.
»Du hättest da draußen draufgehen können«, sagt er heftig. »Endgültig. Für immer. Dein magischer Arsch wäre mit dem Wind gegangen, hätte Fleur dich nicht …« Chill verstummt abrupt. Ich hocke auf der Kante, warte, dass er den Satz beendet. Er tastet nach seinem Tablet und tut so, als müsse er den Screen studieren.
»Was?« Meine Herzfrequenz steigt an auf dem Monitor. Chill antwortet nicht, also beuge ich mich vor. »Hätte Fleur mich nicht …?«
»Halt dich von mir fern.« Er wedelt durch die Luft und rümpft die Nase. »Stasisatem.«
Ich muss mich beherrschen, damit ich den Rest nicht aus ihm rausprügle.
»Festgehalten.« Chill seufzt, wirft das Tablet beiseite. »Sie hat dich festgehalten. Drei verdammte Minuten lang, die ich gebraucht habe, um dich zu finden und wieder online zu bringen.«
Ich berühre die Stelle, an der das Messer mich getroffen hat.
Ich war beinahe ausgeblutet. So schwach, wie ich war, hätte mein Tod – mein endgültiger Tod – schnell gehen müssen. Ohne eine Verbindung zu Chill – ohne eine Verbindung zu den Ley-Linien – hätte es keine Möglichkeit gegeben, mich zurückzubringen. Chill hat recht. Meine Partikel hätten sich im Äther auflösen müssen, mit dem Wind gehen, irgendwo hoch oben über den Bergen der Appalachen schweben, lange bevor drei Minuten vergangen waren.
»Warum …?« Ich reibe über die feinen Pollentupfen auf meiner Handfläche. Fleur muss meinen Fehler erkannt haben. Sie muss meinen Transmitter für mich wieder angeschaltet haben. Doch selbst dann hätte es nicht drei Minuten dauern sollen, mein Signal aufzuspüren, wenn Chill sich bereits an ihres gehängt hatte. »Warum hat es so lange gedauert, uns zu finden?« Aber ich weiß es. Irgendwie kenne ich die Antwort bereits.
»Weil Fleur ihren Transmitter auch abgestellt hat.«
Ich bin immer noch wie angewurzelt neben der Stasiskammer und verdaue Chills letzten Satz, als der Monitor über seinem Schreibtisch aufleuchtet.
»Schalt deine Kamera an, Chill. Ich weiß, dass du da bist.« Poppy Withers Gesicht füllt den Screen aus. Sie tippt gegen die Linse ihrer Videokamera und trommelt ungeduldig auf ihren Schreibtisch.
Chill seufzt auf. »Jeden. Verdammten. Tag«, flüstert er.
»Das habe ich gehört«, erwidert Poppy. »Du weißt schon, dass dein Mikrofon an ist?«
Chill murmelt vor sich hin. Ich kratze die Lilien vom Stasisbett und verberge sie in meiner Faust, während er die Kamera anschaltet.
Poppy beugt sich weiter zu ihrem Monitor vor, ihre neugierigen blauen Augen scannen unser Wohnzimmer. Sie werden groß beim Anblick meiner geöffneten Kammer.
»Gaia sei Dank!« Sie schnaubt ungehalten auf. »Endlich bist du wach.« Poppy ist gern mal theatralisch. Vermutlich, weil sie in ihrer Kindheit an ein Krankenhausbett gefesselt war und ihr deshalb das ganze Drama an einer Highschool entgangen ist. Sie ist die nervigste Sechzehnjährige, die mir je begegnet ist. Und hier unten will das wirklich etwas heißen. »In Chronos’ Namen, wird mir jetzt endlich jemand sagen, was da oben los war? Warum war Fleurs Transmitter aus?«
»Du bist ihre Administratorin«, brumme ich. »Warum fragst du nicht Fleur?«
»Das habe ich! Sie sagt es mir nicht.« Sie zeigt mit dem Finger auf die Kamera. »Wenn du ihr etwas angetan hast …«
»Ha!« Ich reiße mir die Klebepads von der Brust, schleudere die verhedderten Drähte zu Boden. »Wenn ich ihr etwas angetan habe? Hier, das ist Naturwissenschaft, keine Raketentechnologie! Sie ist ein Frühling. Ich bin ein Winter, Poppy! Ich könnte ihr nicht mal dann etwas antun, wenn ich es wollte!«
Sie beißt sich auf die Lippe, wahrscheinlich, weil ich recht habe. Jahreszeiten, die sich gerade erheben, sind fast unmöglich zu töten. Bis sie die vergehende Jahreszeit aufgespürt haben, sind wir viel zu schwach und sie viel zu mächtig. Selbst wenn es so einfach wäre, durch reinen Zufall oder glückliche Umstände, so ist die Bestrafung dafür, den Kreislauf zu durchbrechen, abschreckend genug, weshalb wir es erst gar nicht ausprobieren. Wir laufen weg, wir verstecken uns, und schließlich sterben wir. Genau so, wie die Naturgesetze es uns befehlen.
»Lass uns in Ruhe«, blafft Chill. »Er ist gerade erst aufgewacht, und du treibst seine Vitalfunktionen in die Höhe.«
Poppys Augenbrauen verschwinden unter ihren weißblonden Ponyfransen. »Sonst was? Trittst du dann meine Tür ein und zwingst mich dazu?« Chill murmelt etwas Unverständliches. Poppy weiß, dass sie sich hier so nahe sind, wie sie sich je in einem Raum kommen werden. »Dachte ich’s mir doch«, sagt sie und lehnt sich von der Kamera weg. Hinter Poppy ist Fleurs dunkle Stasiskammer zu sehen, noch leer, und meine Gedanken springen zu den letzten Augenblicken, die ich mit ihr verbracht habe. Zu dem, was sie mir gestanden hat.
»Hast du nicht irgendwas zu erledigen?«, faucht Chill.
Poppy trommelt mit abgeknabberten Fingernägeln auf ihren Schreibtisch. Sieht auf ihr Tablet. Mit einem Seufzer schiebt sie den Stuhl zurück. »Ich muss los, Fleur im Auge behalten«, sagt sie mit einem Anflug von Ärger in der Stimme. »Heute Morgen sollte Julio freigelassen werden. Sie wird bald bereit sein für den Transport.«
Heißt, Fleur wird bald tot sein.
Irgendwas passt nicht ganz. »Moment«, sage ich, während mein von der Stasis verwirrtes Hirn sich bemüht, das zusammenzukriegen. »Du hast gesagt, es waren fünfundfünfzig Tage. Es ist erst Anfang Mai. Warum sollte Fleur bereit sein für den Transport?« Chill sieht mich an und blinzelt, sichtlich genauso verwirrt wie ich. Fleur war stark auf dem Berg. So stark, wie ich es noch nie erlebt habe. Es ist unmöglich, dass Julio sie so schnell erledigen könnte. Sie sollte noch wenigstens zwei, vielleicht sogar drei Wochen da draußen haben, bevor Poppy sie wieder reinholen muss.
»Es ist Julio«, sagt Poppy und verdreht die Augen. »Sie macht es ihm viel zu leicht.«
»Was soll das heißen?«
»Sieh mich nicht an«, sagt Poppy defensiv. »Ich mag Julio genauso wenig wie du. Woher soll ich wissen, was sie in ihm sieht?«
Eifersucht regt sich in mir. Julio Verano (geboren als Jaime Velasquez), dieser verschwitzte Arsch von Sommer. Ich versuche es mir nicht vorzustellen – ihn, wie er halb nackt auf seinem Surfbrett steht, nach Coppertone-Sonnencreme und Sex-Wax-Surfbrettwachs riecht, oder die unzähligen Arten, wie er sie töten könnte. Ich hoffe, sie lässt den Transmitter an. Und er behält seine großen dummen Lippen bei sich.
Poppy tippt mit dem Stift auf den Schreibtisch. »Was soll ich in meinen Bericht für Gaia schreiben?«
»Woher soll ich das wissen?«, grolle ich. »Ich bin nicht die, die was für die Grillfackel übrighat.«
»Ich rede nicht von Julio! Ich meine das, was auf diesem Berg passiert ist. Mit dir.«
Ich fahre mir mit den Händen durch die Haare, die von meinem zweimonatigen Schlaf verstrubbelt sind. Poppy hat recht. Offline zu gehen, geht nicht als kleine Verletzung der Regeln durch. Wenn zwei gegnerische Jahreszeiten gemeinsam offline gehen, ist das einfach verdächtig. Wir sollen einander jagen, einander töten und einander nach Hause schicken. Jeder Kontakt, der darüber hinausgeht, ist ausdrücklich verboten. Das ganze System ist darauf ausgerichtet, uns voneinander abzuschotten. Uns unter Kontrolle zu halten. »Um das natürliche Gleichgewicht beizubehalten«, sagt Chronos. Aber manchmal frage ich mich, ob nicht mehr dahintersteckt.
Poppy wartet immer noch auf eine Antwort. Unsere Geschichten müssen stimmig sein. Und wenn Fleur in Stasis ist, dauert es Monate, bis sie wieder aufwacht.
»Hast du irgendwelche Aufzeichnungen, die du nutzen kannst?«
Sie zupft an einem Nagel herum. Hebt eine Augenbraue. »Du meinst, diese herausragenden zehn Sekunden, in denen sie dich aus dem Wald geschleppt hat, während du um dich getreten und rumgeschrien hast? Ja, hab ich.«
Ich verkneife mir eine gemeine Antwort. »Dann reich das ein. Nachdem sie mich gefangen hat, war es ein normaler Einsatz. Wir hatten technische Schwierigkeiten, und ich habe mein Signal verloren.«
»Und Fleurs?«, fragt sie und nagt an ihrer Lippe, es wirkt, als würde sie mir kein Wort abkaufen.
»Ihr Transmitter ist runtergefallen, als ich sie getreten habe. Sie hat mich erstochen. Nebel hat die Bergung verzögert. Chill hat mich nach Hause gebracht. Ende.« Ich strecke die Hand aus, greife um Chill herum und schalte unsere Kamera ab.
Chill reibt sich durch das leere Gestell hindurch die Augen. Blinzelnd blickt er auf den leeren Screen. »Ich hasse sie.«
»Behalte sie trotzdem im Auge.« Ich ziehe die letzten Klebepads ab, dann gehe ich Richtung Dusche. »Sag Bescheid, wenn Fleur zurück ist.«
Ich trotte in unser angrenzendes Schlafzimmer und öffne meinen Schrank, zerdrücke dabei aus Versehen die Lilien in meiner Faust, weil ich die aufgerollten Karten des Observatoriums auffange, die herausquellen und mir vor die Füße fallen. Ich schiebe die verstaubten Karten zurück in eine Ecke. Seit Ewigkeiten habe ich mir nicht mehr die Mühe gemacht, sie aufzurollen. Ich habe sie vor Jahren gezeichnet, habe akribisch jeden Aufzug und Lüftungsschacht und Wandschrank festgehalten, jeden Ausgang von jedem Flügel zur Stadt über uns und jeden Weg in die Katakomben, den ich finden konnte. Habe alles aufgezeichnet, was ich durch die Plexiglastrennwände am Ende unseres Flügels erkennen konnte, habe das Wenige abgebildet, was ich von den Verwaltungsstockwerken unten noch im Kopf hatte. Es war aussichtslos. Lyon hat mir das jedes Mal gesagt, wenn er mich dabei erwischte, wie ich ein Schloss aufbrach oder aus einem Tunnel kroch, in dem ich absolut nichts zu suchen hatte. »Denk scharf nach, Jack«, hat er mit einem provokativen Lächeln gesagt. »Wenn du wirklich einen Weg aus dem Observatorium hinaus finden könntest, wie würdest du dann überleben?«
Fleur hatte recht. Es gibt nur einen Weg hinaus. Und nur einen Weg hinein. Vielleicht bringt es wirklich nichts, sich dagegen zu wehren.
Ich benutze die Schranktür als Sichtschutz und ziehe die Dietriche aus ihrem Versteck in einem alten Paar Sneaker, dann knacke ich das Schloss einer kleinen metallenen Truhe am Boden. Mit einem Knarren öffnet sich der Deckel, und ich lege die Lilien auf eine Sammlung von Weihnachtsschmuck, der darin aufgestapelt ist – siebenundzwanzig Christbaumanhänger, einer für jedes Jahr, in dem Fleur mich getötet hat. Jeden Herbst finde ich einen an einem Baum in der Nähe des Orts, an dem ich zuletzt gestorben bin, neben meinen Initialen, die hineingeritzt sind – J. S. Ich habe nie jemandem gestanden, dass ich sie suche, nicht einmal Chill. Habe niemals jemandem erzählt, dass ich sie jeden Winter zuallererst aufspüre, oder dass ich jedes Frühjahr dafür sorge, dass jedes Teil hierhergeschickt wird, an mich selbst adressiert. Im ersten


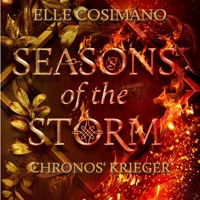














![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)











