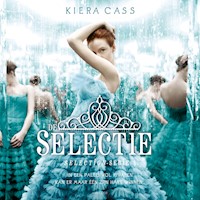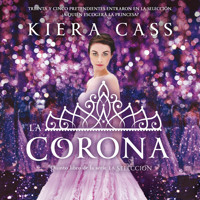Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Goya libre
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Selection
- Sprache: Deutsch
Das ganz große Glück? Von den 35 Mädchen, die um die Gunst von Prinz Maxon und die Krone von Illeá kämpfen, sind mittlerweile nur noch 6 übrig. America ist eine von ihnen, und sie ist hin- und hergerissen: Gehört ihr Herz nicht immer noch ihrer großen Liebe Aspen? Aber warum hat sich dann der charmante, gefühlvolle Prinz hineingeschlichen? America muss die schwerste Entscheidung ihres Lebens treffen. Doch dann kommt es zu einem schrecklichen Vorfall, der alles ändert. Auch im zweiten Band der ›Selection‹-Trilogie geht es um die ganz großen Gefühle! Kiera Cass versteht es meisterhaft, das im ersten Band vorgestellte Liebesdreieck noch ein bisschen verzwickter zu machen und die Leserinnen gemeinsam mit America hin- und her schwanken zu lassen: Maxon oder Aspen? Aspen oder Maxon? Endlich: Die Fortsetzung des weltweiten Bestsellers! Selection - Die Elite schoss bei Erscheinen in den USA direkt auf Platz 1 der New York Times Bestsellerliste!
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kiera Cass
Selection
Die Elite
Über dieses Buch
Nur noch 6 Mädchen kämpfen um die Gunst von Prinz Maxon und die Krone von Illeá. America ist eine von ihnen, und sie ist hin- und hergerissen: Gehört ihr Herz ihrer Jugendliebe Aspen? Oder doch dem charmanten, gefühlvollen Prinzen? America muss die schwerste Entscheidung ihres Lebens treffen. Doch dann kommt es zu einem schrecklichen Vorfall, der alles ändert.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Kiera Cass wurde in South Carolina, USA, geboren und lebt heute mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern in Virginia. Die Idee zu den ›Selection‹-Romanen kam ihr, als sie darüber nachdachte, ob Aschenputtel den Prinzen wirklich heiraten wollte – oder ob ein freier Abend und ein wunderschönes Kleid nicht auch gereicht hätten …
Mit ihren ›Selection‹-Romanen hat sie es weltweit auf die Bestseller-Listen geschafft.
Alle Bücher von Kiera Cass:
Band 1: Selection
Band 2: Selection – Die Elite
Band 3: Selection – Der Erwählte
Band 4: Selection – Die Kronprinzessin
Band 5: Selection – Die Krone
Selection Storys – Liebe oder Pflicht
Selection Storys 2 – Herz oder Krone
Siren
Inhalt
[Widmung]
[Motto]
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
Danksagung
Für Mom
Ruft die Dienerschaft! Die Königin ist erwacht!
1
In Angeles ging kein Lüftchen, und ich lag still da und lauschte Maxons Atem. Es wurde immer schwieriger, ihn ausgeglichen und glücklich anzutreffen, und ich genoss diesen Moment, froh, dass es ihm am besten zu gehen schien, wenn wir beide allein waren.
Seit sich die Anzahl der Bewerberinnen auf sechs Mädchen beschränkte, wirkte er viel angespannter als zu dem Zeitpunkt, als die anderen vierunddreißig Mädchen und ich angekommen waren. Er hatte wohl gedacht, ihm würde mehr Zeit bleiben, seine Wahl zu treffen. Und obwohl ich es nur unter Schuldgefühlen zugeben mochte, war mir dennoch klar – ich war der Grund, warum er sich mehr Zeit wünschte.
Prinz Maxon, Thronerbe von Illeá, hatte ein Auge auf mich geworfen. Eine Woche zuvor hatte er mir für den privaten Umgang das Du angeboten und betont, dass der Wettbewerb entschieden wäre, wenn ich ihm signalisierte, dass er mir genauso viel bedeutete wie ich ihm. Und zwar von ganzem Herzen. Manchmal spielte ich mit diesem Gedanken und fragte mich, wie es sich wohl anfühlen würde, allein Maxon zu gehören.
Doch zum einen war es keineswegs so, dass Maxon wirklich der Meine war. Es gab noch fünf weitere Mädchen – Mädchen, mit denen er sich verabredete und denen er Vertraulichkeiten zuflüsterte. Und ich wusste nicht, was ich davon halten sollte. Zum anderen gab es da auch noch das Problem, dass ich mit Maxon gleichzeitig die Krone akzeptieren musste. Und das war ein Gedanke, den ich lieber beiseiteschob und sei es nur, weil ich nicht sicher war, was das für mich bedeutete.
Und natürlich gab es noch Aspen.
Genau genommen war er zwar nicht mehr mein Freund – er hatte bereits mit mir Schluss gemacht, bevor ich für das Casting ausgewählt wurde. Doch in dem Augenblick, als er im Palast als Wache aufgetaucht war, waren all die Gefühle, die ich zu vergessen suchte, wieder erwacht. Aspen war meine erste große Liebe. Wenn ich ihn ansah, dann wusste ich, ich gehörte zu ihm.
Maxon hatte keine Ahnung, dass Aspen im Palast war. Doch er wusste, dass es in meiner Heimat jemanden gab, über den ich hinwegzukommen versuchte. Er war so großzügig, mir Zeit zu lassen, während er selbst sich bemühte, eine andere Frau fürs Leben zu finden, mit der er glücklich sein könnte – für den Fall, dass ich seine Liebe nicht erwidern würde.
Als er den Kopf bewegte und direkt über meinem Haar einatmete, überlegte ich, wie es wäre, einfach nur ihn zu lieben.
»Weißt du, wann ich mir das letzte Mal richtig die Sterne angeschaut habe?«, fragte er.
Ich rutschte auf der Decke näher an ihn heran, um mich in der kühlen Nachtluft zu wärmen. »Keine Ahnung.«
»Ein Hauslehrer hat mich vor ein paar Jahren in Astronomie unterrichtet. Wenn du genau hinsiehst, kannst du erkennen, dass die Sterne tatsächlich verschiedene Farben haben.«
»Moment mal, das letzte Mal, als du dir die Sterne angesehen hast, war, um sie zu studieren? Und nicht zum Vergnügen?«
Er schmunzelte. »Vergnügen muss ich normalerweise zwischen den Haushaltsberatungen und den Sitzungen des Infrastrukturkomitees einplanen. Ach ja, die Sitzungen zur Kriegstaktik nicht zu vergessen, worin ich übrigens eine absolute Niete bin.«
»Und worin bist du noch eine absolute Niete?«, neckte ich ihn und ließ meine Hand über sein gestärktes Hemd gleiten.
Durch diese Berührung ermutigt, zog Maxon mit den Fingern Kreise auf meiner Schulter.
»Warum willst du das wissen?«, fragte er in gespieltem Ärger.
»Weil ich noch immer so wenig über dich weiß, und du stets so perfekt zu sein scheinst. Es ist einfach beruhigend, einen Beweis zu haben, dass du es nicht bist.«
Er stützte sich auf den Ellenbogen und betrachtete mein Gesicht. »Du weißt, dass ich es nicht bin.«
»Manchmal bin ich mir da nicht so sicher«, entgegnete ich. Wir tauschten winzige Berührungen aus, mit den Knien, den Armen, den Fingern.
Er schüttelte den Kopf und lächelte kurz. »Na schön. Ich kann zum Beispiel keinen Krieg planen. Darin bin ich absolut mies. Und ich glaube, ich bin ein furchtbarer Koch. Ich habe es zwar noch nie probiert, deshalb kann ich …«
»Noch nie?«
»Vielleicht sind dir die Menschen aufgefallen, die für die Elite die köstlichsten Speisen auffahren. Nun, diese Leute sorgen zufällig auch für mein leibliches Wohl.«
Ich kicherte. Ich half zu Hause fast immer beim Kochen mit. »Weiter«, forderte ich. »Worin bist du noch schlecht?«
Er hielt mich ganz fest, seine braunen Augen funkelten geheimnisvoll. »Tatsächlich habe ich da in letzter Zeit noch eine Sache entdeckt …«
»Nun sag schon.«
»Es hat sich gezeigt, dass ich absolut unfähig bin, mich von dir fernzuhalten. Das ist ein sehr ernstes Problem.«
Ich grinste. »Hast du es denn wirklich versucht?«
Er tat so, als dächte er angestrengt darüber nach. »Äh, nein. Und erwarte nicht, dass ich damit anfange.«
Wir mussten beide lachen und hielten einander fest. In diesem Augenblick war es ganz einfach, sich vorzustellen, dass so der Rest meines Lebens aussehen würde.
Das Rascheln von Blättern verkündete, dass sich uns jemand näherte. Obwohl unsere Verabredung den strengen Regeln des Castings entsprach, war ich ein wenig beschämt und setzte mich rasch auf. Maxon folgte meinem Beispiel, als ein Wachmann um die Hecke herum auf uns zukam.
»Eure Majestät«, sagte der Mann mit einer Verbeugung. »Bitte entschuldigen Sie die Störung, Sir, aber es ist wirklich nicht ratsam, zu dieser späten Stunde noch draußen zu sein. Die Rebellen könnten …«
»Schon verstanden«, entgegnete Maxon und seufzte. »Wir kommen gleich ins Haus.«
Der Wachmann ließ uns allein, und Maxon wandte sich mir zu. »Das ist noch einer meiner Fehler. Ich verliere langsam die Geduld mit den Rebellen. Ich bin es leid, mich ständig mit ihnen herumzuschlagen.«
Er stand auf und reichte mir die Hand. Seit Beginn des Castings waren wir zweimal von Rebellen angegriffen worden. Das eine Mal von Nordrebellen, denen es einfach nur um Zerstörung ging, und das andere Mal von Südrebellen, die auch Tote in Kauf nahmen. Doch diese beiden Zwischenfälle reichten schon, um seinen Ärger zu verstehen.
Maxon hob die Decke auf und schüttelte sie aus, er war sichtlich deprimiert, dass unser Abend ein so jähes Ende fand.
»Hey«, sagte ich und zwang ihn, mich anzusehen. »Ich habe mich prima amüsiert.«
Er nickte.
»Nein, ehrlich«, beteuerte ich und trat zu ihm. Er nahm die Decke in die eine Hand und legte den freien Arm um mich. »Wir sollten es irgendwann noch mal wiederholen, und dann erklärst du mir, welcher Stern welche Farbe hat, denn ich kann es wirklich nicht erkennen.«
Maxon lächelte mich traurig an. »Manchmal wünschte ich, die Dinge wären einfacher. Eben ganz normal …«
Ich drehte mich so, dass ich beide Arme um ihn legen konnte, und als ich das tat, ließ Maxon die Decke fallen und erwiderte meine Umarmung. »Es widerstrebt mir, es Ihnen sagen zu müssen, Eure Majestät, aber selbst ohne Wachen sind Sie meilenweit davon entfernt, normal zu sein.«
Sein Gesichtsausdruck hellte sich ein wenig auf, aber er war immer noch ernst. »Du würdest mich lieber mögen, wenn ich es wäre, nicht wahr?«
»Ich weiß, dass du es kaum glauben kannst, aber ich mag dich wirklich genau so, wie du bist. Ich brauche einfach nur mehr …«
»Zeit. Ich weiß. Und ich bin bereit, sie dir zu gewähren. Ich wünschte nur, ich wüsste, dass du tatsächlich mit mir zusammen sein willst, wenn diese Zeit vorüber ist.«
Ich blickte zur Seite. Das war etwas, das ich nicht versprechen konnte. Ich wog meine Gefühle für Maxon und Aspen wieder und wieder in meinem Herzen ab, aber keiner von beiden genoss klar meinen Vorzug. Außer vielleicht, wenn ich mit einem von ihnen allein war. Denn gerade jetzt war ich versucht, Maxon zu versprechen, dass ich die Seine werden würde. Aber ich konnte es nicht.
»Maxon«, flüsterte ich, als ich sah, wie sehr ihn mein Schweigen entmutigte. »Ich kann dir das nicht garantieren, aber was ich dir mit Gewissheit sagen kann, ist, dass ich hier sein will. Ich will wissen, ob es für uns beide ein …« Ich stammelte herum, weil ich nicht wusste, wie ich es ausdrücken sollte.
»Wir?«, kam Maxon mir zu Hilfe.
»Ja, genau.« Ich lächelte und war froh, wie gut er mich verstand. »Ich möchte wissen, ob aus uns beiden ein Wir werden kann.«
Er strich mir eine Locke hinters Ohr. »Ich glaube, die Chancen stehen ziemlich gut«, sagte er.
»Das glaube ich auch. Ich brauche nur … Zeit, einverstanden?«
Er nickte und wirkte deutlich optimistischer. Und ich war froh, dass unser Abend so endete – mit Hoffnung. Ach, und vielleicht noch mit einer anderen Sache. Ich lehnte mich an Maxon und ließ meine Augen sprechen.
Ohne eine Sekunde zu zögern, beugte er sich herab, um mich zu küssen. Sein Kuss war zärtlich und sanft und hinterließ in mir das angenehme Gefühl, bewundert zu werden. Und irgendwie auch ein Verlangen nach mehr. Ich hätte noch Stunden hierbleiben können, nur um herauszufinden, ob ich je genug von diesem Gefühl bekam. Doch Maxon drängte zum Aufbruch.
»Lass uns lieber zurückgehen«, sagte er und führte mich in Richtung des Palastes. »Bevor uns die Wachen noch auf Pferden und mit gezückten Speeren holen kommen.«
Nachdem er sich an der Treppe verabschiedet hatte, überfiel mich schlagartig ein ungeheures Schlafbedürfnis. Müde stieg ich hoch in den zweiten Stock und bog in den kleinen Gang zu meinem Zimmer ein.
»Oh!«, sagte Aspen, der überrascht war, mich zu sehen. »Ich bin wohl die schlechteste aller Wachen. Ich hatte angenommen, dass du die ganze Zeit über in deinem Zimmer warst.«
Ich kicherte. Die Regeln besagten, dass die Mitglieder der Elite in Anwesenheit mindestens einer ihrer Zofen die Nacht verbringen sollten. Da mir das überhaupt nicht gefiel, hatte Maxon darauf bestanden, eine Wache vor meinem Zimmer zu postieren, falls es einen Notfall geben sollte. Meistens war Aspen dieser Wachmann. Und es war eine seltsame Mischung aus freudiger Erregung und Angst, zu wissen, dass er fast jede Nacht draußen vor meiner Tür stand.
Die Unbeschwertheit des Augenblicks verschwand jedoch schnell, als Aspen begriff, was es bedeutete, dass ich nicht brav in meinem Bett gelegen hatte. Er räusperte sich beklommen.
»War es denn schön?«, fragte er ein wenig spitz.
»Aspen«, flüsterte ich und blickte mich um, weil ich sichergehen wollte, dass niemand in der Nähe war. »Sei nicht böse. Ich nehme am Casting teil, und da läuft das nun einmal so.«
»Und wie soll ich da eine Chance haben, Mer? Wie kann ich mich mit ihm messen, wenn du immer nur mit einem von uns beiden sprichst?«
Es stimmte, was er sagte, aber was sollte ich tun?
»Bitte sei nicht wütend auf mich, Aspen. Ich versuche doch, mir über alles klarzuwerden.«
»Nein, Mer«, erwiderte er, und seine Stimme wurde wieder sanft. »Ich bin nicht wütend auf dich. Du fehlst mir.« Er wagte es nicht, die Worte laut auszusprechen, aber er formte sie mit den Lippen. Ich liebe dich.
Ich schmolz dahin.
»Ich weiß«, sagte ich, legte ihm die Hand auf die Brust und gestattete mir, für einen Moment zu vergessen, was wir damit riskierten. »Aber das ändert nichts daran, wo wir uns befinden und dass ich jetzt zur Elite gehöre. Ich brauche Zeit, Aspen.«
Er nahm meine Hand in seine und nickte. »Die sollst du haben. Aber versuch einfach … dir auch ein wenig Zeit für mich zu nehmen.«
Ich wollte nicht näher darauf eingehen, wie schwierig das sein würde, deshalb schenkte ich ihm ein winziges Lächeln, bevor ich ihm sanft meine Hand entzog. »Ich muss jetzt gehen.«
Als ich in mein Zimmer ging und die Tür hinter mir schloss, wusste ich, dass er mir nachblickte.
Zeit. In letzter Zeit hatte ich mir eine Menge davon erbeten. Und ich hoffte, dass sich mit genügend Zeit auch endlich alles klären würde.
2
»Nein, nein«, antwortete Königin Amberly lachend. »Ich hatte nur drei Brautjungfern, obwohl Clarksons Mutter der Ansicht war, das sei nicht genug. Ich aber wollte nur meine Schwestern und meine beste Freundin, die ich während des Castings kennengelernt hatte.«
Ich blickte verstohlen zu Marlee hinüber und freute mich, dass sie ebenfalls zu mir herübersah. Bevor ich im Palast angekommen war, hatte ich angenommen, dass keins der Mädchen nett zu mir sein würde, da bei diesem Wettbewerb so unglaublich viel auf dem Spiel stand. Doch Marlee hatte mich gleich bei unserer allerersten Begegnung umarmt, und von diesem Augenblick an waren wir immer füreinander da gewesen. Bis auf eine einzige Ausnahme hatten wir uns noch nie gestritten.
Vor ein paar Wochen hatte Marlee mir gestanden, dass sie glaubte, nicht mehr mit Maxon zusammen sein zu wollen. Als ich sie drängte, mir das zu erklären, bekam ich kein weiteres Wort aus ihr heraus. Sie war nicht böse auf mich, das wusste ich, aber die stummen Tage, die darauf folgten, waren ziemlich einsam. Dann ließen wir das Ganze auf sich beruhen.
»Ich möchte sieben Brautjungfern«, erklärte Kriss eifrig. »Ich meine, für den Fall, dass Maxon sich für mich entscheidet und die Hochzeit groß gefeiert wird.«
»Nun, ich verzichte lieber auf Brautjungfern«, sagte Celeste an Kriss gewandt. »Sie lenken nur ab. Und da die Hochzeit im Fernsehen übertragen wird, möchte ich, dass sich alle Augen auf mich richten.«
Wut stieg in mir auf. Wir saßen so selten alle zusammen und redeten mit Königin Amberly. Und dann kam Celeste, benahm sich unmöglich und verdarb alles.
»Ich würde gern einige unserer Traditionen in mein Hochzeitsfest integrieren«, warf Elise leise ein. »Die Mädchen in New Asia verwenden viel Rot während der Feierlichkeiten, und der Bräutigam muss den Freundinnen der Braut Geschenke bringen, weil sie ihm gestattet haben, sie zu heiraten.«
»Denk daran, mich bei deinem Hochzeitsfest einzuladen. Ich liebe Geschenke!«, meldete sich Kriss fröhlich zu Wort.
»Ich auch!«, rief Marlee begeistert aus.
»Lady America, Sie sind so still«, wandte sich Königin Amberly an mich. »Wie stellen Sie sich Ihre Hochzeit vor?«
Ich wurde rot, denn die Frage traf mich völlig unvorbereitet. Ich hatte mir bislang immer nur eine Art von Hochzeit vorgestellt, und die fand im Bürgeramt der Provinz Carolina nach dem Ausfüllen eines riesigen Bergs von Schriftstücken statt.
»Nun, eine Sache habe ich mir überlegt, nämlich dass mein Vater mich an den Bräutigam übergeben soll. Wissen Sie, was ich meine? Dass er meine Hand in die des Bräutigams legt. Das ist das Einzige, was ich mir jemals wirklich gewünscht habe.« Tatsächlich entsprach das beschämenderweise der Wahrheit.
»Aber so ist es doch bei allen Hochzeiten«, wandte Celeste ein. »Das ist nicht gerade originell.«
Ich hätte eigentlich wütend darüber sein müssen, dass sie mich so provozierte, aber ich zuckte nur die Achseln. »Ich möchte einfach, dass mein Vater meine Wahl an diesem entscheidenden Tag vorbehaltlos billigt.«
»Das ist schön«, sagte Natalie, nippte an ihrem Tee und sah aus dem Fenster.
Königin Amberly lachte leise. »Ich hoffe doch sehr, dass er sie billigt. Egal, wer es ist.« Den letzten Satz fügte sie eilig hinzu, denn sie hatte bemerkt, dass sie damit angedeutet hatte, Maxon wäre meine Wahl.
Ich fragte mich, ob sie das auch gedacht hätte, wenn er ihr von uns erzählt hätte.
Kurz darauf versiegte das Gespräch über Hochzeiten, und die Königin ging in ihr Arbeitszimmer. Celeste ließ sich vor den großen Fernseher fallen, der in die Wand eingelassen war, und die anderen fingen an, Karten zu spielen.
»Ich bin nicht sicher, ob ich die Königin schon jemals so viel habe reden hören«, sagte Marlee, nachdem wir uns zusammen an einen Tisch gesetzt hatten.
»Ich nehme an, sie erwärmt sich langsam für das Ganze.« Ich hatte niemandem gegenüber erwähnt, dass mir Königin Amberlys Schwester von deren vielen vergeblichen Versuchen, ein weiteres Kind zu bekommen, erzählt hatte. Adele hatte prophezeit, ihre Schwester würde uns gegenüber aufgeschlossener sein, sobald die Gruppe erst kleiner wäre. Sie hatte recht behalten.
»Also los, du musst es mir erzählen. Hast du wirklich keine Pläne für deine Hochzeit, oder willst du sie einfach nur nicht mit uns teilen?«
»Ich habe wirklich keine«, versicherte ich. »Es fällt mir schwer, mir eine große Hochzeitsfeier vorzustellen, verstehst du? Ich bin eine Fünf.«
Marlee schüttelte den Kopf. »Du warst eine Fünf. Jetzt bist du eine Drei.«
»Stimmt«, sagte ich zögerlich.
Ich war in eine Familie von Fünfern hineingeboren worden – Künstler und Musiker, die üblicherweise schlecht bezahlt wurden –, und obwohl ich das Kastensystem grundsätzlich ablehnte, mochte ich das, was ich für meinen Lebensunterhalt tun musste. Mich selbst als Drei zu sehen und mich mit einer Tätigkeit als Lehrerin oder Schriftstellerin anzufreunden, fiel mir noch schwer.
»Hör auf, dir Sorgen zu machen«, sagte Marlee, die meinen Gesichtsausdruck richtig deutete. »Im Moment musst du noch nicht darüber nachdenken.«
Ich wollte widersprechen, wurde jedoch von Celeste unterbrochen, die einen wütenden Schrei ausstieß.
»Jetzt komm schon!«, brüllte sie und warf die Fernbedienung auf die Couch, um sie anschließend wieder auf den Fernseher zu richten. »Mann!«
»Liegt es an mir, oder wird sie immer schlimmer?«, flüsterte ich Marlee zu. Wir beobachteten, wie Celeste verzweifelt auf der Fernbedienung herumdrückte, bis sie es aufgab und zum Fernseher ging, um ein anderes Programm einzuschalten. Wenn ich als Zwei aufgewachsen wäre, hätte ich mich wohl auch über so etwas aufgeregt.
»Vermutlich der Stress«, erklärte Marlee. »Hast du bemerkt, dass Natalie immer, wie soll ich sagen … immer reservierter wird?«
Ich nickte, und wir beide sahen zu den drei Mädchen, die beim Kartenspiel saßen. Kriss lächelte beim Mischen, Natalie hingegen untersuchte akribisch ihre Haarspitzen und zog gelegentlich eine Strähne heraus, die ihr nicht zu gefallen schien. Sie hatte einen abwesenden Gesichtsausdruck.
»Ich glaube, wir alle spüren den wachsenden Druck«, gestand ich. »Jetzt, da die Gruppe so klein ist, ist es viel schwerer, sich zu entspannen und am Palastleben zu freuen.«
Celeste gab ein undefinierbares Schnauben von sich, und wir sahen verstohlen zu ihr rüber, wandten jedoch rasch die Augen ab, als sie uns dabei erwischte.
»Entschuldige mich einen Augenblick«, sagte Marlee und schob ihren Stuhl zurück. »Ich muss kurz zur Toilette.«
»Ich auch. Wollen wir zusammen gehen?«, schlug ich vor.
»Nein, nein, geh schon mal vor. Ich trinke noch schnell meinen Tee aus.«
»Na schön. Dann bis gleich.«
Ich verließ den Damensalon und durchquerte die prächtige Halle. Wie immer, wenn ich hier vorbeikam, fragte ich mich, ob ich mich je daran gewöhnen würde, wie außergewöhnlich schön sie war. Ich war so abgelenkt, dass ich prompt mit einem Wachmann zusammenstieß, als ich um die Ecke bog.
»Oh, entschuldigen Sie bitte, Miss. Ich hoffe, ich habe Sie nicht erschreckt.« Er hielt mich an den Ellenbogen fest, damit ich das Gleichgewicht wiedererlangte.
»Nein«, antwortete ich kichernd. »Mir geht es gut. Ich hätte aufpassen sollen, wo ich hinlaufe. Danke, dass Sie mich aufgefangen haben, Officer …«
»Woodwork«, antwortete er mit einer kurzen Verbeugung.
»Mein Name ist America.«
»Ich weiß.«
Ich grinste und verdrehte die Augen. Natürlich wusste er das.
»Nun, ich hoffe, unsere nächste Begegnung wird nicht ganz so stürmisch verlaufen«, scherzte ich.
Er schmunzelte. »Das hoffe ich auch. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, Lady America.«
»Für Sie auch.«
Bei meiner Rückkehr, erzählte ich Marlee von meinem peinlichen Zusammenstoß mit Officer Woodwork. Den Rest des Nachmittags saßen wir am offenen Fenster, redeten über zu Hause und über die anderen Mädchen und ließen uns von der Sonne bescheinen.
Der Gedanke an die Zukunft stimmte mich traurig. Irgendwann würde das Casting vorbei sein, und obwohl ich wusste, dass Marlee und ich uns auch danach nahestehen würden, würde ich unsere täglichen Gespräche vermissen. Sie war meine erste richtige Freundin, und ich wünschte, ich hätte immer mit ihr zusammen sein können.
Während ich meinen Gedanken nachhing, blickte Marlee träumerisch aus dem Fenster. Ich fragte mich, was ihr wohl im Kopf herumging, doch es war ein so friedlicher Moment, dass ich sie nicht darauf ansprach.
3
Die großen Balkontüren und die Tür zum Flur standen weit offen, und mein Zimmer füllte sich immer mehr mit der warmen, süßen Luft, die vom Garten hereinwehte. Ich hatte gehofft, die leichte Brise würde mich darüber hinwegtrösten, dass ich so viel lernen musste. Stattdessen lenkte sie mich nur noch mehr ab und schürte mein Verlangen, irgendwo anders als hier an meinem Schreibtisch zu sein.
Ich seufzte und lehnte mich in meinem Stuhl zurück. »Anne!«
»Ja, Miss?«, antwortete meine Zofe aus der Ecke, in der sie nähte. Ohne hinzusehen, wusste ich, dass sich auch die beiden anderen, Mary und Lucy, regten, um mir gegebenenfalls behilflich zu sein.
»Ich befehle Ihnen, herauszufinden, was in diesem Bericht steht«, sagte ich und zeigte mit müder Geste auf die detaillierte Aufzeichnung von Militärstatistiken, die vor mir lag. Es war eins der Themen, in denen die Elite später abgefragt werden würde, aber ich schaffte es einfach nicht, mich darauf zu konzentrieren.
Meine drei Zofen lachten – vermutlich wegen der Lächerlichkeit meiner Forderung und weil ich überhaupt etwas befohlen hatte. Ausgeprägte Führungsqualitäten gehörten nicht gerade zu meinen Stärken.
»Es tut mir leid, Lady America, aber ich glaube, das würde meine Kompetenzen überschreiten«, antwortete Anne.
Obwohl mein Befehl ein Scherz gewesen war und ihre Antwort darauf ebenfalls, entnahm ich ihr doch die ernstgemeinte Entschuldigung, dass sie mir nicht helfen konnte.
»Na schön«, stöhnte ich und setzte mich wieder aufrecht hin. »Dann muss ich es wohl selbst machen. Ihr drei seid mir ja eine schöne Hilfe. Morgen bemühe ich mich um neue Zofen. Und diesmal meine ich es ernst.«
Wieder kicherten sie, und ich versuchte, mich erneut den Zahlen zu widmen. Ich hatte zwar den Eindruck, dass der Bericht schlecht abgefasst war, aber das war auch kein Trost. Verbissen vertiefte ich mich in die ungeliebten Paragraphen und Tabellen, zog dabei die Augenbrauen zusammen und kaute auf meinem Stift herum.
Mit halbem Ohr hörte ich, wie Lucy leise auflachte, und blickte hoch, um zu sehen, worüber sie sich so amüsierte. Als ich ihrem Blick bis zur Tür folgte, sah ich, dass Maxon im Türrahmen lehnte.
»Sie haben mich verraten!«, beschwerte er sich bei Lucy, die immer weiter kicherte.
Ich schob schwungvoll den Stuhl zurück und warf mich in seine Arme. »Du kannst Gedanken lesen!«
»Kann ich das?«
»Bitte lass uns nach draußen gehen. Nur für einen kurzen Moment.«
Er lächelte. »Also gut, aber in zwanzig Minuten muss ich wieder hier sein.«
Ich zog ihn den Flur entlang, während hinter uns das aufgeregte Geschnatter meiner Zofen verklang.
Es bestand kein Zweifel, der Garten war unser Ort geworden. Immer wenn wir Gelegenheit hatten, allein zu sein, gingen wir dorthin. Es unterschied sich schon sehr von der Art, wie ich mit Aspen meine Zeit verbracht hatte – in dem winzigen Baumhaus in meinem Garten, dem einzigen Ort, wo wir gefahrlos zusammen sein konnten.
Plötzlich fragte ich mich, ob Aspen – ohne dass ich ihn unter all den anderen Wachen im Palast erblickte – irgendwo in der Nähe war und zusah, wie Maxon meine Hand hielt.
»Was hast du da?«, fragte Maxon und fuhr über meine Fingerspitzen.
»Schwielen. Das kommt vom Geige spielen.«
»Sie sind mir zuvor noch nie aufgefallen.«
»Stören sie dich?« Von den sechs übrig gebliebenen Mädchen gehörte ich der niedrigsten Kaste an, und ich bezweifelte, dass eine der anderen solche Hände hatte.
Maxon blieb stehen, hob meine Finger an seine Lippen und küsste die Fingerkuppen.
»Im Gegenteil. Ich finde sie sehr schön.« Ich spürte, wie ich rot wurde. »Ich habe die ganze Welt gesehen – wenn auch meistens nur durch Panzerglas oder vom Turm irgendeines alten Schlosses aus. Und mir steht das Wissen der Menschheit zur Verfügung. Aber diese kleine Hand hier«, er sah mir tief in die Augen, »diese Hand erzeugt Töne, die mit nichts zu vergleichen sind, was ich je gehört habe. Manchmal denke ich, ich habe nur geträumt, dass du Geige gespielt hast, so schön ist es gewesen. Aber diese Schwielen sind der Beweis, dass es real war.«
Manchmal war seine Art zu sprechen fast schon zu romantisch, um es ihm wirklich abzunehmen. Und obwohl seine Worte mein Herz bewegten, war ich nie völlig sicher, ob ich ihm trauen konnte. Woher sollte ich denn wissen, ob er den anderen Mädchen nicht auch solche reizenden Dinge sagte? Ich wechselte das Thema.
»Steht dir wirklich das Wissen der Menschheit zur Verfügung?«
»Ja. Frag mich irgendetwas. Und wenn ich die Antwort nicht weiß, dann weiß ich zumindest, wo wir sie finden können.«
»Egal, was?«
»Egal, was.«
Es war schwer, sich aus dem Stand heraus eine Frage auszudenken, noch dazu eine, die ihn verblüffen würde. Denn das wollte ich ja erreichen. Ich brauchte einen Moment, um mir klar zu werden, welche Dinge mich in meiner Kindheit am meisten interessiert hatten – zum Beispiel wie ein Flugzeug fliegen konnte, wie es früher in den Vereinigten Staaten gewesen war, wie die winzigen Musikabspielgeräte der oberen Kasten funktionierten.
Und dann hatte ich es.
»Was ist Halloween?«, fragte ich.
»Halloween?« Er hatte eindeutig noch nie davon gehört, was mich nicht überraschte. Mir selbst war das Wort auch nur ein einziges Mal begegnet – in einem alten Geschichtsbuch meiner Eltern. Ganze Teile des Buchs waren ziemlich ramponiert, entweder fehlten die Seiten oder sie waren weitgehend unleserlich. Dennoch hatte mich die Erwähnung dieses Feiertags, der bei uns völlig unbekannt war, immer fasziniert.
»Ist sich Eure Königliche Pfiffigkeit nun doch nicht mehr so sicher?«, neckte ich Maxon.
Er warf mir einen finsteren Blick zu, doch es war klar, dass er nur so tat, als sei er verärgert. Er sah auf seine Uhr und holte tief Luft.
»Also schön. Komm mit. Wir müssen uns beeilen«, sagte er, griff nach meiner Hand und lief mit großen Schritten los. Ich stolperte wegen meiner hohen Absätze, doch dann hielt ich mit ihm Schritt, als er mich mit einem breiten Grinsen zurück zum Palast führte. Ich liebte es, wenn Maxons sorglose Seite zum Vorschein kam, viel zu oft war er furchtbar ernst.
Ich schaffte noch den halben Weg durch die Halle, dann musste ich mit Blick auf meine Schuhe kapitulieren. »Maxon, bleib stehen!«, keuchte ich. »Ich kann nicht so schnell!«
»Komm schon, es wird dir gefallen«, sagte er und zog mich am Arm weiter, als ich langsamer wurde. Schließlich passte er sich jedoch meinem Tempo an, obwohl er offensichtlich darauf brannte, schneller zu gehen.
Wir waren zum Nordflügel unterwegs, dorthin, wo der Bericht aus dem Capitol gedreht wurde, bogen jedoch vorher in ein Treppenhaus ab. Immer weiter stiegen wir nach oben, und ich konnte meine Neugier kaum noch bändigen.
»Wo genau gehen wir hin?«
Er drehte sich um und blickte mich an, dann wurde seine Miene plötzlich ernst. »Du musst schwören, niemandem von dieser kleinen Kammer zu erzählen. Nur einige wenige Mitglieder der Königsfamilie und eine Handvoll Wachen wissen überhaupt von ihrer Existenz.«
Ich starb fast vor Aufregung. »Ich schwöre es.«
Wir erreichten die oberste Treppenstufe, und Maxon hielt mir die Tür auf. Wieder nahm er meine Hand und zog mich einen Gang entlang, bis er schließlich vor einer Wand stehen blieb, die fast vollständig von einem prächtigen Gemälde bedeckt war. Maxon vergewisserte sich, dass außer uns niemand hier war, dann fasste er auf die Rückseite des Rahmens. Ich hörte ein schwaches Klicken, und im nächsten Moment schwang das Gemälde auf uns zu.
Unwillkürlich schnappte ich nach Luft. Maxon grinste.
Hinter dem Gemälde befand sich eine in die Wand eingelassene Tür, die nicht ganz bis zum Boden reichte. Sie besaß ein kleines Tastenfeld, ähnlich wie bei einem Telefon. Maxon tippte ein paar Zahlen ein, und ein leiser Piepton erklang. Dann bewegte er den Türgriff und blickte sich dabei zu mir um.
»Lass mich dir helfen. Es ist eine ziemlich hohe Stufe.« Er reichte mir seine Hand und bedeutete mir, zuerst hineinzugehen.
Was mich hinter der geheimen Tür erwartete, verschlug mir fast den Atem.
Der fensterlose Raum war voller Regale, in denen offenbar sehr alte Bücher standen. Zwei der Regale enthielten Bücher, deren Einband mit einem seltsamen roten Schrägstrich versehen war. An einer Wand lehnte ein riesiger Atlas. Die aufgeschlagene Seite zeigte den Umriss eines Landes, dessen Name ich nicht kannte. In der Mitte der Kammer gab es einen Tisch, auf dem ebenfalls mehrere Bücher lagen, die aussahen, als seien sie erst kürzlich benutzt und für den baldigen Wiedergebrauch herausgelegt worden. Und dann war da noch ein in die Wand eingelassener breiter Bildschirm, der einem Fernseher ähnelte.
»Was haben die roten Striche zu bedeuten?«, fragte ich.
»Das sind verbotene Bücher. Soweit wir wissen, sind es die einzigen Exemplare im gesamten Königreich von Illeá.«
Ich drehte mich zu Maxon um, und mein Blick verriet, was ich nicht laut zu sagen wagte.
»Ja, du kannst sie dir anschauen«, sagte er in einem Ton, der durchblicken ließ, dass ich ihm ganz schöne Umstände machte, jedoch mit einem Gesichtsausdruck, aus dem hervorging, dass er auf diese Bitte gehofft hatte.
Vorsichtig nahm ich eins der Bücher in die Hand, voller Angst, ich könnte aus Versehen einen einzigartigen Schatz zerstören. Ich blätterte ein paar Seiten um, stellte es dann jedoch sofort wieder zurück. Als ich mich umwandte, tippte Maxon auf einem Gerät herum, das wie eine flache Schreibmaschine aussah und offensichtlich zu dem Bildschirm gehörte.
»Was ist das?«, fragte ich.
»Ein Computer. Hast du noch nie einen gesehen?« Ich schüttelte den Kopf und Maxon schien nicht allzu überrascht zu sein. »Es gibt nicht mehr viele Leute, die einen besitzen. Dieser hier enthält ein Verzeichnis aller Informationen, die in diesem Raum versammelt sind. Wenn es irgendetwas über dein Halloween gibt, wird das Gerät uns sagen, wo es zu finden ist.«
Ich verstand nicht genau, was er da sagte, aber ich bat ihn nicht, es mir zu erklären. Innerhalb weniger Sekunden ließ seine Suche eine Liste mit drei Treffern auf dem Bildschirm erscheinen.
»Oh, großartig!«, rief er aus. »Warte hier.«
Ich blieb neben dem Tisch stehen, während Maxon die drei Bücher heraussuchte, die uns erklären würden, was Halloween war. Ich hoffte, dass es nicht irgendetwas Blödes war und ich ihn nicht umsonst diesen ganzen Aufwand treiben ließ.
Im ersten Buch wurde Halloween als ein Fest der Kelten beschrieben, das das Ende des Sommers markierte. Weil ich keine weitere Verzögerung verursachen wollte, erwähnte ich gar nicht erst, dass ich keine Ahnung hatte, was ein Kelte war. Ferner stand dort, dass die Kelten glaubten, an Halloween könnten die Seelen der Toten die Welt verlassen oder in diese zurückkehren. Die Menschen trugen Masken, um die bösen Seelen zu vertreiben. Später entwickelte sich Halloween zu einem profanen Feiertag, hauptsächlich für die Kinder. Sie zogen verkleidet durch die Straßen und drohten mit Streichen, wenn sie keine Süßigkeiten bekamen. Der Spruch »Süßes oder Saures« entstand in diesem Zusammenhang.
Das zweite Buch enthielt eine ähnliche Definition, nur dass noch Kürbisse und der christliche Glaube erwähnt wurden.
»Das hier wird das Interessanteste sein«, meinte Maxon und blätterte ein Buch durch, das handgeschrieben und wesentlich dünner als die beiden anderen war.
»Und wieso?«, fragte ich und trat zu ihm, um es mir genauer anzusehen.
»Das hier ist ein Band von Gregory Illeás persönlichen Tagebüchern.«
»Wie bitte?«, rief ich überrascht aus. »Darf ich es anfassen?«
»Lass mich zuerst die Seite finden, nach der wir suchen. Schau mal, es gibt sogar ein Bild!«
Wie eine Erscheinung aus unbekannter Vergangenheit zeigte es Gregory Illeá – hochaufgerichtet, mit strengem Gesichtsausdruck und steifem Anzug. Es war verblüffend, wie sehr mich seine Haltung an die des Königs und Maxons erinnerte. Neben ihm schenkte eine Frau der Kamera ein halbherziges Lächeln. Irgendetwas an ihrem Gesicht verriet, dass sie einst bezaubernd ausgesehen haben musste. Doch der Glanz in ihren Augen war erloschen. Sie wirkte müde.
Drei Personen flankierten das Paar. Die erste war ein Mädchen im Teenageralter, das breit lächelte. Sie trug eine Krone und ein Rüschengewand. Wie seltsam! Sie war als Prinzessin verkleidet. Und dann standen da noch zwei Jungen, der eine nur ein wenig größer als der andere. Die Figuren, die sie mit ihren Kostümen darstellten, kannte ich nicht. Die beiden sahen jedoch aus, als hätten sie jede Menge Unfug im Sinn. Unter dem Bild stand ein kurzer handschriftlich verfasster Text von Gregory Illeá:
Die Kinder haben dieses Jahr an Halloween eine Party gefeiert. Ich vermute, auf diese Weise können sie vergessen, was um sie herum geschieht. Doch mir kommt es geradezu frivol vor. Wir sind eine der wenigen Familien, die überhaupt noch genug Geld haben, um ein Fest zu veranstalten, doch dieser Kinderkram ist reine Verschwendung.
»Glaubst du, das ist der Grund, warum wir Halloween nicht mehr feiern? Weil es Verschwendung ist?«, fragte ich.
»Gut möglich. Das Datum des Eintrags mag ein Anhaltspunkt sein. Gregory Illeá verfasste ihn unmittelbar nachdem die Amerikanischen Staaten von China angefangen hatten zurückzuschlagen, kurz vor dem Vierten Weltkrieg. Zu diesem Zeitpunkt besaßen die meisten Menschen rein gar nichts – stell dir eine ganze Nation voller Siebener und dazu eine Handvoll Zweier vor.«
»Puuh.« Ich versuchte mir unser Land, wie es damals gewesen war, vorzustellen – vom Krieg zerstört, doch dann sammelte es alle Kräfte, um sich neu zu erschaffen.
»Wie viele von diesen Tagebüchern gibt es?«, fragte ich.
Maxon zeigte auf ein Regal mit einer ganzen Reihe von Heften, die dem ähnelten, das wir in Händen hielten. »Ungefähr ein Dutzend.«
Ich konnte es kaum fassen! Die ganze Geschichte unseres Landes war hier in diesem kleinen geheimen Raum versammelt.
»Danke«, sagte ich. »Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass ich jemals so etwas zu Gesicht bekommen würde. Ich kann fast nicht glauben, dass all das existiert.«
Maxon strahlte. »Möchtest du auch den Rest lesen?« Er deutete auf das Tagebuch.
»Ja, gerne!«, platzte ich heraus. Doch dann fielen mir meine Pflichten wieder ein. »Aber ich kann leider nicht allzu lange hierbleiben, ich muss mich weiter mit diesem furchtbaren Bericht herumschlagen. Und du musst zurück zu deiner Arbeit.«
»Stimmt. Nun, was hältst du davon? Du nimmst das Buch mit und leihst es dir für ein paar Tage aus.«
»Ist das denn erlaubt?«, fragte ich ehrfürchtig.
»Nein.« Maxon grinste spitzbübisch.
Ich zögerte, hatte Angst um das, was ich da in Händen hielt. Und wenn ich es nun verlor? Wenn ich es zerstörte? Ganz bestimmt musste er doch die gleichen Gedanken haben. Doch mir würde sich nie wieder eine solche Möglichkeit bieten. »Gut. Nur für einen Tag oder zwei. Dann gebe ich es wieder zurück.«
»Aber versteck es gut.«
Und genau das tat ich dann auch. Denn das hier war mehr als ein Buch – es war ein Beweis für Maxons Vertrauen. Ich verstaute das Tagebuch in meinem Klavierhocker unter einem Stapel Notenblätter. Dort machten meine Zofen nie sauber. Die einzigen Hände, die es berühren würden, waren meine.
4
»Ich bin ein hoffnungsloser Fall!«, klagte Marlee.
»Nein, nein, du machst das gut«, log ich.
Seit über einer Woche gab ich ihr fast täglich Klavierunterricht, doch es waren keinerlei Fortschritte zu erkennen. Dabei übten wir nach wie vor nur Tonleitern! Wieder schlug sie eine falsche Taste an, und ich konnte ein Zusammenzucken nicht unterdrücken.
»Siehst du?«, rief sie aus. »Ich könnte genauso gut mit den Ellenbogen Klavier spielen.«
Ich grinste. »Wäre zumindest einen Versuch wert. Vielleicht spielst du damit präziser.«
Marlee seufzte. »Ich geb’s auf. Es tut mir leid, America, du bist so geduldig gewesen, aber ich hasse es, mich selbst spielen zu hören. Es klingt, als wäre das Klavier krank.«
»Eigentlich eher, als ob es im Sterben liegt.«
Marlee brach in Lachen aus, und ich fiel mit ein. Als sie mich um Klavierunterricht bat, hatte ich keine Ahnung gehabt, welcher Qual ich meine Ohren aussetzen würde.
»Vielleicht kommst du besser mit der Geige klar«, schlug ich vor. »Mit ihr kann man auch wunderschöne Musik machen.«
»Ich glaube nicht. Am Ende mache ich sie noch kaputt.« Marlee stand auf und ging zu dem kleinen Tisch, wo die Unterlagen, die wir eigentlich lesen sollten, zur Seite geschoben waren und meine reizenden Zofen Tee und Kekse für uns bereitgestellt hatten.
»Oh, nun ja, das wäre schon in Ordnung. Die hier stammt ohnehin aus dem Palast. Du könntest sie Celeste an den Kopf werfen, wenn du willst.«
»Führ mich nicht in Versuchung«, sagte Marlee und schenkte uns beiden Tee ein. »Ich werde dich so vermissen, America. Ich weiß nicht, was ich tun werde, wenn wir nicht mehr die Möglichkeit haben, uns jeden Tag zu sehen.«
»Tja, Maxon ist sehr unentschlossen, also musst du dir darüber noch keine Gedanken machen.«
»Ich weiß nicht«, sagte sie und wurde plötzlich ernst. »Er hat es zwar nicht so direkt gesagt, aber ich weiß, dass ich nur hier bin, weil das Volk mich mag. Und jetzt, da die meisten Mädchen aus dem Rennen sind, wird er bald umschwenken und sich eine neue Favoritin aussuchen. Dann wird er mich wegschicken.«
Ich wählte meine Worte sorgfältig, in der Hoffnung, sie würde mir den Grund für die Kluft zwischen sich und Maxon nennen. Außerdem wollte ich vermeiden, dass sie sich mir gegenüber wieder so verschloss. »Geht es dir denn gut damit? Ich meine, damit, dass du wohl nicht Maxons Frau wirst?«
Sie zuckte leicht mit den Schultern. »Er ist einfach nicht der Richtige. Es würde mir nicht sehr viel ausmachen, aus dem Wettbewerb auszuscheiden, aber ich möchte einfach nicht abreisen«, erklärte sie. »Außerdem will ich gar nicht mit einem Mann zusammen sein, der in eine andere Frau verliebt ist.«
Ich richtete mich kerzengerade auf. »In wen ist er denn …?«
Marlees Blick war triumphierend und das Lächeln, das sie hinter ihrer Teetasse verbarg, bedeutete: Erwischt!
Und erwischt hatte sie mich wirklich.
Im Bruchteil einer Sekunde wurde mir klar, dass mich der Gedanke, Maxon könnte in eine andere verliebt sein, dermaßen eifersüchtig machte, dass ich es kaum aushielt. Und im nächsten Moment – als ich begriff, dass Marlee mich gemeint hatte – war ich unendlich beruhigt.
Ich hatte Mauer um Mauer um mich errichtet, Witze auf Maxons Kosten gemacht und die Vorzüge der anderen Mädchen angepriesen – doch mit einem einzigen Satz hatte sie all das entlarvt.
»Warum hast du das ganze Hin und Her nicht schon längst beendet, America?«, fragte sie sanft. »Du weißt doch, dass er dich liebt.«
»Das hat er nie gesagt«, schwor ich, und es war die Wahrheit.
»Natürlich hat er das nicht«, sagte sie, als ob das ganz klar wäre. »Aber er bemüht sich so sehr, dich für sich zu gewinnen, und jedes Mal, wenn er dir nahe kommt, stößt du ihn zurück. Warum tust du das?«
Konnte ich es ihr sagen? Konnte ich ihr anvertrauen, dass, während meine Gefühle für Maxon wuchsen und tiefer wurden, als mir offenbar selbst bewusst war, es noch jemand anderen gab, von dem ich mich nicht lösen konnte?
»Ich bin mir einfach … nicht sicher, glaube ich.« Ich vertraute Marlee. Aber es war besser für uns beide, wenn sie es nicht wusste.
Sie sah aus, als wäre ihr klar, dass noch mehr dahintersteckte, aber sie drang nicht weiter in mich. Diese stille Akzeptanz unserer jeweiligen Geheimnisse war beinahe tröstlich.
»Dann finde einen Weg, dich zu vergewissern. Bald. Nur weil er für mich nicht der Richtige ist, heißt das nicht, dass Maxon kein toller Mann ist. Es würde mir sehr leid tun, wenn du ihn verlierst, nur weil du Angst hast.«
Und wieder lag sie richtig. Ich hatte Angst. Angst, dass Maxons Gefühle nicht so waren, wie es den Anschein hatte. Angst davor, was es bedeuten würde, eine Prinzessin zu sein. Angst, Aspen zu verlieren.
»Um zu etwas Erfreulicherem überzugehen«, sagte Marlee und stellte ihre Teetasse ab, »das gestrige Gespräch über Hochzeiten hat mich auf eine Idee gebracht.«
»Ja?«
»Würdest du gern meine, ähm, Brautjungfer sein, wenn ich eines Tages heirate?«
»Ach, Marlee, natürlich wäre ich das gern! Würdest du das Gleiche auch für mich tun?« Ich streckte die Hände nach ihr aus, und sie ergriff sie erfreut.
»Aber du hast doch Schwestern, wird ihnen das nichts ausmachen?«
»Sie werden es sicher verstehen. Also? Bitte!«
»Natürlich! Um nichts in der Welt würde ich mir deine Hochzeit entgehen lassen.« Ihr Tonfall schien zu besagen, dass meine Hochzeit das Ereignis des Jahrhunderts werden würde.
»Versprich mir, auch dann dabei zu sein, wenn ich irgendeinen namenlosen Achter heirate.«
Marlee bedachte mich mit einem ungläubigen Blick, zutiefst überzeugt, dass so etwas nicht passieren würde. »Selbst wenn dem so sein sollte – ich verspreche es.«
Sie bat mich nicht um einen ähnlichen Schwur, weshalb ich einmal mehr vermutete, dass es in ihrer Heimat einen anderen Vierer gab, an den sie ihr Herz verloren hatte. Doch ich würde nicht in sie dringen. Offensichtlich hatten wir beide unsere Geheimnisse.
An diesem Abend hoffte ich auf ein Treffen mit Maxon. Marlee hatte mich dazu gebracht, viele meiner Handlungen zu überdenken, aber auch meine Gefühle zu prüfen.
Als wir nach dem Abendessen aufstanden, um den Speisesaal zu verlassen, zupfte ich an meinem Ohrläppchen. Das war das geheime Zeichen zwischen Maxon und mir, mit dem wir einander um ein Treffen baten. Und eine solche Einladung schlug fast nie einer von uns beiden aus. Doch an diesem Abend blickte er mich bedauernd an und formte lautlos das Wort Arbeit. Enttäuscht winkte ich ihm ganz leicht zu, bevor wir uns alle zurückzogen.
Aber vielleicht war es am besten so. In Bezug auf Maxon gab es wirklich einige Dinge, über die ich nachdenken musste.
Als ich in den kleinen Gang zu meinem Zimmer einbog, sah ich Aspen, der vor meiner Tür stand und dort Wache hielt. Er blickte mich von oben bis unten an und schien sich sichtlich an dem eng anliegenden grünen Kleid, das meine wenigen Kurven wunderbar betonte, zu weiden. Ohne ein Wort ging ich an ihm vorbei. Doch bevor ich die Türklinke herunterdrücken konnte, strich er plötzlich sacht über meinen bloßen Arm.
Es war nur eine ganz leichte, flüchtige Berührung, doch sogleich spürte ich ein Gefühl von Verlangen, das Aspen immer wieder in mir wachrief. Ein Blick aus seinen grünen Augen, intensiv und voller Sehnsucht, und ich merkte, wie meine Knie zu zittern anfingen.
So schnell es ging, schlüpfte ich in mein Zimmer. Zum Glück blieb mir kaum Zeit, darüber nachzudenken, welche Gefühle Aspen in mir weckte, denn in dem Augenblick, als die Tür hinter mir zufiel, wuselten meine Zofen bereits um mich herum und bereiteten mich für die Nacht vor. Während sie meine Haare bürsteten und drauflos plauderten, versuchte ich für einen Augenblick, alles um mich herum zu vergessen. Doch es gelang mir nicht. Ich musste mich entscheiden. Aspen oder Maxon.
Aber wie sollte ich mich zwischen diesen beiden entscheiden? Wie sollte ich eine Wahl treffen, die auf jeden Fall einen Teil von mir unglücklich machen würde? Am Ende tröstete ich mich mit dem Gedanken, dass mir noch Zeit blieb. Mir blieb immer noch Zeit …
5
»Nun, Lady Celeste, Sie sind der Ansicht, dass die Anzahl der Soldaten nicht ausreicht, und meinen, bei der nächsten Einberufung sollten mehr Männer eingezogen werden?«
Die Frage kam von Gavril Fadaye, dem Moderator der Diskussionsrunde im Bericht aus dem Capitol. Er war der Einzige, der die Königsfamilie interviewen durfte.
Unsere Debatten im Hauptstadtbericht waren ein Test, und das wussten wir. Auch wenn Maxon keine genaue Zeitvorgabe hatte, lechzte das Volk danach, dass die Zahl der Bewerberinnen sich verringerte. Und ich spürte, dem König, der Königin und ihren Beratern ging es genauso. Wenn wir bleiben wollten, mussten wir uns beweisen – wann und wo immer sie es von uns verlangten. Zum Glück hatte ich diesen schrecklichen Bericht über die Soldaten schließlich doch noch durchgearbeitet und erinnerte mich an ein paar der Statistiken. Deshalb rechnete ich mir auch gute Chancen aus, an diesem Abend einen positiven Eindruck zu hinterlassen.
»Genau, Gavril. Der Krieg in New Asia zieht sich schon seit Jahren hin. Wenn wir die Zahl der Soldaten bei der nächsten oder bei den nächsten beiden Einberufungen erhöhen, hätten wir eine ausreichend große Armee, um ihn endlich zu beenden.«
Ich konnte Celeste einfach nicht ausstehen. Sie hatte ein Mädchen aus dem Wettbewerb geworfen, im letzten Monat Kriss’ Geburtstagsparty ruiniert und im wahrsten Sinne des Wortes versucht, mir die Kleider vom Leib zu reißen. Ihr Status als Zwei ließ sie glauben, sie wäre etwas Besseres als der Rest. Um ehrlich zu sein, hatte ich zwar, was die Zahl der Soldaten von Illeá betraf, gar keine Meinung. Doch nun, da ich Celestes Standpunkt kannte, hielt ich unerbittlich dagegen.
»Da bin ich anderer Ansicht«, sagte ich so damenhaft wie möglich. Celeste wandte sich zu mir und die Bewegung ließ ihr dunkles Haar um ihre Schultern fliegen. Mit dem Rücken zur Kamera, fühlte sie sich sicher genug, um mich unverhohlen anzufunkeln.
»Aha, Lady America, Sie glauben, es ist keine gute Idee, die Anzahl der Soldaten zu erhöhen?«, fragte Gavril.
Ich spürte, wie sich meine Wangen röteten. »Zweier können es sich leisten, sich aus der Einberufung freizukaufen, und ich bin sicher, Lady Celeste hat noch nie gesehen, wie es Familien ergeht, die ihren einzigen Sohn verlieren. Noch mehr Männer einzuziehen, würde verheerende Folgen haben, besonders für die niedrigsten Kasten, die auf die Arbeit jedes Einzelnen angewiesen sind, um zu überleben.«
Marlee, die neben mir saß, verpasste mir einen anerkennenden Knuff.
Dann ergriff Celeste wieder das Wort. »Aber was sollen wir dann tun? Du willst doch bestimmt nicht vorschlagen, dass wir uns zurücklehnen und zusehen sollen, wie der Krieg immer weitergeht?«
»Nein, nein. Natürlich möchte ich, dass Illeá den Krieg beendet.« Ich schwieg kurz, um meine Gedanken zu ordnen, und blickte auf der Suche nach Unterstützung zu Maxon hinüber. Neben ihm saß der König, er wirkte ziemlich verärgert.
Ich musste eine andere Richtung einschlagen, deshalb stieß ich das Erstbeste hervor, das mir in den Sinn kam. »Und wenn der Eintritt in die Armee freiwillig wäre?«
»Freiwillig?«, fragte Gavril.
Celeste und Natalie kicherten, was alles nur noch schlimmer machte. Doch bei näherer Betrachtung drängte sich mir die Frage auf, ob das wirklich so eine schlechte Idee war?
»Genau. Natürlich weiß ich, dass bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein müssen, aber können wir von einer Armee, die aus Männern besteht, die Soldaten sein wollen, nicht mehr erwarten als von einer Gruppe Jungen, die nur das tun, was erforderlich ist, um zu überleben? Die nur ein Ziel kennen – nämlich in das Leben zurückzukehren, das sie hinter sich gelassen haben.«
Nachdenkliches Schweigen senkte sich über das Studio. Offenbar hatte ich ins Schwarze getroffen.
»Das ist eine gute Idee«, pflichtete mir Elise bei. »Dann könnten wir alle ein bis zwei Monate neue Soldaten als Verstärkung schicken, sobald sich genügend Freiwillige gemeldet haben. Das würde sich vermutlich auch positiv auf die Männer auswirken, die bereits eine Weile in Diensten stehen.«
»Dem stimme ich zu«, ergänzte Marlee, was für gewöhnlich alles war, was sie von sich gab. Sie fühlte sich in solchen Diskussionsrunden eindeutig unwohl.
»Äh, ich weiß, das klingt vielleicht ein bisschen verrückt, aber vielleicht könnte man auch Frauen in die Armee aufnehmen«, schlug Kriss vor.
Celeste lachte laut auf. »Und welche Frauen sollten das sein? Würdest du in die Schlacht ziehen?« Ihre Stimme triefte nur so vor verletzendem Spott.




![Selection Storys. Herz oder Krone [Band 1] - Kiera Cass - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/09a2067bd4cef710590deb122408622d/w200_u90.jpg)
![Selection Storys. Liebe oder Pflicht [Band 2] - Kiera Cass - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/158fb1392ee6a14e19034afb01d2e59d/w200_u90.jpg)