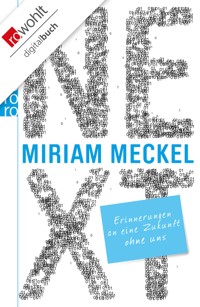13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kein & Aber
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Die Geschichte ist voll von verblüffenden Entdeckungen, nach denen niemand gesucht hat, denen aber später wissenschaftlich oder kulturell große Bedeutung zukam. Ein praktisches Gerät wie der Staubsauger wurde von einem asthmatischen Hausmeister erfunden, um seine Bronchien zu schonen; der Süßstoff ist einem russischen Chemiker zu verdanken, der bei seinen Experimenten vergessen hatte, sich die Hände zu waschen; das Antibiotikum wurde von einem schottischen Bakteriologen entdeckt, der versäumt hatte, sein Labor aufzuräumen, und eine Petrischale mit Bakterien verschimmeln ließ; der erste wissenschaftliche Persönlichkeitstest, den noch heute zahlreiche Unternehmen verwenden, wurde von einer Mutter entwickelt, die dem Freund ihrer Tochter mit großer Skepsis begegnete.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 142
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
INHALT
» Über die Autoren
» Über das Buch
» Buch lesen
» Impressum
» Weitere eBooks von Miriam Meckel
» Weitere eBooks von Daniel Rettig
» Weitere eBooks von Kein & Aber
» www.keinundaber.ch
ÜBER DIE AUTOREN
Miriam Meckel, geboren 1967, ist Herausgeberin der WirtschaftsWoche und Professorin für Kommunikationsmanagement an der Universität St. Gallen. Ihre Bücher Das Glück der Unerreichbarkeit (2007) und Brief an mein Leben (2010) waren Bestseller. Zuletzt erschien Mein Kopf gehört mir. Eine Reise durch die schöne neue Welt des Brainhacking (2018).
Daniel Rettig, geboren 1981 in Köln, leitet bei der WirtschaftsWoche das Ressort Erfolg & Gründer. Er hat mehrere Bücher publiziert. In seinem Blog alltagsforschung.de schreibt er über Psychologie im Berufs- und Privatleben.
ÜBER DAS BUCH
Die Geschichte ist voll von verblüffenden Entdeckungen, nach denen niemand gesucht hat, denen aber später wissenschaftlich oder kulturell große Bedeutung zukam. Ein praktisches Gerät wie der Staubsauger wurde von einem asthmatischen Hausmeister erfunden, um seine Bronchien zu schonen; der Süßstoff ist einem russischen Chemiker zu verdanken, der bei seinen Experimenten vergessen hatte, sich die Hände zu waschen; das Antibiotikum wurde von einem schottischen Bakteriologen entdeckt, der versäumt hatte, sein Labor aufzuräumen, und eine Petrischale mit Bakterien verschimmeln ließ; der erste wissenschaftliche Persönlichkeitstest, den noch heute zahlreiche Unternehmen verwenden, wurde von einer Mutter entwickelt, die dem Freund ihrer Tochter mit großer Skepsis begegnete.
Wie das Neue in die Welt kommt
Vom Zauber des Suchens und der Freude des Findens
Beginnen wir mit einem Gedankenexperiment. Vor dir stehen ein Motorboot, ein Panzer, ein Fahrrad und ein Paar Ski. Welches Gefährt könntest du daraus bauen – und wie würdest du dabei vorgehen?
Auf den ersten Blick haben diese Fortbewegungsmittel wenig bis gar nichts miteinander zu tun. Zumindest solange wir in gewohnten neuronalen Umlaufbahnen denken, führt uns die Suche nach einer Antwort in die gedankliche Sackgasse – es sei denn, wir bedienen uns einer Methode namens first principles thinking.
Das »Denken in ersten Prinzipien« geht zurück auf Aristoteles. Der griechische Philosoph glaubte: Erst wenn man einen Gegenstand oder ein Problem in dessen Kernbestandteile zerlegt (das »Ding an sich«), kann man etwas wirklich verstehen – und daraus Neues schaffen.
Also noch mal: Das Boot besteht aus einem Motor und einem Rumpf. Zum Panzer gehören unter anderem ein Kettenantrieb und Stahlplatten. Und das Fahrrad hat einen Lenker, Räder, eine Gangschaltung und einen Sattel.
Man nehme nun also Lenker und Sattel vom Fahrrad, den Kettenantrieb des Panzers, den Motor des Boots und das Paar Ski. Und fertig ist das Schneemobil.
Die Dinge in ihre Einzelteile zu zerlegen, sie bis auf eine Sammlung letzter, nicht mehr teilbarer Bestandteile zu reduzieren, das bedeutet das »Denken in ersten Prinzipien«. Aus diesen Einzelteilen lässt sich dann Neues schaffen. Das gelingt nämlich erst, wenn man ein »Ding an sich« in seiner Reinheit vor sich sieht, befreit von den Verbindungen und Funktionen, die es in einer bestimmten Konstellation angenommen hat. Der Lenker des Fahrrads ist der Lenker des Fahrrads, solange er zum Fahrrad gehört. Löst man ihn vom Fahrrad und betrachtet ihn an und für sich, wird er zum Ausgangspunkt für etwas ganz Neues, zum Beispiel eine Reise auf einem Schneemobil durch die Arktis.
Diese Herangehensweise, das first principles thinking, haben inzwischen auch Menschen übernommen, die mit Philosophie allenfalls nebenberuflich zu tun haben. Der Unternehmer Elon Musk zum Beispiel. Es heißt, sein Erfolg gehe auf genau dieses Denken zurück. »Ich neige dazu, die Dinge physikalisch zu betrachten«, sagte Musk einmal in einem Interview. Bevor er etwas konstruiert, dekonstruiert er das, was schon da ist.
Beispiel SpaceX: Bei seinen Vorbereitungen für eine Reise zum Mars stieß Musk an die Grenzen exponentiell steigender Kosten.
Oder anders: Wenn es gelänge, die Teile mehrmals zu nutzen und nicht nach dem ersten Start ins Meer zu versenken, würde der Preis für einen Flug rapide sinken. Also kaufte Musk ein, baute selbst, reduzierte die Kosten für Raketenstarts – und revolutionierte den Markt der kommerziellen Raumfahrt.
Solche Beispiele finden sich in allen Branchen und allen Epochen. Als Johannes Gutenberg im Mittelalter die Bibel mehr Menschen zugänglich machen wollte, hätte er versuchen können, Mönche schneller schreiben zu lassen oder weiter in die Welt hinaus zu schicken. Dann hätten wir vielleicht einen Haufen überarbeiteter Mönche auf zerfetzten Sohlen angetroffen, die Aufklärung aber hätte es nie gegeben. Gutenberg dachte von Grund auf anders. Er kombinierte die Techniken der mechanischen Presse für das Weinkeltern oder die Münzprägung mit beweglichen Lettern und erfand so den Buchdruck.
»Denken in ersten Prinzipien« heißt, alles radikal infrage zu stellen. Menschen, die das tun, bekommen entweder einen Tritt in den Hintern oder Nobelpreise. Manche gelten als Genies, andere als Spinner – aber zumindest wird es mit ihnen nie langweilig. Das erste thermodynamische Prinzip der Disruption ist auch eine Alles-oder-nichts-Regel. Entweder du bist der Phoenix. Oder du bist die Asche.
Vor einigen Jahren präsentierte IBM die Ergebnisse einer weltweiten Umfrage. Mehr als 1500 Führungskräfte aus 60 Ländern und 33 Branchen hatten Auskunft darüber gegeben, wie sie die Zukunft sehen. Wenig überraschend: 79 Prozent der Befragten erwarteten, dass das wirtschaftliche Umfeld komplexer wird. Erstaunlicher war dagegen, wie die Manager diesen schwierigen Herausforderungen begegnen wollten. Mit Disziplin? Mit Durchsetzungsvermögen? Nichts dergleichen. Auf Platz eins der wichtigsten Führungsqualitäten der Zukunft landete: Kreativität.
Viele denken bei diesem Wort spontan an Jahrhundertgenies, an Künstler wie Wolfgang Amadeus Mozart und Pablo Picasso oder Wissenschaftler wie Albert Einstein und Isaac Newton. »Kreativität hat für die meisten Menschen eine fast schon magische Anziehungskraft«, sagt Teresa Amabile, Organisationsforscherin an der Harvard Business School.
Auch deshalb, weil die meisten Menschen zu echten Innovationen gar nicht fähig sind. Sie neigen dazu, das Ungewöhnliche aus ihrer menschlichen Erfahrung heraus zu betrachten – womit es das Gewöhnliche bleibt. Es gibt so wenig wirklich Neues, weil die meisten eben nicht out of the box denken, indem sie sich von ihren bisherigen Erfahrungen und Erwartungen frei machen. Wer nicht nach dem Unbekannten sucht, wird nur Bekanntes finden.
Wie aber kommt dann Neues in die Welt, wenn die meisten Menschen nicht dazu in der Lage sind, das Unbekannte zu suchen und zu finden? Wie entstehen die Innovationen, die uns bewegen?
Vielleicht hilft es, zunächst mit einem Mythos aufzuräumen: Es kommt nicht zwingend darauf an, der Erste zu sein. Facebook war nicht das erste soziale Netzwerk der Welt, Google nicht die erste Suchmaschine, eBay nicht das erste Auktionshaus. Als diese Angebote an den Markt gingen, gab es bereits Wettbewerber. Die Deutschen suchten Schulfreunde bei StudiVZ, Informationen bei Altavista und Gebrauchtwaren bei Alando.
Oder noch so ein Mythos: Innovationen sind planbar. Aber wie du in diesem Buch sehen wirst, spielt häufiger serendipity eine Rolle. Das schöne englische Wort beschreibt den glücklichen Zufall, durch den sich entdecken lässt, wonach gar nicht gesucht wurde.
Erfunden hat das Wort der englische Historiker Horace Walpole (1717–1797). In einem Brief an einen Freund berichtete er von dem persischen Märchen über »die drei Prinzen von Serendip«, die den glücklichen Zufall zu nutzen wussten. Sie waren die ersten, die die Signale aus der Zukunft auch im Lärm der Gegenwart entschlüsseln konnten.
Die drei Sagenfiguren hätten, so der Plot des Märchens, auf einer Reise durch Zufall (accident) und Scharfsinn (sagacity) wiederholt Entdeckungen gemacht, die sie gar nicht gesucht hätten. Der Zufall als Geburtshelfer des Fortschritts – was für eine schöne Idee.
Nun heißt das nicht, dass uns die Muse völlig unverhofft küsst. Man muss ihr zumindest die Tür öffnen. Appetit kommt beim Essen, und Ideen kommen beim Arbeiten. Das lehrt uns auch ein ganz großer Erfinder.
Thomas Edison hat nicht nur die Glühlampe erfunden, sondern auch den Generator, die Brennstoffzelle, den Kinematographen, und noch vieles andere. 2332 Patente hat der Mann im Laufe seines Lebens angemeldet. Wie ist das möglich, wenn Erfinderglück oft aus der zufälligen, ungeplanten Begegnung mit dem Neuen entsteht?
Edison hat seiner Muse ziemlich oft die Tür aufgemacht, und außerdem hat er drei Türstopper eingesetzt, damit die Muse nach Belieben in seine Gedankenwelt hinein- und wieder hinausfliegen konnte. Der erste Türstopper heißt Fokus. Edison hatte sich schlicht ganz fest vorgenommen, Neues in die Welt zu bringen. Eine kleinere Erfindung alle zehn Tage, eine größere alle sechs Monate. Ambitioniert, aber offenbar nicht unmöglich, wie die Liste seiner Patente zeigt.
Der zweite Türstopper sorgte dafür, dass immer genug Luft durch seine Gedankenwelt wehen konnte. Für Edison gab es kein Scheitern, es gab nur Lernerfolge. Wann immer ihm etwas misslang, sagte er sich, er habe ja etwas daraus gelernt, und wisse beim nächsten Mal, wie und warum er anders vorgehen musste.
Der dritte Türstopper sorgte dafür, dass der Gedankenverkehr immer auf einer Zweibahnstraße unterwegs ist. Thomas Edison schrieb sein Leben lang eine Art Forschungstagebuch. Darin trug er nicht nur ein, was er tat, sondern vor allem, was er gedacht hatte und wie das vor sich gegangen war. Edison schrieb auf, was sich im Prozess des Denkens tut, um so nachvollziehen zu können, wie er auf welche Ideen gekommen war, wo verschiedene Ideen miteinander gekämpft und wo er etwas aus den Augen verloren hatte, was er besser weiterverfolgt hätte.
Damit hat Edison schon vorweggenommen, was der Verhaltensökonom Daniel Kahneman 2011 in seinem Buch Schnelles Denken, langsames Denken erklärt: Es gibt zwei Arten des Denkens, die ganz unterschiedliche Ergebnisse hervorbringen können. Edison beschreibt in seinem Tagebuch, wie »Mind 1« gegen »Mind 2« antritt. So konnte er ziemlich gut nachvollziehen, wie seine Entscheidungen sich angebahnt hatten und warum sie so und nicht anders ausgefallen waren.
Nicht jeder geht so konsequent und erfindungsreich wie Thomas Edison vor, um der eigenen Kreativität den Weg zu Innovationen zu ebnen.
Bereits im alten Rom nutzten Soldaten Taschen aus Leder, um darin Essen zu transportieren. Gleichzeitig verfügten sie über eine beachtliche Zahl von Fahrzeugen mit Rädern. Trotzdem dauerte es bis ins Jahr 1970, bis jemand beides miteinander kombinierte.
Warum? Weil die Designer und Entwickler zu sehr damit beschäftigt waren, die Taschen zu verbessern. Sie klebten einen Reißverschluss dran und fertigten sie aus verschiedenen Materialien, Leder oder Nylon etwa. Kurzum: Sie konzentrierten sich auf die Form.
Bis ein gewisser Bernard Sadow durch einen Flughafen ging, in der Hand einen Koffer. Und zufällig einen Arbeiter erblickte, der eine schwere Maschine auf einem Rollbrett durch die Gegend schob. Das nahm Sadow zum Anlass, über eine komfortablere Methode nachzudenken, Dinge mit sich herumzuschleppen. Es war die Geburtsstunde des Rollkoffers – und gleichzeitig eine wertvolle Lektion für alle Erfinderinnen und Erfinder und solche, die es werden wollen: Ignoriert die Form – und konzentriert euch auf die Funktion.
Dennoch sollte man nicht davon ausgehen, dass man sich mit seinem Einfallsreichtum unbedingt beliebt machen wird. Kreativität korreliert bedauerlicherweise sehr häufig mit Unbeliebtheit.
Der Psychologe Erik Westby vom Union College in New York befragte im Jahr 1995 Dutzende von Pädagogen nach ihren Erfahrungen mit kreativen Kindern. Zwar behauptete zunächst jeder Lehrer, großen Wert auf einfallsreichen Nachwuchs zu legen. Als Westby die Teilnehmer aber darum bat, ihren Schülerinnen und Schülern verschiedene Charaktereigenschaften zuzuordnen, schnitten ausgerechnet die kreativen am schlechtesten ab: Sie waren bei den Lehrern am unbeliebtesten, weil sie viele Fragen stellten, selten gehorchten und oft in Konflikte gerieten.
Besonders kreative Menschen sind häufig Außenseiter, eben weil sie vermeintlich verrückte Ideen haben, die dem Mainstream nicht passen, und somit immer wieder anecken. Bequem ist anders. Die Macht der Tradition ist stärker als die Lust an der Innovation. Aber wer nicht über den Tellerrand hinausblickt, dem entgeht womöglich seine neue Leibspeise.
Dazu braucht es vor allem einen anderen Blickwinkel, wie der irische Schriftsteller George Bernard Shaw einst bemerkte: »Du siehst Dinge und fragst: Warum? Doch ich träume von Dingen und sage: Warum nicht?«
Das setzt Mut voraus. Den Mut, zu scheitern, anzuecken, immer wieder von vorne zu beginnen, auch bittere Enttäuschungen zu erleben. Aber wenn der eine Moment kommt, in dem sich plötzlich eine neue Welt eröffnet, dann hat sich die Mühe gelohnt. Wegen des Glücksgefühls, das einen überkommt, wenn man in der Welt etwas bewegen kann. Nicht aber des Ruhmes wegen.
Menschen verkennen häufig, dass viele geniale Erfinder völlig unbekannt sind. »Gute Einfälle«, behauptete einst der deutsche Dichter Gotthold Ephraim Lessing, »sind Geschenke des Glücks.« Sie entstehen aus unerwarteten Begegnungen mit anderen Menschen oder mit Dingen, die einem plötzlich eine neue Perspektive eröffnen.
Von solch zufälligen Entdeckungen handelt dieses Buch. Allen gemein ist, dass sie die Welt ein Stück weit verändert haben, dass sie das Leben leichter machen und uns zuversichtlich stimmen. Langfristig setzt sich das Gute, Kluge, Mutige, Neue durch – auch wenn die Erfinderinnen und Erfinder es häufig nicht mehr selbst miterleben konnten. Das Buch ist ein Lob auf den Zufall und die Zuversicht, die in ihm steckt. Und hoffentlich ein Ansporn, sich ihm zu stellen. Zum »Denken in ersten Prinzipien« gehört zuallererst ein offener Geist, der bereit ist, alles auseinanderzunehmen und neu zusammenzusetzen.
1
Das Kleine-Welt-Phänomen
Man kann Facebook durchaus kritisch sehen, aber eines muss man zugeben: Das Netzwerk bringt die Menschen einander näher – und zwar wortwörtlich.
Ein Softwareanalyst untersuchte kürzlich sämtliche Verbindungen aller 1,6 Milliarden Facebook-Mitglieder und stellte dabei fest, dass die durchschnittliche Entfernung zwischen zwei willkürlich ausgewählten Nutzern bei 3,57 Kontakten lag.
Wie klein die Welt wirklich ist, beschäftigt Wissenschaftler schon seit Jahrzehnten – und alles begann mit der Geschichte eines heute fast vergessenen ungarischen Schriftstellers.
Frigyes Karinthy veröffentlichte im Jahr 1929 einen Kurzgeschichtenband. Eine seiner Geschichten handelt davon, dass der Protagonist mit der Literaturnobelpreisträgerin Selma Lagerlöf in Kontakt treten soll.
»Nichts leichter als das. Lagerlöf gewann den Nobelpreis, also hat sie den schwedischen König kennengelernt, denn der überreicht den Preis. Jeder weiß, dass der König gut Tennis spielt. Und er ist bereits gegen den Ungarn Béla von Kehrling angetreten, den ich zufällig kenne.« Voilà, schon war die Verbindung hergestellt.
Dabei handelte es sich natürlich um ein fiktives Gedankenspiel. Doch tatsächlich begründete Karinthy damals ein Konzept, das heute als »Kleine-Welt-Phänomen« bekannt ist. Allerdings dauerte es mehr als drei Jahrzehnte, bis es wieder aufgegriffen wurde.
1967 wollte der Harvard-Professor Stanley Milgram herausfinden, ob es einer zufällig ausgewählten Person gelingen würde, einen Fremden ausschließlich über indirekte Beziehungen zu erreichen. Eine Gruppe von 296 Probanden sollte versuchen, einem Aktienhändler in Boston einen Brief zu schreiben. 196 der Probanden kamen aus zwei verschiedenen Orten im US-Bundesstaat Nebraska, der Rest kam aus Boston. Die Schwierigkeit bestand darin, dass alle den Namen, nicht aber die Adresse des Händlers kannten.
Deshalb sollten sie den Brief einem Bekannten geben, der womöglich näher an der Zielperson dran war. Dieser Bekannte sollte ebenfalls so verfahren. Und siehe da, es stellte sich heraus, dass zwischen dem Absender und dem Empfänger im Schnitt 5,2 Stationen lagen – und nie mehr als sechs.
Einzug in die Popkultur hielt das Konzept der six degrees of separation 1991 mit dem gleichnamigen Stück des US-Autors John Guare. Darin sagt der Hauptdarsteller zu seiner Tochter: »Jeder Mensch ist von jedem anderen Menschen auf der Welt nur durch sechs andere Menschen getrennt. Das sind die six degrees of separation. Zwischen uns und jedem anderen Menschen. Dem amerikanischen Präsidenten; einem Gondoliere in Venedig; einem Eskimo. Was für eine unglaubliche Vorstellung – dass jede Person eine Tür in andere Welten darstellt.«
Offenbar sorgt die digitale Welt nun dafür, dass sich noch mehr Türen in andere Welten öffnen.
2
Süßstoff
Alle Eltern bringen ihren Kindern bei, dass sie sich vor dem Essen die Hände waschen sollen. Doch wie das Beispiel von Constantin Fahlberg zeigt, kann es manchmal von Vorteil sein, Regeln zu brechen.
Der russischstämmige Chemiker mit deutschen Wurzeln arbeitete im Jahr 1878 als Gastforscher an der Johns-Hopkins-Universität im US-Bundesstaat Maryland. Dort beschäftigte er sich vor allem mit der Oxidation von Kohlenwasserstoffen aus Teer – mit eher bescheidenem Erfolg: »Ich hatte eine Reihe wissenschaftlicher Entdeckungen gemacht, die kommerziell komplett nutzlos waren«, sagte er Jahre später dem US-Wissenschaftsmagazin Scientific American. Doch das sollte sich eines Abends ändern.
Fahlberg war mal wieder so vertieft in seine Arbeit, dass er darüber das Essen vergaß. Plötzlich war er so hungrig, dass er zu Tisch hastete, ohne sich vorher die Hände zu waschen. Er setzte sich, nahm ein Stück Brot und biss hinein.
Was war das? Das Brot schmeckte süßer als Kuchen. Er griff nach einem Becher, spülte seinen Mund mit Wasser aus und wollte seinen Schnauzbart mit einer Serviette abtrocknen. Was war das nun wieder? Die Serviette schmeckte sogar noch süßer als das Brot!
Erneut nahm er den Becher und berührte mit den Lippen genau jene Stelle, die zuvor seine Hände berührt hatten. Da verstand er. Er lutschte an seinem Daumen – und der schmeck-te süßer als alles, was Fahlberg jemals gekostet hatte.
Er ließ sein Essen stehen und lief zurück ins Büro. In heller Aufregung probierte er aus sämtlichen Schälchen und Bechern, die auf den Tischen standen. Und tatsächlich, ein Gefäß enthielt die Lösung. An jenem Abend im Labor hatte Constantin Fahlberg Süßstoff entdeckt.
An dieser Lösung tüftelte er nun monatelang, bis er ihre chemische Zusammensetzung ebenso verstanden hatte wie die Reaktion und die beste Methode gefunden hatte, um die Erfindung nicht nur wissenschaftlich, sondern auch kommerziell erfolgreich zu machen. Später ließ er sich das Herstellungsverfahren patentieren und den Namen »Saccharin« schützen. Gemeinsam mit seinem Onkel baute er in Magdeburg die erste Süßstofffabrik der Welt, 1887 kam das Produkt auf den Markt. Und das alles nur, weil er so hungrig gewesen war, dass er den Rat seiner Eltern ignoriert hatte.
3
Die Stadtbibliothek