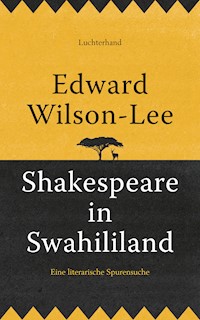
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Luchterhand Literaturverlag
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Shakespeares Botschaft ist universell und trifft die Menschen über Jahrhunderte, Grenzen und Kontinente hinweg ins Herz.
Als viktorianische Forscher sich Mitte des 19. Jahrhunderts im Namen des British Empire in Ostafrika auf Expedition begaben, hatten sie zum Überleben in der Wildnis auch das Werk William Shakespeares im Gepäck. Damit begann der ungewöhnliche Siegeszug des großen Dichters in einer Region, die von seiner eigenen Lebenswelt kaum weiter entfernt sein könnte und in der sein Erbe bis heute präsent ist. Shakespeares Texte gehörten zu den ersten, die von befreiten Sklaven in Swahili gedruckt wurden, indische Bahnarbeiter nutzen die Texte, um für ihre Rechte zu kämpfen. Intellektuelle, Revolutionäre und Staatschefs der ersten unabhängigen afrikanischen Staaten - sie alle machten sich Shakespeare zu eigen.
Der in Kenia aufgewachsene Shakespeare-Experte Edward Wilson-Lee erzählt Geschichten von exzentrischen Forschern und dekadenten Emigranten, von Intrigen des Kalten Krieges und revolutionären Kämpfern. Seine Reise auf den Spuren des Dichters führt ihn durch Kenia und Tansania, Äthiopien und Uganda, Sansibar und den Sudan.
8 Seiten farbiger Bildteil und 15 s/w-Abbildungen im Text.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 442
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Edward Wilson-Lee
Shakespeare in Swahililand
Eine literarische Spurensuche
Aus dem Englischen von Sebastian Vogel
Luchterhand
Die Originalausgabe erschien 2016 unter dem Titel »Shakespeare in Swahililand. Adventures with the Ever-Living Poet« bei William Collins/Harper Collins Publishers, London.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
1. Auflage
Copyright © 2016 Edward Wilson-Lee
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2019 Luchterhand Literaturverlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
Umschlaggestaltung: buxdesign/München
Covermotiv: Ruth Botzenhardt
ISBN 978-3-641-21183-7V001www.luchterhand-literaturverlag.de
www.facebook.com/luchterhandverlag
Für meine Eltern
Inhalt
Vorspiel
Schönheit am falschen Ort
Kapitel 1 Die Regionen der Seen
Shakespeare und die Entdecker
Kapitel 2 Sansibar
Shakespeare und die Sklavendruckerei
Kapitel 3 Zwischenspiel: Die Swahili-Küste
Spielerkönige in Ostafrika
Kapitel 4 Mombasa
Shakespeare, Barde der Eisenbahn
Kapitel 5 Nairobi
Ausländer, Ausgewanderte und Ausgebürgerte
Kapitel 6 Kampala
Shakespeare in der Schule, im Krieg und im Gefängnis
Kapitel 7 Dar es Salaam
Shakespeare an der Macht
Kapitel 8 Addis Abeba
Shakespeare und der Löwe von Juda
Kapitel 9 Panafrika
Shakespeare im Kalten Krieg
Kapitel 10 Juba
Shakespeare, Bürgerkrieg und Wiederaufbau
ANHANG
Eine Bemerkung zu den Quellen und Literaturangaben
Danksagungen
Literatur und Anmerkungen
Bildteil
Abbildungsnachweise
Ortsregister
Namensregister
Vorspiel
Schönheit am falschen Ort
An einem Nachmittag im August, bei einer Besichtigung von Luxor im Süden Ägyptens, sprach mich ein Mann an. Er saß zusammengekauert im Schatten und rief mir eine berühmte Zeile von Shakespeare zu: »Morgen, und morgen, und dann wieder morgen …« Es war der Sommer nach meinem ersten Jahr als Dozent an einer englischen Universität, und auch wenn es unangenehm war, in der flirrenden Hitze zu stehen und iambische Pentameter auszutauschen, war ich mit Sicherheit ein mehr als passender Partner für diesen Fremden mit seinem langen weißen kanzu-Hemd und seiner Papyrusmatte. Ich antwortete mit der nächsten Zeile, dann war er wieder dran; und nach dem Monolog wandten wir uns anderen Versen zu – ich weiß allerdings nicht mehr, welche es waren. Und ich würde meine Fähigkeiten als Rezitator auch gewiss überstrapazieren, wenn ich mich an alle erinnern wollte. Nach ein paar Minuten schwiegen wir. Zumindest mir gingen in der stickigen Wüstenluft vermutlich die Zeilen (und der Atem) aus, und ich hechelte wie eine Eidechse; mein Arabisch beschränkte sich auf die Schimpfworte, die ich in der Schule gelernt hatte, und selbst wenn der Mann der englischen Umgangssprache mächtig gewesen sein sollte, zeigte er doch keine Neigung, sie anzuwenden. Wir grinsten einander an, und dann ging ich weiter, um wieder einmal schwitzend nach einem Glas eisgekühltem Zitronensaft zu suchen.
So seltsam es mir damals auch erschien: Heute bin ich froh, dass ich den Zauber nicht brach, indem ich die Begegnung in die Länge zog. Später dachte ich zwar manchmal daran, was für ein Augenblick es hätte werden können – ein Akt der kulturellen Kameradschaft oder ein trotziges Zurschaustellen der Überlegenheit über einen anmaßenden Touristen –, aber dann kam mir der Gedanke, dass er unter anderem deshalb so anrührend war, weil er vollkommen deplatziert und unerklärlich wirkte. Shakespeare mochte vielleicht von Ferne einmal von Luxor gehört haben – allerdings hätte er es wohl aus dem altgriechischen Roman Aithiopika, der zu seiner Zeit beliebt war,unter dem Namen Theben gekannt. Aber wahrscheinlich hätte er sich niemals vorstellen können, dass Zeilen, die er für Theateraufführungen in Shoreditch oder Southwark geschrieben hatte, irgendwann einmal dort gesprochen würden, in der Nähe der Feluken, die auf dem Nil segelten, und mit hektargroßen pharaonischen Ruinen im Hintergrund. Ergreifend war nach meiner Vermutung, dass ich die eigene Kultur als etwas Exotisches erlebte – so als würde Tarzan im Dschungel den Überrest eines englischen Landhauses finden. Am bemerkenswertesten scheint mir im Rückblick allerdings die Tatsache, dass ich so wenig darauf vorbereitet war. Immerhin war ich in Kenia aufgewachsen und hatte in Afrika an einer Fülle von Orten gelebt, an denen es von Dingen wimmmelte, die von anderswo herrührten. Darunter war natürlich auch Shakespeare gewesen. Heute kommt es mir allerdings so vor, als sei es mir grundsätzlich gelungen, seine Theaterstücke von meinem Wohnort zu trennen. Es war, als wären seine Worte, wo auch immer sie ausgesprochen wurden, fremder Boden, in etwa so wie ein Botschaftsgelände.
Viele Jahre später – mittlerweile war ich sesshaft und verdiente meinen Lebensunterhalt damit, Shakespeares Werke zu lehren – stieß ich auf die unerwartete Tatsache, dass eines der ersten Bücher, die man auf Swahili gedruckt hatte, eines von Shakespeare war. Wohlgemerkt: Es war kein Schauspiel, sondern ein schmaler Band mit Geschichten aus den Tales from Shakespeare von Charles und Mary Lamb, erschienen unter dem Titel Hadithi za Kiingereza (»Erzählungen aus dem Englischen«) in den 1860er Jahren auf der Insel Sansibar. Wieder einmal spürte ich jene seltsame Regung einer Schönheit, die jedoch am falschen Ort in Erscheinung tritt. Ich begann mit einem kleinen Forschungsprojekt, das sich nicht nur mit dem Buch selbst beschäftigte, sondern auch mit seinem Übersetzer (dem Missionar und Bischof von Sansibar, Edward Steere) und dem faszinierenden Umfeld, in dem er seine Bücher druckte: nämlich unter Mithilfe ehemaliger Sklavenjungen vor der Küste Afrikas. Während der darauf folgenden, folgenschweren Reisen durch Kenia, Tansania, Uganda, Äthiopien und den Sudan entdeckte ich eine verborgene Geschichte, die mir sowohl Shakespeare als auch das Land, das ich scheinbar so gut kannte, viel stärker ins Bewusstsein rückten als je zuvor.
Zum Teil war es die Geschichte Afrikas, die wir bereits kennen: Sie handelt von den Entdeckern, die sich durch das Innere des Kontinents schlugen, und von den verschiedenen Exzentrikern, die eine Treibhausversion der englischen Kultur entwickelten und dazu das »gekrönte Eiland« in der afrikanischen Savanne nachbauen wollten. Aber sie erhielt einen frischen Anstrich durch die entwaffnend seltsamen, realen Erlebnisse mit wohlbekannten Gestalten, solchen Gestalten nämlich, deren Geschichten häufig auf karikaturenhaft einfache Fantasien vom »Schwarzen Kontinent« oder ein Tal der Glückseligen reduziert werden. Es war aber auch eine Geschichte Afrikas, die weniger häufig erzählt wird: eine Geschichte indischer Siedlergemeinschaften, für die das Land, in das sie kamen, in jeder Hinsicht ebenso fremd war wie jenes, das die weißen Reisenden tapfer ertrugen – eine Geschichte über afrikanische Intellektuelle und Rebellen, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts in aufstrebenden Ortschaften aufwuchsen; eine Geschichte über das Privatleben der ersten afrikanischen Anführer unabhängiger Staaten und ebenso über die Intrigen des Kalten Krieges, die am Ende des letzten Jahrhunderts die Region prägten. Unheimlich, aber wahr: Alle diese Gestalten gehörten aufgrund ihrer Begeisterung für die britische Kultur zusammen, die wie ein exotischer Sämling mit den aufeinanderfolgenden Wellen der Siedler verpflanzt wurde. Das bedeutete zuallererst, dass sie Shakespeare lasen, aufführten und zu ihrem Idol machten – für sie repräsentierte er den Gipfel jener britischen Kultur. Zwar gab es für Shakespeares kulturelle Dominanz auch Herausforderungen – amüsante Episoden, in denen Tennyson, Burns und Tschechow ihre Häupter über die Brustwehr erhoben. Aber keiner davon konnte ihn auch nur ansatzweise von seinem Platz im ostafrikanischen Leben verdrängen.
Dass die literarische Kultur – von einem einzelnen Autor ganz zu schweigen – in der Politik und Geschichte Europas oder Amerikas zu jener Zeit eine solche Bedeutung hätte gewinnen können, war unvorstellbar. Selbst die außergewöhnliche Geschichte, von der das vorliegende Buch handelt, mag auf den ersten Blick wie eine Reihe von Zufällen erscheinen, aber der Ablauf der Ereignisse entwickelte einen eigenen, unaufhaltsamen Impuls. Als ich die Einzelheiten dieser Lebensgeschichten und Ereignisse aufdeckte, wurde mir zweierlei klar. Ich entdeckte darin eine neue Geschichte über das Land, in dem ich aufgewachsen war, einen Bericht, mit dem ich seine Vergangenheit und seinen Charakter einfangen konnte, ohne mich auf Fragen der Regierungsführung zu konzentrieren, die weit vom Leben der meisten Menschen entfernt ist – und auch, ohne die Wildnis zu beschreiben und die Menschen und ihre Ortschaften beiseitezulassen. Stattdessen konnte ich mir immer wieder die Augenblicke ansehen, in denen die vielen Afrikas, die ich kenne, zusammentrafen: der Busch und die Behausungen der Stammesvölker, ja, aber auch die Kleinstädte und ihre Wohnviertel mit Bantu-Völkern, Indern und Europäern. Die Geschichten, die mir begegneten, als ich Shakespeare durch Ostafrika folgte, waren keine geordneten Berichte über historische Abläufe, sondern ein aufwühlendes Nachvollziehen dieser Abläufe, wie sie sich für die Menschen, die sie durchlebten, angefühlt haben müssen. Diese Geschichten versprachen andererseits auch den Zugang zu etwas Zusätzlichem, das dem heiligen Gral der Shakespeareforschung sehr nahe kommt: einem Verständnis für Shakespeares universellen Reiz.
Dass Shakespeare auf der ganzen Welt verehrt wird, steht nicht in Frage: Immerhin inszenierte das Londoner Globe Theatre im Rahmen der Kulturolympiade von 2012 jedes von Shakespeares siebenunddreißig Theaterstücken in einer anderen Sprache, und die meisten Länder, aus denen die Mitwirkenden stammten, hatten bereits eine lange, reichhaltige Tradition im Lesen und Aufführen der Werke.1 Weniger sicher als früher sind wir heute allerdings, wenn es um die Frage geht, warum das so ist. Im 19. Jahrhundert wäre die Antwort einfach gewesen: Shakespeares Genialität verschaffte ihm Zugang zu einem transzendenten, halbgöttlichen Vorrat an Schönheit, einer Schönheit, die für alle Menschen einen natürlichen Reiz hatte, weil sie über kleinliche Unterscheidungen zwischen dieser oder jener Kultur erhaben war und nicht Gefahr lief, im Laufe der Zeit aus der Mode zu kommen. Im Rückblick aber wird klar, dass es in der Art, wie Shakespeares universeller Reiz durchgesetzt wurde, mehr als nur einen Hauch von Aggression gab. Wie Kant betont, sind wir schließlich gerade in Fragen des Geschmacks, die sich wissenschaftlichen Nachweisen so hartnäckig widersetzen, am stärksten darauf aus, dass andere unserer Meinung sind. Oder, wie W. H. Auden es so scharfsinnig formulierte: »Wer die Musik von Bellini nicht mag oder sein Steak durchgebraten bevorzugt, könnte nach allem, was ich weiß, durchaus bewundernswerte Qualitäten haben, und doch würde ich mir wünschen, ihn niemals wiederzusehen.«2 Im 20. Jahrhundert lieferten sowohl eine westliche Welt, die über die Gräueltaten des Zweiten Weltkrieges und des Kolonialismus reflektiert hatte und dadurch geläutert war, als auch frühere Untertanen in den Kolonien, die jetzt den Mut hatten zu sprechen, viel weniger angenehme Erklärungen für den globalen Aufstieg der europäischen Kultur und ihres Aushängeschildes Shakespeare: War die »Liebe« zu Shakespeare in exotischen Regionen vielleicht nur vorgetäuscht und lediglich das Bestreben, die Gunst der herrschenden britischen Klasse zu gewinnen, deren Mitglieder ihre Shakespeare-verehrenden Oberschulen verließen und dann ein Kolonialreich verwalteten, das große Teile des Erdballs umfasste? Vielleicht war die Liebe zu Shakespeare selbst den Kolonialherren nicht von Natur aus zugeflogen, sondern an Oberschulen eingetrichtert worden, weil diese herrschende Klasse mit ihrer Hilfe ihren Zweck erreichen und die Ansicht durchsetzen konnte, dass der hervorragendste Kopf der Welt einem weißen Briten gehörte? So schwierig es (insbesondere für einen Weißen britischer Abstammung) auch ist, gegen solche Erklärungen zu argumentieren, so sind sie für all jene, die Shakespeare gelesen haben und dabei kaum das Gefühl hatten, man würde sie dazu zwingen oder sie sollten andere dazu zwingen, doch alles andere als befriedigend. Ziemlich herabsetzend sind sie sogar für diejenigen, die nicht weiß, nicht männlich und nicht britisch sind und deren Leidenschaft für Shakespeare Gefahr lief, als bloßes feiges Nachgeben gegenüber den Lehnsherren abgeschrieben zu werden. Als ich Shakespeare lehrte, habe ich die Erfahrung gemacht, dass er nahezu als einziger unter den Autoren über einen solchen Zynismus erhaben ist: Jedes Mal, wenn wieder eine frische Welle von Studierenden die Werke durchkaut, frage ich mich, ob die Verehrung für ihn irgendeine große kollektive Wahnvorstellung sein könnte, also ein Gemeinplatz anstelle einer Wahrheit. Aber jedes Mal lässt die erneuerte Frische einer Wendung, eines kurzen Wortwechsels oder eines fein abgestimmten Monologs die Pfiffigkeit, mit der solche Eindrücke schon als nostalgisch abgeschrieben wurden, geistlos erscheinen. Woran also liegt es, dass die Schriften dieses unbekannten Sohnes eines Handschuhmachers aus einem Dorf in Warwickshire ihre Kraft behalten, wohin sie auch kommen, und selbst wenn sie aus der Sprache, in der er sie schrieb, und aus der Bühne, für die er sie gestaltete, herausgerissen werden? Weisen Shakespeares Theaterstücke den Weg über das Gerangel um Macht und Prestige hinaus in Richtung eines gemeinsamen Menschseins?
Das vorliegende Buch ist die Geschichte eines Versuchs, solche Fragen zu beantworten. Im Rahmen dieses Versuchs ist es auch ein Reisebericht und eine Kulturgeschichte von »Swahililand« – damit meine ich die Länder Kenia, Tansania und Uganda sowie Teile von Kongo, Malawi und Sudan, in denen arabische Kaufleute und europäische Missionare das Swahili einführten, das später zu einer Art pan-ostafrikanischer Sprache wurde.3 Die Handlung muss zwar manchmal Swahililand verlassen, um frühere Geschichten zu ergänzen oder sie außerhalb Afrikas bis zu ihrem Ende zu verfolgen, aber sie bleibt in Ostafrika verwurzelt und ist dem Ziel gewidmet, Ostafrika zu verstehen.
Schon frühzeitig wurde mir auch klar, dass jeder Versuch, mit unpersönlichem, objektivem Blick einen Überblick über die Landschaft zu geben, nicht nur unehrlich, sondern auch zum Scheitern verurteilt wäre. Die Fragen, die ich stellte, waren so grundsätzlicher Natur, und die Geschichte, die ich über eine verpflanzte Kultur erzählte, war meiner eigenen so ähnlich, dass ich nicht so tun konnte, als wären meine Antworten nicht von meiner eigenen Vergangenheit beeinflusst. Als ich mir Gedanken über solche Fragen machte – darunter auch die, warum bestimmte Formulierungen und Geschichten uns bedeutsam und schön erscheinen, und was das damit zu tun hat, woher die Worte kommen und wohin sie am Ende gelangen –, ertappte ich mich dabei, dass sich Erinnerungen aus meiner Kindheit in die Ränder meines Blickfeldes einschlichen. Es erschien mir unaufrichtig, sie einfach auszuschließen und so zu tun, als sei ich durch kalte Logik zu meinen Schlussfolgerungen gelangt und nicht durch die unaufhaltsame Wiederkehr von Augenblicken aus der Vergangenheit. Deshalb gestatte ich solchen Dingen auf den folgenden Seiten hin und wieder, an die Oberfläche aufzusteigen und einen gewissen Eindruck von dem Gewirr der Gefühle zu vermitteln, aus dem meine Urteile hervorgehen: Es ist ein Gefühl der grimmigen Zugehörigkeit zu den Orten meiner Jugend, das aber heute durch ein Bewusstsein für die größere Geschichte, deren Teil ich gewesen bin, erschwert wird – es ist Hingabe und Wiedergutmachung. Und es ist, so vermute ich, nicht anders als bei allen anderen, die eine Liebelei mit ihrer Vergangenheit erleben.
Ihren Höhepunkt, wenn auch noch nicht ganz das Ende, erreicht die Geschichte 1989, als sich die herausragende Bedeutung Shakespeares in großen Teilen Ostafrikas ganz plötzlich in Luft auflöste, womit diese bizarre Abfolge von Ereignissen zu einem noch rätselhafteren Abschluss gelangt. Ich kann mich gut erinnern, wie ich in jenem Jahr in Nairobi auf unserem Küchenfußboden saß und verblüfft über die Freude meiner Mutter war, als der BBC World Service tägliche Lageberichte über den Zusammenbruch der Sowjetunion lieferte. Auch jetzt noch weiß ich nicht genau, ob ich selbst heute in vollem Umfang verstehe, welches Entzücken dieser historische Augenblick bei vielen von denen auslöste, die ihn miterlebten. Es ist sehr schwierig, sich in die Leidenschaften der Vergangenheit hineinzuversetzen, auch wenn wir (wie in diesem Buch) die Gewohnheit, es zu versuchen, nicht von uns weisen können.
Sicher bin ich mir aber, dass ich es damals nicht verstanden habe. Es schien mir einfach nicht zu dem Haus zu passen, das am Rande Nairobis stand und von Waldlandschaften umgeben war, mit seinem provisorischen Cricketfeld zwischen den Wäscheleinen und belagert von Affen, die Obst vom Küchentisch stahlen. Es war eine Welt der großen und kleinen Tiere, die fraßen oder gefressen wurden und sich bemühten, sich von den Fallen aufsässiger Kinder fernzuhalten. Es schien auch nicht in das Leben der Stadt zu passen, in der die Menschen auf dem zerbrochenen Straßenpflaster endlos Schlange standen, um Filme wie Moonwalker und Coming to America zu sehen, die das wichtigste Kino in diesem und im nächsten Jahr ständig und exklusiv spielte. Aber selbst wenn ich verstanden hätte, was der Kalte Krieg war und was sein Ende für diejenigen bedeutete, die ihn miterlebt hatten, wäre es für mich immer noch keine Erklärung dafür gewesen, warum der Präsident Kenias während des verheerenden Entzugs von Dollarmilliarden an Hilfsgeldern – die afrikanische Länder zuvor davon hatten abhalten sollen, abtrünnig zu werden und sich an die Sowjetunion zu binden – einen Teil seines Sommers darauf verwendete, sich für die Größe des Autors Shakespeare einzusetzen. Es hätte die Tatsache, dass ein neues, englischsprachiges Land am Oberlauf des Nil teilweise durch die Liebe eines jungen Kindersoldaten zu Shakespeare auf der Bildfläche erschien, nicht sinnvoller erscheinen lassen, und es hätte auch nicht die vielen Dutzend weiterer literarischer Rätsel gelöst, auf die ich später während meiner Reisen durch Afrika – und durch die Archive – stieß. Dazu musste ich lange vor dem Kalten Krieg anfangen und nicht nur etwas über die große Politik und die vielen Gesellschaften wissen, die Swahililand ausmachen, sondern auch darüber, wie Schönheit in der Welt entsteht. Shakespeares Jeanne d’Arc beschreibt sie so:
Ein Zirkel nur im Wasser ist der Ruhm,
Der niemals aufhört, selbst sich zu erweitern,
Bis die Verbreitung ihn in nichts zerstreut!
HEINRICH VI (I, 2, 133-135)
Dazu betrachtete ich als Erstes die Kontakte zwischen den Briten und Ostafrika einschließlich der seltsamen Geschichte, in der Shakespeare im 19. Jahrhundert zu einem unentbehrlichen Bestandteil von Safariausrüstungen wurde.
Kapitel 1Die Regionen der Seen
Shakespeare und die Entdecker
So ist der Brauch: sie messen dort den Strom
Nach Pyramidenstufen; daran sehn sie,
Nach Höhe, Tief und Mittelstand, ob Teurung,
Ob Fülle folgt. Je höher schwoll der Nil,
Je mehr verspricht er; fällt er dann, so streut
Der Sämann auf den Schlamm und Moor sein Korn
und erntet bald nachher.
ANTONIUS UND KLEOPATRA (II, 7, 17-23)
Zu Shakespeares Lebzeiten begann mit der Jesuitenmission im Fernen Osten und den wachsenden Siedlungen in Amerika die Öffnung der Welt, und doch lebte er in einem Zeitalter, in dem das Mittelmeer seinen Namen als Meer in der Mitte der Welt noch verdiente. Rund um dieses große Binnenmeer gruppierten sich – mit der bemerkenswerten Ausnahme der abgelegenen Insel, die Shakespeare nie verließ – alle Orte, die etwas bedeuteten und zu denen die größten Reisen der Menschen stattgefunden hatten. Nach Ansicht des antiken Geografen Plinius, in der Renaissance immer noch eine angesehene Autorität, waren die Menschen im Süden von der Sonne verbrannt, und die im Norden hatten eine eisige Gesichtsfarbe. Aber das Mischklima der mittleren Länder, so Plinius, bringe sowohl fruchtbare Böden als auch einen fruchtbaren Geist hervor. Nur dort, so behauptete er, hätten die Menschen eine richtige Regierung, während »die Menschen an den Rändern … nie den Menschen in der Mitte gehorcht haben, denn sie sind losgelöst und allein, weil sie die Wildheit der Natur behalten haben, welche sie unterdrückt.«1 Ungefähr die Hälfte von Shakespeares Theaterstücken spielt auf den Inseln seiner Heimat; alle anderen – mit der wichtigen Ausnahme der seltsamen Bestie Hamlet – ordnen sich rund um das Mittelmeer an. Dessen Wasser waren derart mit Geschichte und Mythen geschwängert, dass die zehnjährige Irrfahrt des Odysseus von Kleinasien zu den griechischen Inseln auch dann noch das Musterbild einer Seereise blieb, als Shakespeares Zeitgenossen längst den Erdball auf weitaus heimtückischeren Gewässern umsegelt hatten. Und in dieses zentrale Gewässer mündete der berühmteste und fremdartigste aller Flüsse: der Nil.
Jedes Jahr trat der Nil am Ende des Sommers über die Ufer und überflutete die Ebenen im Norden Ägyptens. Damit war er ein eindringliches Symbol für die unerklärliche, unwiderstehliche Kraft der Natur. »Mein Gram«, sagt Shakespeares Titus Andronicus beim Anblick seiner vergewaltigten, verstümmelten Tochter Lavinia, »stand auf dem Gipfel, eh du kamst/Jetzt, gleich dem Nil, bricht er die Schranken durch« (III, 1, 70-71). Der Zerstörungskraft des Nil kam aber seine nahezu magische Fruchtbarkeit gleich. Wenn die alljährliche Überschwemmung zurückging, hinterließ der Fluss so reichhaltige Wasser- und Schlammmengen, dass die Landwirtschaft inmitten einer Wüstenlandschaft gedeihen konnte. Die Fähigkeit des Nilschlamms, Dinge wachsen zu lassen, stand in so hohem Ansehen, dass Naturforscher vom antiken Griechenland bis zum Europa der Renaissance glaubten, er sei zur Spontanzeugung tierischen Lebens in der Lage, obwohl (wie es sich für einen Fluss geziemte, dessen Quelle tief in einem unbekannten Kontinent lag) das »Feuer, das Nilus’ Schlamm belebt« (Antonius und Kleopatra, I, 3, 67-69) nur ungeheuerliche Schlangen und Krokodile hervorbringen konnte.
Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts hatte sich das mythische Flair aus dem Nil-Delta zu einem großen Teil verflüchtigt. Als der britische Biologe Thomas Huxley wenig später die Vermutung äußerte, dass alles Leben letztlich seinen Anfang im Urschleim habe, glaubten nur noch die Wenigsten, dass Leben regelmäßig neu aus Unbelebtem erwachse. Ägypten war von Napoleon besetzt worden und dann (wie er) in die wachsende britische Einflusssphäre geraten. Seine antiken Artefakte wurden in den Museen Europas sehr schnell zu vertrauten exotischen Gegenständen. (Gegen Ende des Jahrhunderts therapierte Sigmund Freud den europäischen Mittelklassegeist in einem Sprechzimmer, das von Ägyptiana strotzte, darunter war auch die Maske einer Mumie, die er gern streichelte.) Die ägyptischen Überschwemmungsebenen waren an die industrielle Baumwollproduktion übergeben worden, und sowohl in Kairo als auch entlang des Flusses war der aufkommende Tourismus zu beobachten. Ein großer Teil des Kontinents, aus dem der Nil entsprang, war aber nach wie vor vollkommen unerforscht, und die noch nicht entdeckte Quelle des großen Flusses blieb ein faszinierendes Symbol dafür, wie manche Teile der Welt den zunehmend draufgängerischen europäischen Mächten Widerstand leisteten. Sir Roderick Murchison, der Präsident der Royal Geographic Society, vermischte die Sprachen der intellektuellen und der finanziellen Spekulation, als er 1852 in seiner Antrittsrede erklärte, es gebe »in Afrika keine Erkundung, der man einen größeren Wert beimessen würde« als den Nachweis der Nilquelle. Und die Männer, die diese Leistung erbrachten, würden »zu Recht zu den größten Wohltätern in diesem Zeitalter der geografischen Wissenschaft gerechnet werden.«2
Zwar hatte Vasco da Gama schon in den 1490er Jahren den Seeweg nach Indien rund um das Kap der Guten Hoffnung erkundet, Reisen von Europäern ins Innere des Kontinents waren aber bis 1800 noch kaum vorangekommen; die Besiedelung war ausgesprochen dünn und beschränkte sich fast ausschließlich auf die Küsten. Afrika war lange Zeit für weiße Reisende ein äußerst unattraktives Ziel gewesen: Landschaft, Krankheiten und klimatische Extreme bedeuteten sowohl für den unwissenden Europäer als auch für die Packtiere, auf die er vollständig angewiesen war, den Tod. Und selbst wenn sich die Umwelt in Zentralafrika nicht als so widerspenstig erwiesen hätte, bot das Innere des Kontinents für Abenteurer doch kaum einen leicht erkennbaren Lohn: Offensichtlich gab es hier weder die großen Kaufmannsimperien Ostindiens noch die unendlichen Erzlagerstätten und hügeligen Graslandschaften Amerikas. Dass Afrika in der Mitte des 19. Jahrhunderts plötzlich für Europäer und Amerikaner ungeheuer attraktiv wurde, lag an einer Reihe von Faktoren, die eng miteinander zusammenhängen. Die industrielle Revolution hatte sowohl neue Märkte geschaffen als auch diesen einen großen Reichtum entzogen. Menschenfreundliche Industrielle bezahlten zu einem großen Teil die wissenschaftlichen und religiösen Expeditionen, die ihren Weg nach Afrika fanden, und diese sahen in dem Mangel an »Zivilisation« auf dem Kontinent keine Abschreckung, sondern eine Gelegenheit. Afrika lieferte sowohl Seelen für religiöse Unterweisung als auch Herausforderungen, die man durch den unaufhaltsamen Giganten, den das abendländische Wissen darstellte, überwinden konnte. Und wie ohnehin nicht anders zu erwarten, war der Altruismus dieser Philanthropen über alle Fantasie hinaus lukrativ. Obwohl die Unternehmungen von Zeitgenossen als harmlose Torheit eingeschätzt wurden – wobei man häufig kritisierte, dass schlechtem Geld gutes hinterhergeworfen wurde –, lieferten sie Rohstoffe, mit denen neue Vermögen entstanden. Kautschuk, den man von den Bäumen im zentralafrikanischen Wald geerntet hatte, verwandelte sich durch die Erfindung der Vulkanisation in eine unentbehrliche Handelsware; wie sich herausstellte, eignete sich Ostafrika ausgezeichnet für den Anbau von Sisal (für Seilfasern) und Pyrethrum (für industrielle Pestizide). Und während die europäischen Regierungen dem Gedanken an Kolonien in Afrika zu Beginn des Jahrhunderts noch mehr oder weniger gleichgültig oder sogar ablehnend gegenübergestanden hatten, waren sie an seinem Ende überzeugt, dass es von lebenswichtiger strategischer Bedeutung war, sich nicht von anderen zuvorkommen zu lassen. Für Großbritannien bildete der Nil nun das Rückgrat des britischen Afrika, das sich von Ägypten über den Sudan bis nach Ostafrika und Nyasaland sowie von dort über Rhodesien bis zum Kap erstreckte.3
1 Ostafrika mit vielen fantasievollen Details auf Gastaldis Karte von 1564, und Henry Morton Stanley beim Studium einer solchen älteren Karte auf einer kartografischen Expedition.
Die Expedition, der es schließlich gelang, die Nilquelle ausfindig zu machen, brach 1857 an der Küste des heutigen Tansania auf und stand unter der Leitung des Captain Richard Francis Burton. Dieser war noch keine vierzig Jahre alt, aber bereits ein viktorianische Reisender wie aus dem Bilderbuch; insbesondere hatte er mit rasiertem Kopf und in Verkleidung die Pilgerreise nach Mekka – die Hadsch – unternommen, und sein Bericht über diese Leistung hatte ihn sowohl wegen seines Wagemuts als auch wegen seiner phänomenalen sprachlichen Fähigkeiten berühmt gemacht.4 Später leitete Burton weitere Expeditionen durch Afrika und Amerika, daneben fand er aber auch Zeit, die Geschichten aus 1001 Nacht und das Kamasutra zu übersetzen sowie gelehrte Abhandlungen über etruskische Geschichte, mittelalterliche Literatur und Fechten zu schreiben. Doch selbst ein Bibliophiler wie Burton konnte es sich nicht leisten, viel Lektüre mitzunehmen, als er sich ins Innere Afrikas aufmachte. Die Tsetsefliegen töteten regelmäßig Pferde und Transportmaultiere, noch bevor man hundert Meilen ins Landesinnere vorgedrungen war, und auch die Heerscharen der eingeborenen Lastenträger schrumpften im Lauf der Reisen mit entsetzlicher Geschwindigkeit. Einige von ihnen desertierten schon frühzeitig, als die Küste noch in Reichweite war. Dabei ließen sie sich weder durch den Verlust der Bezahlung noch durch die Androhung der Hinrichtung mit Hilfe des Expeditionsleiters abschrecken, der sich (oft hysterisch vor Fieber und Angst) verzweifelt darum bemühte, den Rest seiner Leute zusammenzuhalten. Das übrig gebliebene Kontingent an Einheimischen wurde durch Krankheiten und Hunger weiter verringert, aber auch durch Überfälle der Stämme, deren Land sie durchquerten. Die verfügbaren Transportkapazitäten waren für Munition, Medizin und Handelswaren für die Einheimischen reserviert, insbesondere für amerikanischen Baumwollstoff (merikani genannt) und Kupferdraht, den man unterwegs an Stämme verkaufte, damit sie ihn als Schmuck tragen konnten.
Dennoch fand Burton ein wenig Platz für Bücher:
Die wenigen Bücher – Shakespeare, Euklid –, die meine dürftige Bibliothek bildeten, lasen wir gemeinsam immer und immer wieder …5
Der Shakespeare-Band, den Burton bei sich hatte, ist verloren gegangen. Vermutlich wurde er bei einem Brand in einem Lagerhaus vernichtet, bei dem 1861 Hunderte seiner Besitztümer verbrannten. (Seine Ausgabe der Sonette, die in der Huntington Library in Kalifornien erhalten geblieben ist, enthält amüsanterweise Bleistiftkorrekturen zu Zeilen von Shakespeare, bei denen Burton meinte, er könne es besser.6) Aber die umfangreichen Zitate aus den Werken in dem Expeditionsbericht, den er nach seiner Rückkehr veröffentlichte, lassen darauf schließen, wie genau er sie kannte und wie häufig er sie auf jener Expedition las. The Lake Regions of Central Africa war wie die meisten derartigen Berichte während der Heimreise auf dem Schiff sehr schnell geschrieben worden, damit andere Expeditionsteilnehmer mit ihren Konkurrenzberichten nicht schneller waren. Außerdem hielt sich Burton beim Abfassen des Berichts offenbar eng an sein (ebenfalls verloren gegangenes) Expeditionstagebuch; die Shakespeare-lastige Beschreibung des Landesinneren entnahm er unmittelbar aus dem Tagebuch, in dem er über die Ereignisse und die Lektüre jedes einzelnen Tages reflektierte.[1]
Der Konkurrenzbericht über die Expedition stammte in diesem Fall von John Hanning Speke, dem zweiten mitreisenden Europäer. Gemeinsam mit ihm hatte Burton immer wieder gründlich Shakespeare gelesen, während die beiden die Strauchlandschaften der Savanne durchquerten. Die Seiten ihrer Bücher waren so unverkennbar gezeichnet wie meine, als ich auf den Spuren der Entdecker durch Ostafrika reiste und dabei die Sämtlichen Werke las. Sie trugen Schweißspuren von den Tagen und enthielten geflügelte Insekten, die nachts vom Lampenlicht angezogen und beim Umblättern eingefangen wurden. In manchen Phasen, insbesondere wenn das Fortkommen zu Fuß durch heftigen Regen behindert wurde, weil sich das trockene Land in einen Sumpf verwandelte, dürfte das Lesen eine willkommene Ablenkung von den Frustrationen der erzwungenen Untätigkeit gewesen sein. Für Expeditionsleiter war es wichtig, dicht zusammenzubleiben – schließlich waren sie in den langen Phasen des Malaria-Deliriums vollkommen aufeinander angewiesen. Und dabei war ihre Shakespeare-Lektüre offenbar ein zentraler Bestandteil: Sie lasen (wie Burton berichtet) »zusammen«, und die seltsamen Zeilen, die Burton zitiert, lassen darauf schließen, dass sie die Theaterstücke nebeneinander lasen und nicht einfach nur das Buch hin und her reichten, um berühmte Monologe zu deklamieren.
Aber wie die Erwähnung von Shakespeare neben der geometrischen Abhandlung (den Elementa) von Euklid vermuten lässt, hatte Burton keinen Platz für Bücher, die nur schön, aber nicht nützlich waren; auch Shakespeares Zeilen werden in The Lake Regions wiederholt herangezogen, um englische Entsprechungen zu Formulierungen und Sitten aus der Gegend zu liefern. In einem Fall ist ein Ausspruch auf kinyamwezi (»er sitzt in der Hütte und brütet auf einem Ei«) »deren sprichwörtlicher Ausdruck, um etwas beredter auszudrücken – ›Wer stets zu Haus bleibt, hat nur Witz fürs Haus‹«.7 Die Zeile stammt aus Die beiden Veroneser, einer nicht sonderlich erfolgreichen Komödie über Freundschaft und Betrug, die als eines von Shakespeares frühesten Werken gilt. Angesichts der Tatsache, dass es als untergeordnetes Werk eingeschätzt wird, taucht das Schauspiel überraschend häufig in Burtons Lake Regions auf. Zum Teil lässt sich dies möglicherweise damit erklären, dass es in der ersten Gesamtausgabe von 1623 und danach in nahezu allen Ausgaben bis ins 20. Jahrhundert als zweites Schauspiel nach Der Sturm gedruckt wurde. Man ist versucht zu glauben, dass Die beiden Veroneser ein Nutznießer vieler entschlossener Versuche war, die Gesammelten Werke von vorne bis hinten zu lesen, was dann schon auf den ersten Seiten im Sande verlief.
Shakespeares Geschichte von Valentin, einem Adligen, der von seinem hinterhältigen Freund Proteus betrogen wird, ließ aber offenbar auch eine tiefer liegende Saite anklingen, nachdem die Freundschaft vor allem deshalb ins Wanken geraten war, weil Speke das unfassbare Glück hatte, auf einer eigenen Nebenexpedition die Hauptquelle des Nil zu entdecken, der er den Namen Lake Victoria Nyanza gab. Burton dürfte sich in diesem Augenblick an Valentins grobe Worte über den Betrug des Proteus erinnert haben:
Nie kann ich dir wieder traun,
Und muss um dich die Welt als Fremdling achten.
O schlimme Zeit! o schmerzliches Verwunden!
(V, 4, 70-72)
In der ersten Runde eines Streits, der sich über viele Jahre fortsetzen sollte, unternahm Burton in The Lake Regions den Versuch, Speke zu diskreditieren, indem er engherzig die Ansicht vertrat, dessen Entdeckung sei nicht auf Können, sondern auf Glück zurückzuführen. Darin vergleicht er ihn nicht mit dem betrügerischen Schönwetterfreund Proteus aus Die beiden Veroneser, sondern (noch spitzer) mit einem Dienstmädchen aus dem Schauspiel:
Der glückliche Entdecker hatte eine starke Überzeugung; seine Gründe waren schwach – sie gehörten in die gleiche Kategorie, auf die auch die Magd Lucetta anspielt, als sie ihre Neigung zu Gunsten des »liebenswürdigen Gentleman« Sir Proteus rechtfertigt:
Kein anderer ists als eines Weibes Grund:
Er scheint mir so, nur weil er mir so scheint.8
Burtons kleinliche Empfindungen könnten uns fast davon ablenken, wie außerordentlich seltsam die ganze Situation war: Ein Mann, der durch körperliche Strapazen und Fieber übel zugerichtet ist, umgeben von Gefahren in einem unwirtlichen Land, geplagt von verletztem Stolz und zweifellos mit dem Gefühl, dass er sowohl seinen Freund betrog als auch von ihm betrogen wurde, greift wütend auf Zeilen zurück, die mehrere Jahrhunderte zuvor für die Menschen im elisabethanischen London geschrieben wurden.
Während der Monate, in denen ich mich auf meine erste Recherchereise nach Ostafrika vorbereitete, arbeitete ich Dutzende von Expeditionsberichten durch. Sie stammten von Burton und denen, die nach ihm kamen. Ich ging der Frage nach, welche Bücher sie auf ihren Ausflügen ins Unbekannte mitgenommen hatten. Als ich las, wie stark Burton selbst dann noch an Shakespeare festhielt, als er so allein war, wie ein moderner Kopf es sich kaum vorstellen kann, erwachten meine Erinnerungen daran, wie ich an abgelegenen Orten gelesen hatte. Ich führe die Anfänge meiner eigenen wahren Hingabe an die Literatur auf einen Band mit Gedichten von Auden zurück, die man mir zu lesen gab, als ich in der Wüste Jiddat al-Harasis in Oman war (aber das gehört eigentlich zu einer anderen Geschichte). Die Berichte von Burton und anderen über die Lager im Busch werfen aber auch ein neues Licht auf meine eigene Kindheit, die ich zu einem beträchtlichen Teil auf Safaris in Ostafrika verbrachte. Ich wurde in einer Familie von Naturschützern geboren – meine literarischen Arbeiten sind für sie etwas Ungewöhnliches und auch Verwirrendes –, und deshalb verbrachte ich die Schulferien meist mit meinen Eltern in Regionen, die sie wegen ihrer abgelegenen Lage ausgewählt hatten. Das alles waren natürlich wesentlich ungefährlichere Unternehmungen als die Expeditionen der viktorianischen Zeit: Konvois von Geländewagen, Zeltlager häufig mit Generatoren und Funkgeräten, und meist nicht weiter als einige Stunden von etwas entfernt, das als Straße zu erkennen war. Eines aber hatte sich seit der Zeit der ersten Abenteurer nicht verändert: die seltsame Mischung aus Luxus und Einfachheit, die solche Reisen kennzeichnet. Selbst in den Tagen der Landrover gingen die Lebensmittelvorräte manchmal zur Neige, und eine meiner eindringlichsten Kindheitserinnerungen ist eine Szene, in der Krieger vom Stamm der Samburu im Norden Kenias die Ziege, die mein Vater eingetauscht hatte, in unser Lager brachten: Sie sah uns mit aufgerissenen, starren Augen an, während sie durch ein Rohr in ihrem Hals ausblutete. Nichts wurde verschwendet: Selbst aus dem Hodensack machte man einen Münzbeutel, und das Ziegenfleisch wurde später von einem Koch am Feuer gebraten, während die Erwachsenen bei Sonnenuntergang ihre Cocktails zu sich nahmen.
Diese Mischung aus Primitivität und Dekadenz erschien mir damals keineswegs bemerkenswert – so machte man es einfach. Erst später wurde mir bewusst, dass sich viele Menschen in Europa und Amerika in die Natur flüchten – mit dem Plan, sich der Annehmlichkeiten des Lebens zu berauben. Ein Reisender aus dem frühen 20. Jahrhundert, der selbst ernannte Hinterwäldler Theodore Roosevelt, klagte immer wieder darüber, welche Zügellosigkeit ihm auf seiner zweijährigen Jagdsafari in Kenia begegnet war, die er sich 1909, nach dem Rückzug aus dem US-Präsidentenamt, selbst zum Geschenk gemacht hatte:
In der Kapiti-Ebene erschienen unsere Zelte und unsere Unterbringung ganz allgemein fast zu angenehm für Männer, die das Lagerleben nur aus den Großen Ebenen, den Rocky Mountains und den Wäldern des Nordens kannten. Mein Zelt hatte ein Vordach, das es vor der großen Hitze schützen sollte; hinten gab es einen kleinen Anbau, in dem ich badete – ein heißes Bad, niemals ein kaltes Bad, ist in den Tropen fast eine Notwendigkeit … Dann hatte ich zwei Zeltjungen, die sich um meine Habseligkeiten kümmerten und mir am Tisch wie auch im Zelt aufwarteten … Die Verpflegung war so, wie sie gewöhnlich zu einer Jagd- oder Entdeckungsreise in Afrika gehört, nur dass ich in Erinnerung an meine Tage im Westen in jede Proviantkiste einige Dosen mit Baked Beans aus Boston, Pfirsichen aus Kalifornien und Tomaten gepackt hatte.9
Das komfortable Leben, von dem Roosevelt so enttäuscht war, erschien noch recht zahm im Vergleich zu dem Hedonismus späterer Siedler, die zu ihrer gastronomischen Schwelgerei noch die modischen Sünden von Rauschmitteln und Promiskuität hinzufügten. Aber auch das war sicher nicht völlig neu. Während die Lastenträger ausharrten, wurde Burtons Shakespeare-Lektüre beträchtlich durch die Flasche Portwein belebt, auf deren Genuss er täglich bestand, weil er glaubte, sie werde das Fieber fernhalten. Ein wenig von Burtons Glauben hatte sich auch in meiner Jugend noch in der Gewohnheit der Siedler erhalten, endlos Gin mit Tonic zu trinken, angeblich wegen des Chinins in dem Tonic Water. Aber selbst als die medizinische Rechtfertigung wegfiel, blieb es weiterhin üblich, manche Zutaten des Safarilebens sogar luxuriöser zu gestalten als zu Hause. Das galt selbst für den guten Wein, den man aus Zinnbechern trinken musste.
Die schwelgerischen Gewohnheiten erstreckten sich auch auf die Kunst. Für Burton war es Shakespeare; für Denys Finch-Hatton, den Jäger, dessen Beziehung zu der Baronin Blixen durch deren Memoiren Jenseits von Afrika berühmt wurden, waren es die griechischen Dichter und ein Grammophon, das angeblich die Dienstjungen auf Blixens Farm faszinierte:
Kamantes Vorliebe verharrte seltsamerweise mit unbeirrbarer Hingabe bei Beethovens Adagio aus dem Es-Dur-Klavierkonzert; als er mich das erste Mal darum bat, machte es ihm einige Schwierigkeiten, es mir so zu beschreiben, dass ich begriff, welches Stück er meinte.10
Roosevelt hätte seine Expedition wahrscheinlich für einen Akt der Selbstverleugnung gehalten – viele andere aber hatten Schwierigkeiten, ihm darin zuzustimmen, hatte er doch einige tausend Trophäen von zweihundertneunundsechzig verschiedenen Tierarten mitgenommen, manche davon waren durch den Kuhfänger seines eigenen Privatzuges erlegt worden; weniger strenge Maßstäbe legte er aber an, wenn es um kulturelle Fracht ging. Für seinen zweijährigen Jagdausflug gab er eine fünfundfünfzigbändige »Schweinslederbibliothek« in Auftrag, eine ansehnliche Arche westlicher Kultur, die mit in die Wildnis genommen werden sollte. Dabei mischte Roosevelt aber (in seiner charakteristischen Missachtung dessen, was sich in der feinen Gesellschaft schickte) kühn die unumstrittenen Klassiker des westlichen Kanons mit leichterer Kost von Autoren, die wenig später in Vergessenheit gerieten. Als die Auswahl der Bücher für die Bibliothek, die heute an der Harvard University aufbewahrt werden, nach Roosevelts Rückkehr den Anlass zu einer öffentlichen Diskussion mit dem damaligen Harvard-Präsidenten C. W. Eliot bot, räumte Roosevelt sehr schnell ein, die Auswahl sei zu einem großen Teil nur eine Frage des persönlichen Geschmacks. Dass er drei Bände Shakespeare mitnahm, führte allerdings zu keiner Kontroverse. Nach Roosevelts Vorstellung gab es nur »vier Bücher – die Bibel, Shakespeare, Homer und Dante –, die so wichtig sind, dass unter den kultivierten Männern aller Nationalitäten vermutlich eine allgemein übereinstimmende Meinung herrscht, wonach sie an erste Stelle gestellt werden sollten«.11 Für Roosevelt wie für die Gäste der langjährigen BBC-Radiosendung Desert Island Discs war es selbstverständlich, dass man Shakespeare brauchte, wenn die Verbindungen zur Zivilisation abgebrochen waren.
[1] Die wenigen anderen Autoren, mit denen Burton hier und da seine Beschreibungen Afrikas anreicherte – Marlowe, Byron – vermitteln uns einen Eindruck von dem recht machohaften Beigeschmack seines Shakespeare.
2 Roosevelt während seines afrikanischen Abenteuers auf einem Souvenirdruck.
Obwohl die Bibliothek rund vierundzwanzig Kilo wog und einen eigenen Gepäckträger erforderte, bestand Roosevelt (wie auch Burton) darauf, die Bücher hätten praktischen Nutzen:
Sie waren nicht zur Verzierung da, sondern zur Benutzung. Ich hatte fast immer irgendeinen Band bei mir, entweder in meiner Satteltasche oder in der Patronentasche, in der einer meiner Gewehrträger alle möglichen Kleinigkeiten mit sich führte. Häufig widmete ich mich der Lektüre, wenn ich mich mittags – vielleicht neben dem Kadaver eines Tieres, das ich erlegt hatte – unter einem Baum ausruhte, oder aber wenn ich darauf wartete, dass das Lager aufgeschlagen wurde; in beiden Fällen war es unter Umständen unmöglich, Wasser zum Waschen zu bekommen. Deshalb waren die Bücher fleckig von Blut, Schweiß, Gewehröl, Staub und Asche; eine gewöhnliche Bindung löste sich entweder auf oder wurde ekelhaft, Schweinsleder dagegen sah immer mehr so aus wie eine gut benutzte Satteltasche.12
Roosevelts African Game Trails vermittelt irgendwie den seltsamen Eindruck, solche verfeinerten Produkte der literarischen europäischen Kultur würden zu »Blut, Schweiß, Gewehröl, Staub und Asche« gehören, als lese man sie in dem unwirtlichen Umfeld, um damit zu zeigen, dass die scheinbare Verfeinerung der Werke eine Illusion bedeutet und dass die poetische Seele des Lesers gegen die Verlockungen der Barbarei immun bleibt.
Eines wird sehr schnell klar, wenn man die Berichte der Entdecker, Naturforscher, Jäger und Opportunisten liest, die durch die afrikanische Wildnis reisten: Roosevelt stand in einer Tradition, die zwischen Burton und seiner Zeit Fuß gefasst hatte; ungewöhnlich war an der Handlungsweise des Präsidenten nur, dass er so viele Bücher mitnahm, während die meisten anderen, die ins Innere Afrika reisten, öffentlich versicherten, sie hätten Shakespeare als einzige schöngeistige Lektüre bei sich. Als Walter Montague Kerr 1886 ein Verzeichnis seines eigenen Expeditionsgepäcks erstellte, protestierte er, weil ihn so wenig Gepäck auf dem Landweg von Südafrika bis zu den Seen begleitete. Er stellte fest, sein
Gepäck … hätte einen armseligen Eindruck hinterlassen neben den gewaltigen Vorräten, die manche Expeditionen ins Innere des schwarzen Kontinents mitnahmen – ich besaß auch einige Bücher – eine kleine Shakespeare-Ausgabe, einen nautischen Almanach, Logarithmentafeln und Proctors Sternenatlas.13
Wieder einmal finden wir also einen Shakespeare-Band eingezwängt zwischen Fachbüchern, und nach einiger Zeit wirkt er dort nicht einmal deplatziert. Er wird letztlich zu einem kulturellen Hilfsmittel, das für das Überleben ebenso notwendig ist wie jedes Kartografenhandbuch. Thomas Heazle Parke, ein anderer Reisender im Inneren Afrikas, schrieb von einem Krankenlager unmittelbar westlich von Albert Nyanza (im heutigen Kongo), er fülle »seine Zeit damit aus, Shakespeare und Allingbones Zitate zu lesen. Der Erstere sowie die Bibel und Whittakers große Ausgabe sind die besten Bücher für Afrika, wenn die Transportmöglichkeiten begrenzt sind.«14 Bei Shakespeare, der wie die Bibel in zwei engen Spalten auf dünnem Papier gedruckt war, konnte man jede Menge kraftvoller Sprache auf engem Raum zusammendrängen. Man vergisst aber leicht, dass Shakespeares Werke gerade deshalb leicht transportabel gemacht wurden, weil man sie für unentbehrlich hielt, und nicht andersherum. Roosevelt hielt genau diese Überzeugung fest, als er sagte, seine drei Shakespeare-Bände seien »die literarische Entsprechung zur Ration eines Soldaten – die größte Nahrungsmenge auf dem geringstmöglichen Raum«.15
Eine Art Replik auf diese draufgängerische Welt des Expeditions-Shakespeare lieferte eine der wenigen weiblichen Entdeckerinnen, die ihren Platz in der nahezu ausschließlich männlichen Reihe fand. Gertrude Emily Benham, die zur gleichen Zeit wie Roosevelt in einem privaten Eisenbahnzug durch Ostafrika streifte, als erste Frau den Kilimandscharo bestieg (und später den Kontinent zu Fuß von Osten nach Westen durchquerte), hielt ebenfalls fest, welche »wenigen Bücher« sie auf dieser Expedition und anderen bei sich hatte: »Neben der Bibel und einem Taschen-Shakespeare sind es Lorna Doone und Kiplings Kim«. Aber im Gegensatz zu ihren männlichen Kollegen behauptete Benham, sie habe nie Feuerwaffen auf ihre Expeditionen mitgenommen und auch niemals Wild erschossen; unterwegs tauschte sie ihre eigenen Strickarbeiten gegen lokale Produkte ein und bezeugt, sie habe alle Einheimischen, denen sie begegnete, als angenehm und gastfreundlich erlebt. Ihr Shakespeare, auch das verdient eine Erwähnung, war nicht wie der von Roosevelt in Schweinsleder gebunden; ihr selbst gemachter Stoffeinband, so erklärte sie, reiche aus, um die Bücher während ihrer Reisen auf allen Kontinenten sicher aufzubewahren.16
Die Nuancen der Verbundenheit solcher (männlicher) Reisender mit Shakespeare wird in einer anderen Passage deutlicher. Parke, der von 1886 bis 1889 als Stabsarzt an der berühmten Expedition zur Rettung von Emin Pascha teilnahm, schrieb vor seinem Aufbruch, wie er zu den Werken kam, die er mitnahm:
Einer meiner früheren Patienten schenkte mir ein Shakespeare-Exemplar als Abschiedsgeschenk und Erinnerung für meine Reise. Ich wusste die freundliche Aufmerksamkeit von Herzen zu schätzen, und jetzt, da ich im Begriff stehe, in das unentdeckte Land aufzubrechen, aus dessen Tiefe so wenige weiße Reisende unbeschadet zurückgekehrt sind, vertraue ich darauf, dass die Lektüre der Seiten des unsterblichen Dramatikers mir helfen wird, so manche beschwerliche Stunde durchzustehen.17
Offensichtlich ist Parke zwar bemüht, witzig zu sein, er kann aber nicht verhindern, dass seine Angst vor der Expedition durchschimmert – die ganze Passage ist gespickt mit Sorgen um die Sterblichkeit. Afrika wird hier zur Unterwelt, nach Hamlets Beschreibung »das unentdeckte Land, von des Bezirk/Kein Wandrer wiederkehrt« (III.1), und in einem gewissen Sinn vermitteln die Werke, die von einem »unsterblichen Dramatiker« geschrieben und ihm nach Art eines Talismans als »Erinnerung« mitgegeben wurden, Parke die Hoffnung, aus der Unterwelt wieder aufzutauchen wie der goldene Zweig, mit dessen Hilfe Aeneas seine Frau im Hades besuchen und dann dennoch ins Land der Lebenden zurückkehren konnte. Auf erhabene Weise eingefangen wird seine Furcht von Joseph Conrad in Herz der Finsternis, wo der Wahnsinn des amoklaufenden Kolonialherren Mr Kurtz (zum Teil) auf den Mangel an Büchern zurückgeführt wird:
Wie solltet ihr euch vorstellen können, in welche Gegenden grauer Vorzeit ungehinderte Füße einen Menschen in seiner Einsamkeit tragen können, vollkommener Einsamkeit mit nicht einmal einem Polizisten zum Trost, vollkommenen Schweigens, wo kein freundlich gesonnener Nachbar mahnt, was denn wohl die Leute denken werden. Diese Kleinigkeiten machen einen großen Unterschied. Wenn sie fehlen, dann bleibt einem nur die Stärke, die man in sich hat, die eigene Kraft zur Aufrichtigkeit. Natürlich mag jemand ein so großer Dummkopf sein, dass Fehler unmöglich sind – zu schwerfällig, um zu begreifen, dass die Mächte der Finsternis ihre Klauen nach ihm ausstrecken.18
Kurtz’ berühmte letzte Worte – »Das Grauen! Das Grauen!« – deuten genau auf das hin, was Shakespeare eigentlich hinwegzaubern sollte: auf Chaos, Verderbtheit und einen existenziellen Nihilismus, der unmittelbar vor der Tür des viktorianischen Selbstvertrauens lag.
Parke könnte bei seiner Rückkehr von der Expedition tatsächlich noch stärker an die Shakespeare’sche Magie geglaubt haben als bei seiner Abreise, hatte er eine Expedition doch relativ unbeschadet überlebt und die Welt mit Enthüllungen über eine Barbarei erschreckt, wie sie selbst für Unternehmungen dieser Art ungewöhnlich waren. Die Expedition zur Rettung von Emin Pascha hatte sich mit großem Trara aufgemacht, um einen deutschen Staatsangehörigen namens Eduard Schnitzer zu retten. Dieser war vor seinem Aufenthalt in Afrika nicht besonders aufgefallen, hatte sich dann aber im Sudan als unbedeutender König niedergelassen. Schnitzer, der sich jetzt »Emin Pascha« nannte, wurde schon bald in Kriege mit religiösen Fanatikern verwickelt und am Ende von seinen eigenen Untertanen als Geisel genommen. Er ist der erste Emporkömmling und Siedlerkönig in dieser Geschichte, wird aber sicher nicht der letzte sein. Die Expedition stieß jedoch sehr schnell auf Schwierigkeiten und teilte sich in eine Vorhut von Kundschaftern (die von Henry Morton Stanley und Thomas Heazle Parke angeführt wurde) und eine Hauptgruppe, bei der die Mehrzahl der Europäer zusammen mit einer kleinen Gruppe von Gepäckträgern aus Sansibar blieb. Es gelang ihnen zwar, ein provisorisches befestigtes Lager zu bauen, die Hauptgruppe wurde aber ständig mit Giftpfeilen angegriffen, und der Mais, den man anzubauen versuchte, wurde immer wieder von Elefanten zertrampelt, sodass die Expeditionsteilnehmer am Ende nahezu verhungerten und nur durch zweifelhafte Lebensmittel wie Eselszungen und Gras gerettet werden konnten. Die lange Wartezeit in dem befestigten Lager verschaffte der Hauptgruppe aber viel Zeit zum Lesen, und pflichtschuldigst hatte man die Gesammelten Werke mitgebracht, die zu jener Zeit nahezu als Standardwerk erschienen waren.[2] William G. Stairs, einer der Europäer in der Hauptgruppe, machte in einem Tagebucheintrag am Montag, dem 29. Oktober 1888 die trockene Bemerkung: »Wenn wir noch länger hierbleiben, werden wir alle zu großen Autoritäten in Sachen Shakespeare und Tennyson.«19 Die meisten Europäer überlebten zwar und konnten die Geschichte erzählen, bei ihrer Rückkehr nach Europa wurde die Expedition aber zu einem Skandal, denn nun stellte sich heraus, dass einer der Offiziere in der Hauptgruppe einen Mann unter dem Vorwand, er wolle seine Frau vor Vergewaltigung schützen, zu Tode geprügelt hatte – und ein anderer hatte dafür bezahlt, dass er zusehen durfte, wie ein junges Mädchen rituell aufgegessen wurde.
So abscheulich waren zwar nicht alle Entdeckungsexpeditionen, aber die Teilnehmer, die unterwegs Shakespeare lasen, fühlten sich häufig eher zu den düsteren Teilen der Werke hingezogen. Die Shakespeare’sche Magie, die in Parkes Schilderung verborgen liegt, tritt in vielen dieser Geschichten zutage, und deren Zahl wurde – als die Tradition sich festigte – immer größer. Arthur H. Neumann schildert in seinem Werk Elephant Hunting in East Equatorial Africa folgende Episode:
Lesiat [sein Ndorobo-Fährtenleser] hatte mich schon lange bedrängt, ich solle ihm ein Amulett geben, um seine Fähigkeiten bei seiner Tätigkeit [der Elefantenjagd] zu stärken. Meine Versicherungen, ich hätte keine solchen okkulten Kräfte, ließen ihn nur noch aufdringlicher werden. Er betrachtete meine Einwände als Weigerung, ihm zu helfen, und als Beweis meiner Unfreundlichkeit zu ihm. Als ich im Begriff stand abzureisen, wurde er noch drängender und versprach, zum Dank bis zu meiner Rückkehr Elfenbein für mich aufzubewahren, falls ich zustimmte, und nahm wegen meiner vermeintlich unfreundlichen Halsstarrigkeit einen verletzten Gesichtsausdruck an. Squareface griff auch seinerseits ein und erklärte mir, die Swahili würden solchen Bitten immer nachkommen, und das beliebteste Amulett sei ein Koranvers, der auf Arabisch auf einen Papierstreifen geschrieben würde. Da ich nicht gefühllos zu wirken wünschte und erkannte, dass daraus in jedem Fall kein Schaden erwachsen könne, kam mir die Idee, eine oder zwei Zeilen von Shakespeare könnten vermutlich die gleiche Wirkung erzielen. In dem Gedanken, dass der Ndorobo-Jäger seinen Erfolg – wenn er denn welchen hat – vorwiegend dem starken, auf die Waffe gestrichenen Gift verdankt, sofern es ihm nur gelingt, es auf die richtige Weise in den Organismus des Tieres einzuführen, kam mir die Idee, das folgende Zitat könne angemessen sein; entsprechend schrieb ich es auf ein Stück Papier und verzierte es mit einer kleinen Skizze eines Elefanten:
Ein Scharlatan verkaufte mir ein Mittel,
So tödlich, taucht man nur ein Messer drein,
Wo’s Blut zieht, kann kein noch so köstlich Pflaster
von allen Kräutern unterm Mond, mit Kraft
Gesegnet, das Geschöpf vom Tode retten,
Das nur damit geritzt ist; mit dem Gift
Will ich die Spitze meines Degens netzen
So dass es, streif ich ihn nur obenhin,
Den Tod ihm bringt.20
(HAMLET IV,7)
Neumann erwähnt nie, dass er einen Band Shakespeare bei sich hatte; er vermittelt zwar den Eindruck, als könne er aus heiterem Himmel das ideale Hamlet-Zitat auswählen, wahrscheinlicher ist aber, dass er die Gesammelten Werke zum Nachschlagen zur Hand hatte und diese Zeilen – die, was Hamlet betrifft, wenig denkwürdig sind – nicht auswendig kannte. Wie Parke bemüht sich auch Neumann, auf eine witzige Weise fremdenfeindlich zu sein: Die Vermutung, dass »ein oder zwei Zeilen von Shakespeare wahrscheinlich die gleiche Wirkung erzielen«, soll die Vorstellung von den Zauberkräften des Korans untergraben und zeigen, dass Shakespeares Theaterpoesie ebenso viel Macht hat wie die angeblich heiligen Worte. Aber genau wie bei Parkes Geschichte, kann man sich auch hier kaum des Gefühls erwehren, dass der Glaube an die Shakespeare’sche Magie nicht ausschließlich ironisch gemeint war. Nur ein sehr stumpfsinniger Leser wird sich am Ende dieser Passage nicht fragen, ob der Zauber auch tatsächlich wirkte, und aufschlussreicherweise ist es frustrierend, dass wir nie erfahren, wie Lesiats nächste Jagd ausging.
Die großartigsten Shakespeare-Expeditionsgeschichten von allen stammen jedoch von Henry Morton Stanley, also dem Mann, der die Rettungsexpedition für Emin Pascha leitete. Zu Stanleys Verteidigung sollte man erwähnen, dass alle Gräueltaten, über die von dieser Expedition berichtet wurde, sich zu einer Zeit ereigneten, als er sich nicht bei der Hauptgruppe befand, sondern eine Kundschaftermission leitete. Dennoch gelang es auch Stanley nicht, während seiner langen, ungewöhnlichen Laufbahn eine vollkommen weiße Weste zu behalten. Der Mann, der zu »Afrikas berühmtestem Entdecker« werden sollte, wurde außerehelich als schlichter John Rowlands geboren und verbrachte seine Jugend zum größten Teil in einem walisischen Arbeitshaus; den Namen »Henry Morton Stanley« erfand er als junger Mann in den Vereinigten Staaten, wo er in New Orleans lebte und im amerikanischen Bürgerkrieg kämpfte – auf beiden Seiten.21 Seine neue Identität stand im Zusammenhang mit einer fantastisch reichen, liebevollen Familie, und Stanley gab sie auch dann nicht auf, als die Wahrheit in der Gerüchteküche der viktorianischen Zeit längst zu Allgemeinwissen geworden war. Zu einer Berühmtheit wurde er durch seine Expedition von 1871/72; dort entdeckte er den gefeierten Missionar David Livingstone am Ufer des Tanganyikasees, nachdem der Kontakt zu ihm seit mehr als einem Jahr verloren gegangen war; allerdings gibt es Zweifel, ob seine berühmt gewordene lässige Begrüßung (»Dr. Livingstone, I presume?«) tatsächlich so ausgesprochen und nicht erst später hinzugedichtet wurde, um der Geschichte zusätzlichen Charme zu verleihen. Aber Stanley musste feststellen, dass seine Berühmtheit ein zweischneidiges Schwert war. Die Mitglieder der Royal Geographic Society verziehen ihm nie, dass er so vulgär gewesen war, Livingstones Rettung mit Geldmitteln einer Zeitung zu unternehmen und (was vermutlich noch ärgerlicher war) dass er die Royal Geographical Society mit ihren eigenen Waffen geschlagen hatte. Stanley entging zwar zum größten Teil den öffentlichen Schmähungen, die anderen Mitgliedern der Emin-Pascha-Rettungsexpedition zuteilwurden, ein für alle Mal ruiniert war sein Ruf aber, als er sich im späteren Leben der Association Internationale Africaine des belgischen Königs Leopold II. anschloss, einer Organisation, die mit ihrer Mischung aus Menschenfreundlichkeit und Ausbeutung typisch war, im Ausmaß der begangenen Gräueltaten aber außergewöhnlich erschien – es waren Gräueltaten, auf die Joseph Conrad zu Hause in Europa mit seinem 1899 erschienenen Roman Herz der Finsternis die Aufmerksamkeit lenkte. Nachdem Stanley im Rahmen der Emin-Pascha-Rettungsexpedition einen Weg von der Westküste Afrikas in den Kongo erkundet hatte, stellte er seine Kenntnisse später Leopold zur Verfügung und setzte damit die abscheuliche Geschichte von Belgisch-Kongo in Gang.
Eine von Stanleys Hauptaufgaben bestand darin, mit den lokalen Stammesfürsten Verträge auf Gegenseitigkeit auszuhandeln, die es Leopolds Association gestatteten, Handelsposten in ihren Gebieten einzurichten (und – vielleicht noch wichtiger – zu verhindern, dass die Franzosen das Gleiche taten). Diese Stationen schufen ein Präjudiz dafür, dass die Regionen zur belgischen »Einflusssphäre« gehörten, eine Art De-facto-Macht, die Belgien und andere Mächte später zu einer de jure gesicherten politischen Kontrolle ausbauten; dabei bedienten sie sich einer fadenscheinigen juristischen Logik und fügten zu den Abkommen, die tatsächlich in Afrika unterzeichnet worden waren, viele gefälschte Verträge hinzu. Stanley war sich nicht zu schade, die literarische Magie zu bemühen, um solche Verträge unterzeichnen zu lassen. So auch bei einer Gelegenheit Ende der 1880er Jahre: Der dortige Häuptling Ngaliema war wütend, dass Stanley Abkommen getroffen hatte, die seine Macht untergruben, und näherte sich dem Lager des Engländers mit dem Ziel, ihn zu vertreiben; aber Stanley, den man vor dem Angriff gewarnt hatte, saß mit einem Gong still in seinem Vorzelt und »las während der ganzen Zeit in aller Ruhe die Gesammelten Werke von Shakespeare«. Der Häuptling war durch Stanleys gelassenes Verhalten entnervt und verlangte, dieser solle auf den Gong schlagen; dabei ließ er sich auch nicht von Stanleys Warnung abschrecken, es sei ein gefährliches Ansinnen. Schließlich gab Stanley nach; beim Klang des Gong sprang eine Vielzahl bewaffneter Männer aus ihren Verstecken, weshalb Ngaliema fortan von Stanleys Zauberkräften überzeugt war.22





























