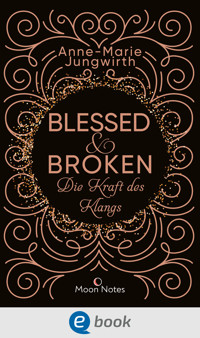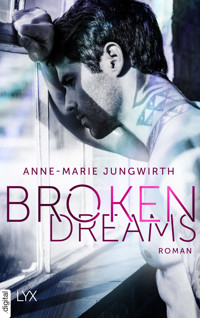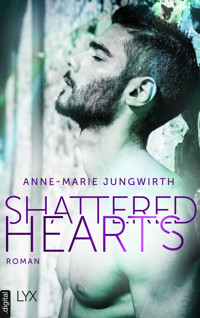
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Only by Chance
- Sprache: Deutsch
Sie stehen auf unterschiedlichen Seiten des Gesetzes und doch ziehen sie sich magisch an!
Die Streetart-Künstlerin Sam träumt davon, die Gesellschaft zu verändern. Als der attraktive Polizist Otis sie bei einer ihrer illegalen Aktionen erwischt, will sie ihn einfach nur hassen. Schließlich sorgt er ihrer Meinung nach lediglich dafür, dass die Rechte der privilegierten Klasse geschützt werden und nicht die von Minderheiten und Frauen. Doch plötzlich taucht Otis überall auf, wo sie ist, und die beiden fühlen sich trotz ihrer unterschiedlichen Definitionen von Recht und Unrecht unwiderstehlich zueinander hingezogen. Alles könnte so schön sein. Doch Sam kann das Sprayen nicht lassen und Otis nicht wegsehen ...
"Eine emotionale Achterbahn mit sympathischen Charakteren!" LOVELYBOOKS über BROKEN DREAMS
Band 2 der ONLY-BY-CHANCE-Serie von Anna-Marie Jungwirth
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 398
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhalt
Titel
Zu diesem Buch
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Epilog
Leseprobe
Die Autorin
Die Romane von Anne-Marie Jungwirth bei LYX
Impressum
Anne-Marie Jungwirth
Shattered Hearts
Roman
Zu diesem Buch
Die Streetart-Künstlerin Sam träumt davon, die Gesellschaft zu verändern. Als der attraktive Cop Otis sie bei einer ihrer illegalen Aktionen erwischt, will sie ihn einfach nur hassen. Schließlich sorgt er ihrer Meinung nach lediglich dafür, dass die Rechte der privilegierten Klasse geschützt werden und nicht die von Minderheiten und Frauen. Doch plötzlich taucht Otis überall auf, wo sie ist, und die beiden fühlen sich trotz ihrer unterschiedlichen Definitionen von Recht und Unrecht unwiderstehlich zueinander hingezogen. Alles könnte so schön sein. Doch Sam kann das Sprayen nicht lassen und Otis nicht wegsehen …
1
Sam
Schamhaare.
Ich musste immer noch über die Zeichnung vor mir lachen. Schon seit Monaten wollte ich ein Graffiti zum Thema Körperbehaarung sprayen, aber keines der Motive, die ich entworfen hatte, hatte sich richtig angefühlt. Bis jetzt. Mir ging diese von der Pornoindustrie verbreitete Ästhetik ungemein auf den Zeiger. Permanent so auszusehen, war nicht nur unrealistisch, es war anstrengend. Wer sich diesem Diktat beugen wollte – schön. Aber Frauen, die das nicht wollten, sollten sich bitte nicht dafür schämen müssen, wenn sie ein paar Körperhaare mehr hatten.
Innerlich kochte ich schon wieder. Es war wirklich an der Zeit, diese Energie in ein Kunstwerk fließen zu lassen, mit dem ich nicht nur mich selbst ein Stück von dieser komplett absurden Forderung befreite, sondern hoffentlich auch andere Frauen. Sie sollten es sehen und anfangen, darüber nachzudenken, was eigentlich normal war und was nicht. Viel wichtiger noch: Sie sollten die Entscheidung treffen, wie sie für sich aussehen wollten.
Ich schnappte mir meinen Rucksack und befüllte ihn mit je einer weißen, schwarzen, pinken und apricotfarbenen Spraydose. Die breiten Caps waren bereits auf den Dosen drauf – mit denen sprayte ich am liebsten, zumindest, wenn es illegal war und schnell gehen musste … Ich stopfte noch einen Mundschutz in den Rucksack, verschloss ihn mit zwei Sicherheitsnadeln, setzte ihn auf und ging zu dem einzigen nicht mit Brettern zugenagelten Fenster. Ein Holzbalken hielt die Scheibe provisorisch von innen verschlossen. Die Uhrzeit war perfekt. Draußen brach gerade erst die Morgendämmerung an und der Großteil Brooklyns schlief noch selig in den Betten. Oder auf Sofas. Mein Blick glitt zu der alten petrolblauen Couch in der Ecke, auf der ich schlief. Nicht die bequemste, aber sie tat ihren Dienst. Nachdem ich den Holzbalken entfernt hatte, stieg ich vorsichtig aus dem Fenster auf die Feuerleiter und nahm das Brett, das draußen an der Wand lehnte. Routiniert klemmte ich es zwischen die beiden auf die Fassade genagelten Bretter links und rechts von meiner Ausstiegslücke. Im Gegensatz zu dem Balken innen war das kein wirklicher Schutz. Wer hier hereinwollte, kam herein. Aber wer es nicht wusste, würde es von der Straße aus nicht erkennen, und viel zu holen war bei mir nun wirklich nicht.
Leise stieg ich die Feuerleiter nach unten in den Hinterhof. Kaum hatten meine Füße den Boden berührt, ertönte ein kräftiges Miauen hinter mir und der weiche pelzige Körper schmiegte sich um meine Beine.
»Crawford!« Ich ging in die Knie und streichelte meinem kleinen streunenden Freund den Kopf. Crawford war schwarz, weiß und braun gemustert – eine Glückskatze. Wobei das Glück, das er mir brachte, sich noch irgendwo verstecken musste.
Genussvoll drückte er seinen Kopf in meine Hand. Um seine Schnauze herum hatte er weißes Fell, das auf der rechten Seite von einer Art Schönheitsfleck gekrönt wurde. Genau dieser schwarze Punkt hatte mich zu seinem Namen inspiriert. Eigentlich hatte ich ihn erst »Cindy« getauft, war aber auf »Crawford« übergeschwenkt, als ich feststellte, dass er ein Kater war.
»Ich werde sehen, ob ich heute etwas Futter für dich auftreiben kann.« Meine Hände glitten durch das weiche, etwas zerzauste Fell des Katers. »Ich muss jetzt los.«
Crawford erhob sich und miaute einen leisen Protest.
»Bis später«, verabschiedete ich mich und trat aus dem Hinterhof auf die Hauptstraße. Ich liebte Brooklyn, vor allem Williamsburg, auch wenn der Stadtteil für meinen Geschmack etwas zu hip und damit teuer geworden war. Vielleicht fühlte ich mich hier auch so heimisch, weil es die Wiege der Graffiti-Art in New York war.
Zu Fuß machte ich mich auf den Weg in die Bedford Avenue. Ich hatte lange überlegt, wo ich das heutige Werk sprayen sollte. Diese Straße war eine gut frequentierte Location und damit perfekt.
Eine halbe Stunde später erreichte ich die Ecke mit den angesagten Restaurants. Die große Hausfront vor mir war die ideale Leinwand für dieses Bild, meine Finger kribbelten bereits vor Vorfreude. Ich stellte den Rucksack ab, öffnete ihn und zog mir die Atemmaske über. Zwar mochte ich den Geruch von Farbe, aber ich mochte auch meine Gesundheit. Es waren bereits einige Leute auf der Straße, was für mich kein Hindernis darstellte. Jeder, der illegal sprayte, hatte seine Strategie. Meine war es, nicht in der Nacht oder vermummt zu sprayen, sondern ganz offen in den frühen Morgenstunden. Der Trick war, so zu tun, als würde ich ein Auftragswerk sprühen. Außerdem ist das hier New York und nicht Connecticut. Hier kümmert niemanden, was der andere tut.
Zuerst nahm ich die Dose mit dem Apricotton und stieg auf den Briefkasten, der vor der Wand stand. Mit geschlossenen Augen rief ich mir die Konturen des Werks ins Gedächtnis, schüttelte die Dose und begann zu sprühen. Wieder und wieder hatte ich das Bild zu Hause gemalt, bis mir jeder Strich und jeder Punkt in Fleisch und Blut übergegangen waren. Genau so muss es sein. Ohne nachzudenken gab ich Druck auf die Dose und erzeugte Formen auf der Wand, die mehr und mehr zu der Gestalt aus meinen Entwürfen wurden: eine komplett überzeichnete Frau im Pin-up-Stil, bekleidet mit einem weißen Trägershirt und Slip. Ich hüpfte vom Briefkasten herunter und widmete mich den nackten Beinen und Füßen. Mit der schwarzen Farbe malte ich anschließend die Konturen nach und schließlich das Sahnehäubchen meines Werks: die sich üppig aus dem Slip kräuselnden Schamhaare. Damit war ich nicht zu geizig, arbeitete mit Licht und Schatten und ließ sie zum Mittelpunkt des Bildes werden. Menschen gingen währenddessen an mir vorbei. Ein Teil von mir war immer in Alarmbereitschaft, darauf trainiert, sofort zu flüchten. Doch die meiste Zeit versank ich in der Kunst und ignorierte die Menschen, so wie sie mich ignorierten. Zumindest die meisten.
»Was tun Sie denn da?«, fragte mich plötzlich eine Passantin.
»Das, wozu ich beauftragt wurde«, antwortete ich wie selbstverständlich und hoffte, dass ihr das Gebäude nicht gehörte. Sie war jedenfalls keine New Yorkerin, das sagten mir ihr Kleidungsstil und ihr völlig entrüsteter Blick.
»Jemand gibt Ihnen Geld, um so etwas auf sein Haus zu malen?«
Ich zuckte mit den Schultern und schüttelte die Dose in meiner Hand. »New York.« Das sollte Erklärung genug sein.
Die Frau schenkte mir noch einen ungläubigen Blick und ging dann weiter.
Mit lockerem Schwung verstärkte ich die weiblichen Kurven meines Kunstwerks. Ich selbst besaß zwar eher weniger Rundungen, aber die Frau auf der Fassade sollte in jeder Hinsicht üppig wirken. Ich stieg wieder zurück auf den Briefkasten und machte mich an den Text. Manche waren der Meinung, dass Kunst für sich sprechen sollte und keine erklärenden Texte benötigt. Für mich persönlich waren die Texte jedoch Teil der Message.
Frauen haben Schamhaare sprühte ich mit weißer Farbe auf die Wand und fügte mit Schwarz ein paar Schatten hinzu. Gerade wollte ich den Schriftzug fortführen, als ich im Augenwinkel einen dunkelblauen Schemen ausmachte.
Verdammt! Ein Blick über die Schulter bestätigte meine Befürchtung. Mit einem Satz sprang ich vom Briefkasten, schnappte meinen Rucksack und rannte los.
2
Otis
Ich wollte nur eines – endlich nach Hause in mein Bett. Unser Department war diese Woche unterbesetzt, mein Partner Elijah und ich waren bereits seit zwölf Stunden auf Streife. Insofern war ich gar nicht böse, dass unser letzter Einsatz sich als Fehlalarm herausgestellt hatte.
»Fahr da mal rechts ran«, wies mich Elijah an.
Ich setzte den Blinker und warf ihm einen fragenden Blick zu.
»Izzy und ich haben uns die Woche quasi nicht gesehen. Ich möchte wenigstens noch mit ihr frühstücken, bevor ich ins Bett gehe«, erklärte er, bevor er ausstieg.
Müde sah ich ihm hinterher, als er in Berry’s Bakery verschwand. Ich schloss meine Augen und lehnte mich zurück.
Ein lautes Klopfen riss mich aus meinem Sekundenschlaf. Vor meinem Seitenfenster stand eine nervös wirkende Frau mit Topfhaarschnitt und einem braunen Pullover.
Ich ließ das Fenster herunter und richtete mich auf. »Kann ich Ihnen helfen?«
»Officer.« Die Frau beugte sich zu mir herunter. »Dort vorne, die Frau, das ist eine Vandalin!«, erklärte sie mir entrüstet.
»Eine Vandalin?«, wiederholte ich, während ich ausstieg und in die Richtung sah, in die sie deutete. Dort stand jemand auf einem Briefkasten und sprayte an die Wand.
»Sehen Sie sie?«
»Ja, ich kümmere mich drum.« Ich nickte ihr zu, entfernte mich vom Wagen und ging die Straße hinunter. So leise wie möglich näherte ich mich der Gestalt im Kapuzenpullover. Die Frau hatte recht gehabt, es handelte sich um eine weibliche Sprayerin. Äußerst ungewöhnlich. Ich sah auf die Wand, die sie gerade verschandelte, und blickte auf dicke schwarze … Schamhaare? Das konnte unmöglich ein legales Graffiti sein. Kein Mensch bei klarem Verstand würde mit etwas derart Geschmacklosem sein Eigentum entstellen.
Sie entdeckte mich, als ich nur noch ein paar Schritte von ihr entfernt war. Wie eine Katze sprang sie vom Briefkasten und rannte los.
Verdammt! »NYPD«, rief ich und nahm die Verfolgung auf. »Stehen bleiben!«
Doch die Vandalin dachte gar nicht daran. Mit kraftvollen Schritten bog sie in die 7. Straße ab. Sie war schnell, wirklich schnell. Ich beschleunigte meine Schritte und rannte nun mit vollem Einsatz. Der Abstand zu ihr schmolz, und als sie in eine Seitengasse abbog, wusste ich, dass dies das Ende der Verfolgungsjagd war.
Schnaufend stand sie am Ende der Sackgasse vor einer Hauswand.
»NYPD«, wiederholte ich. »Lassen Sie den Rucksack fallen und Hände über den Kopf.«
Zögerlich ließ sie die Tasche fallen und hob ihre Hände.
Ich näherte mich so weit, dass ich den Rucksack mit dem Fuß zur Seite schieben konnte. Ihre kinnlangen blonden Haare waren verwuschelt, um ihren Hals hing eine Atemschutzmaske, als wäre sie Schmuck.
»Ich werde Sie jetzt nach Waffen absuchen.« Die Worte hörten sich absurd an, als sie meinen Mund verließen, denn sie sah alles andere als gefährlich aus. Aber Achtlosigkeit in solchen Dingen hatte schon so manchen meiner Kollegen ins Krankenhaus gebracht.
»Echt jetzt?«, spottete sie, und ihre dunklen Augen funkelten mich an.
Für einen Moment verfing ich mich in ihrem Blick. »Ja, echt jetzt. Drehen Sie sich um, Hände an die Wand!«
Mit den Augen rollend folgte sie meinem Befehl.
»Beine etwas breiter«, wies ich sie an.
Über die Schulter hinweg sah sie mich an. »Macht Sie das an?«, fragte sie, während sie mit einem kleinen Hüftkreisen einen Schritt zur Seite tat.
Für meine Antwort brauchte ich lange. Viel zu lange. Diese Frau war pures Feuer und ich dabei, mich an ihr zu verbrennen. »Nicht halb so viel, wie Sie denken.«
Ein verächtlicher Pfiff verließ ihren Mund. »Klar.«
Hinter ihr ging ich in die Knie. Ich umfasste ihre schlanken Fesseln auf der Suche nach Waffen. Ihre Jeans lag so eng an ihrem Körper an, dass man darunter nur schwer etwas verstecken konnte. Trotzdem klopfte ich ihre Beine mit leichtem Druck von unten nach oben ab. Langsam erhob ich mich und versuchte, in ihrer hinteren Hosentasche nach einer potenziellen Gefahr zu suchen. Für gewöhnlich tat ich so etwas, ohne nachzudenken, es gehörte schließlich zu meinem Job. Doch diese Frau war alles andere als gewöhnlich …
Ich konnte ihren Atem hören, der vom Rennen noch immer schnell ging, als ich um ihren Körper herumgriff, um ihre Vordertaschen und den Bund ihrer Hose zu inspizieren. Dabei wandte sie ihren Kopf zur Seite, und ihr Blick durchbohrte mich. Vermutlich war das kein nett gemeinter Blick. Immerhin war ich gerade dabei, sie zu verhaften. Doch mir gefiel ihre Wildheit. Und ja … Ich konnte es nicht leugnen. Mir machte das hier viel mehr Spaß, als es sollte. Meine Hände glitten seitlich ihren Oberkörper entlang, fuhren über ihre schmale Taille, die nur von einem dünnen Tanktop bedeckt wurde, aus dem die Träger ihres BHs hervorblitzten.
»Alles in Ordnung«, schloss ich die Durchsuchung ab.
Schneller als erwartet drehte sie sich um und stand unmittelbar vor mir. Eine Strähne klebte an ihrer Stirn. Ich musste dem Impuls, sie mit meinen Fingern wegzustreichen, widerstehen.
»Ach.« Sie verschränkte ihre Arme vor der Brust, und ich trat einen Schritt zurück. Obwohl sie mit ihrer Körperhaltung Ablehnung ausdrückte, suchten ihre Augen immer wieder meinen Blick. Ob sie es zugeben wollte oder nicht – ein ganz klein wenig gefiel ihr das auch.
Ich schaffte es nicht, ein Lächeln zu unterdrücken.
»Was ist denn so lustig?«, quittierte sie es prompt.
»Nichts.« Mit einer Hand griff ich nach dem Rucksack am Boden und sah hinein.
»Was soll das?«, rief sie und wollte ihn mir entreißen.
Ich stoppte ihre Hand und sah ihr fest in die Augen. »Ich rate Ihnen, mich jetzt nicht bei meiner Arbeit zu behindern.« Unter ihrem verächtlichen Blick durchsuchte ich den Rucksack, in dem sich nichts außer Spraydosen befand. »Ich gehe davon aus, dass Sie weder die Eigentümerin des Gebäudes dort sind, noch eine Genehmigung haben, oder?«
Statt einer Antwort wandte sie den Kopf ab, was Antwort genug war.
»Ich muss Sie mit aufs Revier nehmen.« Langsam trat ich hinter sie und fixierte ihre Hände mit Handschellen hinter dem Rücken. »Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was Sie sagen, kann und wird vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Sie haben das Recht auf einen Anwalt. Wenn Sie sich keinen Verteidiger leisten können, wird Ihnen einer gestellt. Haben Sie das verstanden?«
Natürlich antwortete sie wieder nicht.
»Haben Sie das verstanden?«, fragte ich erneut.
»Ja«, zischte sie und drehte ihren Kopf zur Seite. Ihre braunen Augen durchbohrten mich förmlich und ließen mein Herz in einem schnelleren Takt schlagen.
»Gut.« Ich fasste sie am Arm und ging so mit ihr zurück zum Wagen. In den letzten Jahren hatte ich schon einige Sprayer auf frischer Tat ertappt und abgeführt, aber sie fiel irgendwie aus der Reihe. Nicht nur ihre Erscheinung, auch ihr Werk. Die Schamhaare. Als Polizist hat man irgendwann zwangsläufig Menschenkenntnis. Und was ich schon einmal sicher sagen konnte: Diese Frau sprühte nicht zur Selbstdarstellung.
Die Frau, die mich auf die Sprayerin aufmerksam gemacht hatte, war verschwunden, dafür lehnte Elijah mit zwei braunen Tüten bepackt an der Beifahrertür.
»Was …«, setzte er an.
»Eine Sprayerin.«
Mein Partner sah mich an, als wäre ich der Verbrecher. Verdenken konnte ich es ihm nicht. Schließlich hatten wir uns schon auf unseren wohlverdienten Feierabend eingestellt. Aus dem würde aber erst mal nichts werden. Wir mussten zurück ins Revier, die Frau befragen, Beweise sichern und einen Haufen Papierkram erledigen.
»Eine Passantin hat mich auf sie aufmerksam gemacht«, sagte ich entschuldigend. Ich öffnete die hintere Autotür. »Einsteigen«, forderte ich die Frau auf.
»Bitte, danke«, murmelte sie, folgte aber.
Elijah seufzte und warf mir übers Autodach hinweg eine der beiden Lunchtüten zu.
»Was ist das?«
»Dein Frühstück.«
Schmunzelnd stieg ich ein. Mein Partner war ein zwei Meter großer Bär, der fortwährend brummte, aber jeder, der ihn kannte, wusste, dass er eigentlich eher ein Teddybär war. Auch wenn er im Einsatz natürlich ganz anders sein konnte.
»Warum fährst du nicht nach Hause zu Izzy und ich erledige den Rest?«
»Was?« Er schüttelte den Kopf. »Ich lass dich doch nicht im Stich.«
»Ich weiß.« Ich sah auf den Rücksitz. »Aber ich glaube, ich werde auch allein fertig mit ihr.«
»Meinst du?«, neckte er mich.
»Klar. Warte kurz hier. Ich gehe schnell zurück und mache ein Foto von dem Graffiti.«
Er nickte, und ich stieg aus und zog mein Smartphone aus der Hosentasche. Frauen haben Schamhaare. Das war … Es war ohne jeden Zweifel Vandalismus, aber … Kein Aber. Es war Vandalismus.
Als ich zurück am Wagen war, kam Elijah zu mir herum und klopfte mir auf die Schulter. »Danke, Otis.«
»Du würdest das Gleiche für mich tun.«
»Würde ich?« Er formulierte es als Frage, obwohl wir beide wussten, dass es keine war. »Dann noch viel Spaß mit dem Schmierfink.«
Ich stieg ein und drehte mich nach hinten um. »Wie heißen Sie?«
Anstelle einer Antwort rollte der Schmierfink mit den Augen.
»Was?«
»Ich dachte, ich habe das Recht zu schweigen.«
Ich wusste nicht, warum, aber irgendwie brachte sie mich damit zum Lachen, und meine Müdigkeit war verschwunden. »Ich sehe schon, wir zwei werden noch viel Spaß haben.«
3
Sam
»Haben Sie einen Anwalt, den Sie anrufen möchten?«, fragte der Cop, der mich erwischt hatte, nachdem er mich in den kleinen Verhörraum im 90. Revier gebracht und mich mit Handschellen am Stuhl fixiert hatte. Gemessen an meinem Vergehen fand ich das alles reichlich übertrieben.
»Nein, und ich brauche auch keinen Pflichtverteidiger.« Einen Anwalt hätte ich mir nicht leisten können, und auf einen Pflichtverteidiger konnte ich für den Moment gut verzichten. Es war nicht das erste Mal, dass ich erwischt und abgeführt wurde. Für gewöhnlich hatte die Polizei in New York Wichtigeres zu tun, als sich lange mit solchen Fällen zu beschäftigen.
»Gut.« Der Cop zückte einen Stift und sah mich an, seine gletscherblauen Augen waren auf mich gerichtet wie ein Laser. »Auch wenn Sie mir sonst nichts sagen wollen, muss ich jetzt Ihre Personalien aufnehmen. Haben Sie etwas bei sich, mit dem Sie sich ausweisen können?«
Ich lehnte mich auf dem unbequemen Stuhl zurück und hätte gern meine Arme verschränkt. Mit dem Kinn deutete ich auf den Rucksack, der auf dem Tisch stand. »Mein Führerschein ist in meinem Geldbeutel in der Innentasche.«
Mit einem Nicken öffnete der Cop zuerst die Sicherheitsnadeln, dann das Fach, zog die Geldbörse heraus und förderte meinen Führerschein zutage. »Samantha Burke«, murmelte er vor sich hin. »Ich bin Officer Otis Renshaw«, stellte er sich vor, als würde mich interessieren, wie er heißt.
Konzentriert sah er zurück auf meinen Führerschein. »Fünfundzwanzig«, beendete er die total komplizierte Rechenaufgabe. »Genau wie ich«, fügte er etwas leiser hinzu.
Kommentarlos zog ich die Augenbrauen hoch.
»Und wo wohnen Sie, Miss Burke?«
»Mal hier, mal dort.«
Der Cop legte meinen Führerschein vor sich ab und verschränkte seine Arme. »Etwas konkreter wäre gut.«
»Ich habe keine Wohnung.«
»Schockierenderweise gehört mir bei meinem üppigen Polizistengehalt auch keine eigene Wohnung, aber trotzdem wohne ich irgendwo. Aber wenn es Ihnen zu viel ist, darauf zu antworten, wird mir der Computer schon eine Adresse ausspucken.«
Scharf sog ich die Luft ein. »Dort wohne ich aber nicht mehr und ich möchte auch nicht, dass Sie dort irgendwas hinschicken.«
»Ihre Eltern?«
Ich musste lachen, weil der Gedanke, dass meine Eltern nicht wussten, dass ich sprayte, mir total absurd vorkam. Schließlich redeten – oder besser gesagt stritten wir – über fast nichts anderes. »Nicht, dass Sie das etwas angeht, aber … mein Ex.«
»Ah.« Er lehnte sich zurück und sah mich an, als hätte ich etwas Falsches gesagt. »Dann wäre eine andere Adresse aber gut.«
»Ich habe keinen festen Wohnsitz«, log ich. »Schlafe mal hier, mal dort.«
Kopfschüttelnd erhob er sich und wedelte mit meinem Führerschein. »Ich prüfe nur kurz Ihre Angaben und bin gleich wieder da.«
»Ich warte hier«, rief ich ihm hinterher, und ohne dass er sich zu mir umdrehte, konnte ich sehen, dass er lachen musste. Was mir eigentlich egal sein sollte – schließlich hatte der Typ mich verhaftet.
Gedankenverloren sah ich hinab zu meinen Händen, die mit Handschellen am Tisch fixiert waren. Farbsprenkel übersäten meine Haut. So sah ich meistens aus. Das Malen und Sprayen war nun mal ein wichtiger Bestandteil meines Lebens.
Der Officer kam mit einer Akte in der Hand zurück in den Verhörraum. Er setzte sich wieder mir gegenüber an den Tisch und krempelte die Ärmel seines dunkelblauen Uniformhemdes zurück. Muskeln zeichneten sich unter seiner leicht gebräunten Haut ab.
»Ihre Angaben stimmen offenbar.« Er hielt mir meinen Führerschein hin. »Ich lege ihn wieder zurück in Ihren Geldbeutel, okay?«
Ich nickte knapp.
»Der Eigentümer des Gebäudes ist informiert und auf dem Weg hierher.« Der Cop biss sich auf die Lippen und legte ein paar Fotos meines Graffiti vor mir auf den Tisch.
Was wollte er denn jetzt von mir hören?
»Auch wenn ich nicht fertig geworden bin …« – die erhobene pinke Faust, mein Markenzeichen, fehlte noch –, »… finde ich, es ist sehr ausdrucksstark.«
»Ausdrucksstark«, wiederholte er und wiegte seinen Kopf hin und her. »Hier auf dem Revier haben wir dafür einen anderen Begriff.«
Mit fragendem Blick lehnte ich mich – soweit es meine Handschellen zuließen – über den Tisch.
»Sachbeschädigung.«
»Für Menschen, die nicht mehr als das darin sehen, ist es auch nicht gemacht.«
Mit einem vernichtenden Blick nahm er die Bilder wieder an sich. »Und für wen ist die Schamhaar-Aufklärungskampagne gedacht?«
»Vermutlich für Menschen, die es nötig haben, exakt so etwas zu fragen.«
Lässig fuhr er sich durch sein Haar und sah mich mit gespielter Erkenntnis an. »Ach so … Frauen haben Schamhaare. Es war wirklich nötig, das auf eine Hauswand zu sprühen. Dieses total geheime Wissen muss dringend unter die Menschen gebracht werden.«
Wie gern würde ich aufspringen, mich vor ihm aufbauen und einen flammenden Vortrag halten. Doch er war ein Mann … Ein Cop … Und dazu noch ein total arroganter Schönling. Die Energie sollte ich mir wirklich sparen. Aber natürlich konnte ich das nicht … »Traurigerweise ist es nötig. Heutzutage wächst eine ganze Generation heran, die geprägt ist von Pornos und glaubt, dass Frauen eben keine Schamhaare haben. Oder haben sollten. Ich finde, man kann gerade jungen Frauen gar nicht oft genug sagen, dass sie sich diesem Diktat nicht beugen müssen, wenn sie das nicht möchten.« Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich meinen, dass in seinen Augen so etwas wie Verständnis aufblitzte.
»Dann sollten Sie das besser auf die Hauswand eines Pornoproduzenten sprühen.« Verteidigend hob er die Hände. »Nicht, dass ich das dann gutheißen würde, aber … Der arme Besitzer dieses Hauses kann nun wirklich nichts dafür.«
Ja, klar. Der arme Besitzer, dessen Vermögen sich in den letzten Jahren mindestens verdreifacht hat und der vermutlich die ein oder andere nicht so wohlhabende Familie vor die Tür gesetzt hat, um mit gut verdienenden Hipstern das Doppelte einzunehmen. Wie konnte ich nur so kalt und rücksichtslos sein? »Ja, der Arme.«
»Miss Burke«, sagte er und ich hasste, wie das klang. So distanziert und kalt …
Auch das sollte mir total egal sein. War es aber nicht. »Sam.«
»Was?«
»Sam … Nennen Sie mich Sam.«
»Otis«, erwiderte er sanft.
Ich schwieg. Er schwieg. Für einen Moment sahen wir uns einfach nur an. Sein Blick fühlte sich so merkwürdig vertraut an, dass ich verlegen meinen Kopf abwandte und mich prompt dafür verfluchte.
Die Tür öffnete sich und eine uniformierte Frau trat ein. »Der Besitzer, Mr Stuart, ist gerade gekommen.«
Otis nickte und erhob sich. »Ich gehe sofort zu ihm. Kannst du mir einen Gefallen tun und sie bitte so lange in eine Untersuchungszelle bringen?«
Ich hasste es, wenn man in meiner Anwesenheit in der dritten Person über mich sprach.
»Klar.« Die Polizistin lächelte so süß, dass mir fast schlecht wurde.
Er warf seiner Kollegin den Schlüssel für meine Handschellen zu und verschwand.
4
Otis
Wütend auf mich selbst ging ich zu meinem Schreibtisch. Warum nur versuchte ich, diese Frau zu verstehen? Was sie getan hatte, war falsch, ein Verbrechen. Ihre Bewegründe waren letztlich egal. Ich sollte sie nicht sympathisch finden und mir sollte nicht auffallen, dass sich ihre Nase so süß kräuselte, wenn sie mir Kontra gab. Vermutlich lag das nur an meiner Müdigkeit. Es gab schließlich genug Untersuchungen, die bescheinigten, dass Schlafmangel fast wie Alkohol für das Gehirn war. Ich war schlicht nicht mehr zurechnungsfähig und es war gut, dass Andrea sich nun um sie kümmerte.
Ein Mann, der viel zu jung aussah, um ein derart großes Gebäude in begehrter Lage zu besitzen, stand im Wartebereich.
»Sind Sie Mr Stuart?«, fragte ich ihn.
»Ja.« Er reichte mir seine Hand. »Russel Stuart.«
»Ich bin Officer Otis Renshaw«, sagte ich, während ich seine manikürte Hand schüttelte. »Danke, dass Sie gleich gekommen sind. Bitte folgen Sie mir.«
Wieder ging ich zu meinem Schreibtisch und Mr Stuart folgte mir. Während ich die Akten, die dort noch verteilt lagen, aufeinanderstapelte, um etwas Platz zu schaffen, setzte er sich auf den Stuhl mir gegenüber. Er legte einen Arm über die Lehne seines Stuhls und wirkte – dafür, dass sein Eigentum beschädigt worden war – merkwürdig entspannt.
Sams Akte lag vor mir. Ich schlug sie auf und legte die Bilder, die ich gemacht hatte, vor ihn hin.
»Ich habe das Graffiti schon vor Ort gesehen«, sagte Mr Stuart nach einem kurzen Blick darauf.
Davon war ich ausgegangen. »Und gestern war das noch nicht an der Wand?«
»Nein.«
Nickend nahm ich die Bilder wieder an mich.
»Und Sie haben den Kerl, der das gemacht hat, auf frischer Tat erwischt?«
Ich seufzte. »Erstens ist es eine Frau, die ich erwischt habe, und zweitens ist sie im Augenblick nur eine Verdächtige. Über ihre Schuld müssen andere urteilen.«
»Aber Sie haben sie doch erwischt?«
»Ich habe gesehen, wie sie etwas an die Wand gesprüht hat. Aber theoretisch hätte das auch nur ein kleiner Strich sein können und jemand anderes hätte den ganzen Rest gemacht haben können.«
»Aber das glauben Sie doch nicht wirklich?« Mr Stuart hob seine Brauen.
»Was ich glaube, ist unerheblich.«
Mit verschränkten Armen lehnte er sich zurück. »Eine Frau also …« Er wirkte, als würde er überlegen.
»Ja, es gibt auch Sprayerinnen. Nicht viele, aber ein paar.«
»Hm …«
Ich wurde nicht ganz schlau aus seinem Gesichtsausdruck. Machte es das für ihn besser oder schlimmer? »Möchten Sie Anzeige erstatten?«
Nachdenklich wiegte er seinen Kopf hin und her. »Ich möchte vor allen Dingen wieder eine saubere Wand.«
»Verständlich.«
»Das heißt, wenn ich nicht auf dem Schaden sitzen bleiben will, muss ich Anzeige erstatten.«
»Na ja«, sagte ich seufzend. »Wenn bei ihr nichts zu holen ist – und für mich sieht es danach aus –, könnte das trotzdem passieren.«
»Der Richter könnte sie wenigstens dazu verdonnern, alles zu entfernen.«
»Das könnte er. Aber bis die Verhandlung angesetzt wird … das kann dauern.«
Mr Stuart legte seine Unterarme auf dem Tisch ab und sah mich an. »Und was schlagen Sie vor?«
»Verstehen Sie mich nicht falsch, ich schlage das nicht vor. Ich sage nur: Sie müssen nicht sofort Anzeige erstatten. Sie könnten auch mit ihr reden und mit ihr vereinbaren, dass sie die Schmiererei entfernt. Und wenn sie das nicht tut, können Sie immer noch Anzeige erstatten.« Ich lehnte mich nach vorn und spiegelte seine Pose. »Wenn es Ihnen nur um eine saubere Wand geht, wäre Ihnen damit vermutlich viel schneller geholfen.«
»Wohl wahr.« Er überschlug seine Beine und wippte mit dem Fuß. »Was würden Sie tun, wenn es Ihr Haus wäre?«
»Ich würde den Gerichten Arbeit und mir Nerven sparen, und es versuchen.«
Er nickte knapp. »Kann ich sie sehen?«
»Natürlich.« Ich erhob mich und sah ihn auffordernd an. »Folgen Sie mir.«
Gemeinsam gingen wir zum Verhörraum, wo ich ihn bat, Platz zu nehmen, dann machte ich mich auf den Weg, um Sam zu holen. Sie saß auf der Pritsche in der Untersuchungszelle, den Rücken an die Wand gelehnt und die Beine angezogen.
Ich blieb vor den Gitterstäben stehen. »Der Hauseigentümer ist hier und möchte die Person kennenlernen, die für den Schaden verantwortlich ist.«
»Wozu?«, fragte sie und starrte weiter vor sich hin.
Ich öffnete die Zellentür und trat hinein. »Möglicherweise, um einen Deal auszuhandeln und Ihnen eine weitere Anzeige zu ersparen.«
Nun hob sie den Blick und sah mich an, als erwartete sie, eine versteckte Kamera zu entdecken.
»Jetzt kommen Sie schon.«
Zögernd erhob sie sich und hielt mir ihre Hände hin.
Gerne hätte ich darauf verzichtet, aber Vorschrift war Vorschrift. Mit einem Klicken befestigte ich die Handschellen an ihren schlanken Handgelenken. Vor mir führte ich sie aus der Zelle und in den Verhörraum.
Die Art, wie sie Mr Stuart ansah, stimmte mich nicht gerade zuversichtlich. Vielleicht hätte ich ihr vorher noch sagen sollen, dass sie sich zusammenreißen sollte. Andererseits … Ich war nicht ihr Vater oder ihr Anwalt.
»Mr Stuart, das hier ist Ms Burke«, stellte ich die beiden vor.
»Ich würde ja jetzt sagen: ›Angenehm …‹«, witzelte der Hausbesitzer, »aber das wäre gelogen.«
Sam rollte mit den Augen.
Das fing ja gut an. »Haben Sie schon einmal Graffiti entfernt?«, fragte ich sie.
»Ja, leider.«
»Dann wissen Sie ja, wie es geht.« Eindringlich sah ich sie an.
Mr Stuart mischte sich nicht ein, vermutlich bereute er, sich auf diesen Versuch eingelassen zu haben.
»Auch wenn es mir das Herz bricht«, wandte sich Sam schließlich an ihn. »Wenn Sie auf eine Anzeige verzichten, kann ich mein Werk entfernen.«
»Ihr Werk?«, wiederholte er sarkastisch.
»Ja, mein Werk.«
»Und Sie können das komplett entfernen, ohne Rückstände?«, fragte ich.
Sam setzte ein zuckersüßes Lächeln auf – das sie offensichtlich nur für gewisse Menschen und Situationen reserviert hatte. »Die Wand wird aussehen wie neu, Mr Stuart.«
Der erhob sich und sah auf sie hinab. »Okay, Sie haben dafür zwei Tage Zeit. Wenn bis dahin nicht alles entfernt ist, werde ich Anzeige erstatten.«
»Deal.« Sam grinste und deutete auf ihre Handschellen. »Und wenn ich die los bin, können wir sogar darauf einschlagen.«
»Ich verzichte«, sagte Mr Stuart und verließ den Raum.
Mit einem Schritt war ich bei Sam, die mir wieder die Arme entgegenstreckte. Ich nahm ihre weichen Hände und fischte den Schlüssel aus meiner Tasche. Während ich das Schloss öffnete, trafen sich unsere Blicke. Ihre braunen Augen waren nicht nur warm, sie wirkten auch klug. Sie war kriminell, aber irgendwie hatte sie es mir angetan.
»Dann kann ich jetzt gehen?« Sam sah mich herausfordernd an.
»Sieht so aus.«
Theatralisch legte sie die Hand an ihr Herz und seufzte. »Auf Nimmerwiedersehen, Officer.«
Das hoffte ich. Für sie.
5
Sam
Ich nahm meinen Rucksack entgegen und belegte mit meiner Unterschrift, dass alles vollständig war. Obwohl ich versucht war zu behaupten, dass hundert Dollar in meinem Geldbeutel fehlten. Die konnte ich nämlich gerade gut gebrauchen, um den Graffitientferner, den ich zur Beseitigung der Farbe brauchte, zu kaufen. So ein Mist! Es war nicht so, dass ich noch nie erwischt worden war, und heute war ich vergleichsweise glimpflich davongekommen. Aber mir graute schon vor dem, was ich mal wieder tun musste, um an das nötige Geld zu kommen. Dass ich das Werk, das ich so lange und mit so viel Herzblut vorbereitet hatte, wieder entfernen musste, daran wollte ich noch gar nicht denken.
Mit dem Rucksack auf den Schultern ging ich den grell beleuchteten Flur entlang Richtung Ausgang. Otis lief mir nicht mehr über den Weg. Während des Gesprächs mit dem Besitzer hatte er enttäuscht gewirkt. Vielleicht war ich nicht dankbar genug, aber eben nur, wenn man die Welt durch seine Augen betrachtete. Natürlich hatte er mir so eine Anzeige erspart, aber um ehrlich zu sein, machte das für mich keinen großen Unterschied. Die Konsequenzen waren für mich mehr oder weniger dieselben. Denn ich musste nun meinen Dad anrufen und nach Geld fragen, und es war egal, ob ich das tat, um nach hundert Dollar für Graffitientferner zu fragen, oder um tausend für Schadensersatz. Es war das gleiche Gefühl. Das Gefühl, versagt zu haben. Das Gefühl, nicht auf eigenen Beinen stehen zu können. Und das Schlimmste von allen: das Gefühl, dass meine Arbeit umsonst und ich komplett nutzlos war.
Ich verließ das Polizeigebäude und trat auf die Straße. Es war bewölkt, das Grau spiegelte mein Innerstes perfekt wider. Lustlos ging ich die Union Avenue entlang. Das Guthaben auf meiner Prepaidkarte war so gut wie aufgebraucht, aber ganz in der Nähe fand ich den nächsten Free-WiFi-Hotspot, wo ich gratis telefonieren konnte. Es war sinnlos, das Gespräch mit meinem Vater hinauszuschieben. Schließlich fühlte ich mich schon bei dem Gedanken daran so schlecht, dass es die Realität kaum übertrumpfen konnte. Unachtsam öffnete ich die Sicherheitsnadeln, die meinen Rucksack zusammenhielten, und stach mir eine in den Finger. Ich saugte an der Fingerkuppe, bis der Schmerz nachließ und öffnete dann das Reißverschlussfach im Inneren. Wahrscheinlich käme ohnehin niemand auf die Idee, mich zu beklauen, und das uralte Handy, das ich mein Eigen nannte, war jedem Gangster zu unhip. Aber auch wenn ich nicht viel besaß – auf das, was ich hatte, gab ich eben acht.
Mein Smartphone war mit einer dicken Schicht Klebeband umhüllt, um das kaputte Display notdürftig zusammenzuhalten. Dieses Gerät war nicht mehr dazu gedacht, schicke Fotos zu machen oder hochauflösende Videos zu sehen, aber es reichte, um Nachrichten zu verschicken und zu telefonieren. Seufzend entsperrte ich das Display und verband das Handy mit dem Hotspot. Es widerstrebte mir mit jeder Faser meines Körpers, meinen Vater schon wieder anzubetteln. Die zehn Dollar, die ich noch von meinem letzten Gelegenheitsjob hatte, würde ich schon bald wieder für Monatshygiene brauchen. Für alles andere hatte ich Lösungen gefunden, für die ich kein Geld brauchte. Aber Tampons wuchsen nun einmal nicht auf Bäumen, und mein erster und letzter Versuch mit der Menstruationstasse war nicht sehr appetitlich gewesen.
Eine gefühlte Ewigkeit schwebten meine Finger über der WhatsApp-Kontaktliste. Dad. Ich hatte keine schlechte Beziehung zu meinen Eltern. Ganz im Gegenteil. Sie liebten und unterstützten mich. Letzteres taten sie zumindest so lange, bis ich mein Kunststudium geschmissen hatte … Dad kam immer noch nicht darüber hinweg. Er war gegen das Leben, für das ich mich entschieden hatte. Und die Tatsache, dass ich immer mal wieder angekrochen kam, um mir Geld zu borgen, machte es nicht besser. Es bestätigte seine Ansicht, dass das, was ich tat, nicht die richtige Art war, Kunst zu leben. Für mich war es nur leider die einzige Art. Den Traum, Gemälde in großen Galerien auszustellen, hatte ich schon lange begraben. Nicht aus Bequemlichkeit, sondern weil es sich für mich falsch anfühlte. Kunst sollte provozieren. Doch viel zu oft tat sie das auf einem derart intellektuellen Level, dass den meisten Menschen die Botschaft verborgen blieb. Meiner Meinung nach lag das nicht am Betrachter, sondern am Künstler, der nicht bereit war, seine Aussage auf eine Weise zu transportieren, die auch der großen Masse zugänglich war. Als dürfte Kunst nur von einem ausgewählten Publikum betrachtet und verstanden werden. Vielleicht war es das, was die meisten Menschen unter Kunst verstanden. Ich nicht. Auch wenn mein Leben dadurch alles andere als einfach war.
Endlich drückte ich auf das Telefonsymbol.
»Hey, Dad«, begann ich das Gespräch zögerlich.
»Samantha.« Er klang, als wüsste er schon, warum ich anrief.
»Wie geht es euch?«
»Gut. Sehr gut.«
»Das freut mich zu hören.«
Dad war eigentlich nicht der schweigsame Typ. Unsere Gespräche waren erst in den letzten Jahren so einsilbig geworden. Es war mir nicht egal, aber ich konnte nichts daran ändern. Ich konnte kein Leben führen, das ich nicht führen wollte, nur um ihn glücklich zu machen. Aber ich konnte definitiv mehr eigenes Geld verdienen. Den Vorsatz hegte ich schon länger, doch die Realisierung war bisher gescheitert.
»Und dir?«
»Na ja …«, ich sog scharf die Luft ein, »ich wurde heute Morgen beim Sprayen erwischt.«
»Bist du im Gefängnis?«
»Nein, nicht mehr. Der Besitzer des Hauses erstattet keine Anzeige.«
Dad atmete geräuschvoll aus. »Wenigstens bleibt dir eine weitere Vorstrafe erspart.«
Das würde meinen Lebenslauf nicht wahnsinnig aufwerten. »Ich muss allerdings das Gebäude reinigen. Und …« Wie ich das hasste! »Und ich habe nicht mehr genug Geld, um das Material dafür zu kaufen.«
»Wie viel brauchst du?«
»Wenn ich sparsam bin, vielleicht hundert Dollar.«
Er räusperte sich. »Und wenn du gründlich bist und so tust, als wäre dir wirklich daran gelegen, den Schaden zu beseitigen?«
Autsch. »Vermutlich zweihundert.«
»Hast du mittlerweile wieder ein Konto?«
»Nein.«
Dad schwieg, aber ich konnte hören, wie er im Hintergrund mit jemandem redete. »Okay«, sagte er schließlich. »Ich habe hier noch drei Patienten. Danach fahre ich zu dir.«
Zu mir? Er durfte unter gar keinen Umständen sehen, wie ich wohnte. Das würde ihm bestimmt einen Herzanfall bescheren. »Wir könnten uns auch gleich in einem Baumarkt treffen. Ich schicke dir die Adresse.«
»Ja.« Er wirkte enttäuscht.
»Und danach einen Kaffee trinken.«
»Mal sehen.« Er räusperte sich. »Bis später, Samantha.«
»Bis dann, Dad.«
Ich starrte auf das ramponierte Smartphone in meiner Hand. Warum nur verwandelte ich mich immer, wenn ich mit ihm sprach, von der selbstbewussten Frau, die ich eigentlich war, zurück in das kleine Mädchen? War es die Macht des Geldes, die ich doch eigentlich verabscheute, oder war es einfach, weil er mein Vater war und ich immer seine kleine Tochter bleiben würde?
Lustlos schlenderte ich zurück nach Hause. Bis Dad hier war, würde es noch Stunden dauern, und es war noch zu früh, um die Container der Supermärkte zu plündern. Der Innenhof war leer, Crawford schlief vermutlich in irgendeiner Ecke. Mit einer Hand zog ich die Feuerleiter zu mir, kletterte in den ersten Stock, zog sie wieder herauf und nahm dann die nächste. Das Brett vor meiner Eintrittsluke war noch dort, wo ich es vorhin befestigt hatte. Mit beiden Händen entfernte ich es, lehnte es an die Wand an und stieg hinein. Ich streifte meinen Rucksack von den Schultern und ließ das Fenster geöffnet. Kraftlos durchquerte ich das Zimmer und fiel auf das Sofa.
6
Otis
Endlich hatte ich den Papierkram erledigt und fuhr nach dieser Vierzehn-Stunden-Schicht nach Hause. Dort dunkelte ich das Schlafzimmer ab, zog meine Uniform aus und legte mich rücklings auf mein Bett. Ich schloss die Augen und wollte nur schlafen. Zwecklos. Eine Weile wälzte ich mich hin und her, bevor ich schließlich aufstand und in die Küche ging, um mir Frühstück zu machen. Ich setzte mich mit meiner Kaffeetasse und meinem Teller vor den Fernseher und sah Nachrichten. Was wie immer keine gute Idee war. Ich hatte kein Faible für Katastrophenmeldungen und war Polizist geworden, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Wenn man die Nachrichten einschaltete, bekam man aber immer das Gefühl, dass das komplett zwecklos war. Manchmal wünschte ich mir einen Sender, der den ganzen Tag nur positive Nachrichten verbreitete. Der berichtete, wie viele Verbrechen heute vereitelt und Menschen geheilt wurden. Es gab so viele, die sich täglich den Arsch dafür aufrissen und genau dafür arbeiteten. Mir ging es nicht um Ehre oder Anerkennung. Das war nie mein Antrieb gewesen. Ich wollte nur, dass jeder da draußen, der versuchte, etwas Gutes zu tun, wusste, dass es nicht vergebens ist. Dass es wirklich hilft und wahrgenommen wird. Vielleicht würden dann viel mehr Leute tatsächlich etwas tun und ihre Zeit nicht mit Netflix oder Selfies verschwenden.
Frustriert schaltete ich den Fernseher aus und ging wieder zurück ins Schlafzimmer. Es war nicht leicht, nach einem so langen Einsatz auf Kommando abzuschalten. Meistens gelang es mir. Nur heute … Irgendwie war mein Kopf noch nicht bereit, den Tag loszulassen und ließ gewisse Bilder wieder und wieder Revue passieren. Ich beschloss, nicht gegen sie anzukämpfen, sie einfach zu betrachten, und irgendwann musste ich tatsächlich in einen tiefen Schlaf gefallen sein.
Die Türklingel weckte mich unsanft. Müde wankte ich zur Tür und drückte auf den Knopf für die Sprechanlage. »Ja?«
»Ich bin’s, Elijah.«
Verdammt! War es schon so spät? »Komm hoch.«
Während ich auf den Öffner drückte, sah ich um die Ecke auf die Uhr. Es war schon nach vier. So lange schlief ich nach der Nachtschicht für gewöhnlich nicht.
»Kommst du gerade aus dem Bett?«, fragte Elijah, als er im Türrahmen erschien und mich in Boxershorts sah.
»Ja, ich bin erst gegen Mittag eingeschlafen. Sorry.«
Elijah winkte ab. »Du hast noch zehn Minuten, um dich fertig zu machen.«
»Da hab ich sogar noch Zeit, in Ruhe einen Kaffee mit dir trinken«, wiederholte ich den alten Scherz unseres Ausbilders in der Police Academy. Elijah und ich hatten sie im gleichen Jahr absolviert. Er hatte immer hart trainiert und war so viel disziplinierter als die meisten von uns. Für mich war er damit immer ein Vorbild. Vor einem Jahr wurden wir uns dann gegenseitig als Partner zugeteilt. Wir waren ein verflixt gutes Team und konnten uns blind aufeinander verlassen.
»Ich würde das schaffen, aber du Lahmarsch«, zog er mich auf, »du brauchst doch schon fünf Minuten, bis der Kaffee überhaupt die richtige Temperatur hat und du dir nicht die Zunge verbrennst.«
Da hatte er leider recht. »Dann geh ich wohl besser schnell duschen.« Ich deutete auf meine Kaffeemaschine. »Aber bedien dich ruhig.«
Eilig ging ich ins Bad, drehte den Hahn auf und stellte mich unter das heiße Wasser. Zwei Minuten später schlüpfte ich in eine frische Uniform. Weil es in ein paar Stunden wieder kühler werden würde, nahm ich ein langes Hemd aus dem Kleiderschrank. Ich legte mir den Gürtel an und steckte die gesicherte Waffe in das Halfter. Mit der Mütze unter meinem Arm ging ich in die Küche.
»Sieben Minuten«, bemerkte Elijah, der sich tatsächlich einen Kaffee gemacht hatte, anerkennend. »Gar nicht schlecht für einen Weißen.«
»Früher ist bestimmt kein Tag vergangen, an dem du nicht auf dem Pausenhof verprügelt wurdest.«
»Jep.« Er nahm einen Schluck aus seiner Tasse. »War das beste Training, das ich kriegen konnte. Und es hat mich hart gemacht.«
Kopfschüttelnd setzte ich mir die Mütze auf und deutete zur Tür. »Lass uns fahren.«
»Kein Kaffee mehr?«
»Nein, ich weiß, wie du Kaffee kochst, und eigentlich würde ich nach der Schicht heute gerne schlafen.«
Elijah legte den Kopf schief. »Ich nicht.«
»Nicht?«
»Izzy und ich versuchen schwanger zu werden.«
»Ihr wollt ein Kind?« Natürlich war das ein verständlicher Wunsch. Nur für mich lag der in weiter Ferne. Nicht nur, weil ich nicht die passende Frau dafür hatte, sondern auch, weil ich noch auf Streife war …
»Ja.« Elijah zuckte mit den Schultern und setzte sich seine Mütze auf. »Ich denke, es ist an der Zeit. Und ich glaube, Izzy wird eine ganz großartige Mutter werden.«
Ich klopfte ihm auf die Schulter. »Und du ein ganz großartiger Vater. Aber ich hoffe, du weißt, dass Babys ihre Milch nicht brühheiß trinken.«
»Nicht? Gut, dass ich einen Experten wie dich an meiner Seite habe. Ich werde dich dann mitten in der Nacht anrufen, wenn ich einen schlauen Rat brauche.«
»Ich bitte darum.«
Gemeinsam verließen wir die Wohnung und stiegen in meinen roten Honda Accord, der unten parkte. Er hatte schon Rost angesetzt und war etwas verbeult, aber für die kurzen Strecken, die ich fuhr, reichte er.
»Gestern noch alles gut gegangen mit dem Schmierfink?«, erkundigte sich Elijah, als wir vor dem Revier parkten.
»Ja, ja«, antwortee ich gedankenverloren. »Sie ist schon wieder auf freiem Fuß.«
Fragend sah er zu mir.
»Der Besitzer hat darauf verzichtet, Anzeige zu erstatten, wenn sie dafür seine Fassade säubert und alles entfernt.«
»Du weißt, dass das nicht gerade gut für unsere Quote ist?«
Ich biss mir auf die Unterlippe und suchte nach einer Antwort. »Es gibt vieles, was gut für unsere Quote wäre, und trotzdem tun wir es nicht, oder?«
»Ja, weil ich komischerweise ein Problem mit Racial Profiling habe. Was total merkwürdig für einen Schwarzen ist.«
Mit dem Zeigefinger tippte ich ihm an den Schirm seiner Mütze. »Dann verstehen wir uns ja.«
»Wieso? Bist du jetzt ein Schmierfink?«
»Sie ist … Wie soll ich das erklären? Sie macht das nicht, um zu zerstören. Ich glaube, sie will etwas damit sagen.«
Elijah zuckte gelangweilt mit den Schultern. »Und was ist das? Dass ihr Daddy sie zu wenig geliebt hat?«
»Du verstehst das nicht.« Er hatte ja schließlich nicht mit ihr geredet.
»Weißt du was«, Elijah legte eine Hand auf meine Schulter und sah mich ernst an, »ich glaube, du verstehst das zu gut. Und das ist kein Kompliment.«
Das war möglicherweise der springende Punkt. Doch ich würde aufpassen, dass es kein wunder werden würde …
7
Sam
Ich hatte noch etwas Zeit, bis ich meinen Vater im Baumarkt treffen würde, musste aber bis dahin ganz dringend duschen. Fließendes Wasser hatte ich in meiner Bleibe leider nicht. Aus einer Schnur und einem Kanister hatte ich mir im Waschraum zwar eine kleine Notdusche gebastelt, aber bei all der Farbe auf meinen Händen und Armen brauchte ich heute etwas mehr als das. Mittlerweile hatte ich dafür zwei ganz passable Optionen aufgetan, die auch mein Toilettenproblem zum Großteil lösten. Zwar gab es in der Nähe auch ein öffentliches WC, aber das war eher etwas für Notfälle … Eine meiner Duschlocations war ein Discount-Fitnessstudio hier um die Ecke. Dort gab es kein Personal, der Zugang funktionierte über einen Chip, den ich zwar nicht hatte, aber es war leicht, sich hinter einem der Gäste hineinzuschmuggeln. Noch etwas näher gab es eine Schule, durch deren Hintereingang ich mich schon öfter zum Sporttrakt mit den Waschräumen geschlichen hatte. Allerdings musste man hier immer sehr aufpassen. Ich beschloss deshalb, heute ins Fitnessstudio zu gehen. Dort hatte mir noch nie jemand Fragen gestellt.
Durch das Fenster verließ ich die Wohnung, verbarrikadierte den Ausgang wieder und lief die zwei Blocks zum Fit Planet. Dort wartete ich einen Hauseingang weiter, bis jemand kam. Es dauerte verhältnismäßig lange, bis ein junger Mann mit Trainingshose und AirPods in den Ohren auf die Tür zuging. So unauffällig wie möglich sprintete ich – gerade rechtzeitig – zur Tür. Ich hörte das Piepsen und sah das kleine Lämpchen an der Tür grün aufleuchten. Der Mann trat hinein und während er seinen Chip in der Trainingstasche verstaute, schlüpfte ich hinter ihm durch. Erst jetzt bemerkte er mich.
»Hi«, grüßte ich ihn überschwänglich und hob die Hand.
»Hi.«
Strahlend lachte ich ihn an und deutete den Gang runter in Richtung der Geräte. »Bis später!«
»Ja«, sagte er und nickte verwirrt.
Dann verschwand ich in der Frauenumkleide. Ich war mir sicher, der Kerl würde mich beim Training nicht wirklich vermissen. Die Umkleide war nur mäßig belegt, die Duschen wie fast immer leer. Kaum einer schien sie zu benutzen. Hätte ich zu Hause ein schönes Badezimmer, würde ich das vermutlich auch diesem hier vorziehen. Eine Augenweide war es nicht. Es war zwar nicht wirklich schmutzig, aber den Kampf gegen den Schimmel in den Fugen hatte man offensichtlich schon vor langer Zeit aufgegeben. Ich war allerdings nicht zimperlich und einfach froh über unbegrenzt fließendes Wasser.
Schnell schlüpfte ich aus meinen Sneakers und Klamotten und ging barfuß, mit Duschgel bewaffnet in den Waschraum. Ich drehte das Wasser heiß auf, ließ es mir über das Gesicht und den ganzen Körper laufen und genoss diesen nicht alltäglichen Luxus.
Nachdem ich mich sauber geschrubbt hatte, zog ich mir eine frische Jeans und ein Oversized-Shirt an, das ich mit einem Knoten an einer Seite etwas verkürzte. Wie immer war das Haarebürsten eine kleine Tortur. Bevor ich komplett verzottelte, musste ich dringend mal wieder an Conditioner kommen. Mit nassen Haaren verließ ich das Fitnessstudio und brachte nur meine Tasche zurück, denn es wurde schon Zeit, mich auf den Weg zum Baumarkt zu machen.
Vor der Tür von Crest Hardware