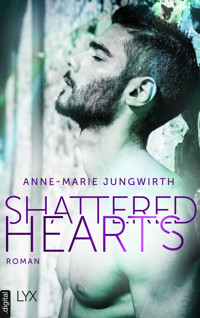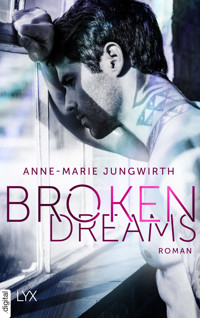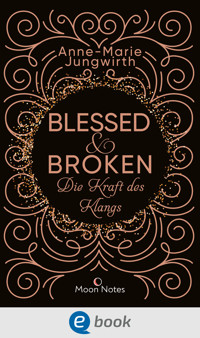
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Moon Notes
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Es gibt nur wenige Frauen im Königreich Palente, die über die magische Kraft verfügen, mittels Klang und Schall Materie zu beherrschen. Zu diesen Frauen gehört die Bäckerstochter Livia. Ihr Vater verbietet ihr die Nutzung ihrer Gabe, denn diese wurde einst ihrer Mutter zum Verhängnis. Doch dann verliert ihr Vater seine Bürgerrechte und ihre schwangere Schwester benötigt dringend eine Mitgift. Livia muss einen Pakt mit dem jungen und attraktiven Kriegsherrn Cristan schließen, um ihre Familie zu retten …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Sammlungen
Ähnliche
Über dieses Buch
Sie macht dich zum reichsten Menschen des Königreichs oder sie wird dich töten. Livia ist eine der wenigen jungen Frauen im Königreich Palente, die über die Segnung verfügt. Mittels Klang und Schall beherrscht sie Materie. Diese Gabe wurde einst ihrer Mutter zum Verhängnis, weshalb ihr Vater Livia die Nutzung der außergewöhnlichen Magie verbietet. Doch als das Schicksal ihrer ganzen Familie auf dem Spiel steht, trifft Livia eine schwerwiegende Entscheidung: Sie geht einen Pakt mit dem jungen und attraktiven General Cristan ein, der sie auf dem Schlachtfeld als Waffe an seiner Seite haben möchte …
»Eine starke Heldin zwischen Verantwortung und Selbstbestimmung und eine Lovestory wider Willen. Cristan hat auf jeden Fall Bookboyfriend-Potenzial!«
Stefanie Hasse
Für Mama
1
Keuchend zerre ich den prall gefüllten Getreidesack hinter mir her und platziere ihn lieblos neben dem Mahlstein. Während ich mir mit der Hand den Schweiß von der Stirn wische, wünsche ich mir einmal mehr, meine Segnung würde das für mich erledigen. Oder mein Vater – schließlich wiegt das Ding beinahe doppelt so viel wie ich. Beides bleibt mir verwehrt.
Seufzend beuge ich mich vor, löse die Kordel und ziehe die Öffnung des rauen Tuchs weit auf. Mit einem tiefen Atemzug prüfe ich, ob die Ware verdorben ist. Dann gleite ich mit einer Hand in den Sack und lasse ein paar Körner durch meine Finger rieseln, bevor ich eine kleine Portion Kamut herausnehme. Er ist etwas zu trocken, aber immer noch in Ordnung. Nickend werfe ich die Probe zurück und sinke auf dem staubigen Boden hinter unserem Haus in einen Schneidersitz.
Wachsam lasse ich meinen Blick umherschweifen, stelle sicher, dass ich keine Zuschauer habe. Keine Menschenseele ist zu sehen. Die schmalen einstöckigen Häuser um mich herum verschmelzen farblich mit der Gasse. Nur gelegentlich wird die sandfarbene Einheit von bunten Vorhängen durchbrochen, die im Moment alle fest zugezogen sind. Die Sonne steht hoch und jeder, der kann, flüchtet um diese Tageszeit in sein Haus. Jeder außer mir. Ich habe mich an die Arbeit in der brütenden Hitze gewöhnt und sie stört mich nicht mehr.
Natürlich könnte ich – wie alle anderen auch – eine Mittagsruhe einlegen, aber dann wäre ich noch länger an diesen Ort gekettet. Lieber beiße ich die Zähne zusammen, halte durch und habe später etwas Zeit, um durch den Innenbezirk zu streifen oder mich heimlich in die Bibliothek zu schleichen. Allein der Wunsch danach ist den meisten Menschen aus meiner Schicht fremd, denn von jeher ist ihr Tag von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang mit Arbeit gefüllt. Doch als ich klein war und Mutter großzügig vom Herrscher bezahlt wurde, da gab es so etwas wie freie Zeit. Manchmal kommt es mir vor, als wäre es in einem anderen Leben gewesen oder in einem Traum, den ich nur noch verwaschen vor mir sehe. Immer wieder versuche ich, an diesen kleinen Erinnerungsfetzen festzuhalten, will verhindern, dass sie mir entgleiten. Im Gegensatz zu meinem Vater möchte ich nämlich nicht vergessen, sondern zurück. Zurück in das Leben, das wir hinter uns gelassen haben. In das Leben, das mir bestimmt ist und er mir verwehrt.
Ich lege meine Hände in den Schoß und spüre den rauen Stoff meines Wickelkleids. Es ist kaum besser verarbeitet als der Sack mit den Kamutkörnern vor mir, aber immerhin ein wenig schöner. Während ich meine Augen schließe, beschwöre ich Bilder meiner Mutter herauf. Dabei bleibt ihr Gesicht unscharf, einzig ihre Lippen sehe ich deutlich vor mir und lausche ihrer Stimme. Sie ist das, was mich mit ihr verbindet – über ihren Tod hinaus.
Wie so oft, wenn ich unbeobachtet bin, summe ich die Melodie, mit der Mama früher meine bemalten Steine zum Tanzen gebracht hat. Vorsichtig öffne ich meine Augen, ohne dabei zu verstummen. Die Körner fliegen kreisend aus dem Sack in die Luft, drehen kleine Pirouetten und versüßen mir mit ihrem Anblick den Tag. Ich wünschte, sie würden nicht nur tanzen, sondern wirklich tun, was ich ihnen sage und auf den Mahlstein schweben, um sich dort gleichmäßig auszubreiten. Leider weiß ich nicht, wie ich das bewerkstelligen soll. Ich summe höher, tiefer, versuche, mehr zu vibrieren, doch der Kamut gehorcht meinen Klängen nicht. Er ändert die Richtung, wird mal schneller, mal langsamer, aber es scheint, als würde er es aus einer Laune heraus tun und nicht, weil ich es ihm befehle. Wäre nur Mama noch hier und könnte mir sagen, was ich falsch mache!
Schritte erklingen hinter mir. Augenblicklich presse ich meine Lippen zusammen, lasse die Melodie verstummen und die Körner damit alle auf einmal zu Boden fallen. Sie bewegen sich so unnatürlich schnell, dass selbst einem schlichten Gemüt klar sein muss, dass die Segnung ihre Finger im Spiel hat. Ruckartig fahre ich herum und sehe ausgerechnet meinen Vater näher kommen. Er ist der letzte Mensch, der mich beim Üben erwischen soll.
Finster blickt er mich an und baut sich vor mir auf. »Livia, ins Haus. Sofort!«
Langsam erhebe ich mich, klopfe den Staub vom Kleid und folge ihm. Schnaubend marschiert mein Vater voran und stößt die dunkle Holztür so schwungvoll auf, dass sie sich fast aus der Verankerung löst. Meine Füße berühren den gefilzten Teppich, der über dem gesamten Boden ausgebreitet ist. Er ist schmucklos, aber weich und gemütlich.
In der Mitte des Zimmers bleibt Vater stehen. Seine schütteren Haare und sein am Kinn ergrauter Bart lassen ihn selbst an guten Tagen grimmig wirken. Doch wenn er die Augen so wie jetzt zusammenkneift, ist er es auch.
Ich schließe die Tür hinter mir und gehe einen Schritt auf ihn zu. Was jetzt folgt, weiß ich genau, und ich bin es so leid.
»Was fällt dir eigentlich ein?«, zischt mein Vater leise, um den Rest der Familie nicht zu wecken.
Doch das ist zwecklos. Unser Haus besteht aus nur einem Raum und ich kann genau erkennen, wie mein kleiner Bruder Toman und seine Mutter Turia sich auf ihren Schlafstätten nur schlafend stellen.
Ich wende mich wieder meinem Vater zu und zucke mit den Schultern. Was soll ich schon sagen?
»Bist du völlig von Sinnen? Schlimm genug, dass du nicht darauf verzichten willst … Aber draußen im Freien, wo dich jeder beobachten kann …«
»Mich hat aber niemand gesehen«, entgegne ich, obwohl ich mich manchmal frage, ob ich nicht die Tracht Prügel riskieren und dafür der Heimlichtuerei ein Ende setzen sollte.
»Aber es hätte dich jemand sehen können.«
Mir liegt viel auf der Zunge, doch ich verkneife es mir. »Ich bin vorsichtig.«
»Ich weiß wirklich nicht, was ich noch mit dir machen soll, Livia. Du weißt, welches Schicksal deine Mutter ereilt hat. Willst du ihrem Beispiel folgen?«
Ich sage nichts, denn die einzig vernünftige Antwort darauf lautet Ja. Schließlich ist alles besser als dieses Leben hier.
»Entweder bist du unglaublich dumm oder hast Todessehnsucht.«
Oder du bist einfach ein unglaublich feiger Mann, der nicht einsieht, dass meine Segnung die Rettung für unsere Familie sein könnte.
»Du wirst nicht nur den Kamut für die heutige Teigration mahlen, sondern den gesamten Sack. Und wenn ich dich noch einmal dabei erwische, wie du deine Kräfte einsetzt, lasse ich dir deinen Mund zunähen.«
»Wie soll ich so essen?«
»Schweig!«
Kopfschüttelnd wende ich mich von ihm ab. »Ich bin draußen und mahle den Kamut.«
»Ich warne dich. Überstrapaziere nicht meine Geduld.«
Wenn hier etwas überstrapaziert ist, dann meine Nerven. Über die Schulter blicke ich zurück. »Entschuldige, Vater.«
Er nickt wohlwollend, und ich verschwinde wieder hinaus in die Hitze. Missmutig stapfe ich hinters Haus. Der Sack steht noch genau dort, wo ich ihn kurz zuvor hingeschleift habe. Natürlich tut er das. In Palente gibt es zwar Verbrechen, aber der Herrscher sorgt mit seiner strikten Rechtsprechung dafür, dass sie die Ausnahme darstellen. Dieben wird ohne Prozess die Hand abgehackt, und die meisten Menschen besitzen genug, um das nicht zu riskieren.
Schicksalergeben lese ich die verstreuten Körner vom Boden auf, puste den Staub weg und werfe sie wieder in den Sack. Ich knie mich hin und lege ein paar große Blätter des Roten Schirmbaums vor dem Mahlstein aus, mit denen ich später das Mehl auffange. Dann streue ich eine Handvoll Kamut auf den Stein und verteile die Körner gleichmäßig auf der durch harte Arbeit glatt polierten Oberfläche. Mit beiden Händen greife ich nach dem länglichen Reibwerkzeug und umschließe es fest. Von vorn nach hinten presse ich es schwungvoll über die Körner und wieder zurück. Ich höre, spüre und sehe, wie die ersten von ihnen aufspringen. Doch obwohl meine Arme in den letzten sieben Sommern kräftig geworden sind und ich immer schneller werde, brauche ich für eine Portion Mehl trotzdem mindestens fünfzehn Schübe. Weil ich lustlos arbeite, waren es für diese sogar achtzehn. Mit den Händen schiebe ich den gemahlenen Kamut vom Stein auf die Blätter hinunter und wiederhole den Vorgang ein paarmal.
In der Gasse ist es nach wie vor gespenstisch still, und ich finde es passend, weil ich manchmal das Gefühl habe, wir sind zusammen mit Mama gestorben. Ich hasse dieses Leben jeden Tag ein Stückchen mehr. Wie gern würde ich all dem den Rücken kehren und mein eigenes Leben beginnen. Doch das geht nicht. In Palente gibt es nur zwei Arten von Frauen, die allein leben – Witwen und Huren. Und natürlich die Priesterinnen. Aber die sind nicht nur eine Klasse, sondern sogar eine Schicht für sich.
Inzwischen hat sich auf den ausgelegten Blättern schon so viel Mehl angesammelt, dass es an der Zeit ist, es umzufüllen. Ich stehe auf und schleiche mich zurück ins Haus. Die Mittagsruhe ist noch nicht vorbei und Vater hat sich zu den anderen gebettet. Sie alle liegen auf ihrem Stroh und haben die Augen fest geschlossen. Vorsichtig husche ich zum hinteren Teil des Zimmers, denn dort lagert neben dem kleinen Hausofen ein ungeordnetes Sammelsurium von Säcken und Behältern. Kniend suche ich im Halbdunkel nach einem der feiner gewebten Säcke, in den ich das Mehl umfüllen kann. Normalerweise ist das nicht nötig, weil wir alles, was ich mahle, gleich zu Teig verarbeiten und backen. Aber normalerweise schläft mein Vater um diese Zeit auch schon tief und erwischt mich nicht beim Üben. Vermutlich ist er zu spät in die Schänke gekommen und hatte nicht genug Zeit, um sich vor der Mittagsruhe einen Rausch anzutrinken. Aber der Tag ist noch jung …
Endlich habe ich den engmaschig gewebten Sack gefunden und verschwinde mit ihm zurück zu meinem Arbeitsplatz hinters Haus. Dort angekommen, hebe ich vorsichtig die Blätter, die vor dem Mahlstein liegen, hoch und leere den gemahlenen Kamut in den Sack, den ich mit einer Hand aufhalte. Die wenigen Körner wirken erbärmlich darin. Schon beim Gedanken daran, dass ich ihn heute komplett füllen muss, gerate ich ins Schwitzen und die Sonne tut ihr Übriges. Aber ich jammere nicht. Zwar wäre mir danach zumute, doch die Genugtuung will ich meinem Vater nicht gönnen. Er soll nicht denken, dass er mich gebrochen hat. Denn diese Macht über mich gestehe ich ihm nicht zu.
*
Die Sonne ist bereits Richtung Westen gewandert, und rings um mich herum kehren die Menschen von der Arbeit in ihre Häuser zurück. Auch meine Schwester Rina ist unter ihnen. Sie ist der Tupfen Farbe, der mein Leben wie ein Licht erhellt. Meine Kleidung ist – wie nahezu alles in dieser Siedlung – braun. Vermutlich will man uns so unseren Wert zeigen. Doch Rina schafft es immer, irgendwo Pigmente aufzutreiben, um sich ihre Kleider zu färben. Ihre Tunika ist gelb und ihr Gürtel in einem weit kostbareren Rot gehalten.
Mit einem breiten Lächeln setzt sie sich neben mich auf den Boden und lehnt sich gegen den großen, längst erkalteten Ofen, in dem wir das Brot backen.
»Ich habe auf dem Markt alles bis aufs letzte Brot verkauft«, verkündet sie stolz und sieht verwundert vom Mahlstein zu mir. »Und warum arbeitest du immer noch?«
»Vater hat mich wieder beim Üben erwischt und lässt mich zur Strafe den gesamten Kamut mahlen.«
Rina erhebt sich etwas, schielt in den Sack mit dem Mehl und verzieht mitleidig das Gesicht.
Obwohl ich ohne Pause gearbeitet habe, ist er erst zu einem Drittel voll. Vermutlich werde ich bis nach Sonnenuntergang hier sitzen. »Ich brauche wohl noch etwas.«
»Ich helfe dir, dann geht es schneller.«
»Du hasst es, Mehl zu mahlen.«
Seufzend legt sie ihre Hände auf meine Schultern und zwingt mich damit, sie anzusehen. Mit jedem Tag, den sie älter wird, ähnelt sie Mutter mehr. Sie hat ihre dunklen Locken, ihre honigfarbenen Augen, ihre vollen Lippen und ihr Mienenspiel geerbt. Die Leute sagen immer, Rina und ich könnten Zwillinge sein. Da meine Haare jedoch glatt sind, behaupten sie das vermutlich nur, um mir zu schmeicheln.
»Ja, ich hasse es, Mehl zu mahlen. Aber ich liebe dich und kann unmöglich mit einem ruhigen Gewissen in die Schänke gehen, während du hier schuften musst.« Lächelnd löst sie ihre Hände von meinen Schultern und lässt sie in ihren Schoß gleiten.
»Ach was. So viel ist das gar nicht mehr.«
Rina zieht eine Braue nach oben, genau wie Mama es immer getan hat, wenn ich sie angeflunkert habe.
»Ja, es ist viel«, lenke ich ein. »Aber ehrlich gesagt ist mir heute nicht nach Gesellschaft. Geh du ruhig und amüsiere dich.«
»Livi«, setzt sie an, wird jedoch von Hufgetrappel unterbrochen, das unweit von uns erklingt und den Boden erzittern lässt. »Was …«
Niemand in unserer Schicht besitzt Pferde, und die Oberschicht interessiert sich viel zu wenig für uns, als dass sie ohne triftigen Grund durch unser Viertel reiten würde.
»Vermutlich nichts Gutes.«
Das Lächeln verschwindet aus dem Gesicht meiner Schwester und gemeinsam erheben wir uns, gehen ums Haus und suchen nach der Quelle der Geräusche. Lange müssen wir nicht Ausschau halten. Aus südlicher Richtung kommen vier, fünf, nein, es sind sogar acht Reiter. Sie schreien etwas, das wir nicht verstehen, und halten ihre Banner in die Höhe. Sie sind blau, die Farbe des Herrschers. Das heißt, es ist nicht wirklich die Farbe des Herrschers, aber sie kommt in der Natur nicht vor und es ist so kompliziert, sie herzustellen, dass nur er oder sehr wohlhabende Oberschichtler sich mit ihr schmücken.
»Was sagen sie denn?«, fragt Rina dicht an mein Ohr gepresst.
»Keine Ahnung, aber ich glaube, ich habe das Wort ›Markt‹ gehört.«
Mittlerweile stehen fast alle Nachbarn auf der Straße und beobachten gebannt, was passiert. Auch Turia, die zweite Frau unseres Vaters, und unser kleiner Bruder Toman, haben das Haus verlassen und kauern neben uns. Mehrere schwarze Strähnen hängen unserer Stiefmutter ins Gesicht und ihre braunen Augen blicken besorgt auf ihren Sohn herab. Weil er fast den ganzen Tag draußen ist und nur einen Schurz trägt, ist er sonnengebräunt. Schützend zieht sie ihn an sich und fährt ihm übers Haar, das schon lange nicht mehr auf eine einheitliche Länge gestutzt wurde.
Die Reiter teilen sich auf. Zwei von ihnen steuern weiter auf uns zu, der Rest zweigt ab. Die Menschen um uns herum beginnen, aufgeregt zu tuscheln, und obwohl niemand weiß, worum es geht, liegt Spannung in der Luft.
Endlich kommen die Boten näher und stoppen abrupt vor der Menschentraube, an deren Rand wir stehen. Dabei wirbeln sie Staub auf, der in der Luft feine Muster bildet, bevor er sich vor meinen Augen auflöst. Unwillkürlich frage ich mich, ob die Priesterinnen die Segnung so wahrnehmen. Denn sie können mit ihr nicht nur Gegenstände bewegen und verformen, sondern die Welle des Klangs, die all das bewirkt, auch sehen und steuern.
»Bürger von Kalasin!«, ruft einer der beiden Reiter. »Unser Herrscher, Cyr der Siegreiche, hat seinen Untertanen etwas kundzugeben. Die gesamte Bevölkerung der Stadt wird aufgefordert, sich unverzüglich auf dem Marktplatz zu versammeln.«
»Was hat er uns denn zu verkünden?«, fragt einer unserer Nachbarn.
Der andere Bote hebt abwehrend seine Hand, antwortet aber nicht. Dann reiten die beiden Männer einfach davon und lassen uns ratlos zurück.
Rina umklammert meinen Arm und lehnt sich an mich. »Was meinst du, worum es geht?«
»Krieg«, höre ich immer wieder aus dem Stimmengewirr um uns herum. Nachdenklich versuche ich, mich an die letzte Kundgebung, bei der ich dabei war, zu erinnern. Es ist Jahre her und die Bilder in meinem Kopf schon etwas verblasst, aber sie passen zu dem, was die meisten hier denken. Krieg. Damals wurde allen Handwerkern auferlegt, extra Rationen für die Armee zu produzieren und abzugeben. Die Schlachten tobten weit entfernt von Kalasin, doch an die langen Tage, die schmerzenden Hände und Arme erinnere ich mich gut.
»Livi«, sagt meine Schwester und schüttelt mich. »Glaubst du, die Leute haben recht?«
»Wir werden es bald herausfinden«, erwidere ich sanft. »Wo ist Vater?«
Rinas Blick ist Antwort genug.
»In der Schänke?«
Sie nickt und Turia antwortet für sie: »Er wird von dort sicher direkt zum Marktplatz kommen.«
Manchmal frage ich mich, wie sich Turia freiwillig ein Leben mit meinem Vater aussuchen konnte. Bei meiner Mutter habe ich es noch verstanden. Denn damals – vor ihrem Tod – war er ein anderer Mann. Aber heute …
»Dann lasst uns gehen«, schlage ich vor.
Toman streckt seine Hand nach seiner Mutter aus. Normalerweise macht er das schon lange nicht mehr, doch die gedrückte Stimmung hier in der Siedlung lässt ihn kindlicher erscheinen, als er eigentlich ist. Rina hakt sich bei mir unter und gemeinsam folgen wir dem Tross, der sich mit uns auf den Weg zum Marktplatz begibt.
Obwohl es beängstigend ist, dass der Herrscher so viel Macht über uns hat, ich vertraue Cyr. Er ist hart, aber gerecht. Palente ist ein sicheres Land und niemand leidet Hunger. Glaubt man den Geschichten der Älteren, ist das nicht selbstverständlich und war nicht immer der Fall. Ein flaues Gefühl breitet sich in mir aus. Was, wenn wir gerade alle zurück in diese grauen Zeiten steuern?
2
Je näher wir dem Marktplatz kommen, desto größer werden die Häuser. Sie bestehen aus Stein, nicht aus Lehm wie die in unserer Siedlung, und scheinen eine einschüchternde Wirkung auf die Menschen um mich herum zu haben. Doch während die Bewohner aus meiner Schicht vor Furcht gebeugt gehen, wird meine Haltung mit jedem Schritt aufrechter. Hier im Innenbezirk lebe ich auf. Ich betrachte die monumentalen Säulen, die den Marktplatz einfassen, und fühle mich mit ihnen verbunden. Denn jeder einzelne dieser großen Steine wurde mithilfe der Segnung aus den Granitsteinbrüchen im Osten aus den Felsen gelöst, geformt und hier wieder aufgetürmt.
Gemeinsam halten wir Ausschau nach Vater und finden ihn neben dem Wirt und dem Gerber. Selbst aus der Entfernung kann ich seine vom Bier geröteten Wangen und die Flecken auf seiner Tunika erkennen.
Turia und Toman stürmen auf ihn zu, doch ich wende mich an meine Schwester. »Lass uns ganz nach vorn gehen.«
»Seit wann bist du so neugierig?«
Vermutlich ist es der Wunsch nach etwas, das die Eintönigkeit meines Lebens durchbricht – wenn auch nur kurz. »Du denn nicht?«
Rina zuckt mit den Schultern und wendet sich nach dem Rest unserer Familie um. Vater winkt jedoch ab, bedeutet uns, ruhig ohne sie weiterzulaufen.
So voll wie heute ist der Marktplatz sonst nicht einmal bei Hinrichtungen. Und die sind wahre Attraktionen. Aber im Gegensatz zu einer Kundgebung des Herrschers sind sie auch keine Pflicht. Wir setzen uns in Bewegung und ergattern einen Platz nur wenige Schritte von der Tribüne entfernt. Seitlich von ihr sitzt die Oberschicht bereits auf den für sie vorgesehenen Steinbänken. Im Gegensatz zu uns mutet man ihnen nicht zu, einfach zu stehen – eines der wenigen Dinge, um die ich sie nicht beneide. Dazu bin ich zu gern aktiv.
Eine Handvoll Soldaten tritt auf die Tribüne. Sie alle wirken stark und anmutig, doch nur einer von ihnen erregt meine Aufmerksamkeit.
Natürlich entgeht das meiner Schwester nicht. »Wie ich sehe, genießt du die Aussicht. Aber wenn du nicht gleich deinen Mund schließt, wird eine Biene hineinfliegen.«
Verlegen wende ich meinen Blick von der Tribüne zu Rina. »Ich starre nicht ihn an, sondern seine Rüstung.«
Wieder einmal quittiert sie meine Äußerung mit einer hochgezogenen Augenbraue. »Selbstverständlich.«
Ich will gar nicht leugnen, dass er attraktiv ist, aber … »Im Ernst. Er sieht kaum älter aus als wir, ist aber total dekoriert.« Während die restlichen Soldaten eine einfache schwarze Rüstung über ihrer saphirblauen Tunika tragen, ist seine zusätzlich mit goldenen Ornamenten verziert.
»Und muskelbepackt.«
Seufzend verschränke ich meine Arme vor der Brust. »Du weißt, dass mich so was nicht interessiert.«
»Ja«, antwortet sie und nickt bedächtig. »Manchmal kann ich gar nicht glauben, dass wir verwandt sind.«
Rinas liebster Zeitvertreib war es schon immer, den Jungen in der Siedlung den Kopf zu verdrehen. Für mich sind Männer nur Hindernisse, die zwischen mir und meiner Freiheit stehen. Zwischen mir und meinem Traum, meine Segnung zu beherrschen. Meine Schwester wird das nie verstehen können. »Ich habe eben andere Interessen.«
Gequält lächelt sie. »Ich weiß. Aber du solltest nicht vergessen zu leben und zu lieben.«
»Ich …«, setze ich an, verstumme jedoch, als die Sänfte des Herrschers auf der Tribüne abgesetzt wird. Er trägt ebenfalls eine blaue Tunika, doch seine Rüstung ist komplett vergoldet und genau wie seine Krone mit funkelnden Saphiren besetzt.
Cyr steigt aus seiner Sänfte und mit seinem Auftritt erstirbt jedes andere Geräusch. Er hebt seine Arme, streckt sie seinem Volk entgegen und die Menge jubelt ihm zu. Auch ich kann mich dem nicht entziehen und applaudiere. Ich lasse meinen Blick kurz zu meinem Vater wandern und sehe seine hassverzerrten Augen. Er gibt dem Herrscher die Schuld am Tod meiner Mutter. Als hätte dieser den Befehl gegeben … Sie starb in seinem Dienst, im Dienst an ihrem Volk. Und ich bin mir sicher, sie würde Vaters Groll gegen Cyr nicht gutheißen. Denn sie glaubte an ihn und seine Vision für Palente.
»Bürger von Kalasin«, begrüßt er uns und erntet für diese drei Worte erneuten Beifall. Als er abflaut, fährt er fort: »Palente lebt in einem nie da gewesenen Wohlstand, und ihn zu erhalten ist meine oberste Priorität. Doch wie die meisten von uns wissen, hat es die Göttin dieses Jahr nicht gut mit uns gemeint und uns eine Dürre geschickt.«
Um mich herum nicken die Menschen mit betrübter Miene und ich folge ihrem Beispiel. Die Bauern sprechen über nichts anderes mehr, und viele der Brunnen in Kalasin mussten tiefer gegraben werden.
»Die gute Nachricht ist: Für unser Volk besteht kein Grund zur Sorge. Unsere Kornspeicher sind prall gefüllt, und die diesjährige Ernte wird zwar mager, aber nicht komplett ausfallen.« Cyrs Miene wird ernst. »Doch leider habe ich auch eine schlechte Nachricht. Denn während wir in den letzten Jahren vorausschauend gewirtschaftet haben und deshalb eine Katastrophe abwenden können, hat Tritevo dies nicht getan.«
»Unzivilisierte Bestien«, zischt ein Mann neben mir verächtlich.
Ich bin noch nie jemandem aus einem Land außerhalb Palentes begegnet, und wenn von dem, was man sich über unsere Nachbarn erzählt, nur die Hälfte wahr ist, möchte ich es auch lieber nicht.
»General Cristan, erzählen Sie dem Volk von Ihren Beobachtungen«, fährt der Herrscher fort.
Der hochdekorierte Soldat tritt neben Cyr, verneigt sich vor ihm und Rina knufft mir in die Seite. »Jetzt haben wir sogar einen Namen zu den Muskeln.«
Sanft schüttele ich den Kopf, bedeute ihr zu schweigen und will hören, was dieser junge General zu sagen hat.
Aufrecht und stolz steht er neben dem Herrscher. »Ich komme gerade mit einem Spähtrupp aus Tritevo zurück, und was wir dort gesehen haben, ist äußerst beunruhigend. Da das Land – im Gegensatz zu uns – nicht über Bewässerungsanlagen verfügt, hat die Dürre dort schlimmer zugeschlagen. Die Speicher des Landes sind so gut wie leer, die Schmieden hingegen arbeiten unermüdlich.« Er lässt seinen Blick einmal über die Menge schweifen, als wollte er sicherstellen, dass jeder hört, was er zu sagen hat. »Für uns lässt dies nur einen Schluss zu: Tritevo rüstet auf und will uns unsere Vorräte streitig machen. Das bedeutet Krieg.«
Krieg. Da ist das Wort wieder. Die Menschen wirken plötzlich ein paar Nuancen blasser, und obwohl es auch mich beunruhigen sollte, tut es das nicht. Im Gegenteil. Etwas wird sich ändern und ich fühle mich bereit dafür.
Cyr nickt dem General zu und ergreift das Wort. »Bürger von Kalasin. Was General Cristan eben mit euch geteilt hat, klingt beunruhigend, doch es besteht kein Grund zur Sorge. Wir fürchten uns nicht vor Tritevo, und sollten sie uns angreifen, werden wir zurückschlagen und sie besiegen.«
Die Menschen um mich herum beginnen zu klatschen und zu jubeln.
Mit einer beschwichtigenden Geste sorgt der Herrscher für Ruhe. »Trotzdem werden wir nicht leichtsinnig sein, sondern Maßnahmen ergreifen. Obwohl unsere Armee stark und gut ausgerüstet ist, werden auch wir die Produktion unserer Waffen verstärken. Hierzu muss jeder Bürger seinen Beitrag leisten, und dieser Beitrag erfolgt in Form einer Steuer auf Getreide. Bei jeder Abholung aus dem Kornspeicher wird der zwanzigste Teil davon als Steuer einbehalten.«
Nun jubelt niemand mehr.
»Für Palente!«, ruft Cyr und reckt seine Hände in die Luft.
Während die Zuschauer verhalten klatschen, steht in ihren Gesichtern der blanke Horror. Und ich muss mir ebenfalls eingestehen – dafür bin ich nicht bereit. Wir verkaufen ein Brot für einen Kupferling. Niemand würde zwei bezahlen. Und ein Großteil der Bürger Kalasins wird vom Kornspeicher aus bezahlt. Wenn ihnen künftig der zwanzigste Teil fehlt, ist fraglich, wie viele sich überhaupt noch ein Brot für einen Kupferling leisten können. Schon jetzt müssen wir hart arbeiten, um unser Überleben zu sichern. Doch in Zukunft …
Ich fühle mich klein, machtlos und bin enttäuscht von Cyr. Sieht er denn nicht, wie hart diese Steuer uns Menschen in der Unterschicht trifft? Oder schlimmer: Sieht er es und es ist ihm egal?
»Du dreckiger Bastard!«, höre ich jemanden aus der Masse schreien und zucke zusammen. Ich kenne die Stimme und bete, dass sie sofort wieder verstummt. »Erst meine Frau, jetzt meine Lebensgrundlage. Was willst du mir noch nehmen, du dreckiger Bastard?«
»Vater?«, fragt Rina mit geweiteten Augen neben mir.
»Ja«, antworte ich knapp und suche ihn in der Menge. Als ich ihn erfasse, ist er bereits von Soldaten umzingelt, die ihn nach vorn zerren. Turia versucht erfolglos, sie daran zu hindern. Die Männer schleifen ihn auf die Tribüne und werfen ihn dort vor den Füßen des Herrschers zu Boden.
Cyr sieht ungerührt auf ihn herab und spricht mit eiskalter Stimme: »Palente ist Palente, weil es Dinge gibt, die ich nicht dulde.« Er dreht seinen Kopf zur Seite. »Cristan.«
Schneller als ich blinzeln kann, zieht der General sein Schwert aus der Scheide. Die Klinge glänzt fast unwirklich über dem Kopf meines Vaters.
»Livi, tu was«, fleht meine Schwester mich an.
»Stopp!«, schreie ich und renne los, ohne genauer darüber nachzudenken. Kurz bevor ich die Tribüne erklimmen will, versperrt mir ein Soldat den Weg. »Bitte nicht!«
»Er weiß nicht, was er da spricht«, höre ich Turia in meinem Rücken.
»Ich bin seine Tochter«, sage ich zu dem Soldaten und schiebe mich an ihm vorbei.
Der General hält inne, senkt sein Schwert und sieht mich an.
Bis zu diesem Augenblick dachte ich immer, ich hasse meinen Vater. Jetzt, da ich ihn hier auf dem Boden liegen sehe, empfinde ich zum ersten Mal Mitleid mit ihm. »Ich bitte Euch, verschont sein Leben! Es ist die Trauer, die aus ihm spricht. Er hat seine Frau im Krieg verloren und ist seitdem nicht mehr er selbst.«
»Frau im Krieg?«, wiederholt der General, als würde das überhaupt keinen Sinn ergeben. »Eine Gesegnete?«
Ich nicke und schicke eine stumme Bitte hinterher.
Cyr kneift seine Augen zusammen und betrachtet meinen Vater und mich näher. »Amara«, spricht er leise den Namen meiner Mutter aus.
Obwohl auch ich wütend auf ihn sein will, erfüllt es mich mit Stolz, dass er sie noch kennt. »Ja«, bestätige ich.
Mit erhobener Hand weist der Herrscher den General zurück. Dann wendet er sich an meinen Vater und gleichzeitig an sein Volk. »Eigentlich verdienst du, dass dir der Kopf abgeschlagen wird. Auf der Stelle.« Er seufzt. »Aber weil deine Frau Palente wertvolle Dienste geleistet hat, verschone ich dein Leben. Stattdessen«, fügt er mit erhobenem Zeigefinger hinzu, »entziehe ich dir hiermit den Status als Bürger.«
Ich schlage mir die Hände vors Gesicht. Ein Teil von mir ist erleichtert, dass mein Vater noch lebt, der andere denkt sich, er hätte ihn besser gleich töten sollen. Denn entbürgert sein ist nicht mehr als der Tod auf Raten. Man hat keine Rechte und jeder Oberschichtler kann jederzeit bedingungslos über einen verfügen. Ich an seiner Stelle würde jetzt vermutlich darum betteln, dass man mir lieber den Kopf abschlägt. Doch mein Vater ist nicht ich und erhebt sich stattdessen kleinlaut, um die Tribüne zu verlassen.
»Danke für Eure Gnade«, erwidere ich stellvertretend für ihn.
Wie angewurzelt stehe ich da. Die dichten Augenbrauen des Generals ziehen sich zusammen und seine grünbraunen Augen funkeln mich finster an. Womöglich habe ich ihm gerade seinen Spaß verdorben. Mir liegen ein Dutzend Dinge auf der Zunge, die ich ihm gern sagen würde, doch bevor mein Kopf hier zur Debatte steht, lasse ich es lieber und verlasse ebenfalls das Geschehen.
Am Fuß der Tribüne steht meine gesamte Familie versammelt. Der Schrecken steht Rina und Toman ins Gesicht geschrieben. Lediglich Turia wirkt erleichtert und zieht mich an sich. »Danke«, haucht sie mir ins Ohr, während sich mein Vater abwendet und mich keines Blickes würdigt.
Wie sehr ich mir gerade das Leben zurückwünsche, das ich heute Morgen noch so gehasst habe.
3
Schweigend und ohne Vater gehen wir nach Hause. Ob er direkt zurück in die Schänke ist, um seine letzten Kupferlinge zu vertrinken, oder ob ihn bereits ein Oberschichtler für niedere Tätigkeiten eingespannt hat, wissen wir nicht.
Zu viert betreten wir unser Haus. Sorge steht ins Gesicht meiner Stiefmutter geschrieben und ich teile sie.
Ich strecke meine Hand aus und lege sie auf ihren Unterarm. »Wir werden härter arbeiten müssen als vorher, aber wir schaffen das.«
»Natürlich«, bestätigt Rina, doch ich kann ihr ansehen, dass sie ihren Worten keinen Glauben schenkt.
Toman baut sich vor uns auf. »Und ich werde euch dabei helfen. Ich bin alt genug und kann mit anpacken.«
Für mich wird er vermutlich immer mein kleiner Bruder bleiben, aber er hat recht. Er ist zu jung, um sich für Mädchen zu interessieren oder um in den Krieg zu ziehen, aber zum Arbeiten ist er alt genug. Zumindest war ich das in seinem Alter.
Turia löst sich von mir und drückt ihren Sohn fest an sich. »Ja, das bist du wohl.«
»Was machen wir mit unseren Preisen?«, stelle ich schließlich die Frage, die mich am meisten beschäftigt.
»Wir können nicht mehr verlangen als die anderen Bäcker«, entgegnet unsere Stiefmutter blitzschnell.
Rina wiegt ihren Kopf hin und her. »Nicht für ein gewöhnliches Brot. Das werden wir wohl weiterhin für einen Kupferling verkaufen müssen. Aber die Menschen aus der Oberschicht fragen immer wieder nach besonderen Broten.«
»Besondere Brote?«, hake ich nach.
»Ja, welche mit Gewürzen oder Früchten, ausgefallen geformte … besonders eben. Dafür würden sie bestimmt zwei oder sogar drei Kupferlinge zahlen.«
Während Turia skeptisch die Stirn runzelt, nicke ich zustimmend. Meine Schwester ist täglich auf dem Markt, verkauft unsere Ware und ist mit den Menschen im Gespräch. Ich traue ihrem Urteil und Gespür für die Lage. »Wir sollten das probieren.«
»Mit einer kleinen Menge«, stellt unsere Stiefmutter klar.
»Mit Zimt und Honig.« Toman legt eine Hand auf seinen Bauch und sein Blick wird schwärmerisch.
Fragend sehe ich zwischen Turia und Rina hin und her und beide nicken. »Mit Zimt und Honig«, bestätige ich. »Aber wo bekommen wir das her?«
»Ich kenne den Sohn des Gewürzhändlers«, erwidert meine Schwester mit einem Lächeln auf den Lippen. »Ich kann bei ihm sicher einen guten Preis für uns herausschlagen.«
Wenn das irgendwer kann, dann Rina mit ihrem Charme.
»Klingt gut. Versuchen wir es.«
Meine Schwester fährt sich durchs Haar und zupft ihr Kleid zurecht. »Ich werde gleich mal in die Schänke gehen. Normalerweise ist er immer dort. Kommst du mit?«
Unter Menschen gehen, trinken und mich amüsieren – danach ist mir selten zumute und heute noch weniger als sonst. »Vielleicht komme ich nach.«
Rina zwinkert mir zu und verabschiedet sich mit einem »Bis später!«.
Wir wissen beide, dass ich nicht nachkommen werde. Wenn ich das Haus verlasse und behaupte, in die Schänke zu gehen, schleiche ich mich meist heimlich in die Bibliothek. Denn abgesehen davon, dass der Unterschicht der Zugang verboten ist, hält mein Vater Lesen für Zeitverschwendung. Zum Glück war Segur, der Bibliothekar, mit meiner Mutter befreundet. Abends drückt er beide Augen zu und gewährt mir Zutritt.
Doch das Ende des Tages ist weit entfernt und die Wände unseres Hauses erdrücken mich. Ich muss dringend ins Freie und öffne ohne ein Wort die Tür.
»Wo willst du hin?«, fragt Turia, als ich mich auf den Weg nach draußen mache.
»Den Kamut fertig mahlen«, murmele ich, weil mir gerade tatsächlich nichts Besseres einfällt.
Missmutig stapfe ich hinters Haus. Mit dem, was mich dort erwartet, hätte ich nie gerechnet. Ein Mann steht dort und schultert die Säcke mit dem Kamut und dem Mehl – hier in Kalasin, wo es sonst kaum Verbrechen gibt. Ich kenne sein Gesicht, aber nicht seinen Namen. Jemand aus unserer Siedlung will meine Familie und mich bestehlen! Ich habe genug Geschichten gelesen, um zu wissen, dass Menschen zu Bestien werden können. Nur wusste ich nicht, dass es so schnell geht.
»Lass sofort die Säcke fallen«, fahre ich den Mann mit erstaunlich fester Stimme an.
Er blickt mich an und lacht.
Zuerst war ich geschockt und traurig, jetzt bin ich wütend. »Ich meine es ernst, ich lasse dir die Hand abhacken. Wie es sich für Diebe wie dich gehört.«
»Ich sehe kein Schwert in deiner Hand, und bis du die Stadtwache gerufen hast, bin ich längst weg, und dann steht dein Wort gegen meines.«
Wenn ich ihn jetzt fliehen lasse, können wir morgen auf dem Markt kein Brot verkaufen. Der Kamut, den er gerade stehlen will, ist unsere Lebensgrundlage, und ich werde nicht zulassen, dass er sie mir raubt. Koste es, was es wolle. »Um dir die Hand abzuhacken, brauche ich zum Glück kein Schwert.«
»Ach«, kontert er süffisant. »Machst du das etwa mit deiner spitzen Zunge?«
Anstatt ihm zu antworten, beginne ich zu singen. Ich kann nicht sagen, was sich gleich bewegen wird, dazu bin ich zu aufgebracht, aber ich hoffe, irgendetwas wird jetzt durch die Luft wirbeln. Das Mehl, das ich vor der Kundgebung des Herrschers auf dem Mahlstein zurückgelassen habe, beginnt zu vibrieren und weht hinab auf den Boden. Davon lasse ich mich nicht entmutigen und konzentriere mich nur auf meinen Klang. Er mutet etwas schief an, doch kleine Steine fliegen über den Boden und ein Blick in die Augen des Mannes verrät mir, er begreift nun.
»Du hast die Segnung«, stammelt er.
»Ja, und glaube mir, du möchtest nicht herausfinden, zu was ich alles in der Lage bin.«
Langsam nickend stellt er die Säcke ab und verschwindet.
Innerlich jubele ich. Zum ersten Mal seit dem Tod meiner Mutter habe ich wieder das Gefühl, jemand zu sein. Und es gefällt mir mehr, als es das vermutlich sollte.
Schnell laufe ich zu dem Kamut und Mehl und bringe sie ins Haus. Turia und Toman warne ich, in Zukunft nichts mehr unbewacht zu lassen, und trete anschließend wieder hinaus.
Ohne Ziel streife ich durch die Straßen und lasse unsere Siedlung und die anderen äußeren Bezirke hinter mir.
Der Marktplatz ist mittlerweile wie leer gefegt, und es fällt mir schwer zu glauben, dass genau hier vor Kurzem mein Leben so unerwartet auf den Kopf gestellt wurde. Ich gehe weiter, und die Häuser hochrangiger Beamter säumen den Weg zum Tempel der Göttin und zum Palast des Herrschers. Unwillkürlich frage ich mich, ob auch sie sich Gedanken über die heute verkündeten Einschnitte machen. Vermutlich bemerken sie es nicht einmal.
Vor der Bibliothek bleibe ich stehen. Das Gebäude ist älter als viele der Prachtbauten, die tagsüber ihren Schatten darauf werfen. Nicht ein einziges Relief ziert die Säulen am Eingang, und die Kanten der Mauern wirken, als hätte ein hungriges Tier daran genagt. Für gewöhnlich fällt mir das nicht auf und ich sehe das Gebäude so vor mir, wie es bei seiner Erbauung erstrahlt sein muss, und höre Mutters liebliche Stimme in meinem Ohr, deren Geschichten farbenfrohe Bilder vor meinem inneren Auge entstehen lassen. Heute nehme ich nichts davon wahr.
Ich trete an die Tür, die wie immer um diese Tageszeit verschlossen ist, und klopfe. Normalerweise öffnet mir der Bibliothekar, vergewissert sich, dass mich niemand sieht, und lässt mich hinein. Doch heute bleibt die Tür verschlossen. Natürlich tut sie das. An einem Abend wie diesem hat Segur sicher andere Sorgen, als mir eine Zuflucht vor meinem Alltag zu gewähren.
Enttäuscht mache ich mich auf den Weg zurück in unsere Siedlung. Schon von Weitem dringt das lautstarke Treiben in und vor der Schänke an mein Ohr. Ein Ersatz für die geschlossene Bibliothek ist dieser Ort für mich nicht. Um Rinas willen werde ich jedoch zumindest einen kurzen Blick hineinwerfen.
Eine Gruppe Männer, die nicht mehr in der Lage ist, gerade zu stehen und klar zu sprechen, steht vor dem Eingang versammelt.
»Sieh an«, sagt einer von ihnen. »Die Tochter des Entbürgerten will es heute wohl noch einmal wissen.«
Genervt musterte ich den Mann, der kaum älter ist als ich. »Nicht wirklich. Und was ist mit euch? Hat der Wirt euch schon vor die Tür gesetzt? Vor Sonnenuntergang?«
»Hier draußen ist der beste Platz.« Verächtlich schnalzt er mit der Zunge. »Aber du solltest lieber gleich wieder gehen. Mit deinem losen Mundwerk wirst du dadrinnen keinen Mann betören.«
»Das will ich hoffen«, beende ich das Gespräch und öffne die Tür. Die Schänke ist bis in den letzten Winkel mit Gästen gefüllt. Ich habe das Gefühl, die gesamte Siedlung ist heute hier, um vor der Einführung der Steuer ein letztes Mal zu feiern.
Obwohl es so voll ist, entdecke ich Rina sofort. Sie steht am Tresen und unterhält sich äußerst angeregt. Auch sie erspäht mich schnell und winkt mich zu sich. Der Gedanke, mich bis ganz nach vorn durchzudrängen und dabei an den vielen schwitzenden, bierausdünstenden Körpern vorbeizumüssen … Mit einem Kopfschütteln und einen Fingerzeig nach draußen signalisiere ich ihr, dass ich lieber heimgehe.
Rina will mich offenbar vom Gegenteil überzeugen und schiebt sich durch die Menge zu mir durch. »Du bist ja doch gekommen – wie schön! Komm mit nach vorn, ich muss dir jemanden vorstellen.«
Sie zeigt auf einen Mann, von dem ich nur die kurzen, dunklen Haare erkennen kann. »Ein anderes Mal. Du bleibst noch?«
»Natürlich. Der Abend fängt gerade erst an.«
»Dann amüsiere dich gut. Wir sehen uns später.«
»Oder morgen«, erwidert sie mit einem verschmitzten Lächeln.
Ich drücke ihr sanft den Oberarm, bevor sie sich wieder durch die Menschenmenge zurück an den Tresen quetscht.
Unser Zuhause ist der letzte Ort, an dem ich gerade sein möchte. Weil ich sonst nicht weiß, wohin mit mir, mache ich mich trotzdem auf den Weg zurück. Ich lasse mir Zeit, versuche, mich mit meinem neuen Schicksal anzufreunden, Ordnung in das Chaos in meinem Kopf zu bringen.
Und während es um mich herum dunkel wird, flammt ein Funke Hoffnung in mir auf. Ein Gedanke macht sich in mir breit und lässt mich nicht mehr los. Jetzt, da mein Vater entbürgert ist und mir nichts mehr verbieten kann, steht es mir frei, mich mit meiner Segnung in den Dienst des Herrschers zu stellen. Die Entscheidung liegt nun allein bei mir. Meine Segnung für Palente einsetzen im Tausch gegen ein Leben in der Oberschicht oder mein Leben behalten? Wären da nicht noch Rina und Toman, um die ich mich sorge – ich wäre schon auf dem Weg zum Palast.
*
Obwohl Vaters Wort von heute an keine Bedeutung mehr hat, mache ich mich zu Hause wieder über den Kamut her. Ich schleife die Säcke mit den Körnern und dem Mehl nach hinten zum Mahlstein und setze meine Arbeit fort. Wenn ich nicht dazu gezwungen werde, fühlt es sich nicht einmal halb so schlimm an. Außerdem helfen mir die monotonen Bewegungen dabei, meine Gedanken fließen zu lassen.
Selbst als das Mehl gemahlen ist, bleibe ich draußen an die Wand gelehnt sitzen. Die Sterne schmücken bereits den Himmel, als ich Rinas unverwechselbares Lachen in der Ferne höre. Schritte kommen näher – nicht nur die leichtfüßigen meiner Schwester. Ich springe auf, laufe ums Haus herum und sehe sie gemeinsam mit dem Mann aus der Schänke. Er ist groß, kräftig gebaut und stützt sie etwas.
»Du kannst gehen. Ich übernehme sie«, raune ich ihm zu und lege Rinas Arm um meine Schulter.
Nickend kehrt der Mann um und verschwindet in der Nacht.
»Livia«, begrüßt mich meine Schwester strahlend und nicht nur an ihrem Gang wird klar, dass sie wohl etwas zu viel Bier getrunken hat.
»Ist alles in Ordnung?«
Ihre Augen und Wangen leuchten so stark, dass es mir selbst im Mondschein auffällt. »Mir geht es blendend!«
»Gut.« Ich drücke sie an mich und bin froh, dass wenigstens sie glücklich ist. Das war schon immer ihre Segnung – immer glücklich sein, egal wie die Umstände auch sind.
»Und ich habe einen guten Preis für unsere Gewürze ausgehandelt.« Bei diesen Worten leuchten ihre Augen noch ein Stück mehr.
Ein schrecklicher Gedanke kommt mir. »Du hast dich doch nicht …«
»Nicht was?«
Ich räuspere mich, weiß gar nicht recht, wie ich das Thema laut aussprechen soll. »Für die Gewürze prostituiert«, flüstere ich ihr ins Ohr und meide ihren Blick.
»Nein, nicht für die Gewürze«, antwortet sie mit einer ausschweifenden, wegwischenden Handbewegung.
»Aber du hast?«
»Ssschh!« Rina legt sich einen Finger auf den Mund und schüttelt den Kopf. »Alles ist gut. Mach dir keine Sorgen um mich.«
Ihre Worte beruhigen mich nicht wirklich, doch ihr Anblick tut es sehr wohl. Sie sieht nicht aus, als hätte sie Schreckliches erlebt. Sie sieht aus wie immer. Glücklich. Wie Rina eben. Trotzdem bin ich nicht in der Lage, es darauf beruhen zu lassen. Statt ins Haus ziehe ich sie zurück an meinen Mahlplatz. »Sag mir, was los ist.«
Sie lächelt mich an, als wäre das Antwort genug. »Ich bin verliebt.«
»Verliebt?«
»Schon länger. In Mator, den Sohn des Gewürzhändlers.«
Ihr Geständnis trifft mich unvorbereitet. Dabei sollte es das nicht. Mädchen in ihrem Alter verlieben sich. Mädchen in ihrem Alter werden zu Frauen. Frauen in ihrem Alter heiraten. Und auch wenn es schwer für mich zu verstehen ist – genau das war immer Rinas Traum.
4
Ein sanfter Windhauch streicht über meinen Körper, und als ich meine Augen halb öffne, sehe ich Rina nach draußen schleichen. Müde bleibe ich liegen und drehe mich zur Seite. Viel habe ich nicht geschlafen. Schuld sind die neuen Möglichkeiten, die mir begleitet von quälenden Vorwürfen die ganze Nacht im Kopf herumgegeistert sind. Doch nun weiß ich, was ich zu tun habe, auch wenn ich vorerst Stillschweigen bewahre. Schließlich ist meine Familie dagegen, dass ich meine Segnung in den Dienst des Herrschers stelle. Vater war es schon immer und Turia ist immer seiner Meinung. Selbst bei Rina überwiegt die Angst, mich zu verlieren. Und Toman … Er ist nicht dagegen, aber er ist ein Kind und seine Meinung zählt nicht.
Gähnend strecke ich mich und richte mich auf. Das Rascheln des Strohs unter mir weckt auch den Rest der Familie. Meine Arme schmerzen von meiner langen Arbeitseinheit gestern. Mit kreisförmigen Bewegungen massiere ich meine Muskeln und verschaffe mir so etwas Erleichterung.
»Guten Morgen«, murmeln wir uns zu, obwohl jedem von uns klar ist, dieser Tag wird alles andere als gut. Vor allem nicht für Vater.
Während Rina vom Waschhaus zurückkehrt, bereitet Turia eilig eine kleine Menge Teig zu und backt erste Brote, die sie in ein Bündel packt und Vater in die Hand drückt.
Dankend blickt er jeden einzelnen von uns an. »Bis heute Abend«, sagt er und verschwindet mit seinem Proviant.
Zurück bleibt die gedrückte Stimmung im Raum, die Turia versucht zu vertreiben. »An die Arbeit, wir haben viel zu tun.«
»Ich muss noch etwas erledigen.« Ich hoffe, es klingt so beiläufig wie möglich. »Aber nachdem ich gestern genug Mehl gemahlen habe, kommt ihr sicher auch eine Weile ohne mich aus.«
»Ich weiß nicht«, setzt Turia an.
»Das war keine Frage«, unterbreche ich sie schroffer, als sie es von mir gewohnt ist.
Irritiert sieht sie mich an.
»Entschuldige«, sage ich, meine damit allerdings nur meinen Ton. »Aber meine Arbeit ist erledigt und ich bin zurück, ehe dir das Mehl ausgeht.«
»Wenn du das für richtig hältst«, erwidert sie schmallippig.
Meine Geschwister beobachten unser Wortgefecht mit großen Augen und zusammengepressten Mündern.
»Bis später«, verabschiede ich mich von ihnen und mache mich auf den Weg.
Kaum habe ich die äußeren Siedlungen hinter mir gelassen, beginnt mein Herz schneller zu schlagen. Ich erreiche den Kern von Kalasin und vor mir erhebt sich der prächtige Palast. Ein mit Säulen gesäumter Weg führt auf ihn zu, und die darin eingemeißelten Bilder erzählen die Geschichte Palentes. Als ich noch im inneren Bezirk wohnte, brachte mich mein Lehrer beinahe täglich hierher, um mir die wichtigsten Episoden einzutrichtern. Erfolgreich – an die meisten kann ich mich erinnern.
Ich lasse meine Hand über die Säule gleiten, auf der die Geschichte der Göttin erzählt wird. Wie sie Palente in größter Not beistand und mithilfe der Macht des Klangs aus Tritevos Unterjochung befreite. Und anschließend die Segnung wie einen Samen über die Palenter streute, auf dass sie in uns weitersprießt. Für mich ist es nicht nur die Geschichte des Landes, sondern meine und die meiner Mutter. Aufrecht gehe ich weiter und erklimme die Treppen, die zum Palast führen. Wie erwartet, versperren mir oben zwei bewaffnete Wachen den Weg.
»Was tust du hier?«, fährt mich einer der beiden an.
»Ich verlange eine Audienz beim Herrscher.«
»Der Herrscher ist heute nicht für die Anliegen der Unterschicht verfügbar«, antwortet der andere.
Natürlich … Schließlich hat er ja gestern schon zu uns gesprochen. »Ich möchte gar nichts von ihm. Ganz im Gegenteil. Ich habe ein Angebot für ihn, das ihn überaus interessieren wird.«
Die beiden mustern mich skeptisch und ich fürchte, ich habe mich etwas missverständlich ausgedrückt.
»Ein Angebot«, wiederholt der Erste und prüft mich weiter mit seinen Blicken, als wäre ich eine Ware.
»Nicht so eines«, stelle ich klar und bin versucht, mich abzuwenden und zu gehen.
Im gleichen Moment tritt ein Mann aus dem großen Eingangstor des Palasts und kommt direkt auf mich zu. Ich erkenne ihn sofort. Es ist der General, der gestern meinem Vater den Kopf abschlagen wollte.
»Macht sie Ärger?«, fragt er die Wachen, lässt mich dabei jedoch nicht aus den Augen.
»Nein, sie hat nur nach einer Audienz gefragt«, erklärt einer der beiden.
Der General steht nun unmittelbar vor mir. Er ist mindestens einen Kopf größer als ich und sieht auf mich herab. »Cyr war großzügiger, als er meiner Meinung nach sein sollte. Wenn du ihn jetzt anbetteln willst, dem alten Mann den Bürgerstatus zurückzugeben …«
»Was dann?« Nicht, dass ich das vorhabe, aber ich schaffe es einfach nicht, seiner Provokation zu widerstehen.
»Dann werde ich ihn persönlich davon überzeugen, doch noch einen Kopf rollen zu lassen.« Er umfasst mein Kinn und mustert mich. »Vielleicht sogar deinen hübschen.«
Ich winde mich aus seinem Griff. »Ich wollte ihn nicht anbetteln. Ich verfüge über die Segnung und möchte mich in seinen Dienst stellen.«
Plötzlich sieht er mich an, als wäre ich mit Gold überzogen. »Die Segnung.«
»Ganz genau.« Ich stemme meine Hände in die Hüften und mache mich so groß wie möglich.
»Beweis es«, fordert er mich auf.
Das musste ja kommen. Mein Blick verfängt sich in seinen Augen, und in ihnen spiegeln sich alle Farben des Waldes, Schmerz und Entschlossenheit. »Wenn Ihr mich so anstarrt, kann ich mich nicht konzentrieren.«
Kopfschüttelnd grinst er mich an. »Wenn hier jemand starrt, dann du. Ich beobachte nur. Und ich bin ein General, du solltest mich mit dem gebührendem Respekt anreden.«
Anstatt darauf etwas zu erwidern, beginne ich zu singen. Um mich herum finde ich keine kleinen Gegenstände und alles, worauf ich mich fokussiere, ist der General. Sein Umhang flattert und das Schwert, das an einem Gürtel um seine Hüften hängt, beginnt zu vibrieren. Er umfasst das Heft, schließlich weiß er nicht, dass ich es vermutlich gar nicht schaffen würde, es vollständig aus der Scheide zu befreien. Unsicher, ob er damit schon zufrieden ist, verstumme ich.
»Wie es aussieht, hast du nicht gelogen.«
»Dann bringt Ihr mich zu ihm?«
Er legt seinen Kopf schief und lächelt. »Das könnte ich.«
Das hier ist sinnlos. Resigniert werfe ich die Hände in die Luft, drehe ihm den Rücken zu und gehe die Stufen hinab.
»Gibst du so schnell auf?«
Ich bleibe stehen und sehe über die Schulter zu ihm. »Hat man als General nichts Besseres zu tun, als junge Frauen zu necken?«
Er lächelt schief und kommt auf mich zu. »An manchen Tagen nicht.«
»Soll ich auf die nächste Audienz für die Unterschicht warten oder bringt Ihr mich jetzt zum Herrscher?« Langsam drehe ich mich wieder zu ihm.
»Ich könnte …«
Meine Zeit nicht verschwenden? Aufhören, Spiele zu spielen? Ungeduldig wippe ich auf meinen Ballen auf und ab.
Nachdenklich fährt er sich durch seine langen, braunen Haare. »Warum eigentlich nicht? Folge mir.«
Das lasse ich mir nicht zweimal sagen und betrete hinter ihm den Palast. Seit meiner Kindheit war ich nicht mehr hier, doch es sieht noch genauso aus, wie ich es in Erinnerung habe. Der Boden ist mit poliertem Marmor ausgelegt und an den Wänden prangen opulente Gemälde der Herrscherfamilie und ihrer Schlachten. Alles ist mit Gold verziert und ich frage mich, wie viele Säcke Kamut allein der Schmuck in der Eingangshalle wohl wert ist.
Der General marschiert mit großen Schritten durch den Raum und ich bleibe dicht hinter ihm. Als wir den Thronsaal betreten, verneigt er sich und ich tue es ihm gleich.
»Mein Herrscher«, setzt er an. »Diese junge Frau verfügt über die Segnung und möchte sie in Euren Dienst stellen.«
Cyr winkt mich zu sich heran und ich gehorche seinem stummen Befehl. Sein vergoldeter Thron steht auf einem Podest und über ihm flattern blaue Banner, auf denen vier Sterne ein Trapez bilden. Es ist das Sternenbild Gav, das die Regentschaft seiner Familie einläutete. Am Fuße des Podests bleibe ich stehen und verbeuge mich erneut.
»Du bist das Mädchen vom Markt. Du bist Amaras Tochter.« Alles an Cyr scheint zu strahlen. Seine schwarzen Locken, die goldene Krone und das massive Amulett mit dem größten Saphir, den ich je gesehen habe, an seinem Hals.
»Cyr der Siegreiche«, setze ich an und nicke. »Ich verfüge ebenso wie meine Mutter über die Segnung, und ich möchte sie in Euren Dienst stellen.« Ich pausiere kurz und sammele mich, ehe ich meine Forderung vorbringe. »Im Tausch gegen ein Leben in der Oberschicht für mich und meine Familie.«
Der Herrscher legt eine Hand an seinen Kinnbart und streicht ihn glatt. »Interessant.«
Nervös zupfe ich an dem herabbaumelnden Stoffgurt meines Kleides herum und hoffe, dass er endlich weiterspricht.
»Wie alt bist du, Tochter von Amara?«
Für die Menschen in der Unterschicht gibt es so etwas wie Alter nicht. Solange Kinder gesäugt werden, sind sie Babys, danach Kinder. Mädchen, die ihre Menstruation bekommen, werden Frauen. Jungen, die in den Stimmbruch kommen, werden Männer. Mehr wird nicht gezählt, mehr spielt keine Rolle. Deshalb muss ich kurz überlegen und mithilfe meiner Finger zählen. Ich war in meinem sechsten Sommer, als meine Mutter starb und im zehnten, als wir in unsere Siedlung zogen, weil Vater das Geld, das ihm der Herrscher nach Mutters Tod hat zukommen lassen, bereits vertrunken und verspielt hatte. »Ich bin siebzehn Sommer«, sage ich schließlich. »Und ich heiße Livia.«
Unwillkürlich werfe ich einen kurzen Schulterblick zum General, der den Kopf schüttelt, als wäre es ein Fehler gewesen, meinen Namen zu nennen.
Der Herrscher lehnt sich in seinem Thron zurück und seine Ellen ruhen auf den Armlehnen. »Warum erfreust du mich nicht mit einer Kostprobe?«
»Sehr gern.« Ich wische meine schweißnassen Hände am rauen Stoff meines Kleids trocken und hole einmal tief Luft. Verzweifelt suche ich im Raum nach kleinen Gegenständen. Auf einem Tisch neben dem Herrscher stehen ein Bierkrug und Becher neben einer Schale mit Beeren.
»Einen Moment.« Mit einer entschuldigenden Geste steige ich auf das Podest und greife nach der Schüssel. Natürlich ernte ich dafür ein erneutes Kopfschütteln vom General, aber ich muss sie vom Krug separieren und in der Hand halten. Nicht, dass ich dem Herrscher am Ende das Bier versehentlich ins Gesicht kippe.
Wieder am Fuß des Podests angekommen, lasse ich die ersten Töne von Mutters Lied erklingen. Meine Augen fixieren die Beeren und die obersten beginnen, sich zu erheben. Ich singe lauter weiter und die roten Kugeln wirbeln durch die Luft. Sie tanzen, wechseln ihre Partner und formieren sich ständig neu. Ich werde leiser und versuche so, den Beeren zu befehlen, zurück in die Schale zu schweben. Nur ein Bruchteil von ihnen gehorcht mir und die meisten der dunkelroten Früchte liegen nun vor meinen Füßen und auf dem Podest. Immerhin habe ich es geschafft, den Herrscher nicht damit zu besprenkeln.
»Schenke mir einen Becher Bier ein«, fordert Cyr mich auf.
Mit meiner Segnung? »Ich … Ich … Das kann ich nicht.«
Der Herrscher verzieht seinen Mund. »Wurdest du ausgebildet?«
»Nein«, antworte ich und senke kurz den Kopf.
Cyr reibt sich müde die Augen. »Du bist schon zu alt.«
»Zu alt?«, wiederhole ich.
»Ja, zu alt. Ich habe keine Verwendung für dich.«
»Aber …« Wie kann man zu alt für seine Segnung sein? »Amara war sehr mächtig und ich weiß, ich kann es auch sein. Ich werde hart an mir arbeiten. Härter als jede andere Gesegnete. Bitte, gebt mir die Möglichkeit, mich zu beweisen.«
Er verschränkt die Arme vor der Brust und mustert mich eingehend von oben bis unten.
»Ich werde euch nicht enttäuschen«, setze ich nach.
»In Ordnung. Ich gebe dir die Möglichkeit. Dir allein. Ich werde nicht zusätzlich zu deiner teuren und trotzdem ungewissen Ausbildung noch deine Familie in die Oberschicht erheben und durchfüttern.«
»Euer Angebot ehrt mich, mein Herrscher. Doch ich kann meiner Familie nicht den Rücken kehren. Jetzt, da mein Vater nicht mehr für sie sorgen kann, muss ich das tun.« Obwohl es mir das Herz bricht, ich kann sie nicht im Stich lassen – vor allem Rina und Toman nicht.
»Das ist nobel von dir. Solltest du es dir anders überlegen, mein Angebot steht.« Der Herrscher nickt dem General zu, der mich augenblicklich am Oberarm packt und aus dem Thronsaal schleift. Und er muss mich schleifen, denn ich fühle mich selbst nicht imstande zu gehen.
»Bist du völlig von Sinnen?«, fragt er, während wir den Palast durch das Haupttor verlassen und an den Wachen vorbei die Stufen nach unten nehmen. Dabei klingt er eher neugierig als vorwurfsvoll.
Am Fuß der Treppe bleiben wir stehen. »Weil ich abgelehnt habe?«
Er nickt und löst seinen Griff. »Du musst deine Familie sehr lieben, wenn du auf diese Gelegenheit verzichtest.«
Ich lache laut auf. »Eigentlich nur meine Schwester und meinen kleinen Bruder.«
Mit vor der Brust verschränkten Armen mustert mich der General, als wäre ich ein Kind, das etwas angestellt hat, und er müsse sich überlegen, wie er mich nun bestraft. Dabei bleibe ich erneut an seinen Augen hängen. Sie wecken eine Sehnsucht in mir, die ich nicht näher benennen kann. Vielleicht ist es nur der Wunsch, mal wieder durch einen Wald zu streifen. Aber noch mehr fühlt es sich wie ein Verlangen nach Abenteuer an, nach einem Leben, das so viel voller ist als meines. Ich wende meinen Blick ab, aus Angst davor, wo meine Gedanken mich sonst hinführen.
»Komm«, fordert mich der General plötzlich auf.
Zögerlich sehe ich zu ihm. »Wohin?«
»In den Tempel. Ich will prüfen lassen, wie viel Potenzial deine Segnung hat.«
Das kommt unerwartet. »Warum tut Ihr das, General?«
»Spielt das denn eine Rolle?«
Zaghaft schüttele ich den Kopf.
»Gut. Aber nenn mich Cristan. Und lass doch besser diese respektvolle Anrede. Aus deinem Mund klingt das … Egal. Lass es einfach.« Lächelnd streckt er mir seine Hand entgegen. »Wollen wir?«
Ohne zu zögern, greife ich nach ihr. Sie ist überraschend warm und weich. »Sehr gern, Cristan.«
5
Gemeinsam mit Cristan überquere ich den großen Platz zwischen Palast und Tempel. Vielleicht war die angebotene Hand nur eine höfliche Geste und ich sollte sie loslassen. Doch ich kann nicht. Sein fester Griff gibt mir Kraft und Mut, verhindert, dass ich den Verstand verliere.
Obwohl heute der Tag sein könnte, an dem meine Träume wahr werden, fällt es mir schwer, daran zu glauben. Nicht nur die Absage des Herrschers lässt mich zweifeln, bereits der Anblick des Tempels löst Furcht in mir aus. Der Gedanke an Honoria, die Hohepriesterin … Wenn mein Schicksal allein von ihrem Wort abhängt, bin ich verloren. Einst waren sie und meine Mutter beste Freundinnen, befanden sich gemeinsam in der Ausbildung im Tempel. Aber etwas entzweite die beiden, machte aus den Freundinnen Rivalinnen. Über die Gründe kann ich nur spekulieren.
Mama sagte stets: »Das erzähle ich dir später.« Aus später wurde nie.
Cristan beschleunigt neben mir seine Schritte und zieht mich hinter sich her, als hätte er Angst, der Tempel könnte wegrennen. Ich folge ihm stumm. Was auch immer ihn dazu bewogen hat, sich für meine Segnung zu interessieren – ich möchte ihn nicht davon abbringen.
Der Tempel vor uns sieht aus wie das geschrumpfte Ebenbild des Palasts. Zumindest der lang gezogene Eingangsbereich, dessen Dach von Säulen getragen wird. Diese Mauern und alles, was ich mit ihnen verbinde, rauben mir den Atem.
Wir erreichen die Treppe, und während Cristan die erste Stufe nimmt, schrecke ich zurück, lasse seine Hand los und bleibe an ihrem Fuß stehen.