
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Julia ist zu kurz geraten für ihr Alter. Sogar ihr zwei Jahre jüngerer Bruder ist größer als sie. Als ihre Mutter sie zu einem Casting für die Musical-Produktion von "Der Zauberer von Oz" anmeldet, fragt sie sich, wozu. Sie kann weder singen noch tanzen – und sie ist … nicht groß. Doch Julia ist schnell verzaubert von der aufregenden Theaterwelt. All die ungeahnten Möglichkeiten und Inspirationsquellen! Julias Selbstbild ändert sich von Grund auf: Spielt es wirklich eine so große Rolle, welche Körpergröße man hat? Kommt es nicht vielmehr darauf an, wer man ist und was einen als Künstler ausmacht? Julia wachsen buchstäblich Flügel, und das nicht nur in ihrer Rolle als Fliegender Affe.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 320
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Julia ist zu kurz geraten für ihr Alter. Als ihre Mutter sie zu einem Casting für die Musical-Produktion von Der Zauberer von Oz anmeldet, fragt sie sich, wozu. Sie kann weder singen noch tanzen – und sie ist … nicht groß. Doch sie ist schnell verzaubert von der aufregenden Theaterwelt. All die ungeahnten Möglichkeiten und Inspirationsquellen! Spielt die Körpergröße wirklich eine so große Rolle bei allem? Kommt es nicht viel mehr darauf an, wer man ist und was alles in einem steckt? In diesem Sommer wachsen Julia buchstäblich Flügel!
Holly Goldberg Sloan
Short
Aus dem Englischen von Katharina von Savigny
Carl Hanser Verlag
Für Harold Arlen, E. Y. Harburg und Frank L. Baum
&
Für alle, die Teil des Carnegie Theaters an der Universität von Oregon waren
Eins
Ich schaue ziemlich oft nach oben.
Meine Eltern sind nicht klein. Meine Mum ist sogar eher groß. Aber Grandma Däumling (ja, wir nennen sie wirklich so) ist winzig. Ich bin nicht besonders gut in Bio, aber manchmal überspringen die Gene eine oder zwei Generationen und bringen die ganze Sache ziemlich durcheinander. Vielleicht, damit man eine bessere Beziehung zur älteren Generation aufbauen kann.
Eines Abends, ich war in der dritten Klasse, merkte ich, dass ich Halsschmerzen bekam. Ich ging runter, um nach einem Halsbonbon zu fragen, oder wenigstens ein Glas warmes Salzwasser zum Gurgeln zu bekommen. Wenn vom Nachtisch ein Erdnussbutter-Cookie übrig war, würde der vielleicht auch helfen. Meine Eltern saßen noch im Wohnzimmer, und ich hörte, wie mein Vater gerade sagte: »Gott sei Dank ist Julia ein Mädchen. Stell dir vor, sie wäre ein Junge und derart zu kurz geraten!«
Ich blieb wie angewurzelt stehen. Sie redeten über mich.
Ich war sicher, Mum würde jetzt sagen: »Also hör mal, Glen, so kurz geraten ist sie nun auch wieder nicht!« Aber das tat sie nicht. Sie sagte: »Ja, oder? Meine Mutter ist schuld. Däumling hat ihr das angetan.« Und dann lachten sie beide.
Man hatte mir etwas angetan.
Wie ein Verbrechen.
Jemand war schuldig.
Ich weiß, dass sie mich total lieb haben, aber ich bin zu kurz geraten und sie nicht. Bis zu diesem Augenblick hatte ich nicht gewusst, dass meine Körpergröße ein Problem für sie war. Ihre Worte lagen wie Blei auf meinen Schultern, dabei hatte ich nicht mal einen Bademantel an. Es war ein Gefühl wie Sand in nassen Schuhen oder so ein Wuschelknoten im Haar, der sich nicht rauskämmen lässt, weil Kaugummi drin klebt. Außerdem war ihre Bemerkung teilweise sexistisch, und das ist auch nicht okay.
Ich bin wieder nach oben in mein Zimmer gegangen und hab nicht mehr nach einer Lutschtablette gefragt. Ich schlüpfte unter die Bettdecke zu meinem Hund Ramon. Er schlief mit dem Kopf auf meinem Kissen. Als wir ihn bekommen haben, durfte er noch nicht aufs Bett. Aber bei Hunden gelten Regeln nicht so wie bei Menschen. Ich flüsterte Ramon ins Ohr: »Ich werde das Wort ›kurz‹ nie wieder in den Mund nehmen.«
Ich ahnte nicht, wie schwer das werden würde.
Tatsache ist: In der Schule bin ich auf Gruppenbildern immer in der ersten Reihe. Keiner aus der Klasse – auch meine besten Freundinnen nicht – wählt mich in seine Mannschaft, wenn wir Basketball spielen. Ich kann gut passen, bin aber zu leicht zu blocken.
Bei Familienausflügen sitze ich in der dritten Reihe, auf dem Platz ganz hinten. Ich kann mich leichter zwischen die Koffer quetschen, und außerdem macht es mir nichts aus, gegen die Fahrtrichtung zu sitzen.
Ich brauche einen Tritt, um an die Wassergläser in der Küche zu kommen, und ich bin noch nicht zu groß, um durch die Hundeklappe ins Haus zu kriechen, wenn wir uns zufällig ausgesperrt haben. Und das passiert öfter, als man denkt.
Grandma Däumling nennt mich den Familienterrier. Sie behauptet, Terrier sind vielleicht klein, aber zäh. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Ich kannte nämlich nur einen einzigen Terrier wirklich, Riptide hieß er, und der war bissig.
Bis vor sieben Wochen hatten wir Ramon.
Der war kein Terrier.
Er war schwarz-weiß gepunktet und nicht reinrassig. Eine »Promenadenmischung«. Das Wort mag ich aber nicht. Es hat einen negativen Beigeschmack, das heißt, man kann sich etwas Schlechtes dabei denken. Manche Leute hielten ihn für eine Pitbullmischung, weil er einen ähnlichen Körperbau und einen großen Kopf hatte. Ich mag ihn aber nicht so einordnen.
Er stammte aus dem Tierheim, und wir hatten ihn an einem Parkplatz übernommen, neben einem Wochenmarkt, wo das Tierheim regelmäßig einen Stand hat. Er war der absolut beste Hund auf der ganzen Welt. Wir hatten ihn über fünf Jahre, und dann, vor anderthalb Monaten, ist er auf Papas Sessel rauf (ich weiß gar nicht, wieso der Sessel so heißt, auf den setzen wir uns nämlich alle, sogar der Hund, wenn es keiner sieht). Jedenfalls war Ramon auf dem Sessel, also auf dem einzigen Platz, auf dem er nicht sitzen sollte.
Das Sofa ist okay, weil da eine Decke drauf liegt, und die kann man waschen. Papas Sessel aber ist ein Ledersessel.
Ich kam also rein und sagte: »Ramon, runter da!«
Er verstand viele Wörter, z. B. »Leckerli!« und »Sitz!« und »Lauf!« und »Eichhörnchen!« und »Platz!«, aber an dem Tag reagierte er, als hätte er noch nie irgendeinen Laut gehört. Er schaute ganz starr geradeaus, und dann knickte irgendwie sein ganzer Körper ein. So als hätte er einen elektrischen Schlag bekommen.
Hinterher haben wir erfahren, dass er herzkrank war. Was auf dem Sessel passierte, war die Folge davon.
An dem Abend ist Ramon gestorben, beim Tierarzt, eingewickelt in meine grüne Lieblingsdecke.
Wie alt er war, wissen wir nicht, weil wir ihn ja adoptiert hatten. Wir wissen bloß, dass wir ihn mit jeder Faser unseres Herzens liebten.
Ich warte immer noch darauf, dass er gleich um die Ecke kommt. Ich gehe ins Wohnzimmer und denke, da sitzt er jetzt auf dem Sofa. Oder in der Küche, wo er am liebsten auf dem blauen Teppich direkt vor dem Kühlschrank lag. Er wusste genau, wo er im Weg war. Na ja, in Wahrheit hatte er einfach nur ein Gespür für die besten Plätze.
Grandma liebt Nachrufe, also im Grunde Nachrichten über Tote. Wenn sie bei uns zu Besuch ist, liest sie mir welche vor. Ich wünschte, es gäbe so was auch für Haustiere. Dann könnte man so interessante Sachen lesen wie:
HIESIGE KATZE BEI AUTOUNFALL UMS LEBEN GEKOMMEN
oder:
SIE WAR DIE SCHÖNSTE HÜNDIN IHRER ZEIT
oder vielleicht:
HAMSTER WAR VORREITER EINER NEUEN BEWEGUNGSTHEORIE
vielleicht sogar:
BEKANNTER GOLDFISCHCHEF STIRBT UNTER MYSTERIÖSEN UMSTÄNDEN
Diese Überschrift hat mir Grandma mal vorgelesen, als ich noch jünger war, und ich habe sie nie mehr vergessen. Nur ging es nicht um einen Goldfisch, sondern um einen Militärchef in Südamerika. An seinen Namen kann ich mich nicht mehr erinnern. Historische Fakten sind nicht meine Stärke.
Von einer Sache bin ich inzwischen überzeugt: Das Leben ist einfach ein großer und langer Kampf um Beifall.
Selbst wenn die Leute sterben, hoffen sie, dass jemand ihre Verdienste auflistet.
Auch Haustiere brauchen Lob. Okay, Katzen vielleicht nicht. Aber unser Hund war überglücklich, wenn ich sagte: »Gut gemacht, Ramon!«
Sein Nachruf hätte gelautet:
BESTER HUND DER WELT HINTERLÄSST GEBROCHENE HERZEN UND EIN LEERES HAUS
Seit dem Abend seines Herzinfarkts im Ledersessel versuche ich über den Verlust von Ramon hinwegzukommen. Meine Eltern sagen: Die Zeit heilt alle Wunden. Doch das stimmt einfach nicht, weil es alle möglichen Sachen gibt, die die Zeit nicht heilt. Wenn man sich zum Beispiel das Rückgrat bricht, kann die Zeit das nicht heilen. Dann kann man nie wieder gehen.
Deswegen glaube ich, mit dem Spruch meinen sie, dass eines Tages der Schmerz nicht mehr so schmerzt.
Vielleicht sollte man sagen: Die Zeit schafft es irgendwie, dass die Wunden weniger wehtun.
Das wäre genauer.
Mein Schuljahr ist vor zehn Tagen zu Ende gegangen. Ich weiß nicht, warum das Schuljahr und das normale Jahr nicht am gleichen Tag enden und beginnen. Es kommt mir irgendwie völlig falsch vor, dass das neue Jahr am ersten Januar beginnt. Wenn ich bestimmen könnte – was noch nie passiert ist –, dann würde ich Neujahr auf den 15.Juni legen und zum Feiern allen Kindern zwei Monate schulfrei geben.
Jetzt, wo das Schuljahr vorbei ist, schaffe ich es hoffentlich, meinen Schmerz über Ramons Tod loszuwerden, weil mich das sonst vielleicht in meiner Entwicklung hemmt.
Aber ich werde Ramon nicht vergessen.
Niemals.
Ich hab um sein Halsband gebeten, und irgendwie hatte ich den Eindruck, meine Eltern waren nicht sonderlich glücklich, als ich es um meine Nachttischlampe legte. Wenn man genau hinschaut, entdeckt man noch Haare auf der Innenseite. Es riecht auch nach ihm.
Es ist kein toller Geruch, aber es ist seiner, und das ist das Wichtigste. Das Metallschildchen mit seinem Namen habe ich am Fußende meines Bettes angebracht, sodass ich jeden Morgen beim Aufwachen RAMON vor mir sehen kann. Mir ist es wichtig, dass ich den Tag damit beginne, an ihn zu denken.
Ehrlich gesagt glaube ich, dass er jeden Tag damit begann, an seinen Futternapf zu denken. Er hat wahnsinnig gern gefressen.
Ich war diejenige, die ihn gefüttert hat.
Ich behaupte nicht, dass er mich deswegen am liebsten hatte. Aber wahrscheinlich war das mit ein Grund dafür.
Außer dem Halsband habe ich auch noch eine geschnitzte Holzfigur, die mein Onkel Jake für mich gemacht hat. Sie sieht genauso aus wie Ramon.
Onkel Jake war früher ein ganz normaler Versicherungsvertreter in Arizona, wo er mit Tante Megan lebt. Eines Tages hatten sie einen Verkehrsunfall. Onkel Jake wurde am Rücken verletzt und musste lange liegen. Tante Megan hatte Angst, er würde im Bett verrückt werden, weil er so ein unruhiger Typ ist. Deswegen kaufte sie ihm in einem Bastelladen ein Set für Holzschnitzarbeiten.
Das erste Stück, das er geschnitzt hat, hieß »Der alte Seebär«. In seinem Schnitzkasten lag schon ein handtellergroßer Holzblock in der passenden Form. Man nimmt einfach das beiliegende Schnitzmesser und arbeitet drauflos, weil sie einem mit einer Schablone zeigen, wo man ansetzen muss. Das ist kein Schummeln. So lernt man.
Nach dem Seebären hat Onkel Jake alle möglichen Sachen gemacht, die wahrscheinlich komplizierter waren, und am Ende hat er sich auf das Schnitzen von Vögeln verlegt. Es gibt Leute, die so was tun und dann an Wettbewerben teilnehmen, und Onkel Jake gehörte bald dazu. Inzwischen ist er ein Weltmeister in Holzarbeiten, Spezialität Wasservögel.
Seine Begabung liegt offensichtlich darin, sehr sorgfältig ein scharfes Messer zu führen.
All das passierte vor meiner Geburt. Inzwischen verdient Onkel Jake sein Geld damit, dass er Skulpturen schnitzt, statt Versicherungen zu verkaufen.
Vor zweieinhalb Jahren hat er mir Ramon aus Holz geschnitzt. Ich hab die Figur schon damals gemocht, aber jetzt hab ich sie richtig lieb gewonnen.
Zwei
Wenn ich ein Ziel für diesen Sommer hätte, dann wäre es, mir keine Gedanken über meine Körpergröße zu machen und neue Wege zu finden, glücklich zu sein, jetzt, wo Ramon tot ist.
Ich bin aber nicht so der zielgerichtete Typ. Normalerweise überlasse ich das Planen meinen beiden besten Freundinnen.
Kaylee und Piper kenne ich schon länger als mein halbes Leben. An den Wochenenden in der Schulzeit nehmen wir zu dritt den Bus in die Innenstadt zur Bücherei und suchen nach Lesestoff. Ich lese nicht jedes Buch zu Ende wie Kaylee. Sie ist ein Bücherwurm, was eine ziemlich blöde Bezeichnung ist für jemanden, der sehr gern liest (denn wer findet schon gern Würmer in Büchern?). Oft gehen wir auch zusammen Eis kaufen. Im Laden bei uns um die Ecke sind unsere Lieblingssorten ziemlich billig. Als wir letzten Sommer mal wieder dort waren, haben wir nicht jeder eine Kugel Eis gekauft, sondern alle drei zusammen eine Wasserschildkröte. Die gab es nämlich im Angebot, in einer Wasserschale an der Kasse.
Wir wollten die Schildkröte teilen, also, jeder sollte sich zehn Tage pro Monat um sie kümmern.
Unsere Eltern fanden die Idee dann nicht so toll, und wir mussten Petula zurückbringen. Der Laden wollte uns das Geld nicht zurückgeben. Das war unfair.
Wir behaupten immer, dass Petula uns fehlt. Das stimmt aber gar nicht, weil wir sie nur zwei Stunden lang hatten.
Und Kaylees Mama, die selbstständige Krankenpflegerin ist, meint, wir hätten uns damals Salmonellen holen können.
Piper musste dieses Jahr ins Sommercamp. Sie ist vor zwei Tagen losgefahren. Ihre Mama ist da als Kind auch hingefahren, und das soll jetzt wohl eine Tradition werden. Piper schien sich nicht wahnsinnig darauf zu freuen. Ich habe ihr gesagt, ich würde ihr jeden Tag schreiben, aber bisher habe ich das noch nicht getan. Das Camp ist »medienfrei«, ich kann ihr also nur einen richtigen Brief schreiben.
Kaylee ist nicht im Sommercamp, aber sie ist seit letzter Woche mit ihrer Familie unterwegs, um Baseballstadien anzuschauen. Ehrlich. Sie fährt in einem Auto durch die Gegend und guckt sich Sportplätze an. Sie ist nicht besonders sportlich, deswegen vermute ich mal, es ist für sie kein Vergnügen.
Seit die beiden weg sind, habe ich ziemlich viel Zeit damit verbracht, nichts zu tun, aber das macht mir überhaupt nichts aus. Ich sitze jetzt nicht rum und blase Trübsal oder so. Ich vermisse Ramon, aber das ist innerlich, also dürfte es niemand bemerken.
Oder vielleicht doch. Gestern hat mir Mum nämlich mitgeteilt, ich soll für irgend so ein Musical an der Uni zum Vorsingen gehen.
Ich hab ihr gesagt, dass ich das nicht will.
Worauf sie sagte, dass mein jüngerer Bruder Randy vorsingen möchte, und ich sollte es mir noch mal in Ruhe überlegen. (Das bedeutet, sie wird dafür sorgen, dass ich hingehe.)
Mein älterer Bruder Tim darf im Sommer machen, was er will, weil er schon fünfzehn wird. Ich bin mir sicher, dass es für mich nicht das Richtige ist, in einem Musical mitzumachen, und dass mein Bruder ohne mich zum Vorsingen gehen sollte. Allerdings ist es mein Job, auf Randy aufzupassen, wenn Mama arbeitet, und ich werde dafür bezahlt. Wahrscheinlich will sie also Geld sparen, indem sie uns beide in ein gemeinsames Ferienprogramm steckt.
Jedenfalls, kaum hab ich angefangen, es mir noch mal zu überlegen, da stehe ich schon in einer langen Schlange von Kindern und warte, dass ich zum Vorsingen auf die Bühne in einem sehr dunklen Theater auf dem Universitätscampus gerufen werde. Dabei höre ich, wie zwei Erwachsene gerade sagen: »Ein paar von den Schauspielern sind Profis.«
»Wirklich?«
»Das hat die Frau im Büro erzählt. Die werden bezahlt. Einer kommt sogar von der Ostküste.«
»Jemand, den man kennt?«
»Das werden wir wohl erfahren, wenn sie die große Ankündigung machen.«
»Der Regisseur kommt aus Florida. Er soll schon am Broadway gearbeitet haben.«
Ich bin froh, dass meine Mutter nicht mit diesen Frauen redet. Sie beantwortet Nachrichten auf ihrem Handy, während wir in der Schlange stehen. Randy hat ein Gummiband im Mund. Mum weiß das nicht. Er ist viel zu alt, irgendetwas anderes als Kaugummi im Mund zu haben, aber er macht gern solche Sachen, und ich werde ihn nicht verpetzen. Vielleicht ist er ja nervös, während er hier aufs Vorsingen wartet? Ich jedenfalls schon.
Hoffentlich nimmt er das Gummiband aus dem Mund, wenn er singt. Er könnte nämlich daran ersticken. Dann würde es Mum bestimmt leidtun, dass sie die Sache hier vorgeschlagen hat.
Randy hat eine schöne Stimme, und er singt ständig. Er braucht ein Lied nur zweimal im Radio zu hören, und schon hat er es im Ohr. Also auf angenehme Art. (Wieder ein blödes Wort für eine tolle Fähigkeit meines Bruders.)
Ich bin nicht musikalisch.
Vor über zwei Jahren haben meine Eltern Leuten, die nach Utah gezogen sind, ein Klavier abgekauft. Mum und Dad haben es dann uns Geschwistern zu Weihnachten geschenkt. Ich musste so tun, als würde ich mich wahnsinnig freuen, weil es ja so ein Riesengeschenk war. In Wirklichkeit hasste ich das Ding von dem Moment an, als es nach oben in die Diele gleich neben meinem Zimmer geschafft wurde. Das Klavier starrte mich an. Es war wie ein Singvogel, den man in einen Käfig gesperrt hat. Es wartete darauf, freigelassen zu werden. Aber mir fehlte das Talent.
Fast ein Jahr lang musste ich einmal in der Woche nach der Schule zum Klavierunterricht bei dieser alten Dame im Skyline Drive gehen. Die Tortur dauerte immer fünfundvierzig Minuten. Ich habe die Tonleitern gelernt, weil man damit wahrscheinlich im ersten Unterrichtsjahr beginnt, aber danach ging es nicht mehr weiter.
Mrs. Sookram hatte andere Schüler, und die meisten waren so ungefähr in meinem Alter. Es war mein Glück, dass wir in verschiedene Schulen gingen.
Ich wollte unbedingt vermeiden, dass mich das Mädchen, das nach mir kam, spielen hörte. Dann hätte sie gewusst, wie schlecht ich war und dass ich keine Fortschritte machte.
Das lag zum Teil daran, dass ich nicht übte. Meine Finger fühlten sich auf den Tasten einfach nicht richtig an. Vielleicht sind sie nicht lang genug, denn sie glitten nicht dahin, suchten sich nicht ihren eigenen Weg, und so hätte es eigentlich sein müssen.
Es war ein schrecklicher Kampf, ganz anders als bei meinem großen Bruder Tim, wenn er Musik macht. Er spielt Gitarre und wünscht sich ständig alles mögliche Zubehör, Verstärker, Schultergurte usw. Er übt stundenlang in seinem Zimmer bei geschlossener Tür, und man kann ihn draußen im Hof hören, was für die Nachbarn ziemlich anstrengend ist, weil er immer wieder denselben Song spielt.
Kinder sind eben verschieden, nur ist er der Älteste und gab meinen Eltern wohl deshalb »Anlass zu übertriebenen Hoffnungen«. Ich hab mal gehört, wie mein Vater das zu meiner Mutter sagte.
Tims Plektren liegen überall im Haus rum, wie die Köttel von einem Tier.
In dem einen Jahr Klavierunterricht bei Mrs. Sookram habe ich schon etwas gelernt. Ich habe herausgefunden, wie man mit Erwachsenen Konversation machen und sie ablenken kann. Der entscheidende Trick dabei ist, dass man eine erste große Frage stellt und dann lauter kleine Fragen nachschiebt, die zeigen, dass man zuhört.
Meine große Frage war immer die nach Mrs. Sookrams Leben als Kind. Wo sie aufgewachsen wäre, wann sie gemerkt hätte, dass ihr Musik das Liebste war. Wenn ich sie erst mal zum Reden gebracht hatte, dann redete sie immerzu – und die ganze Klavierstunde lang – über ihr Leben damals in Idaho. Ich erfuhr alles über ihre Kindheit, Stück für Stück, Woche für Woche. Ich weiß besser über die Vergangenheit dieser Frau Bescheid als über die meiner Eltern. Im Wesentlichen ging es darum, dass sie auf einer Kartoffelfarm aufwuchs und so verrückt nach Musik war, dass sie nach der Schule vier Meilen zu Fuß marschierte, um eine Dame in einer Hotellobby Harfe spielen zu hören.
Ich denke, zum Verlieben ist die Harfe bestimmt das traurigste Instrument, weil man sie nicht mit sich herumschleppen kann, und wenn man in das Haus anderer Leute geht, kann man auch nicht erwarten, dass sie eine haben, so wie beim Klavier. Die zeigen dann bestimmt nicht in eine Zimmerecke und sagen: »Ja, klar haben wir eine Harfe. Warum spielst du uns nicht was vor?«
Am Ende kam ich zu der Überzeugung, dass Mrs. Sookram lieber über Musik redete, als sich anzuhören, wie ich die falschen Tasten erwischte – die Stunden waren dann vorhersehbarer.
Doch eines Tages sagte sie: »Julia, heute Nachmittag rufe ich deine Mutter an. Ich habe einfach ein ungutes Gefühl, wenn ich Geld von ihr verlange.«
Ich wusste nicht recht, was ich antworten sollte, und sagte schließlich: »Das macht ihr nichts aus.«
Mrs. Sookram sah mich traurig an. »Liebes«, sagte sie, »ich glaube, das Klavier ist nicht dein Instrument.«
Ich nickte so, dass es zur Hälfte Ja und zur Hälfte Nein bedeutete. Und dann hörte ich sie sagen: »Ich werde dich vermissen, Julia.«
Mrs. Sookram nahm meine Hand. Sie war wärmer als meine. Mir wurde klar, dass sie die Wahrheit sagte, weil ihre Augen ganz wässrig aussahen und ihr die Nase lief. Ich war ziemlich sicher, dass sie weinte. Oder aber eine schlimme Allergie hatte.
Ich hätte antworten sollen, dass ich sie auch vermissen würde. Ich wollte das auch sagen, aber eine so dicke Lüge wäre unmöglich gewesen. Also legte ich die Arme um ihre Hüfte und drückte sie ganz fest. Sie war eine beleibte Frau, sodass ich ziemlich viel zum Drücken hatte.
Minuten später, als ich die Auffahrt runterging, fühlte ich mich federleicht. Es war so ein Gefühl, das man vielleicht bekommt, wenn man seine Gefängnisstrafe abgesessen hat oder gerade aus einem Ganzkörpergips befreit wurde. Erst als ich an der frischen Luft war, wurde mir klar, wie wenig ich das Klavier mochte und wie viel ich über den Kartoffelanbau erfahren hatte.
Seitdem habe ich so gut wie gar nicht mehr über Musik nachgedacht, und da stehe ich nun und warte mit zig anderen Kindern darauf, »Somewhere Over the Rainbow« bei einer Riesen-Hörprobe vorzusingen, zu der die halbe Stadt erschienen ist.
Ich hatte wenig Zeit, mir meine Klamotten für diese Folterveranstaltung auszusuchen, und entschied mich für meine Ledersandalen, die Jeansshorts und eine weiße Bluse, die als »Trachtenbluse« bezeichnet wird. Es ist meine Lieblingsbluse, aus dünner Baumwolle, mit Puffärmeln und einem runden Kragen.
Ich habe die Bezeichnung »Trachtenbluse« nicht erfunden, ich finde, es klingt altmodisch. Aber die Leute nennen es so. Wir haben zwar ein paar Farmer außerhalb der Stadt, aber ich glaube kaum, dass sie festliche Blusen tragen, während sie mit riesigen Maschinen übers Feld fahren und Unkraut vernichten.
Na ja, jedenfalls habe ich Sachen an, die zu meinen Lieblingsklamotten zählen, und das ist wichtig, denn ich hab gelernt, dass es gut ist, sich in seiner Kleidung wohlzufühlen, wenn man in eine Situation kommt, die neu ist und Angst macht.
Was man unbedingt vermeiden sollte, wenn man nervös ist: Wolle tragen.
Mein Bruder hat ein gestreiftes Hemd und braune Shorts mit Gummizug an, die ich für sehr unmodisch halte. Und er hat das Gummiband im Mund.
Na ja, jeder kann man machen, was er will – außer natürlich, wenn es um die ganz wichtigen Sachen geht. Da machen wir, was Mum will, weshalb ich jetzt hier stehe.
Nach einer Ewigkeit bin ich dran.
Die meisten Kinder vor mir haben »Somewhere Over the Rainbow« gesungen. Ich hab aber gesehen, dass ein Mädchen den Klavierspieler fragte, ob sie »Amazing Grace« vortragen könne, und das war kein Problem für ihn. Ich konnte dann kaum zuhören, weil mich ihr Lied an Ramon erinnerte, sodass ich mir beide Ohren zuhielt. Ich habe lange Haare und konnte deswegen so tun, als ob ich nur meinen Kopf aufstützte.
In dem Moment, als ich auf die Bühne zum Klavier hinübergehe, kommt mir plötzlich eine Idee, und ich frage: »Kann ich ›This Land Is Your Land‹ singen?«
Der Mann am Klavier nickt und zwinkert mir dann zu. Das ist irgendwie nett, weil ich mir jetzt denke, er weiß etwas, was ich nicht weiß – zum Beispiel, wieso ich hier vor zweihundert fremden Leuten stehe, um vorzusingen.
Ich beginne mit meinem Lied und schaue an der Frau, die uns mit der Videokamera aufnimmt, vorbei, geradewegs ins Publikum.
Ich will hier nicht stehen, aber Grandma Däumling sagt, ich bin ein Terrier, und die können laut bellen. Also singe ich aus voller Kehle und achte darauf, meine Hände nicht zu Fäusten zu ballen. Ich habe ein paar von den anderen Kindern vorher beobachtet, und die sahen aus, als ob sie gleich zuschlagen wollten.
Als ich fertig bin, schaue ich mich nach dem Klavierspieler um und sage: »Vielen Dank.« Er zwinkert mir wieder zu. Ich muss lachen. Und dann mache ich eine kleine Verbeugung in seine Richtung. Keine Ahnung, warum.
Meine Mum weiß wohl, dass heute ein schwerer Tag für mich war, weil wir gleich nach dem Vorsingen zum Bäcker fahren, wo Randy und ich einen Schokomuffin bekommen. Wir essen ihn noch im Auto, obwohl es schon in einer halben Stunde Abendessen gibt.
Auf der Fahrt meint Mum dann: »Deine Verbeugung war eine gute Idee, Julia. Sehr passend fürs Theater. Die Zuschauer mochten das.« Ich sage nichts dazu, weil ich nicht versucht hatte, mich fürs Theater passend zu verhalten – ich weiß nicht einmal, was das heißen soll. Aber ich bin froh, dass sie zufrieden mit mir war.
Singen kann ich nicht besonders, das weiß ich. Als Randy sang, klang seine Stimme wie Honig. Es war so eine Art Süße drin. Meine Stimme ist laut, aber nicht wie Zucker. Sie hat keinen Schmelz.
Randy hat das, was Mrs. Vancil (das ist meine Lieblingslehrerin an der Schule) »echtes Potenzial« nennen würde.
Es liegt nicht an meiner Körpergröße, aber mein Gesangspotenzial ist einfach nicht sonderlich groß.
Drei
Ich habe vier Tage lang nicht an das Vorsingen gedacht.
Vorbei ist vorbei.
Ich liege draußen auf der Wiese, schaue in den Himmel und denke an Ramon. Dabei schließe ich die Augen und stelle mir vor, er wäre bei mir. Alle Hunde schlafen gern, und Ramon liebte sein Nickerchen. Er konnte sogar im Sitzen einschlafen. Ich habe nicht vor einzudösen, aber dann passiert es einfach. Leider war ich nicht eingecremt, und als ich aufwache, brennt mein Gesicht. Hoffentlich merkt meine Mum nichts. Sonnencreme wird bei ihr ganz groß geschrieben.
Ich gehe zurück ins Haus. Mum ist in der Küche. Sie möchte ein Auge auf uns haben und arbeitet deswegen im Sommer öfter von zu Hause aus. Als ich die Tür aufmache, sagt sie nichts. Sie lächelt sogar. Der Sonnenbrand ist also vielleicht gar nicht so schlimm.
Dann brüllt mein Bruder: »Julia, wir sind Zwerge!« Er sitzt auf einem Hocker vor der Anrichte. In diesem Moment geht mir auf, dass er auf mich gewartet hat.
Eine Sekunde lang denke ich, er will mir sagen, dass ich sehr klein geraten bin, was ich natürlich schon weiß. Aber dann ergänzt meine Mutter: »Wir haben einen Anruf bekommen. Man hat euch beide als Munchkins für das Stück ausgewählt!« (Das sind die Zwerge im Zauberer von Oz.)
Ich starre sie an und bin ziemlich entsetzt.
Sie strahlen wie Honigkuchenpferde, würde Grandma Däumling jetzt sagen. Und das soll heißen: »begeistert grinsen«. Genau das tun sie nämlich. Sie finden, wir haben das große Los gezogen.
Ich lächle verkrampft zurück.
Was wird nun aus meinem Sommer? Wie soll ich jetzt an Ramon denken, wann immer mir danach zumute ist? Und Kaylee und Piper Briefe schreiben? Ich habe zwar noch keinen geschrieben, aber immerhin habe ich schon mit einer Zeichnung angefangen, und wenn sie mir einigermaßen gelingt, wollte ich sie ihnen schicken. Meine beiden besten Freundinnen zählen darauf, dass ich hier zu Hause die Stellung halte und sie auf dem Laufenden bleiben. Ich bin der Leim, der uns zusammenhält. Und – ich bin ein Terrier. Ich kann kein Munchkin sein.
Stundenlang denke ich darüber nach, was ich tun könnte. Am nächsten Tag – das soll unser erster Probentag werden – tue ich so, als würde ich auf der Treppe stolpern, und lege einen perfekten Sturz hin. Anschließend behaupte ich, ich hätte mir den Fuß verstaucht. Mum schaut sich den Fuß nicht mal an (in Wirklichkeit ist das Einzige, was mir vom Sturz wehtut, der rechte Ellbogen). Ich hinke trotzdem durch die Gegend.
Es funktioniert nicht, sie will mir nicht mal ein Kühl-Pack geben. Ich höre also auf zu hinken und ziehe meine Trachtenbluse und meine Shorts an. Als ich meine Ledersandalen holen will, sagt Mama, dass Randy und ich Turnschuhe anziehen müssen.
Turnschuhe? Die passen nicht zur Trachtenbluse, aber wir haben nicht die Zeit, dass ich mir ein neues Outfit aussuchen könnte.
Als Mum beim Theater vorfährt, kommen etliche andere Kinder an. Ich kenne Gott sei Dank keines.
Was, wenn zum Beispiel Stephen Boyd auch ein Munchkin wäre?
Er saß neben mir in Mrs. Vancils Klasse, und er ist besser in Mathe als alle anderen (außer Elaenee Allen). Im Basketball ist er auch super. Und in Rechtschreibung. Das ganze letzte Schuljahr habe ich immer, wenn es nichts anderes zu tun gab, zu Stephen Boyd rübergeguckt, und ich glaube nicht, dass ich mich richtig konzentrieren könnte, wenn er auch im Stück mitspielen würde. Er lenkt mich ab, mit seinen glänzenden schwarzen Locken.
Die meisten anderen Munchkins sind mit ihren Eltern hier, die jetzt ihre Autos parken. Mum ist der Meinung, Randy und ich kämen allein zurecht, und setzt uns deswegen an der Einfahrt ab. Außerdem muss sie zur Arbeit. Ich komm damit klar, vor allem, als gleich darauf eine Frau mit einem Klemmbrett den anderen Eltern mitteilt, sie könnten nicht zum Zuschauen dableiben. Wir haben »nicht-öffentliche Proben«.
Die Eltern wirken daraufhin richtig traurig.
Ich hab keine Ahnung, warum sie zuschauen möchten, wie wir zu Zwergen werden (was ganze vier Wochen in Anspruch nehmen soll).
Die Frau mit dem Klemmbrett befiehlt den Erwachsenen mehr oder weniger, zur Kasse am Haupteingang vorzugehen. Im August haben wir zweiundzwanzig Aufführungen, und offenbar ist sie sicher, dass sie Tickets für jede einzelne davon kaufen werden und auch noch jede Menge Freunde mitbringen wollen.
Mir geht dabei nur eine Sache durch den Kopf: Mit vier Wochen Proben und drei Wochen Vorstellungen ist der Sommer praktisch gelaufen.
Puff!
Vorbei.
Ich bin kurz davor, in Tränen auszubrechen, kämpfe aber erfolgreich dagegen an (nur meine Augen glänzen besonders stark).
Sobald all die enttäuschten Eltern gegangen sind, werden wir durch die Vorhalle ins Theater gebracht. Wir sind eine große Gruppe. Die Klemmbrett-Frau fängt an zu zählen, und als sie bei fünfunddreißig ist, hör ich nicht weiter hin.
Drinnen ist es ziemlich dunkel, aber ich stehe vorn und sehe, dass drei Kinder schon auf der Bühne sind, von der eine offene Tür nach draußen führt.
Eins der Kinder steht im Türrahmen, und ich bin schockiert: Das Kind raucht!
Ich kann’s nicht fassen.
Wer lässt da ein Kind rauchen?
Kein Wunder, dass die Eltern gehen sollten!
Das muss ich unbedingt und sofort meiner Mum und meinem Dad erzählen. Mum kann Rauchen überhaupt nicht ausstehen, und das wird alles ändern.
Dann dreht sich das rauchende Kind um, kommt wieder herein, und ich kann das Gesicht sehen:
Das ist gar kein Kind – es hat einen Bart!
Es ist ein winziger Erwachsener. Er ist der perfekte Munchkin. Wir anderen sind alle nur große Schummler, denn als wir näher kommen, sehe ich, dass die drei Menschen auf der Bühne genau richtig aussehen.
Sie sind exakt so wie im Film.
Jetzt wird mir klar, dass es in unserer Stadt nicht genug winzige Erwachsene gibt, die Munchkins spielen könnten. Deswegen brauchen sie uns Kinder, um die Rollen zu übernehmen. Das ist der Grund.
Ich kann nichts dagegen tun. Ich starre sie an.
Das ist unhöflich, aber es geht nicht anders. Außerdem ist es hier drinnen ziemlich düster, sodass es ihnen vielleicht nicht so auffällt.
Es sind zwei Männer und eine Frau. Einer der beiden Männer ist schwarz, und er ist der Raucher. Er hat einen Vollbart. Der andere Mann hat orangefarbene Haare. Er ist der superperfekte Kobold und nicht bloß, weil er ein grünes Hemd trägt. Er hat orangefarbene Bartstoppeln, und seine Nasenspitze ist gerötet. Vielleicht hat er eine Erkältung. Die Frau ist nur ein bisschen größer als die beiden. Sie hat die Haare zu einem langen Zopf nach hinten gebunden und trägt große silberne Kreolen und eine türkisfarbene Halskette mit passenden Armbändern. Obwohl Sommer ist, hat sie Lederstiefel mit Absätzen an. Na ja, ich mache ja zum ersten Mal bei einer semiprofessionellen Theateraufführung mit, vielleicht funktionieren für die Profis auch Lederstiefel auf der Bühne. Jedenfalls finde ich ihren Look richtig gut.
Ich werde sie noch kennenlernen, und dann kriege ich raus, wo sie die Lederstiefel mit Absätzen herhat. Ihre Füße sind richtig klein, so wie bei mir, und möglicherweise sind die Stiefel eine Sonderanfertigung von irgendwo.
Bald darauf geht das Licht an. Ich stehe zusammen mit meinem Bruder in der restlichen Gruppe, als die kleine Frau auf uns zukommt, die Hand ausstreckt und zu mir sagt: »Ich bin Olive. Schön, dich kennenzulernen.«
Jedes einzelne Kind wird von ihr auf diese Weise begrüßt, und das bricht das Eis. Daraufhin erwachen auch die beiden Männer zum Leben.
Der Raucher heißt Quincy. Der Kobold ist Larry.
Quincy erzählt, dass er professioneller Schauspieler ist. Die meisten Jobs hatte er im Zirkus, aber er arbeitet auch als Clown bei Rodeos, um die Pferde abzulenken, wenn sie bocken. Alles, was Quincy sagt, ist spannend. Er hat Elefanten abgerichtet, kann Einrad fahren und einen beeindruckenden Rückwärtssalto machen.
Nachdem uns Quincy einige akrobatische Kunststücke gezeigt hat, kommt auch Larry in Fahrt. Er kann mit verschiedenen Stimmen sprechen, die verrücktesten Dialekte nachmachen und Tierlaute perfekt imitieren.
Wir amüsieren uns gerade prächtig, als hinten eine Tür aufgeht und ein Mann hereinkommt. Er hat einen großen Hefter dabei. Er geht nicht schnell, aber langsam geht er auch nicht. Er geht, als sei er wichtig.
Wir hören ein »Bitte, setzt euch«.
Die Klemmbrett-Frau flitzt aus dem Hintergrund auf die Bühne und sagt: »Shawn Barr ist hier.«
Das wussten wir schon, nur seinen Namen kannten wir nicht.
Shawn Barr hat einen »Jumpsuit« an, das heißt, das Oberteil hängt mit dem Unterteil zusammen. Automechaniker tragen so was. Dann heißt es Blaumann. Shawn Barrs Jumpsuit ist nicht blau, und er sitzt ziemlich eng. Er ist orange wie eine aufgeschnittene Melone, und dazu gehört ein falscher Gürtel mit einer goldenen Schnalle.
Shawn Barr trägt kein Theaterkostüm. Das ist sein normales Outfit. Das erkenne ich daran, dass sein Portemonnaie in der hinteren Hosentasche steckt, die abgewetzt aussieht. Also trägt er den Jumpsuit ziemlich oft. Ich versuche, mir meinen Vater in melonenfarbener Kluft vorzustellen, und flippe bei dem Gedanken fast aus. Aber irgendwie wirkt diese Kleidung an Shawn Barr nicht unpassend oder komisch, was vielleicht daran liegt, dass er selbst sie passend findet.
Er ist kein großer Mann, eher kurz geraten, aber das würde ich natürlich nie laut sagen, weil ich das Wort ja nicht in den Mund nehme. Er könnte keinen Munchkin spielen, aber so viel größer als wir wirkt er auch wieder nicht – bis er den Mund aufmacht.
Einige Kinder klingen wie ein Schwarm aufgeregter Bienen. Ich bin mucksmäuschenstill. Shawn Barr klatscht einmal in die Hände und sagt dann: »Darsteller – wenn ich rede, brauche ich absolute Ruhe.«
Das Summen hört schlagartig auf.
»Meine Name ist Shawn Barr. Möglicherweise haben viele von euch schon von mir gehört.«
Ich riskiere einen Seitenblick zu den anderen Kindern. Sie sehen nicht so aus, als hätten sie schon von ihm gehört.
»Ich habe als Regisseur am Broadway in New York gewirkt, und meine Produktionen sind am Londoner West End aufgeführt worden.«
Als ich einen zweiten Seitenblick riskiere, sehe ich, dass Olive, Larry und Quincy nicken.
Ich habe sie zwar gerade erst kennengelernt, aber ich mag sie jetzt schon sehr, und deswegen nicke ich auch.
Und Randy macht es mir nach. Einen kleinen Bruder zu haben ist, als hätte man einen treuen Angestellten. Er hält ganz klar zu mir – das ist sein Job.
Ich frage mich, wie alt Shawn Barr ist, und merke, dass es schwer zu schätzen ist. Er hat graue Haare, aber sie sind sehr voll. Er bewegt sich nicht wie ein alter Mann. Er hat alle möglichen Falten im Gesicht, aber er braucht keinen Stock, keine Gehhilfe. Bestimmt ist er älter als meine Eltern. Und die sind alt, nämlich zweiundvierzig und vierundvierzig.
Möglicherweise ist er superalt.
Fünfundfünfzig vielleicht?
Ich hab keine Ahnung.
Die ältesten Menschen, die ich kenne – so wie Grandma Däumling, die am Nationalfeiertag, am 4.Juli, neunundsechzig wird –, sind Verwandte von mir, und deshalb weiß ich natürlich, wie alt sie sind. Ich nehme mir vor, Shawn Barrs Alter später herauszufinden. Wahrscheinlich ist es gut, mehr über ihn zu wissen, wenn er so berühmt ist. Das macht er uns absolut klar, als er sagt: »Ich habe mit vielen Theatergrößen gearbeitet. Und sie haben, abgesehen von wenigen Ausnahmen – wenigen Anomalien – alle eins gemeinsam: Sie wissen, was Engagement bedeutet.«
Ich habe das Wort »Anomalie« schon mal gehört, aber ich weiß nicht mehr, was es heißt. »Engagement« dagegen, das weiß ich, bedeutet, dass man sich sehen lässt; letztes Jahr habe ich nämlich den Antrag zur Aufnahme bei den Pfadfinderinnen gestellt, nur leider sagte die Gruppenführerin meiner Mutter, nachdem ich zu viele Treffen geschwänzt hatte, ich hätte zu wenig Engagement gezeigt.
Die Vorstellung von mir als Pfadfinderin gefiel mir gut, aber Pfadfinderin zu sein gefiel mir dann nicht so sehr.
Shawn Barr redet immer noch: »Unser Engagement gilt dem Stück und der übrigen Truppe. Wir werden sehr, sehr hart arbeiten. Ich bin darauf angewiesen, dass ihr euer Bestes gebt. Wir werden lernen, auf höchstem Niveau zu singen und zu tanzen. Wir werden ein Team sein mit einem Ziel: eine tolle Show zu machen!«
Ich höre ihm zu und werde ein bisschen aufgeregt.
Shawn Barr hat eine bestimmte Art, beim Reden die Arme zu bewegen. Seine Stimme ist tief, energiegeladen und irgendwie »emotional«. Alles, was er sagt, ist auf eine lässige Art furchtlos. Über dieses Wort habe ich bisher nie nachgedacht.
Aber es stimmt. Der Mann ist furchtlos.
Dann verändert sich seine Stimme, und ich bekomme etwas zu hören, was mir den Magen zusammenzieht. »Ich war beim Vorsingen nicht dabei, weil ich erst gestern hier angekommen bin. Ich musste noch eine Show in Pigeon Forge abschließen. Ich bin sicher, dass ihr alle der Rolle von Munchkins gewachsen seid. Allerdings habe ich meine Auswahl aufgrund der Aufzeichnungen getroffen. Ich will damit nicht sagen, dass ihr euch die Rolle erst verdienen müsst. Ich behalte mir aber das Recht vor, jemanden nach Hause zu schicken, der meiner Meinung nach für seine Aufgabe nicht geeignet ist.«
Wieder schaue ich verstohlen zu den anderen. Die meisten tun ziemlich gleichgültig, ich kann aber erkennen, dass ein paar von den Munchkins nervös sind.
Olive, Quincy und Larry haben offensichtlich keine Angst, aber die sind ja auch fest gebucht.
Gott sei Dank spricht Shawn nicht mehr weiter darüber, uns feuern zu müssen, falls wir »unserer Aufgabe nicht gewachsen« sind. Und ich spüre in dem Moment, dass ein Teil von mir – ein ziemlich großer Teil in meinem Inneren – wohl unbedingt hierbleiben will, weil es sich jetzt gerade schrecklich anfühlt, eventuell nicht mit dabei sein zu dürfen.
Wenn ich mir überlege, dass ich vor nur drei Stunden einen Sturz gefakt habe, um mir angeblich den Fuß zu verstauchen!
Allerdings war das, bevor ich Shawn Barr kannte und bevor ich wusste, dass es Olive und Quincy und Larry überhaupt auf dieser Welt gab.
Shawn hat weitergesprochen, und ich habe einen Moment nicht hingehört. Er hat, glaube ich, ein paar Verse von Shakespeare zitiert, die für mich überhaupt keinen Sinn ergaben. Jetzt ist er fertig; er räuspert sich nämlich, hebt die Hände hoch in die Luft und sagt: »Darsteller – ich brauche euer hellstes Licht! Ihr werdet alle strahlen! Ihr seid alle meine Stars!«
Ich blicke auf, und Olive sieht aus, als ob sie weint.
Vielleicht ist sie ja ein großer Shakespeare-Fan. Ich weiß, dass er vor mehreren Hundert Jahren gestorben ist, aber immer noch Menschen traurig machen kann. Jedenfalls die, die seine Worte verstehen.



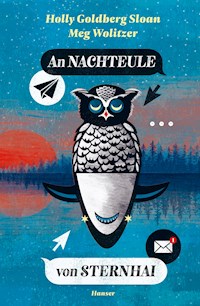













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)











