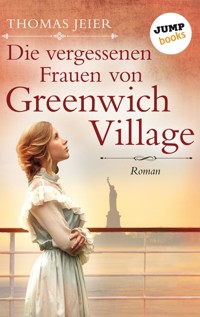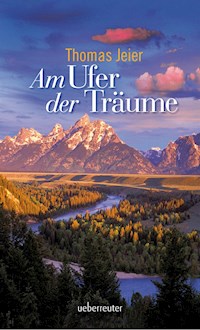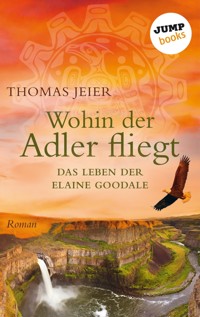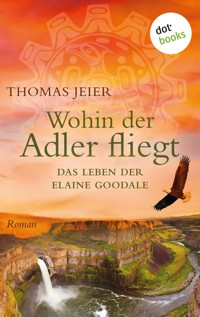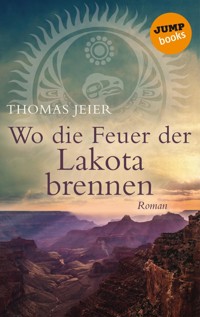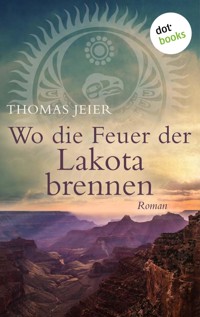Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein ergreifendes Buch gegen Rassenhass und Diskriminierung: "Sie hatten einen Traum" von Thomas Jeier als eBook bei dotbooks. Alabama 1963: Das Leben der Schwarzen wird von strengen Gesetzen, Hass und Gewalt dominiert. Die junge Audrey hat sich damit abgefunden: Sie geht den Weißen aus dem Weg und hält sich an die Regeln … bis sie nachts von zwei Männern des Ku Klux Clans überfallen und gequält wird. Zum ersten Mal erwacht in ihr der Wunsch, sich zu wehren, etwas zu tun – doch was? Als sie Edward kennenlernt, einen Mitarbeiter des berühmten Martin Luther King, scheint der Weg klar: friedliche Proteste für die Aufhebung der Rassentrennung. Die Behörden und weißen Einheimischen gehen gewaltsam gegen sie vor, doch nichts kann Audrey aufhalten: An Edwards Seite kämpft sie für eine bessere Zukunft … Ein ebenso berührendes wie wegweisendes Buch, das neue Aktualität erlangt – nominiert für den Deutschen Jugendliteraturpreis: "Jeiers Roman ist ein Denkmal für die Opfer, die der Kampf um Recht und Gerechtigkeit für jeden Menschen gekostet hat." Magazin für Amerikanistik Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der Jugendbuchklassiker "Sie hatten einen Traum" von Erfolgsautor Thomas Jeier – in Zeiten "Black Life Matters" aktueller denn je. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 438
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Alabama 1963: Das Leben der Schwarzen wird von strengen Gesetzen, Hass und Gewalt dominiert. Die junge Audrey hat sich damit abgefunden: Sie geht den Weißen aus dem Weg und hält sich an die Regeln … bis sie nachts von zwei Männern des Ku Klux Clans überfallen und gequält wird. Zum ersten Mal erwacht in ihr der Wunsch, sich zu wehren, etwas zu tun – doch was? Als sie Edward kennenlernt, einen Mitarbeiter des berühmten Martin Luther King, scheint der Weg klar: friedliche Proteste für die Aufhebung der Rassentrennung. Die Behörden und weißen Einheimischen gehen gewaltsam gegen sie vor, doch nichts kann Audrey aufhalten: An Edwards Seite kämpft sie für eine bessere Zukunft …
Ein ebenso berührendes wie wegweisendes Buch, das neue Aktualität erlangt – nominiert für den Deutschen Jugendliteraturpreis: „Jeiers Roman ist ein Denkmal für die Opfer, die der Kampf um Recht und Gerechtigkeit für jeden Menschen gekostet hat.“ Magazin für Amerikanistik
Über den Autor:
Thomas Jeier wuchs in Frankfurt am Main auf, lebt heute bei München und „on the road“ in den USA und Kanada. Seit seiner Jugend zieht es ihn nach Nordamerika, immer auf der Suche nach interessanten Begegnungen und neuen Abenteuern, die er in seinen Romanen verarbeitet. Seine über 100 Bücher wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt und mehrfach ausgezeichnet.
Bei dotbooks erscheint auch:
Die Tochter des Schamanen
Biberfrau
Das Lied der Cheyenne
Weitere Titel sind in Vorbereitung.
Die Website des Autors: www.jeier.de
Der Autor im Internet: www.facebook.com/thomas.jeier
***
eBook-Neuausgabe März 2018
Copyright © der Originalausgabe 2003 by Verlag Carl Ueberreuter, Wien
Copyright © der Neuausgabe 2018 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/MJTH (Frau), Albert Pego (Washington)
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (sh)
ISBN 978-3-96148-191-0
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort Sie hatten einen Traum an: [email protected]
Gerne informieren wir Sie über unsere aktuellen Neuerscheinungen und attraktive Preisaktionen – melden Sie sich einfach für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Thomas Jeier
Sie hatten einen Traum
Roman
dotbooks.
Für Christian Miesbach von der falschen Mainseite, der so manche Höhen und Tiefen mit mir durchlebt hat
Wir haben gelernt, wie Vögel zu fliegen und wie Fische zu schwimmen, aber wir haben die einfache Kunst nicht erlernt, als Brüder zusammenzuleben.
Martin Luther King Jr.
1
Audrey Jackson zitterte vor Angst. Sie war allein auf dem Highway und hielt das Lenkrad ihres Plymouth mit beiden Händen umklammert. Ihr Blick wanderte nervös durch die Dunkelheit. Wie bedrohliche Schatten flogen die Reklametafeln an ihr vorbei. Die Luft war feucht und schwül und der Mond lag hinter dunklen Wolken verborgen. Dunstschwaden zogen über die Felder und verfingen sich in den Bäumen am Straßenrand. In den wenigen Gebäuden brannte kein Licht. Die schwarzen Farmer wollten keine Aufmerksamkeit erregen. Das Brummen des Motors und das Singen der Räder auf dem nassen Asphalt waren die einzigen Geräusche in der ungewöhnlich dunklen Februarnacht.
Kalter Schweiß perlte von ihrer Stirn. An der Straße zwischen Bessemer und Birmingham trieb der Ku-Klux-Klan sein Unwesen, ein weißer Geheimbund, der seit hundert Jahren bestand und gewaltsam gegen alle Schwarzen vorging. Die Kapuzenmänner überfielen wehrlose Männer und Frauen und zündeten Farmhäuser und Scheunen an. Wenn Audrey in die Hände dieser Mörder fiel, hatte sie keine Gnade zu erwarten.
Audrey blickte in den Rückspiegel. Ihre Augen waren ungewöhnlich groß und leuchteten weiß. Sie war neunzehn und wirkte sogar in ihrem einfachen Kleid und der Strickjacke wie eine junge Dame. Ihr gelocktes Haar reichte bis auf die Schultern. Auch weiße Männer drehten sich heimlich nach ihr um, wenn sie in ihrem Sonntagskleid aus der Kirche kam und ihre Freundinnen umarmte. Ihre schwarze Haut glänzte im schwachen Licht der Armaturen. Sie hatte Betty Ann besucht, ihre zwei Jahre jüngere Freundin, und war auf dem Rückweg nach Birmingham.
Betty Ann war die Tochter eines Stahlarbeiters und so impulsiv, dass Audrey manchmal Angst um sie bekam. Das Mädchen hatte alle Zeitungsberichte über die Protestaktionen in Montgomery und Albany gesammelt und war fest entschlossen, an den Freiheitsmärschen teilzunehmen, falls die Bewegung jemals nach Birmingham kam. Martin Luther King, ein Pastor aus Atlanta, setzte sich für die Gleichberechtigung ein und hatte die Schwarzen ermuntert, gegen die Willkür der Weißen zu protestieren. Im Fernsehen und in den Zeitungen wurde ausführlich über ihre gewaltlosen Demonstrationen berichtet. »Ich habe keine Angst«, behauptete Betty Ann. »Die Polizei kann uns nichts anhaben, wenn wir uns friedlich verhalten! Wir müssen uns wehren, Audrey!«
»Und was ist mit dem Klan?«, fragte Audrey. »Die Kapuzenmänner scheren sich nicht darum, ob wir uns friedlich verhalten! Neulich haben sie einen Farmer und seine Frau verprügelt, hast du das vergessen? Sie haben die Farm niedergebrannt und das Vieh vertrieben! Die beiden kommen nie wieder auf die Beine!«
Betty Ann blätterte in ihrem Album mit den Zeitungsausschnitten. »Der Klan kann nicht überall sein. Aber wenn Martin Luther King und seine Leute nach Birmingham kommen, werden wir ihn besiegen! In der Zeitung haben sie seine Predigt abgedruckt.« Sie fand den Ausschnitt und las vor: »Ich glaube, dass selbst der schlimmste Befürworter der Rassentrennung zu einem Befürworter des friedlichen Miteinanders von Schwarz und Weiß werden kann!« Ihre Augen leuchteten. »Stell dir vor, du gehst auf dieselbe Schule wie die Weißen und die weißen Jungs quatschen dich nicht mehr blöd an, wenn sie dich sehen!«
»Dagegen kann auch Martin Luther King nichts tun!«, erwiderte Audrey lächelnd. Sie deutete auf ein Zeitungsbild, das weiße Schüler bei einem Protestmarsch gegen die Aufhebung der Rassentrennung zeigte. Die Gesichter der Kinder waren voller Hass. »Geh den Weißen aus dem Weg und du bekommst keinen Ärger! Du weißt doch, wie es den schwarzen Schülern in Little Rock ergangen ist. Ohne die Nationalgarde wären die niemals in die High School gekommen! Die Weißen hätten sie erschlagen!«
Audrey stammte aus einer besser gestellten Familie. Ihre Eltern führten einen Gemischtwarenladen in Birmingham. Sie waren angesehene Leute im schwarzen Viertel. Ein Massenprotest wie in Montgomery oder Alabama würde ihre Welt zum Einstürzen bringen. »Ich verstehe diesen Martin Luther King nicht«, sagte ihr Vater. »Warum will er alles verändern? Uns geht es doch nicht schlecht! Was macht es schon, wenn wir in den Bussen hinten sitzen müssen? Ändert es irgendwas, wenn wir im Drugstore einen Milchshake bestellen dürfen? Durch seinen Protest macht er alles nur noch schlimmer! Ich glaube, er will sich nur in den Vordergrund spielen! Was meint ihr, was passiert, wenn er sich in Birmingham mit der Polizei anlegt? Wir werden alle darunter leiden! Nein, nein, er soll in Atlanta bleiben!«
Das Angebot, die Nacht im Haus ihrer Freundin zu verbringen, hatte Audrey abgelehnt. Obwohl sie große Angst vor dem Klan hatte, wollte sie so schnell wie möglich nach Hause. Bis nach Birmingham waren es nur ein paar Minuten und es würde schon nichts passieren. Doch während sie allein durch die sternenlose Nacht fuhr, tauchten schreckliche Bilder vor ihren Augen auf: Weiße Kapuzenmänner, die brennende Kreuze in den Boden rammten. Weiße Männer, die ein schwarzes Mädchen bespuckten und schmutzige Bemerkungen machten. Der Ku-Klux-Klan wollte, dass sich die »Nigger« den Weißen unterordneten.
Im Rückspiegel erschien ein Wagen. Ein Scheinwerfer war schwächer als der andere, bohrte sich mit einem grellen Lichtstrahl in ihre Augen. Sie nahm den Fuß vom Gas und fuhr so dicht wie möglich am Straßenrand entlang. Am liebsten hätte sie die Augen geschlossen, als der Wagen sie überholte. Aus den Augenwinkeln sah sie einen gelangweilten Weißen, der sich gar nicht darum kümmerte, wer sie war. Er blickte stur geradeaus und paffte eine Zigarre. Erleichtert beobachtete sie, wie er in der Dunkelheit verschwand. Sie steuerte den Plymouth nach links und folgte dem weißen Mittelstreifen einen Hügel hinauf. In der Ferne waren bereits die Lichter von Birmingham zu erkennen.
Sie lockerte den Griff um das Lenkrad, redete sich ein, dass nun nichts mehr passieren konnte. Später würde sie sich Vorwürfe machen, nicht schneller gefahren oder in einen der Feldwege abgebogen zu sein. Dann wäre sie dem Pick-up, der hinter ihr auftauchte, vielleicht entkommen. Vielleicht war es auch ein Fehler, ausgerechnet in dem Augenblick nach links zu blicken, als der Kleinlaster sie überholte. So merkten die beiden Männer auf der Vorderbank sofort, dass sie eine Schwarze war. Das Licht der Armaturenbeleuchtung spiegelte sich auf ihren hohen Wangenknochen. Nur für einen Sekundenbruchteil sah sie das Gesicht des Beifahrers. Lange genug, um einen harmlos aussehenden Burschen mit kurz geschorenem Haar und aufgeblasenen Wangen zu erkennen. Er grinste frech. Sie wandte sich rasch ab und hörte im selben Augenblick, wie der Motor des Pick-ups aufheulte. Der Kleinlaster fuhr mit quietschenden Reifen an ihr vorbei.
Sie glaubte schon, die weißen Männer würden sie in Ruhe lassen und weiterfahren, als die Bremslichter des Pick-ups aufleuchteten und der Wagen sich quer stellte. Es gab keine Möglichkeit, daran vorbeizufahren. In panischer Angst trat Audrey auf die Bremse. Ihr Plymouth schleuderte nach rechts, streifte die Ladeklappe des Pick-ups und rutschte mit dem rechten Vorderrad in den Straßengraben. Sie fiel nach vorn und prallte gegen das Lenkrad. Stechender Schmerz durchzuckte ihre Brust. Sie schaffte es nicht mehr, die Türen zu verriegeln. Noch bevor sie den Knopf berührt hatte, waren die jungen Burschen heran und rissen ihre Tür auf. Ihre Augen waren voller Hass und Hohn.
»Hast du das gesehen, Steve?«, rief der Beifahrer in gespielter Entrüstung. »Die verdammte Niggerschlampe hat unseren Pick-up gerammt! Das hat sie absichtlich getan, Steve, nicht wahr?«
»Das glaube ich auch«, meinte Steve, ohne den Blick von Audrey zu nehmen. Er war größer und schlanker als sein Beifahrer und sein Grinsen wirkte überheblich.« Sie will wohl, dass wir ihr eine Abreibung verpassen! Zieh sie aus dem Wagen, Duncan!«
Audrey wich ängstlich vor den Männern zurück. Das Scheinwerferlicht des Pick-ups ließ sie wie bedrohliche Riesen aussehen. Sie waren noch jung, vielleicht zwei oder drei Jahre älter als sie, und trugen ölverschmierte Overalls. Der Fahrer hatte eine Baseballkappe in den Nacken geschoben. Ihre Gesichter waren weiße Flecken in dem Halbdunkel und wirkten im künstlichen Licht der Scheinwerfer seltsam fahl. Ihr Atem roch nach Alkohol.
Duncan griff nach dem Mädchen und zerrte es aus dem Wagen. Er hielt sie an den Oberarmen fest und sagte: »Jetzt werden wir dir zeigen, was es heißt, den Pick-up anständiger weißer Bürger zu rammen!« Er stieß sie gegen den Wagen und zeigte kein Mitleid, als sie rückwärts gegen die Tür prallte und mit schmerzverzerrter Miene zu Boden sank. Ihr Entsetzen war so groß, dass sie nicht einmal weinen konnte. Duncan versetzte ihr einige heftige Tritte mit seinen Cowboystiefeln. »Wir sollten sie am nächsten Baum aufknüpfen, Steve«, schimpfte er, »so wie es die Klanmänner mit den verdammten Niggern machen!« In seinen Augen brannte ein gefährliches Feuer, wie bei einem Soldaten, der zum ersten Mal im Gefecht war und die Nerven verlor.
»Ich weiß was Besseres!«, erwiderte Steve. Er war nüchterner als sein Kumpan und schien genau zu wissen, was er tat. Sein Gesicht verzog sich zu einem Grinsen. »Hol das Abschleppseil!«
»Was hast du vor, Steve?«
»Wir machen es wie die Cowboys in den Westernfilmen. Die binden ihre Feinde mit dem Lasso ans Sattelhorn und schleifen sie quer über die Prärie! Mal sehen, ob die Niggerschlampe das durchhält! Wo bleibt das verdammte Abschleppseil, Duncan?«
»Ich geh schon, Steve!« Der Beifahrer verschwand in der Dunkelheit und kehrte mit dem ölverschmierten Seil zurück. Erst jetzt schien er zu kapieren, was sein Kumpan vorhatte. »He, die wird ganz schön Augen machen, wenn wir sie durch Birmingham ziehen! Hoffentlich kapieren die Nigger dann endlich, dass sie uns in Ruhe lassen sollen!« Er betrachtete das Abschleppseil. »Hast du gehört, was in Montgomery los ist? Da bedienen sie die Nigger in den Drugstores! Und in den Bussen dürfen sie vorne sitzen! Hat alles dieser Obernigger auf dem Gewissen, dieser ...«
»Martin Luther King«, ergänzte Steve grimmig, »den erwischen wir auch noch! Worauf wartest du, Duncan? Binde die Schlampe an den Pick-up! Und mach einen anständigen Knoten, kapiert?«
Audrey hörte die Worte des jungen Weißen und glaubte sich in einem bösen Traum. Dies konnte nicht die Wirklichkeit sein. Nicht einmal zwei Mistkerle wie diese beiden waren dazu fähig, einen so grausamen und kaltblütigen Mord zu begehen. Gleich würde sie aufwachen und sich in ihrem Zimmer wiederfinden. Ihre Mutter würde sie ermahnen, endlich aufzustehen, sonst käme sie zu spät in die Schule und der Direktor würde ihr kündigen. Audrey arbeitete als Sekretärin in der schwarzen High School.
Doch die Stimmen der beiden Männer blieben und sie spürte, wie Duncan das Abschleppseil um ihren Körper schlang und es auf ihrem Rücken verknotete. Seine Tritte hatten alle Kraft aus ihrem Körper gepresst und sie war unfähig sich zu wehren. Durch den Nebel, der sich vor ihren Augen gebildet hatte, sah sie den Beifahrer zum Pick-up gehen und das andere Ende des Seiles an die hintere Stoßstange binden. Ein verzweifeltes Stöhnen kam über ihre Lippen. Sie wollte nach dem Seil greifen, den Knoten über ihrer Hüfte lösen, und schaffte es nicht einmal, die Finger zu bewegen. Die Weißen hatten ihre Widerstandskraft gebrochen und würden sie töten. Man würde ihre Überreste auf der Straße finden und jeder würde von einem bedauerlichen Unfall sprechen.
Sie schloss die Augen und ergab sich in ihr Schicksal. Die Stimmen der beiden Weißen drangen wie aus weiter Ferne zu ihr. Sie betete leise. Wenn der allmächtige Gott wollte, dass sie schon als junge Frau zu ihm kam, gab es keinen Grund, sich dagegen aufzulehnen. Er würde sie beschützen und sie mit seiner Gnade umfangen. »Lieber Gott, bitte mach, dass es schnell vorbei ist!«, sagte sie. »Und kümmere dich um meine Eltern und um Betty Ann! Sag ihnen, dass ich bei dir im Himmel bin und keine Schmerzen erleide!« Sie hörte, wie einer der beiden Männer den Pickup startete. »Vater unser, der du bist im Himmel ...«
Flackerndes Licht öffnete ihre Augen. Sie drehte den Kopf und sah einen Polizeiwagen neben dem Pick-up stehen. Das Warnlicht war eingeschaltet und warf grelle Blitze in die Dunkelheit. Sie kniff die Augen zusammen und erkannte einen stämmigen Deputy Sheriff, der langsam aus seinem Wagen stieg und kopfschüttelnd in ihre Richtung blickte, bevor er sich an die Burschen im Pickup wandte. Eine Taschenlampe flammte auf. »Hallo, Jungs!«, begrüßte er sie in seinem breiten Südstaatenslang. »Habt ihr nichts Besseres zu tun, als euch nachts auf dem Highway rumzutreiben? Im Kino läuft ein neuer Film mit John Wayne.«
»Den kann ich nicht leiden«, erwiderte Steve, als gäbe es das schwarze Mädchen gar nicht. »Randolph Scott ist viel besser!«
»Und Gary Cooper«, rief Duncan vom Beifahrersitz. »Haben Sie ›High Noon‹ gesehen, Sheriff? Das war ein Film, kann ich Ihnen sagen!«
»Halt die Klappe, Duncan!«, wies der Deputy Sheriff ihn zurecht. Er schien die beiden Burschen zu kennen. »Und binde die verdammte Negerin los! Ihr habt euren Spaß gehabt, das reicht. Alles andere gibt nur Scherereien.« Er drehte sich zu Audrey um und ließ erkennen, dass er genauso wenig von ihr hielt wie die Männer. Seine Augen waren kalt und abweisend. »Hast du gehört, Duncan? Ich will, dass ihr sie losbindet und verschwindet!«
»Geht in Ordnung, Sheriff!«, meinte Duncan eingeschüchtert. »Wir wollten ihr nur ein wenig Angst einjagen!« Er stieg aus dem Pick-up und befreite Audrey von dem Abschleppseil. Nachdem er es von der Stoßstange gezogen und auf die Ladefläche des Kleinlasters geworfen hatte, stieg er wieder ein. Er legte seinen Arm ins offene Fenster und vermied es, den Deputy anzublicken.
»Und jetzt verschwindet! Fahrt endlich nach Hause und bleibt von meiner Straße weg! Ich hab schon genug Ärger am Hals!«
»Wird gemacht, Sheriff«, gehorchte Steve. Er wendete den Pick-up und fuhr rasch davon. Die Rücklichter tanzten durch die Dunkelheit und erloschen, als er über den Hügel verschwand.
Der Deputy wartete, bis das Motorengeräusch verklungen war, und richtete den Lichtkegel seiner Taschenlampe auf Audrey. Er bewegte sich aufreizend langsam und machte keinerlei Anstalten, ihr zu helfen. »Und du steigst besser in deine Schrottkarre und haust ab, bevor ich dich wegen Landstreicherei festnehme und ins Gefängnis werfe! Kein Wunder, dass die Jungs auf dumme Gedanken kommen! Geh zu deinen Leuten!«
Audrey wusste, dass es keinen Zweck hatte, sich gegen den Deputy aufzulehnen. Wenn eine schwarze Frau von weißen Männern belästigt wurde, war immer sie schuld. Sie konnte froh sein, dass er sie laufen ließ. Es gab auch Polizisten, die diese Gelegenheit ausgenützt und sie vergewaltigt hätten. Der Deputy beließ es bei einem Blick, der von Lüsternheit und Abscheu geprägt war. Sie erhob sich und ging stöhnend zu ihrem Wagen. Ihre Rippen schmerzten höllisch. Sie presste eine Hand auf die Stelle, an der sie Duncans Fußtritt getroffen hatte, und lehnte sich gegen den Kotflügel ihres Plymouth. Zu ihrer Erleichterung sah sie, wie der Deputy in seinen Wagen stieg und davonfuhr.
Erst als das flackernde Warnlicht hinter dem Hügel verschwunden war, begann sie zu weinen. Sie verbarg ihr Gesicht in beiden Händen und ließ den Tränen freien Lauf. Den Truck aus dem nahen Stahlwerk, der mit röhrendem Motor an ihr vorbeibrauste, bemerkte sie kaum. Sie war dem Tod knapp entronnen. Nur das Auftauchen des Deputy Sheriffs hatte sie vor einem grausamen Ende bewahrt. Die Erkenntnis, dass ein schwarzes Leben weniger wert war als zur Zeit der Sklaverei im 19. Jahrhundert, traf sie wie ein Schlag. Weiße Männer hatten sie bedrängt und beschimpft, aber niemals zuvor war sie auf diese Weise bedroht und gequält worden.
Sie rieb sich die Tränen vom Gesicht und stieg in den Plymouth. Mit brennenden Augen starrte sie in die Dunkelheit. Sie verdrängte die Schmerzen und startete den Motor. Im Rückwärtsgang versuchte sie aus dem Graben zu kommen. Vergeblich. Sie sank erschöpft nach vorn und stützte sich mit der Stirn auf das Lenkrad. Sie nahm den Kopf erst hoch, als sie das Motorengeräusch eines fremden Wagens hörte und grelles Scheinwerferlicht durch ihre Windschutzscheibe fiel. Im Rückspiegel beobachtete sie, wie ein alter Cadillac hielt und ein Mann ausstieg. »O nein, nicht schon wieder!«, flüsterte sie in panischer Angst.
2
Ihre Angst war unbegründet. Der junge Mann, der neben ihren Wagen trat und sich neugierig zu ihr herunterbeugte, war schwarz. Im schwachen Licht der Scheinwerfer erkannte sie ein schmales Gesicht mit ausdrucksvollen Augen. Unter seinem Kinn war eine Narbe. »Entschuldigen Sie, Miss!«, meinte er, als er ihr verstörtes Gesicht sah, »ich wollte Sie nicht erschrecken! Hatten Sie einen Unfall? Ihnen ist doch nichts passiert?«
Audrey schüttelte den Kopf. Sie kauerte verängstigt auf ihrem Sitz, die Arme vor der Brust verschränkt. Der Ausdruck ihrer Augen erinnerte den jungen Mann an ein Wild, das man in die Enge getrieben hat. Zögernd antwortete sie: »Ich bin okay, Mister ...«
»Edward. Ich bin Edward Hill aus Chicago.« Er lächelte. »Und sagen Sie bloß nicht Eddy zu mir! Das würde mich an den Ziegenbock meiner Großeltern erinnern und der war so ziemlich das störrischste und gemeinste Wesen in ganz Illinois!« Er schüttelte ihr die Hand. »Freut mich, Sie kennen zu lernen, Miss!«
»Audrey Jackson«, erwiderte sie freundlich. Die Erleichterung, einem höflichen und gebildeten Mann wie ihm zu begegnen, war ihr deutlich anzumerken. »Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist!«, schwindelte sie ohne ihn anzublicken. Sie wollte ihn nicht mit ihrem Erlebnis belasten. »Plötzlich ist mein Wagen ins Schleudern gekommen! Würden Sie mir helfen, ihn aus dem Graben zu fahren? Ich bin keine besonders gute Autofahrerin ...«
»Natürlich«, erklärte er bereitwillig. »Sieht so aus, als hätte Ihr Wagen nicht mal eine Beule abbekommen. Hoffentlich ist der Achse nichts passiert!« Er half ihr heraus und blickte verwundert auf ihr schmutziges und zerrissenes Kleid. Irgendetwas stimmte nicht mit dieser jungen Frau. »Was ist mit Ihnen?«, fragte er. »Sind Sie sicher, dass Sie sich nicht wehgetan haben?«
»Ein paar Prellungen, weiter nichts«, beruhigte sie ihn.
Edward ahnte, dass sie die Unwahrheit sagte, und musterte sie lange, bevor er in den Wagen stieg. Vielleicht hatte ihr Freund sie geschlagen und sie war davongelaufen. Aber das ging ihn nichts an. Er startete den Motor und legte den Rückwärtsgang ein. Obwohl er den Gashebel nur langsam durchdrückte, bewegte sich der Plymouth kaum vom Fleck. Der Graben war zu tief. Er schob den Schalthebel zurück und seufzte: »Der Wagen sitzt fest. Ich muss Sie rausziehen. Ich hole das Abschleppseil.«
Während er sich am Kofferraum seines Cadillacs zu schaffen machte, klopfte sich Audrey rasch den Staub aus den Kleidern. Sie hatte seinen kritischen Blick bemerkt. Ihre Rippen schmerzten bei jeder Bewegung und es kostete sie viel Kraft, sich nichts anmerken zu lassen. »Und Sie kommen wirklich aus Chicago?«
»Chicago, Illinois«, bekräftigte er, »dort bin ich aufgewachsen und zur Schule gegangen. Mein Vater arbeitet auf dem Güterbahnhof vor der Stadt. Er ist mächtig stolz auf mich, weil ich das College geschafft habe.« Er lächelte. »Zum Glück weiß er nicht, wie schlecht meine Noten waren. Wohnen Sie in Birmingham?«
»Bei meinen Eltern. Sie haben einen Gemischtwarenladen im schwarzen Viertel, ein paar Blocks hinter der Baptistenkirche.« Sie beobachtete, wie er den Kofferraum schloss und hinter dem Wagen hervorkam. Er war ein vornehmer Mann. Sein Anzug saß wie angegossen und seine Schuhe glänzten. »Ich arbeite als Sekretärin in unserer High School. Zum College hat's leider nicht gereicht. Ich hab drei Geschwister und meine Eltern drehen jeden Penny um! Vielleicht schafft es mein jüngerer Bruder!«
Er kehrte mit dem Abschleppseil zurück. »Um diese Zeit sollten Sie eigentlich gar nicht mehr unterwegs sein, Audrey. An diesem Highway soll der Ku-Klux-Klan sein Unwesen treiben, wissen Sie das nicht? Der Alte an der Tankstelle hat mich ausdrücklich gewarnt! Sie können von Glück sagen, dass Ihnen nicht mehr passiert ist.« Er hielt inne. Audrey! Was ist denn? Hab ich was Falsches gesagt? Ich hab Ihnen doch keine Angst eingejagt?«
Sie starrte auf das Abschleppseil in seinen Händen und stolperte rückwärts gegen ihren Wagen. Ihre Augen waren starr vor Angst und sie zitterte am ganzen Körper. Sie begann zu weinen.
»Um Gottes willen, Audrey! Ich wollte Ihnen keine Angst machen, ganz bestimmt nicht!« Er ließ das Seil fallen und eilte zu ihr, wusste nicht, ob er sie in die Arme schließen und trösten sollte. Unbeholfen blieb er stehen. Er streckte die Arme nach ihr aus und ließ sie wieder sinken. »Audrey! Was ist mit Ihnen los?«
Sie schüttelte sich und wischte sich die Tränen aus den Augen. »Es ist meine Schuld, Edward. Ich habe Sie belogen. Ich wollte nicht zugeben, dass diese Männer ... Mich haben zwei Männer überfallen! Zwei junge Kerle in einem Pick-up. Sie wollten mich mit einem ... Abschleppseil ... an ihren Wagen binden und zu Tode schleifen! Einer hat mir in die Rippen getreten! Wenn der Sheriff nicht vorbeigekommen wäre ... Es war ganz furchtbar, Edward!«
Sie blickte ihn mit ihren verweinten Augen an und schlang ihre Arme um seine Hüften, als wären sie seit vielen Jahren miteinander vertraut. Er erwiderte die Umarmung zögernd. Seine sanften Hände, die tröstend über ihren Rücken strichen, vertrieben ihre Angst und den Schock. Nach einer Weile löste sie sich von ihm und ordnete nervös ihre Haare. Er wusste nicht, was er sagen sollte, und beeilte sich das Abschleppseil an ihrem Plymouth zu befestigen. Das andere Ende band er an den Cadillac. »Und Sie sind wirklich okay?«, fragte er.
Sie nickte stumm.
Edward blieb unschlüssig stehen. Am liebsten hätte er sie noch einmal in die Arme genommen.« Und der Sheriff hat Ihnen nicht geholfen?«, meinte er. »Er hat diese Bursche; laufen lassen? Er hat nicht mal Ihren Wagen aus dem Graben gezogen?«
»Ich kann froh sein, dass er mich nicht wegen Landstreicherei festgenommen hat«, erwiderte sie bitter. »In Alabama ist noch kein Weißer, der einen Neger geschlagen hat, verhaftet worden!«
»In Chicago auch nicht«, sagte er. »Aber das wird sich bald ändern! Haben Sie gehört, was in Montgomery passiert ist? Die Schwarzen haben so lange die Busse boykottiert, bis sie vorn sitzen durften. Die Gesellschaft ging beinahe bankrott! Über achtzig Prozent der Passagiere sind Schwarze! Wir haben mehr Macht, als viele denken! In Montgomery gibt es kaum noch ›Nur für Weiße‹-Schilder! Irgendwann wird es in ganz Amerika so sein, Audrey!«
Nicht in Birmingham, Edward. Hier gibt's den Ku-Klux-Klan und weiße Mistkerle wie diesen Steve und diesen Duncan, die mich überfallen haben! Und wenn es neue Gesetze gäbe, würde niemand sie einhalten. Hier sieht die Polizei tatenlos zu, wenn die Kapuzenmänner unschuldige Schwarze aufhängen! Daran könnten nicht mal Martin Luther King und seine Leute was ändern. Vielleicht ist es auch besser so.«
»Wieso?«
»Immer wenn sich was verändert, gibt es Ärger«, wiederholte Audrey die Worte ihres Vaters. »Es gäbe einen jahrelangen Krieg, der viele von uns ruinieren würde. Meine Eltern haben einen Laden, die würden bestimmt nicht mitmachen.«
»Und Sie? Sie sind noch jung!«
»Soll ich mich deswegen von einem Polizisten zu Tode prügeln lassen? Oder von der Nationalgarde? Unser Polizeichef sieht bestimmt nicht tatenlos zu, wenn es einen Aufstand gibt! Der hetzt die Hunde auf uns, und wenn es hart auf hart geht, lässt er schießen! Ich habe in der Wochenschau gesehen, wie sie den Bus der Freedom Riders mit Benzin übergossen und angesteckt haben! Ein Wunder, dass da jemand heil rausgekommen ist!«
»Ich war dabei.«
»Wie bitte?«
»Ich war dabei«, wiederholte Edward. »Ich war ein Free-dom Rider. Ich war in Anniston, als der weiße Mob die Reifen zerstach, und ich war einer der Letzten, die aus dem Bus entkamen, als sie die Brandbombe durch die Hintertür warfen. Ich bin einer von denen, die es nicht ertragen können, dass wir wie Menschen zweiter Klasse behandelt werden. Es muss sich was ändern!«
Audrey ging einige Schritte auf ihn zu und starrte ihn an. »Sie arbeiten für Martin Luther King, nicht wahr? Sie kommen nach Birmingham, weil hier die nächsten Proteste stattfinden sollen.«
»Wir reden später darüber, Audrey«, sagte Edward, als hätte er Angst, dass man ihn hier draußen hören könnte. Er stieg rasch in seinen Cadillac und ließ den Motor an. Im Rückwärtsgang zog er den Plymouth aus dem Graben. Er stieg aus, löste das Abschleppseil, wickelte es zusammen und untersuchte das rechte Vorderrad des Plymouth.«Alles okay«, zeigte er sich zufrieden, »die Achse scheint nichts abbekommen zu haben.« Er ging zum Cadillac und warf das Abschleppseil in den Kofferraum. »Ich begleite Sie nach Hause, okay? Ich fahre hinter ihnen her.« Er öffnete die Wagentür. »Ich hoffe, Sie halten mich nicht für aufdringlich, Audrey. Ich will nur nicht, dass Ihnen etwas passiert.«
»Ich bin Ihnen sehr dankbar, Edward. Ohne Sie hätte ich die ganze Nacht hier festgesessen!« Sie stieg in ihren Wagen und blickte aus dem offenen Fenster. »Es sind nur ein paar Meilen!«
Der Motor des Plymouth heulte auf und sie steuerte ihn langsam auf die Lichter jenseits der Felder zu. Im Rückspiegel sah sie, dass Edward dicht hinter ihr blieb. Einen Mann wie ihn hatte sie noch nie getroffen. Er trug einen dreiteiligen Anzug wie die Geschäftsleute, die während der Mittagspause aus dem neuen Hochhaus der Bank of Savings kamen, und war doch ganz anders. Sehr nachdenklich und ruhig, aber auch mutig und entschlossen, wenn es um die Gleichberechtigung der Schwarzen ging. Seine Berührung war warm und liebevoll gewesen. Sie schämte sich jetzt noch dafür, ihn wie ein junges Mädchen umarmt zu haben. Doch sie bereute ihr Vorgehen kein bisschen. Er war ein außergewöhnlicher junger Mann und sie hatte jetzt schon Angst, sich für immer von ihm verabschieden zu müssen.
Sie bremste leicht, als die ersten Häuser von Birmingham am Straßenrand auftauchten. »The Magic City« stand in großen Lettern über dem Eingang zum Straßentunnel. Sie fragte sich, was an Birmingham magisch sein sollte. Die Stadt war hässlicher als Montgomery und Mobile und lebte von den Stahlwerken, deren Schornsteine wie drohende Finger in den nächtlichen Himmel ragten. Die Lichter einer Bierreklame leuchteten über dem Eingang zu einer Bar. Die Straßen waren leer, als wären die Bewohner vor einer drohenden Katastrophe geflohen, und wenn Audrey daran dachte, warum Edward in die Stadt gekommen war, erschien ihr dieser Vergleich gar nicht so abwegig. Wenn Martin Luther King und seine Leute in Birmingham waren, stand tatsächlich großes Unheil bevor. Hier würde die Polizei niemals nachgeben und der Ku-Klux-Klan würde alles daran setzen, eine mögliche Protestaktion mit allen Mitteln zu unterbinden.
Audrey gehörte zur überwiegenden Mehrheit der Schwarzen, die ihr Schicksal geduldig ertrugen. Sie war keine Heldin, spürte keinen Zorn wie Betty Ann, die nur darauf wartete, an einer solchen Protestaktion teilnehmen zu können. Sie nahm die Rassentrennung als etwas hin, das nicht geändert werden konnte, und hatte sich mit der Welt, wie sie in Birmingham aufgeteilt war, abgefunden. Die Weißen lebten in ihrer »Nur für Weiße«-Welt und die Schwarzen in ihrer »Black Community«, die auf einige Straßenzüge, Häuserblocks, Schulen, Läden, Kinos und die hinteren Sitzbänke der Stadtbusse beschränkt war. Jeder hatte seinen Platz, und solange es nicht zu gewalttätigen Aktionen wie in dieser Nacht kam, hatte Audrey nichts dagegen einzuwenden. Ihre Eltern verdienten gut, sie hatte einen Job und es fehlte ihnen an nichts.
Sie bog von der Hauptstraße ab und erreichte das schwarze Viertel im Westen der Stadt. In ihrem Rückspiegel leuchteten die Scheinwerfer des Cadillacs. Es war bereits nach Mitternacht und keines der Häuser war noch beleuchtet. Die wenigen Straßenlampen verbreiteten ein trübes Licht und ließen die schmucklosen Wohnblocks und verfallenen Holzhäuser noch armseliger erscheinen. Auf dem Gehsteig vor einem der Apartmenthäuser lag ein umgestürztes Dreirad. Das Haus ihrer Eltern, ein zweistöckiger Bau aus solidem Stein, den ihr Vater eigenhändig verputzt hatte, lag hinter einem der eingezäunten Sportplätze, zwischen einem mehrstöckigen Wohnblock und einer Tankstelle. Über dem Schaufenster ihres Gemischtwarenladens hingen Coca-Cola-Reklametafeln. Sie parkte vor dem Eingang und griff nach ihrer Handtasche. Beim Aussteigen spürte sie ihre geprellten Rippen und sie musste sich mit dem Rücken gegen die Wagentür lehnen, bis der Schmerz nachließ und sie wieder atmen konnte.
»Alles in Ordnung?«, fragte Edward besorgt. Er war aus seinem Cadillac gestiegen und hielt den Zündschlüssel in der Hand. »Soll ich nicht doch lieber einen Arzt rufen? Wer weiß, wie schwer diese Mistkerle Sie erwischt haben! Soll ich Ihre Eltern wecken?«
Audrey konnte schon wieder lächeln. »Nein, nein, ich hab nur vergessen, dass ich mich nicht so ruckhaft bewegen darf.« Sie verschloss die Wagentür. »Vielen Dank für Ihre Hilfe, Edward! Das war sehr freundlich von Ihnen! Ich weiß nicht, was ich ohne Sie gemacht hätte. Nächstes Mal fahre ich früher nach Hause.«
Edward war mit seinen Gedanken längst woanders. »Hören Sie, Audrey«, meinte er, »wenn ich Sie vorhin erschreckt habe, tut es mir Leid. Ich hätte daran denken sollen, dass Birmingham ein gefährliches Pflaster ist. Hier haben die Menschen besonders große Angst. Ich hätte es Ihnen vielleicht etwas vorsichtiger beibringen sollen. Martin Luther King und seine Leute kommen tatsächlich hierher. Sie wollen eine große Protestaktion starten, um der Rassentrennung endgültig den Kampf anzusagen. Die Schwarzen sind es leid, Menschen zweiter Klasse zu sein! Sie müssen endlich aus ihrer Gleichgültigkeit erwachen und für ihre Rechte kämpfen!«
»Und wie soll das gehen?«, fragte Audrey leise. »Sollen wir uns Kutten überstülpen und gegen den Klan in den Krieg ziehen? Sollen wir mit Knüppeln und Steinen gegen die Polizei vorgehen? Mit der gewaltlosen Methode kommen Sie in Birmingham nicht weit. Was in Montgomery oder Albany funktioniert hat, geht hier noch lange nicht! Hier verstehen die Weißen keinen Spaß!«
»Das weiß ich, Audrey. Das wissen wir alle. Aber wir dürfen nicht länger zusehen, wie Menschen nur wegen ihrer Hautfarbe zu niederen Wesen abgestempelt werden. Die Freiheit ist das höchste Gut des Menschen und es ist unsere Pflicht, dafür zu kämpfen. Sie brauchen keine Angst zu haben, Audrey! Wir werden auch in Birmingham auf jegliche Gewalt verzichten und Sie werden sehen, dass wir stark genug sind, um auch einen Gouverneur Wallace oder einen Polizeichef Bull Connor zu überzeugen. Liebe ist stärker als Hass. Wir kämpfen nicht gegen die Weißen, sondern gegen das Böse. Das Ziel unserer Aktionen ist es, mit den Weißen in Frieden und Freundschaft zu leben. Deshalb verzichten wir auf jegliche Gewalt. Nur wer Liebe sät, kann Liebe ernten. So ähnlich steht es schon in der Bibel. Ich weiß, ich höre mich wie ein Prediger an, aber mir liegt sehr viel daran, dass Sie mich verstehen. Sie haben Angst, das ist ganz natürlich. Ich weiß, dass es für viele Schwarze bequemer wäre, alles so zu lassen, wie es ist. Doch eine innere Stimme sagt mir, dass wir die Ungerechtigkeit auf dieser Welt nicht länger hinnehmen dürfen. Ich war bei den Freedom Riders, obwohl mir klar war, dass ich mein Leben aufs Spiel setze. Ich wollte der ganzen Welt zeigen, wie die Schwarzen im amerikanischen Süden behandelt werden. Wir dürfen jetzt nicht aufgeben, Audrey!« Er merkte, wie sehr er sie mit seinem langen Vortrag verwirrt hatte, und lächelte schwach. »Darf ich Sie wiedersehen, Audrey?«
Nach seiner Predigt hatte sie eine solche Frage nicht erwartet. Sie wusste nicht, was sie davon halten sollte. »Um mir von Martin Luther King und seinem gewaltlosen Protest gegen die Weißen zu erzählen? Oder soll das eine Einladung zu einem Date sein?«
»Beides«, räumte er mit einem unsicheren Lächeln ein. »Wir könnten zusammen ins Kino gehen! Oder einfach nur in der Gegend rumfahren. In meinem Cadillac ist genug Platz. Ich hab ihn von meinem Großvater geerbt, ein ziemlich betagter Schlitten, und immer wenn ich bremse, quietscht er wie eine alte Dampflok, aber die Sitze sind bequem und das Radio funktioniert auch noch. Darf ich Sie abholen, Audrey? Sagen wir, um sechs Uhr?«
Audrey lächelte zurück. »Aber nur, wenn Sie mir versprechen, nicht den ganzen Abend über Politik zu sprechen!« Sie gab ihm die Hand. »Also abgemacht, Edward! Morgen Abend um sechs!«
3
Audrey blieb vor der Haustür stehen und wartete, bis der Cadillac auf die Fourth Avenue abgebogen war. Das Motorengeräusch verlor sich in dem geschäftigen Lärm, der wie eine Dunstglocke über der Hauptstraße des schwarzen Viertels hing. Sobald die schwarzen Geschäftsleute ihre Firmen und Läden verließen, öffneten die Nachtlokale und Zuhälter und leichte Mädchen bevölkerten die Gehsteige. Nur eine Straße weiter regierte der Rat Killer in seinem Shoeshine Parlor, ein skrupelloser Geschäftemacher, der sich hinter der Fassade seines Schuhputzbetriebs versteckte und an fast allen schmutzigen Geschäften im Rotlichtbezirk beteiligt war. Selbst weiße Männer sollten zu seinen Kunden gehören. »Wo Armut herrscht, hat die Moral wenig Platz«, hatte ihr Vater einmal gesagt, obwohl er bedauerte, dass sein Laden nicht an der Hauptstraße lag. Dort wäre das Geschäft besser gegangen. Seiner Tochter hatte er verboten, sich nach Einbruch der Dunkelheit auf der Fourth Avenue sehen zu lassen.
Sie öffnete die Tür und blieb in dem dunklen Hausflur stehen. Im Parterre lagen der Laden und das dazugehörige Lager, im ersten Stock wohnten ihre Eltern und ihre beiden Brüder, der vierjährige Robin und der sechsjährige Napoleon. Ihre Schwester, die zwölfjährige Alberta, hatte ein Zimmer im zweiten Stock, neben der kleinen Wohnung, die Audrey sich eingerichtet hatte. Obwohl die Türen keine Fenster hatten, verzichtete sie darauf, das Flurlicht einzuschalten. Zögernd betrat sie die hölzerne Treppe. Fast jede Stufe knarrte und es gab keine Möglichkeit, lautlos in den zweiten Stock zu steigen. Dennoch hoffte sie, unbemerkt an der Wohnung ihrer Eltern vorbeizukommen.
Durch das kleine Fenster im ersten Stock fiel schwaches Licht. Das Knarren der brüchigen Stufen hallte unheilvoll durch das schmale Treppenhaus. Sie hatte gerade den ersten Absatz erreicht, als die Wohnungstür ihrer Eltern aufging und ihre Mutter in den Lichtschein trat. Sie war eine kräftige Frau mit ausdrucksvollem Gesicht und lebhaften Augen. Ihr geblümtes Nachthemd reichte bis auf den Boden. »Audrey, bist du das?« Ihren Namen nannte Nellie Jackson nur, wenn sie besorgt oder wütend war, sonst sagte sie »Honey« oder »Baby« zu ihrer Tochter.
»Ja, Mom«, erwiderte Audrey schuldbewusst. »Es ist ein bisschen später geworden. Du weißt doch, wie das ist, wenn Betty Ann und ich zusammen sind. Wir haben gar nicht gemerkt, wie es dunkel wurde.« Sie spürte ihre schmerzenden Rippen und hielt sich am Geländer fest. »Ich wollte euch nicht wecken, Mom.«
»Ich habe nicht geschlafen, Audrey.« In ihrer Stimme klang leichter Ärger, aber auch Sorge mit. »Wo warst du so lange? Wir haben uns schon Sorgen gemacht! Es ist gleich halb eins!«
»Ich weiß, Mom. Ich hab zu spät auf die Uhr gesehen.«
»Ich hab gedacht, es wäre was passiert!«
Audrey ließ das Geländer los und verzog das Gesicht. Immer wenn sie sich in eine bestimmte Richtung bewegte, wurde der Schmerz stärker. Duncan hatte ganze Arbeit geleistet. Sie versuchte den Schmerz vor ihrer Mutter zu verbergen und senkte den Kopf. Die blauen Flecken würden tagelang zu sehen sein.
»Was ist mit deinem Kleid?«, fragte ihre Mutter scharf.
»Was soll damit sein?« Sie blickte an sich hinunter und erschrak, als sähe sie die Risse und den Schmutz zum ersten Mal. »Ach, das! Ich ... ich bin gefallen, Mom. Das krieg ich wieder hin.«
»Lüg mich nicht an, Audrey!«
Audrey begann zu weinen. »Ich ... ich bin überfallen worden, Mom! Diese Kerle ... sie haben mich aus dem Auto gezogen und wollten mich ... sie wollten mich umbringen, Mom! Der eine hat mich getreten! Wenn die Polizei nicht gekommen wäre ... Der Deputy hat sie weggejagt ... Er hat sie nicht mal festgenommen!«
Nellie Jackson kam die Treppe herunter und nahm ihre Tochter in die Arme. Ihr Blick war voller Fürsorge. »Warum sagst du das nicht gleich, Baby?« Sie wischte ihr die Tränen vom Gesicht und fragte besorgt: »Sie haben dich doch nicht ...« Sie blickte auf das schmutzige Kleid und blickte sie in aufkommender Panik an. »Sag mir die Wahrheit, Baby! Haben sie dich unsittlich berührt?«
»Nein, Mom.«
»Du sollst die Wahrheit sagen!«
»Sie haben mich nicht vergewaltigt, Mom!« Audrey hatte ihre Fassung wiedergefunden und löste sich von ihrer Mutter. »Sie wollten mich zu Tode schleifen! Wenn der junge Mann nicht ...«
»Welcher junge Mann?«, erklang die dunkle Stimme ihres Vaters. Er war unbemerkt in der Tür erschienen und blickte auf seine Frau und seine Tochter hinab. Mit seinem kantigen Gesicht und den funkelnden Augen wirkte er strenger, als er in Wirklichkeit war. »Was ist passiert, Audrey? Wo warst du die ganze Zeit?«
»Zwei Weiße haben sie überfallen«, sagte Nellie Jackson, bevor Audrey antworten konnte. »Aber es ist nichts passiert, Honey, nicht wahr?« Sie blickte ihre Tochter an. Audrey nickte stumm und wagte nicht ihrem Vater in die Augen zu sehen. »Der Sheriff hat die Burschen vertrieben.« Ihre Mutter lächelte schwach. »Es ist alles in Ordnung, Emory! Der Sheriff war rechtzeitig da! Ein heißes Bad und unser Baby ist wieder okay! Stimmt's, Honey?«
»Ja, Mom«, sagte Audrey gehorsam.
Emory Jackson brauchte einige Zeit, um die Nachricht zu verdauen. Er setzte mehrmals zu einer Antwort an, bevor er hilflos die Arme hob und seiner Tochter vorwarf: »Wie oft hab ich dir gesagt, nicht bei Dunkelheit durch die Gegend zu fahren! Warum hörst du nicht auf mich? Du weißt doch, dass die Klansmänner unterwegs sind! Die machen auch vor einem Mädchen nicht Halt!«
»Ich weiß, Daddy! Ich weiß! Ich hätte früher losfahren sollen.« Sie sah ihn noch immer nicht an. »Aber es ist ja noch mal gut gegangen. Edward hat mich nach Hause begleitet, ein junger ...«
»Edward? Wer ist Edward?«, unterbrach ihr Vater sie.
»Edward Hill«, antwortete sie schüchtern. »Ein junger Mann, ein paar Jahre älter als ich. Er kam zufällig vorbei, als die Weißen weg waren. Er hat mir geholfen, den Plymouth aus dem Graben zu ziehen. Dem Wagen ist nichts passiert, Daddy! Edward hat mich nach Hause begleitet. Er arbeitet für Martin Luther King ...«
»Auch das noch!«, stöhnte ihr Vater. »Dann stimmt es also doch! Martin Luther King und seine Leute sind in Birmingham und wollen hier die gleiche Aktion wie in Montgomery und Albany durchziehen. Das hat uns gerade noch gefehlt!« Er blickte seine Tochter an. »Sag bloß, er hat versucht, dich mit reinzuziehen?«
»Emory!«, mischte sich Nellie Jackson ein. »Das spielt doch jetzt wirklich keine Rolle! Deine Tochter kann von Glück sagen, dass die weißen Männer sie nicht zu Tode geprügelt haben! Wie kannst du da mit so etwas anfangen? Hauptsache, der junge Mann hat dafür gesorgt, dass sie sicher nach Hause kommt!«
»Ich möchte wissen, mit wem meine Tochter ausgeht!«, blieb Emory Jackson stur. »Solange sie ihre Beine unter meinen Tisch streckt, habe ich ein Recht dazu! Und wenn dieser dahergelaufene Jüngling glaubt, meine Tochter zu einem Sit-in überreden ...«
»Emory!«, rief Nellie Jackson noch einmal. »Darüber können wir morgen reden. Du siehst doch, wie sehr Audrey unter der Sache leidet!« Sie senkte ihre Stimme. »Außerdem weckst du die Kinder auf!«
»Okay, okay, ich geh ja schon!«, meinte Emory Jackson aufgebracht und verschwand in der Wohnung. »Aber morgen möchte ich wissen, was es mit diesem ... diesem Edward auf sich hat!«
Nellie Jackson lächelte hintergründig. »Dein Vater meint es nicht so«, tröstete sie ihre Tochter. »Er macht sich Sorgen, das ist alles! Er hat Angst um dich! Und ich ehrlich gesagt auch!« Ihre Miene wurde ernst. »Und du bist sicher, dass dir nichts passiert ist? Wenn du willst, rufe ich den Doktor. Doc Snyder kommt auch nachts, wenn es sein muss. Hast du große Schmerzen, Baby?«
»Es geht schon, Mom. Nur ein paar blaue Flecken.«
»Kannst du morgen arbeiten?«
»Es ist nicht schlimm, Mom.«
Audrey sagte ihrer Mutter gute Nacht und stieg in den zweiten Stock hinauf. Vor ihrer Tür blieb sie stehen und wartete, bis ihre Mutter das Licht gelöscht und den Flur verlassen hatte. Erleichtert betrat sie ihre Wohnung. Aus dem Zimmer ihrer Schwester drang leises Schnarchen. Sie ging in die Küche, zog die Milchflasche aus dem Kühlschrank und nahm einen tiefen Schluck. Mit der Flasche in der Hand trat sie ans Fenster und blickte hinaus.
Die Straße lag verlassen im trüben Licht der Lampen. Selbst die Tankstelle war geschlossen. Ein herrenloser Hund stöberte in den Abfallbeuteln vor einem Apartmenthaus und rannte jaulend davon, als er mit der Schnauze in einige Glasscherben stieß. Der leichte Wind trieb eine alte Zeitung über den Gehsteig. Sie verfing sich hinter der Stoßstange eines aufgebockten Lieferwagens, segelte zu Boden und flatterte in einen Hauseingang.
Audrey trank den Rest der Milch und stellte die leere Flasche auf die Fensterbank. Ohne den Blick von der Straße zu nehmen zog sie ihre Strickjacke aus. Sie blickte dem Hund nach, der in einer schmalen Gasse zwischen zwei Häusern verschwand, und seufzte unterdrückt. Wie begrenzt ihre Welt doch war! Sie reichte von der Fourth Avenue bis zum Busbahnhof, dahinter begannen die Geschäftsviertel der Weißen. Beide Welten waren durch unsichtbare Grenzen voneinander getrennt. Bereits in der Innenstadt war sie eine Fremde, betrachteten die Weißen sie mit einer Mischung aus Verwunderung und Abscheu, so wie man eine Ziege betrachten würde, die sich ins Wohnhaus verirrt hatte. Seit dem Bürgerkrieg vor hundert Jahren hatte sich kaum etwas verändert. Zwar gab es keine Sklavenhalter und Aufseher mehr, doch die strengen Gesetze und die Bürokratie, die während der so genannten Reconstruction nach dem Ende des Bürgerkriegs gekommen waren, verhinderten die von Präsident Abraham Lincoln geplante Befreiung der Schwarzen. Der Süden wehrte sich mit aller Macht gegen die »Ausbeuter« aus dem Norden und sorgte mit Privatarmeen und Geheimbünden dafür, dass die »verdammten Nigger« auf der untersten gesellschaftlichen Stufe blieben.
Wie jedes schwarze Mädchen kannte auch Audrey die Geschichte des Ku-Klux-Klans. Ihr Vater hatte ihr beizeiten von den vermummten Klansmännern erzählt und sie schon als kleines Kind vor ihren Überfällen gewarnt. Im Moment war der KKK, wie der Geheimbund auch genannt wurde, stärker denn je. Die Protestmärsche, Boykotte und Sitzstreiks der Schwarzen waren den meisten Weißen im Süden ein Dorn im Auge und die Klansmänner brauchten sich nicht einmal zu verstecken. Wenn sie einen Schwarzen verprügelten oder umbrachten, mussten sie keine Strafe befürchten. Das Gesetz war auf ihrer Seite. Am schlimmsten war Gouverneur Wallace. Er hatte sich nach seiner Amtseinführung auf die Stufen des Kapitols gestellt und lautstark die Rassentrennung befürwortet. Audrey erinnerte sich noch genau an seine Worte: »Rassentrennung jetzt! Rassentrennung morgen! Rassentrennung für immer!« Eine bewusste Abwandlung des Ku-Klux-Klan-Mottos: »Hier gestern! Hier morgen! Hier für immer!«
Audrey ging ins Bad und duschte gründlich, als könnte sie die Erinnerung an die Worte des Gouverneurs und die furchtbaren Geschichten, die über den Klan im Umlauf waren, aus ihrem Gedächtnis waschen. In Montgomery hatten sie eine weiße Frau und einen elfjährigen schwarzen Jungen aus einem Auto gezerrt und so schwer verletzt, dass der Junge einen Tag später gestorben war. Die Frau, eine zwanzigjährige Jüdin, die während des Busstreiks geholfen hatte, die schwarzen Kinder zur Sonntagsschule zu bringen, lag ein halbes Jahr im Krankenhaus und litt noch Monate später unter den Verletzungen.
Nachdem sie in ihr Zimmer zurückgekehrt und ihr Nachthemd angezogen hatte, setzte Audrey sich auf den Bettrand. Sie stützte den Kopf in die Hände und versuchte vergeblich die quälenden Gedanken zu vertreiben. Das schreckliche Erlebnis auf dem Highway, das Treffen mit ihrer Freundin und die Begegnung mit Edward ließen Bilder aus ihrem Bewusstsein aufsteigen, die sie längst verdrängt hatte. Sie erinnerte sich, die Freedom Riders im Fernsehen gesehen zu haben. Allein der Gedanke, dass ihr neuer Freund in dem Bus gewesen war, den die aufgebrachten Weißen überfallen hatten, trieb ihr einen kalten Schauer über den Rücken. Die Bilder waren auf den Titelseiten der großen Zeitungen gewesen und um die ganze Welt gegangen: der brennende Bus auf dem Highway, der von der johlenden Menge vor Anniston aufgehalten und mit einer Brandbombe ausgeräuchert worden war. Die weißen Männer im Busbahnhof von Birmingham, die einige der Passagiere krankenhausreif geschlagen hatten. Einer der Passagiere musste mit fünfzig Stichen genäht werden, ein anderer blieb sein Leben lang gelähmt. Die Polizei erschien eine halbe Stunde später und machte keine Anstalten, die Täter zu verhaften. Polizeichef Bull Connor sagte, seine Männer seien wegen des Muttertags nicht am Busbahnhof gewesen. Betty Ann glaubte, dass die Polizei und der Ku-Klux-Klan gemeinsame Sache machten. »Die stecken alle unter einer Decke!«, schimpfte sie.« Aber wir werden dennoch siegen! Unser Protest wird sie in die Knie zwingen!«
Audrey löschte das Licht und legte sich ins Bett. Verwirrt starrte sie in die Dunkelheit. Bisher hatte sie sich kaum mit den Protestaktionen der Schwarzen beschäftigt. In ihrer kleinen Welt fühlte sie sich einigermaßen sicher. Erst an diesem Abend hatte sich einiges verändert. Sie hatte einen jungen Mann getroffen, der mit Martin Luther King zusammenarbeitete. Einen Freedom Rider, der sie nicht nur wegen seiner politischen Aktivitäten durcheinander brachte. Mit dem Gedanken an sein verschmitztes Lächeln schlief sie ein.
4
Die Ullman High School gehörte zu den wenigen weiterführenden Schulen, die es für schwarze Kinder in Birmingham gab, ein schmuckloses Gebäude im schwarzen Viertel mit einem eingezäunten Schulhof und einem Sportplatz. Audrey nahm den Bus und setzte sich auf eine der hinteren Bänke, obwohl außer dem Fahrer kein einziger Weißer zu sehen war. Zum ersten Mal dachte sie darüber nach, was wohl passieren würde, wenn sie sich auf eine der vorderen Bänke setzte. Würde der Fahrer anhalten und die Polizei rufen? Würde man sie ins Gefängnis sperren so wie Rosa Parks in Montgomery?
Auf dem Schulhof wartete ein Lehrer und forderte die Kinder auf, sich in der Eingangshalle zu versammeln. »Beeilt euch!«, rief er ihnen ungeduldig zu. »Der Direktor hat euch etwas zu sagen!«
»Hallo, John!«, begrüßte Audrey ihn erstaunt. »Was ist denn los?«
»Wirst du gleich hören«, erwiderte John Glenn, der Englischlehrer. Anscheinend wollte er die Kinder nicht erschrecken. Er blickte an Audrey vorbei, als hätte er Angst vor einem unwillkommenen Besucher, und bedeutete ihr, so schnell wie möglich ins Schulhaus zu gehen. »Beeil dich! Der Chef wartet auf dich!«
Claude A. Wesley, der Direktor der Ullman High School, stand auf einem Podest in der Eingangshalle und gestikulierte aufgeregt, als sie die Halle betrat. »Morgen, Chef«, begrüßte sie ihn nervös. Sie deutete auf die vielen Kinder, die erwartungsvoll herumstanden oder auf den Treppen saßen. »Ist was passiert?«
Der Direktor, ein stämmiger Mann mit einem breiten Gesicht, überhörte ihre Frage. »Gut, dass Sie kommen, Audrey! Kümmern Sie sich um Cynthia, ja? Sie sitzt da drüben auf der Treppe. Sie hat mitbekommen, was passiert ist, und weint die ganze Zeit!«
Cynthia Dianne war die Adoptivtochter des Direktors, ein vierzehnjähriges Mädchen mit großen Augen und einer hellgrünen Schleife im dichten Haar. Sie war kleiner als die meisten anderen Mädchen ihres Alters und sah jünger aus. »Hallo, Cynthia!«, begrüßte Audrey sie betont fröhlich. »Darf ich mich zu dir setzen?«
Das Mädchen blickte auf und rückte wortlos zur Seite. Ihre Augen waren rot vom vielen Weinen und ihre Nase tropfte. Audrey reichte ihr ein Taschentuch und legte ihr einen Arm um die Schultern. »Sieht so aus, als wollte dein Vater eine Rede halten!«
Claude A. Wesley stand auf seinem Podest und bat die Kinder um Ruhe. Ein rascher Blick überzeugte ihn davon, dass Audrey neben seiner Tochter saß. »Guten Morgen«, begrüßte er die Kinder ernst, und ohne auf eine Erwiderung seines Grußes zu warten, fuhr er fort: »Ich hab euch in die Halle kommen lassen, um euch etwas Wichtiges mitzuteilen. Wie ich erfahren habe, hat gestern ein Treffen des Ku-Klux-Klan in West End stattgefunden.« Jeder Schüler kannte den Geheimbund und schreckte allein bei der Erwähnung seines Namens zusammen. »Die Klansmänner wollen heute Mittag durch die Innenstadt marschieren! Ich glaube nicht, dass sie sich ins schwarze Viertel wagen, aber ich möchte euch dennoch bitten, das Schulhaus nicht zu verlassen. Nicht einmal während der Pause. Es ist zu gefährlich! Bleibt bitte in euren Klassenzimmern und gehorcht euren Lehrern! Bis heute Nachmittag wissen wir, ob es sicher ist, den Bus nach Hause zu nehmen!«
Seinen Worten folgte eine betretene Stille. Die Kinder wussten, wie es ihnen ergehen würde, wenn sie den Klansmännern in die Hände fielen.
Cynthia klammerte sich an Audrey. »Ich hab Angst!«, sagte sie. »Der Klan will sich an uns rächen, weil wir Martin Luther King und seine Leute nach Birmingham gerufen haben! ›Das gibt Krieg!‹, hat mein Vater gesagt!« Sie blickte Audrey ängstlich an. »Bringen sie mich um, Audrey? Töten sie mich, weil ich die Tochter des Direktors bin?«
»Unsinn«, beruhigte Audrey das Mädchen, »gerade weil du die Tochter des Direktors bist, werden sie nicht wagen dir etwas anzutun!«
»Und was ist mit Sarah Lee?«, fragte Cynthia besorgt. »Sie ist nicht in die Schule gekommen! Meinst du, der Klan hat sie erwischt? Ihr großer Bruder ist letztes Jahr von den Klansmännern verprügelt worden! Sie hat Angst, dass sie ihn noch einmal überfallen! Was ist, wenn sie Sarah Lee entführt haben, um ihren Bruder aus dem Haus zu locken?«
»Sarah Lee? Sarah Lee Thornton?«, fragte Audrey. Sie erinnerte sich an ein schmächtiges Mädchen mit langen Zöpfen. »Und sie ist heute nicht in die Schule gekommen? Sie ist bestimmt krank. Ich bin sicher, ihre Mutter hat angerufen und sie entschuldigt.«
»Gestern war sie noch gesund«, meinte Cynthia.
»Ich erkundige mich, ja?«, versprach Audrey dem Mädchen und schob es ins Klassenzimmer. »Und jetzt ab in den Unterricht! Sonst verpasst du noch deine Englischstunde!« Sie wartete, bis die Tür hinter Cynthia zugefallen war, und ging ins Büro. Dort suchte sie die Nummer der Thorntons heraus. Sie wählte und ließ es mehrmals klingeln. »Hat Mrs. Thornton bei Ihnen angerufen, Chef?«, fragte sie den Direktor, als er hereinkam. »Sarah Lee ist nicht in die Schule gekommen!«
»Sarah Lee Thornton?«, wunderte sich Claude A. Wesley. »Nein, hier hat niemand angerufen. Sind Sie ganz sicher, dass sie nicht erschienen ist? Sie kommt mit dem Schulbus, wissen Sie?«
»Cynthia hat sie nicht gesehen.«
Der Direktor nickte. »Die beiden sind befreundet. Ihr Bruder ist kurz vor Weihnachten vom Klan überfallen worden. Er kann von Glück sagen, dass sie ihn nicht umgebracht haben. Aber davon haben Sie sicher gehört.« Er seufzte leise, als er daran dachte, wie die Mutter des Mädchens tränenüberströmt bei ihm in der Sprechstunde gesessen hatte. »Haben Sie bei ihr angerufen?«
»Gerade eben. Es meldet sich niemand.«
»Dann sind sie bestimmt auf dem Acker«, versuchte der Direktor sich selbst zu beruhigen. »Die Thorntons haben eine Farm.«
»Im Februar?«, fragte Audrey verwundert.
Claude A. Wesley gab sich einen Ruck. »Sie haben Recht, Audrey. Wir sollten den Tatsachen ins Auge sehen. Es ist gut möglich, dass ihnen etwas passiert ist. Ich fahre bei ihnen vorbei.«
»Sie können hier nicht weg«, hielt Audrey den Direktor zurück, »die Kinder würden nur Angst bekommen, wenn sie nicht mehr hier sind. Und die Lehrer müssen auch bleiben. Ich fahre!«
»Das lasse ich nicht zu! Es ist viel zu gefährlich!«
Audrey hütete sich von den Ereignissen der letzten Nacht zu berichten. Sie versuchte tapfer ihre Angst zu verbergen. »Ich nehme die Hauptstraße, da begegne ich den Klansmännern bestimmt nicht. Wenn Sie mir den Pick-up geben und ich mir ein Kopftuch umbinde, hält mich jeder für eine Farmersfrau.«
»Okay, meinetwegen. Aber meiden Sie die Innenstadt und fahren Sie bloß nicht über irgendwelche Feldwege! Wer weiß, wo sich die Kuttenträger überall verstecken!« Er lächelte zaghaft. »Ich würde gern dabei sein, wenn die Klansmänner vor dem Jüngsten Gericht stehen! Was meinen Sie, was Gott zu ihnen sagt?«
»Ich glaube nicht, dass Gott sie empfangen wird.«
»Da haben Sie Recht«, meinte der Direktor.