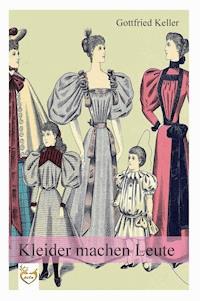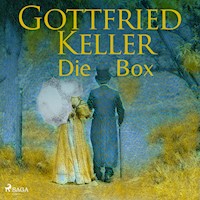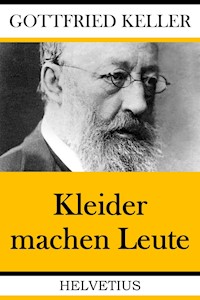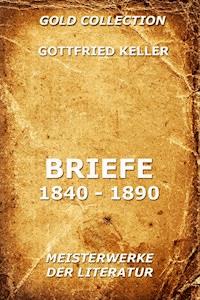Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Klassiker bei Null Papier
- Sprache: Deutsch
Neue Deutsche Rechtschreibung Gottfried Keller (19.07.1819–15.07.1890) war ein Schweizer Dichter und Staatsbeamter. Man kann ohne Zweifel sagen, dass Gottfried Keller der wichtigste Autor der Schweiz im 19. Jahrhundert war. Wegen eines Dummejungenstreiches von einer höheren Schulbindung oder gar einem Studium ausgeschlossen, fand der Halbwaise über den Umweg der Lehre zum Landschaftsmaler doch noch zur Literatur. Er hinterlässt ein großes Werk an Gedichten, Dramen, Novellen und Romanen. Null Papier Verlag
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 126
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gottfried Keller
Sieben Legenden
Erzählungen
Gottfried Keller
Sieben Legenden
Erzählungen
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected] 2. Auflage, ISBN 978-3-962812-60-7
null-papier.de/newsletter
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Eugenia
Die Jungfrau und der Teufel
Die Jungfrau als Ritter
Die Jungfrau und die Nonne
Der schlimm-heilige Vitalis
Dorotheas Blumenkörbchen
Das Tanzlegendchen
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Klassiker bei Null Papier
Alice im Wunderland
Anna Karenina
Der Graf von Monte Christo
Die Schatzinsel
Ivanhoe
Oliver Twist oder Der Weg eines Fürsorgezöglings
Robinson Crusoe
Das Gotteslehen
Meisternovellen
Eine Weihnachtsgeschichte
und weitere …
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
Vorwort
Beim Lesen einer Anzahl Legenden wollte es dem Urheber vorliegenden Büchleins scheinen, als ob in der überlieferten Masse dieser Sagen nicht nur die kirchliche Fabulierkunst sich geltend mache, sondern wohl auch die Spuren einer ehemaligen mehr profanen Erzählungslust oder Novellistik zu bemerken seien, wenn man aufmerksam hinblicke.
Wie nun der Maler durch ein fragmentarisches Wolkenbild, eine Gebirgslinie, durch das radierte Blättchen eines verschollenen Meisters zur Ausfüllung eines Rahmens gereizt wird, so verspürte der Verfasser die Lust zu einer Reproduktion jener abgebrochen schwebenden Gebilde, wobei ihnen freilich zuweilen das Antlitz nach einer anderen Himmelsgegend hingewendet wurde, als nach welcher sie in der überkommenen Gestalt schauen.
Der ungeheure Vorrat des Stoffes ließe ein Ausspinnen der Sache in breitestem Betriebe zu; allein nur bei einer mäßigen Ausdehnung des harmlosen Spieles dürfte demselben der bescheidene Raum gerne gegönnt werden, den es in Anspruch nimmt.
Eugenia
Ein Weib soll nicht Mannsgeräte tragen, und ein Mann soll nicht Weiberkleider antun; denn wer solches tut, ist dem Herrn, deinem Gott, ein Gräuel.
5. Mos. 22, 5
Wenn die Frauen den Ehrgeiz der Schönheit, Anmut und Weiblichkeit hintansetzen, um sich in andern Dingen hervorzutun, so endet die Sache oftmals damit, dass sie sich in Männerkleider werfen und so dahintrollen.
Die Sucht, den Mann zu spielen, kommt sogar schon in der frommen Legendenwelt der ersten Christenzeit zum Vorschein, und mehr als eine Heilige jener Tage war von dem Verlangen getrieben, sich vom Herkommen des Hauses und der Gesellschaft zu befreien.
Ein solches Beispiel gab auch das feine Römermädchen Eugenia, freilich mit dem nicht ungewöhnlichen Endresultat, dass sie, in große Verlegenheit geraten durch ihre männlichen Liebhabereien, schließlich doch die Hilfsquellen ihres natürlichen Geschlechtes anrufen musste, um sich zu retten.
Sie war die Tochter eines angesehenen Römers, der mit seiner Familie in Alexandria lebte, wo es von Philosophen und Gelehrten aller Art wimmelte. Demgemäß wurde Eugenia sehr sorgfältig erzogen und unterrichtet, und dies schlug ihr so wohl an, dass sie, sobald sie nur ein wenig in die Höhe schoss, alle Schulen der Philosophen, Scholiasten und Rhetoren besuchte, wie ein Student, wobei sie stets eine Leibwache von zwei niedlichen Knaben ihres Alters bei sich hatte. Dies waren die Söhne von zwei Freigelassenen ihres Vaters, welche zur Gesellschaft mit ihr erzogen waren und an all ihren Studien teilnehmen mussten.
Mittlerweile wurde sie das schönste Mädchen, das zu finden war, und ihre Jugendgenossen, welche seltsamerweise beide Hyazinthus hießen, erwuchsen desgleichen zu zwei zierlichen Jünglingsblumen, und wo die liebliche Rose Eugenia zu sehen war, da sah man allezeit ihr zur Linken und zur Rechten auch die beiden Hyazinthen säuseln oder anmutig hinter ihr hergehen, indessen die Herrin rückwärts mit ihnen disputierte.
Und es gab nie zwei wohlgezogenere Genossen eines Blaustrümpfchens; denn nie waren sie anderer Meinung als Eugenia, und immer blieben sie in ihrem Wissen um einen Zoll hinter ihr zurück, sodass sie stets recht behielt und nie befürchten musste, etwas Ungeschickteres zu sagen als ihre Gespielen.
Alle Bücherwürmer von Alexandrien machten Elegien und Sinngedichte auf die musenhafte Erscheinung, und die guten Hyazinthen mussten diese Verse sorgfältig in goldene Schreibtafeln schreiben und hinter ihr hertragen.
Mit jedem halben Jahre wurde sie nun schöner und gelehrter, und bereits lustwandelte sie in den geheimnisvollen Irrgärten der neuplatonischen Lehren, als der junge Prokonsul Aquilinus sich in Eugenia verliebte und sie von ihrem Vater zum Weibe begehrte. Dieser empfand aber einen solchen Respekt vor seiner Tochter, dass er trotz des römischen Vaterrechtes nicht wagte, ihr den mindesten Vorschlag zu machen, und den Freier an ihren eigenen Willen verwies, obgleich kein Eidam ihm willkommener war als Aquilinus.
Aber auch Eugenia hatte seit manchen schönen Tagen heimlich das Auge auf ihn geworfen, da er der stattlichste, angesehenste und ritterlichste Mann in Alexandrien war, der überdies für einen Mann von Geist und Herz galt.
Doch empfing sie den verliebten Konsul in voller Ruhe und Würde, umgeben von Pergamentrollen und ihre Hyazinthen hinter dem Sessel. Der eine trug ein azurblaues Gewand, der andere ein rosenfarbiges und sie selbst ein blendend weißes, und ein Fremdling wäre ungewiss gewesen, ob er drei schöne zarte Knaben oder drei frisch blühende Jungfrauen vor sich sehe.
Vor dieses Tribunal trat nun der männliche Aquilinus in einfacher würdiger Toga und hätte am liebsten in traulicher und zärtlicher Weise seiner Leidenschaft Worte gegeben; da er aber sah, dass Eugenia die Jünglinge nicht fortschickte, so ließ er sich ihr gegenüber auf einen Stuhl nieder und tat ihr seine Bewerbung in wenigen festen Worten kund, wobei er sich selbst bezwingen musste, weil er seine Augen unverwandt auf sie gerichtet hielt und ihren großen Liebreiz sah.
Eugenia lächelte unmerklich und errötete nicht einmal, so sehr hatte ihre Wissenschaft und Geistesbildung alle feinern Regungen des gewöhnlichen Lebens in ihr gebunden. Dafür nahm sie ein ernstes, tiefsinniges Aussehen an und erwiderte ihm: »Dein Wunsch, o Aquilinus, mich zur Gattin zu nehmen, ehrt mich in hohem Grade, kann mich aber nicht zu einer Unweisheit hinreißen; und eine solche wäre es zu nennen, wenn wir, ohne uns zu prüfen, dem ersten rohen Antriebe folgen würden. Die erste Bedingung, welche ich von einem etwaigen Gemahl fordern müsste, ist, dass er mein Geistesleben und Streben versteht und ehrt und an demselben teilnimmt! So bist du mir denn willkommen, wenn du öfter um mich sein und im Wetteifer mit diesen meinen Jugendgenossen dich üben magst, mit mir nach den höchsten Dingen zu forschen. Dabei werden wir dann nicht ermangeln, zu lernen, ob wir füreinander bestimmt sind oder nicht, und wir werden uns nach einer Zeit gemeinsamer geistiger Tätigkeit so erkennen, wie es gottgeschaffenen Wesen geziemt, die nicht im Dunkel, sondern im Lichte wandeln sollen!«
Auf diese hochtragende Zumutung erwiderte Aquilinus, nicht ohne ein geheimes Aufwallen, doch mit stolzer Ruhe: »Wenn ich dich nicht kennte, Eugenia, so würde ich dich nicht zum Weibe begehren, und mich kennt das große Rom sowohl wie diese Provinz! Wenn daher dein Wissen nicht ausreicht, schon jetzt zu erkennen, was ich bin, so wird es, fürchte ich, nie ausreichen. Auch bin ich nicht gekommen, nochmals in die Schule zu gehen, sondern eine Ehegenossin zu holen; und was diese beiden Kinder betrifft, so wäre es, wenn du mir deine Hand vergönntest, mein erster Wunsch, dass du sie endlich entlassen und ihren Eltern zurückgeben möchtest, damit sie denselben beistehen und nützlich sein könnten. Nun bitte ich dich, mir Bescheid zu geben, nicht als ein Gelehrter, sondern als ein Weib von Fleisch und Blut!«
Jetzt war die schöne Philosophin doch rot geworden, und zwar wie eine Purpurnelke, und sie sagte, während ihr das Herz klopfte: »Mein Bescheid ist bald gegeben, da ich aus deinen Worten entnehme, dass du mich nicht liebst, o Aquilinus! Dieses könnte mir gleichgültig sein, wenn es nicht beleidigend wäre für die Tochter eines edlen Römers, angelogen zu werden!«
»Ich lüge nie!« sagte Aquilinus kalt; »lebe wohl!«
Eugenia wandte sich ab, ohne seinen Abschied zu erwidern, und Aquilinus schritt langsam aus dem Hause nach seiner Wohnung. Jene wollte, als ob nichts geschehen wäre, ihre Bücher vornehmen; allein die Schrift verwirrte sich vor ihren Augen, und die Hyazinthen mussten ihr vorlesen, indessen sie voll heißen Ärgers mit ihren Gedanken anderwärts schweifte.
Denn wenn sie bis auf diesen Tag den Konsul als denjenigen betrachtet hatte, den sie allein unter allen Freiern zum Gemahl haben möchte, wenn es ihr allenfalls gefiele, so war er ihr jetzt ein Stein des Anstoßes geworden, über den sie nicht hinwegkommen konnte.
Aquilinus seinerseits verwaltete ruhig seine Geschäfte und seufzte heimlich über seine eigene Torheit, welche ihn die pedantische Schöne nicht vergessen ließ.
Es vergingen beinahe zwei Jahre, während welcher Eugenia womöglich immer merkwürdiger und eine wahrhaft glänzende Person wurde, indessen die Hyazinthen allbereits zwei starke Bengel vorstellten, denen der Bart wuchs. Obgleich man jetzt von allen Seiten anfing, sich über dies seltsame Verhältnis aufzuhalten, und anstatt der bewundernden Epigramme satirische Proben dieser Art aufzutauchen begannen, so konnte sie sich doch nicht entschließen, ihre Leibgarde zu verabschieden; denn noch war ja Aquilinus da, der ihr dieselbe hatte verbieten wollen. Er ging ruhig seinen Weg fort und schien sich um sie nicht weiter zu bekümmern; aber er sah auch kein anderes Weib an, und man hörte von keiner Bewerbung mehr, sodass auch er getadelt wurde, als ein so hoher Beamter unbeweibt fortzuleben.
Um so mehr hütete sich die eigensinnige Eugenia, ihm durch Entfernung der anstößigen Gesellen scheinbar ein Zeichen der Annäherung zu geben. Überdies reizte es sie, der allgemeinen Sitte und der öffentlichen Meinung zum Trotz nur sich allein Rechenschaft zu geben und unter Umständen, welche für alle andern Frauen gefährlich und untunlich gewesen wären, das Bewusstsein eines reinen Lebens zu bewahren.
Solche Wunderlichkeiten lagen dazumal eben in der Luft.
Mittlerweile befand sich Eugenia doch nicht wohl und zufrieden; ihre geschulten Diener mussten Himmel, Erde und Hölle durchphilosophieren, um plötzlich unterbrochen zu werden und stundenweit mit ihr im Feld herumzulaufen, ohne eines Wortes gewürdigt zu sein. Eines Morgens verlangte sie auf ein Landgut hinauszufahren; sie lenkte selbst den Wagen und war lieblicher Laune; denn es war ein klarer Frühlingstag und die Luft mit Balsamdüften erfüllt. Die Hyazinthen freuten sich der Fröhlichkeit, und so fuhren sie durch eine ländliche Vorstadt, wo es den Christen erlaubt war, ihren Gottesdienst zu halten. Sie feierten eben den Sonntag, aus der Kirche eines Mönchsklosters ertönte ein frommer Gesang, Eugenia hielt die Pferde an, um zu hören, und vernahm die Worte des Psalmes: »Wie eine Hindin nach den Wasserquellen, so lechzet meine Seele, o Gott! nach dir! Meine Seele dürstet nach dem lebendigen Gott!«
Bei dem Klange dieser Worte, aus frommen demütigen Kehlen gesungen, vereinfachte sich endlich ihr künstliches Wesen, ihr Herz ward getroffen und schien zu wissen, was es wolle, und langsam, ohne zu sprechen, fuhr sie weiter nach dem Landgute. Dort zog sie insgeheim männliche Kleider an, winkte die Hyazinthen zu sich und verließ das Haus mit ihnen, ohne von dem Gesinde gesehen zu werden. Und sie kehrte nach dem Kloster zurück, klopfte an der Pforte und stellte sich und ihre Begleiter dem Abt als drei junge Männer vor, welche begehrten, in das Kloster aufgenommen zu werden, um von der Welt abzuscheiden und dem Ewigen zu leben. Sie wusste, da sie wohlunterrichtet war, auf die prüfenden Fragen des Abtes so trefflich zu antworten, dass er alle drei, die er für feine und vornehme Leute halten musste, in das Kloster aufnahm und den geistlichen Habit anziehen ließ.
Eugenia war ein schöner, fast engelgleicher Mönch und hieß der Bruder Eugenius, und die Hyazinthen sahen sich wohl oder übel desgleichen in Mönche verwandelt, da sie gar nicht gefragt worden waren und sich längst daran gewöhnt hatten, nicht anders zu leben, als durch den Willen ihres weiblichen Vorbildes. Doch bekam ihnen das Mönchsleben nicht übel, indem sie ungleich ruhigere Tage genossen, nicht mehr zu studieren brauchten und sich gänzlich einem leidenden Gehorsam hingeben konnten.
Der Bruder Eugenius hingegen rastete nicht, sondern wurde ein berühmter Mönch, weiß wie Marmor im Gesicht, aber mit glühenden Augen und dem Anstand eines Erzengels. Er bekehrte viele Heiden, pflegte die Kranken und Elenden, vertiefte sich in die Schrift, predigte mit goldener Glockenstimme und ward sogar, als der Abt starb, zu dessen Nachfolger erwählt, alsodass nun die feine Eugenia ein Abt war über siebenzig gute Mönche, kleine und große.
Während der Zeit, als sie so unerklärlich verschwunden blieb mit ihren Gefährten und nirgends mehr aufzufinden, hatte ihr Vater ein Orakel befragen lassen, was aus seiner Tochter geworden sei, und dieses verkündete, Eugenia sei von den Göttern entrückt und unter die Sterne versetzt worden. Denn die Priester benutzten das Ereignis, um den Christen gegenüber ein Mirakel aufzuweisen, während diese den Hasen längst in der Küche hatten. Man bezeichnete sogar einen Stern am Firmament mit zwei kleineren Nebenschnüppchen als das neue Sternbild, und die Alexandriner standen auf den Straßen und den Zinnen ihrer Häuser und schauten hinauf, und mancher, der sie einst hatte herumgehen sehen und sich ihrer Schönheit erinnerte, verliebte sich nachträglich in sie und guckte mit feuchten Augen in den Stern, der ruhig im dunkeln Blau schwamm.
Auch Aquilinus sah hinauf; aber er schüttelte den Kopf, und die Sache wollte ihm nicht einleuchten. Desto fester glaubte der Vater der Verschwundenen daran, fühlte sich nicht wenig erhoben und wusste es mit Hilfe der Priester durchzusetzen, dass Eugenien eine Bildsäule errichtet und göttliche Ehren erwiesen wurden. Aquilinus, der die obrigkeitliche Bewilligung erteilen musste, tat es unter der Bedingung, dass das Bild der Entrückten ähnlich gemacht würde; das war leicht zu bewerkstelligen, da es eine ganze Menge Büsten und Bildchen von ihr gab, und so wurde ihre Marmorstatue in der Vorhalle des Minerventempels aufgestellt und durfte sich sehen lassen vor den Göttern und Menschen, da es unbeschadet der sprechenden Ähnlichkeit ein Idealwerk war in Kopf, Haltung und Gewändern.
Die siebenzig Mönche des Klosters, als diese Neuigkeit dort verhandelt wurde, ärgerten sich höchlich über den Trumpf, der von heidnischer Seite ausgespielt worden, über die Errichtung eines neuen Götzenbildes und die freche Anbetung eines sterblichen Weibes. Am heftigsten schalten sie über das Weib selber als über eine Landläuferin und betrügerische Gauklerin, und sie machten während des Mittagsmahles einen ganz ungewöhnlichen Lärm. Die Hyazinthen, welche zwei gutmütige Pfäfflein geworden und das Geheimnis des Abtes in der Brust begraben hielten, sahen diesen bedeutungsvoll an; aber er winkte ihnen zu schweigen und ließ das Schelten und Toben über sich ergehen als Strafe für seine frühere heidnische Sündenzeit.
In der Nacht aber, als die Hälfte derselben vorüber war, erhob sich Eugenia von ihrem Lager, nahm einen starken Hammer und ging leise aus dem Kloster, um das Bild aufzusuchen und zu zerschlagen. Leicht fand sie den marmorglänzenden Stadtteil, wo die Tempel und öffentlichen Gebäude lagen und sie ihre Jugendzeit zugebracht hatte. Keine Seele rührte sich in der stillen Steinwelt; als der weibliche Mönch die Stufen zum Tempel hinaufging, erhob sich eben der Mond über die Schatten der Stadt und warf sein taghelles Licht zwischen die Säulen der Vorhalle hinein. Da sah Eugenia ihr Bild, weiß wie der gefallene Schnee, in wunderbarer Anmut und Schönheit dastehen, die feinfaltigen Gewänder sittig um die Schultern gezogen, mit begeistertem Blick und leis lächelndem Munde vor sich hinsehend.