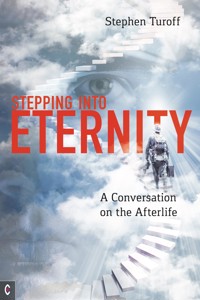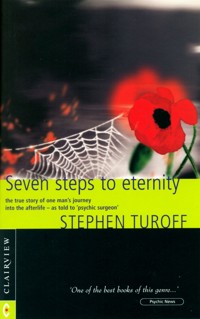Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Giger Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
»Ich starb in der Schlacht an der Somme«. Das waren die ersten verblüffenden Worte, die die Seele von James Legett, eines im ersten Weltkrieg gefallenen Soldaten, an den Geistheiler Stephen Turoff richtete. Zwei Jahre lang kommunizierte er mit der Seele des Soldaten und hielt seine bemerkenswerte Geschichte fest – nicht die Erzählung von Legetts tragischem Leben auf der irdischen Ebene, sondern die seines Todes und die Reise, die seine Seele anschliessend in das Leben nach dem Tod unternahm. Daraus entstand dieses erhellende Zeugnis vom Leben jenseits der Illusion des Todes. Ein verständnisvolles und weises Buch. Es will uns zeigen, dass wir alle ewig sind. Stephen Turoff, geboren 1947 in England, gehört heute zu den anerkanntesten Geistheilern unserer Zeit. Er empfängt täglich viele Patienten in seiner Praxis in Chelmsford, der Danbury Healing Clinic. Er bereist viele Länder in Europa und Übersee, hält Vorträge und Seminare. www.stephenturoff.com
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 276
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Stephen TuroffSieben Schritte zur Ewigkeit
Stephen Turoff
Sieben Schrittezur Ewigkeit
Aus dem Englischen übersetztvon Susanne Lötscher
Giger Verlag
Titel der englischen AusgabeSeven Steps to EternityErschienen bei Clairview Books, London
1. Auflage 2005© Stephen Turoff, London© der deutschsprachigen Ausgabe 2005 Giger Verlag,CH-8852 Altendorf/Zürichwww.gigerverlag.chUmschlagbild: In medias res, Jürgen Schmidt, D-90402 NürnbergLayout: Roland Poferl Print-Design, D-50733 KölnKoordination: Kölner Medienbüro(www.koelner-medienbuero.de)
e-Book: mbassador GmbH, BaselPrinted in GermanyISBN Nr. 3-9523065-1-7eISBN 978-3-907210-96-3
Ich möchte mich bei all meinen Freundenin der sichtbaren und unsichtbaren Welt bedanken,die die Entstehung dieses Buchesermöglicht haben.Stephen Turoff
Inhalt
Vorwort
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
VORWORT
Als Medium genieße ich das Privileg, oft Seelen der Astralebene zu begegnen. Sie haben mich im wahrsten Sinn des Wortes über ihre Erfahrungen in den Ebenen nach dem Tod aufgeklärt und erleuchtet.
Wenn eine Seele ihren Körper zum ersten Mal verlässt, gerät sie in einen schlafähnlichen Zustand und erwacht auf jener Ebene der Astralwelt, die für sie geeignet ist. Ich werde oft nach diesem Begriff »Ebene« befragt und die nahe liegendste Antwort ist Schwingungszustand. Klangwellen beispielsweise; die UVStrahlen der Sonne; Strahlen einer elektrischen Lampe; sie sind alle unsichtbar, durchdringen sich gegenseitig, beeinträchtigen oder behindern sich aber nicht. So ist es auch mit den Ebenen der Astralwelt.
Auf jeder dieser Ebene weilen jene Seelen, die dort am besten ihrer spirituellen Entwicklung gemäß leben und wirken können: »Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen.«
Neulich hielt ich am Volkstrauertag einen Vortrag. Als ich so am Rednerpult stand und überlegte, wie ich anfangen sollte, trat ein junger Mann in mein Bewusstsein. Mit meinem medialen Blick konnte ich ihn deutlich sehen und begann mich einzuklinken in das, was er mir über seinen Tod im Ersten Weltkrieg erzählte. »Ich heiße James«, fing er an und dann erzählte er mir, was er im Alter von zwanzig Jahren nach seinem Tod erlebt hatte.
Auf dem Heimweg war ich mir seiner immer noch bewusst. Als ich es mir in meinem Lehnstuhl bequem machte, um mich gedanklich zu sammeln, näherte er sich wieder. Wir scherzten ein bisschen und ich dankte ihm für seine Unterstützung bei meinem Vortrag. Wir erzählten uns sogar ein paar Witze! In den folgenden Tagen lernte ich diese liebenswerte Seele gut kennen und es entstand eine Verbindung zwischen uns.
Eines Tages fragte er mich, ob ich mir vorstellen könnte, ein Buch über sein Leben zu schreiben–nicht über sein tragisch kurzes auf unserer Ebene, sondern auf den Ebenen, durch die er sich seit seinem Ableben bewegt hatte. »Da bist du bei mir an den Falschen geraten«, entgegnete ich als Erstes. Doch da Jim alle Überredungskünste aufbot und ich darauf bestand, dass er mir dabei sehr viel helfen müsse, erklärte ich mich bereit, diese Herausforderung anzunehmen. Es war mir nicht ganz klar–und vielleicht war das auch ganz gut so -, was für ein gewaltiges Unterfangen dies sein würde. Doch ich bin froh, dass ich mich darauf eingelassen habe, weil ich damit, wie Jim bemerkte, sowohl ihm half, als auch selbst so viel dazulernte.
Ich nahm mir dafür jeden Tag etwas Zeit und durch meine gewissenhafte Arbeit nahm das Buch allmählich Gestalt an. Vor Beginn jeder Sitzung bat ich in einem Gebet zuerst um Führung und Jim näherte sich. Ich spürte, wie er mir auf die Schulter klopfte, und hörte seine besonderen Begrüßungsworte: »Und, bist du bereit?«
Beim Lesen werden Ihnen unterschiedliche Stilebenen auffallen–das liegt an der Art, wie Jim mir dieses Buch vermittelte. Er belieferte meinen Geist mit Bildern und überließ es mir, sie zu deuten.
Die folgenden Seiten sind die unmittelbaren Berichte darüber, wie Jim unsere irdische Ebene verließ und welche Erfahrungen er im Leben nach dem Tod machte. Ich habe oft angezweifelt, ob wirklich ich diese Berichte verfasst habe! Manche Abschnitte sind wie rohe Diamanten mit etwas rauen Kanten, so wie Jim selbst. Andere Passagen sind eher wie Perlen, Perlen der Weisheit von den Führungsgestalten und Lehrern, die ihm Beistand leisteten. Es wurde ihm bald klar, dass er viel zu lernen hatte.
Ich habe mein Bestes getan, um diese Rohdiamanten und Perlen, diese Juwelen, aufzufädeln; und ich hoffe wirklich, dass ihre Schönheit und Wahrheit Ihr Leben genauso bereichern werden wie meines.
Stephen Turoff
KAPITEL 1
»ICHSTARBINDER SCHLACHTANDER SOMME« Das waren die ersten dramatischen Worte, die James Legget mir vermittelte. In der Folge erklärte er, wie er mit zwanzig Jahren den Tod gefunden hatte.
Es war im August 1914. Ich war erst achtzehn Jahre alt, als der Krieg ausbrach. Wie die meisten Jugendlichen wollte ich unbedingt zur Armee und hatte das Glück–wenigstens glaubte ich das damals -, genommen zu werden. Ich machte mir kaum bewusst, dass ich nicht zurückkommen würde.
Im November desselben Jahres verließ ich ein Zuhause, in dem ich immer liebevoll umsorgt worden war, und begab mich in das Lager in caterham. Das war ziemlich beschwerlich für mich, denn ich vermisste die Annehmlichkeiten von daheim. Jener Herbst war einer der regenreichsten, die ich jemals erlebt habe. Wir wurden in primitiven Armeezelten untergebracht, wo wir nur unter einer Wachstuchdecke und zwei Laken schliefen.
Mit der Aufstellung der Holzbaracken für den Winter war gerade erst begonnen worden. Bis spät in den Herbst hinein mussten wir in mit Sackleinen bespannten Unterständen leben und auf dem Boden schlafen.
Es wurden neue Befehle ausgegeben, denen zufolge wir in die Chelsea-Baracken umquartiert werden sollten. Diese erfreuliche Nachricht gab uns Grund zu feiern, denn es bedeutete, dass wir endlich ein richtiges Dach über dem Kopf haben würden. Nach Beendigung der Grundausbildung wurde das Regiment ins Ausland abkommandiert, wo wir das Gelernte praktisch anwendeten.
Im darauf folgenden Jahr kam ich zum Glück oft um Haaresbreite davon, verlor aber viele Freunde auf dem Schlachtfeld, bevor das Schicksal dann ein letztes Mal zuschlug. Bereits 1916 wurde meine Zeit knapp. Ich wurde in die Schützengräben verlegt. Die Deutschen beschossen unsere Frontlinien und das Niemandsland dazwischen mit Granaten. Wir warteten auf den Angriff, der, wie wir wussten, auf das Sperrfeuer folgen würde. Es kam zu einem grimmigen Nahkampf, aber wir schlugen sie zurück, wobei es auf unserer Seite nur geringe Verluste gab. An der Front wurde der Befehl ausgegeben, wir sollten zum Gegenangriff übergehen, bevor sich die Deutschen neu formieren konnten.
Bei Einbruch der Dunkelheit lag Stille über dem Schlachtfeld, man hörte nur ein paar Granaten explodieren, die den Nachthimmel erhellten. Vorsorglich duckte ich mich, denn die deutschen Heckenschützen brauchten nicht viel Licht, um ihr Ziel zu treffen. Plötzlich ertönte der Pfiff und man hörte den Schrei »Auf sie, Jungs!«
Wir waren erfüllt vom Kampfgeist, der nur in dieser einzigartigen Kameradschaft entstehen kann, die es in solchen Situationen gibt. Auf diesen Augenblick hatten wir die ganze Zeit gewartet. Mit aufgesteckten Bajonetten drängten wir über die Brustwehr. Für die Deutschen war unser Kommen nicht überraschend, denn sie bewarfen uns mit allem, mit Ausnahme des Spülbeckens.
Während wir auf Niemandsland vorrückten, wurde ich von einem Granatsplitter in der Brust getroffen. Stundenlang lag ich im Todeskampf auf dem Boden. Die Dämmerung zog auf und ich spürte, wie ununterbrochen Wellen von vorwärts stürmenden Männern über mich hinwegstolperten
Nach einer Weile wurde ich aufgrund des Blutverlusts bewusstlos. Bei Sonnenuntergang kam ich dann wieder zu mir. Über allem hing ein unheimlicher Nebel. Ich betete darum, eine Granate möge mich treffen und meinen Todeskampf beenden, denn der quälende Schmerz war unerträglich. Wieder wurde ich bewusstlos. Als ich wieder zu mir kam, fühlte ich mich benommen, verspürte aber wenig Schmerzen und fühlte mich nicht mehr schwach und müde. Ich legte die Hand auf die Brust, um festzustellen, wie viel Schaden der Granatsplitter angerichtet hatte. Zu meinem Erstaunen hatte meine Uniformjacke keinen einzigen Riss. Ich zog mich mühsam hoch, weil mich völlige Dunkelheit umgab. Obwohl sie entfernt schienen, hörte ich die Gewehrschüsse und das Geschrei um mich herum. Nach einer Weile gewöhnte ich mich an die Dunkelheit, die einem dicken Nebel glich, und sah dunkle Schatten darin hin und her huschen. Andere Schatten lagen reglos da. Ich beschloss, weiterzugehen; ich wollte nicht geschnappt oder von den übrigen Jungs getrennt werden.
Was dann geschah, ist schwer zu erklären. Es war wie ein Traum, in dem man versucht, weiterzugehen, aber es nicht kann. Etwas hinderte mich daran, mich mehr als ein oder zwei Schritte weiterzubewegen. Ich tastete mich ab und entdeckte eine Schnur, die sich auf geheimnisvolle Weise an mich gehängt hatte. Ich ergriff sie und zerrte daran, konnte sie aber nicht lösen. Ich sah an meinen Händen hinunter bis zu der Stelle, wo sie als nicht erkennbare dunkle Form endete. Das verwirrte mich ziemlich und löste Beklommenheit, ja Schrekken in mir aus. Ich setzte mich hin, um nachzudenken.
Den Kopf in den Händen vergraben, überlegte ich fieberhaft, was ich als Nächstes tun sollte. Plötzlich hörte ich Stimmen in der Nähe, und als ich die eines Freundes erkannte, rief ich nach ihm; doch ich bekam keine Antwort. Ich zog mich hoch und rief: »Ich bin hier!« Die Stimmen wurden lauter und zwei schattenhafte Gestalten bewegten sich auf mich zu.
»Passt doch auf!«, schrie ich, als sie geradewegs durch mich hindurchgingen. Sie knieten sich neben die schattenhafte Masse, an der ich festgebunden war, und einer schien etwas damit zu machen. Ich war verwirrt und dachte, ich sei im Delirium, doch wenigstens hatten sie mich gefunden. Plötzlich hörte ich, wie einer der Schatten ausrief: »Er ist tot, armer Kerl, wir bringen ihn am besten zurück.« Ich fragte mich, über wen sie sprachen. Beide beugten sich hinunter und hoben zu meinem Erstaunen die schattenhafte Masse hoch, an der ich festgebunden war. Als sie sich fortbewegten, wurde ich von dieser geheimnisvollen Schnur mitgezogen. Ich schrie, sie sollten stehen bleiben. »Um Himmels willen, was tut ihr da? Ich kann euch sehen, ich kann euch hören, warum gebt ihr keine Antwort?« Aber es war zwecklos.
Dann brandeten die Worte eines der beiden Schatten zurück: »Er ist hinüber, der arme Kerl.« Ich sagte mir die ganze Zeit: »Ich kann doch nicht tot sein, ich kann hören und sehen; zwar nicht besonders gut, aber ich kann sehen.« Ich hoffte und betete, dass sie sich irrten. Bei einem niedrigen Gebäude blieben sie stehen und hielten noch immer den Schatten, an dem ich festgebunden war.
Eine neue Stimme sagte: »Bringt ihn nicht hierher, er ist schon eine Weile tot. Legt ihn hinten zu den anderen, die begraben werden sollen.« Ich erinnere mich vage an die Worte, die bei der Trauerfeier gesprochen wurden, dann war es still. Die Schatten wandten sich zum Gehen und zum letzten Mal vernahm ich die Stimme meines Freundes: »Er war ein netter Typ.«
Die Stimmen verloren sich allmählich im Nebel und ich hörte nichts mehr. Langsam fuhr ich mit den Händen über Körper und Gesicht. Ich hatte immer noch einen Körper, aber irgendetwas mussten sie ja begraben haben. Inzwischen dämmerte es mir langsam, dass ich vielleicht wirklich tot war. Ich war entsetzlich verwirrt und hatte Angst. Ich fragte mich, was wohl als Nächstes passieren würde. Falls ich tot war, wo war dann der Himmel? Ich fing an, hemmungslos zu weinen, und stieß hervor: »Lieber Gott, bitte hilf mir. Ich weiß, ich bin nie in die Kirche gegangen, aber ich habe immer versucht, ein guter Mensch zu sein.«
Seltsamerweise verwandelte sich meine Angst in Wut. Mein ganzer Körper begann zu pulsieren. Ich wollte verzweifelt von dieser Schnur loskommen und meine Wut gab mir die Kraft dazu. Ich ergriff sie und zog daran. Ich kann nicht ohne weiteres beschreiben, was ich anschließend fühlte. Ich empfand eine Leichtigkeit in meinem Körper und Geist. Ich hatte das Gefühl, zum ersten Mal, seit ich verletzt worden war, einen klaren Kopf zu haben. Jetzt war ich frei!
Ich sah an mir herunter und starrte hinüber zu der Stelle, von der das Kriegsgeschrei zu mir drang. Ich konnte viele Gestalten sehen, die umherrannten und zu Boden fielen. Manche standen wieder auf, manche lagen einfach da. Eine der Gestalten fiel mir besonders auf. Als ich genauer hinsah, bemerkte ich, dass ein dünner Nebel aus ihr strömte und die Gestalt eines Mannes annahm, der über der dunklen Masse schwebte. Erstaunt mutmaßte ich, dass mir wohl dasselbe widerfahren war. Darauf sah ich eine vollständige Gestalt, an der eine dünne Silberschnur hing, die mit dem Schatten am Boden verbunden war. Ich sah weiter hin. Der Mann fing an, sich zu regen und zu kämpfen. Offensichtlich konnte er nicht verstehen, was da vor sich ging–genauso wenig wie ich gerade. »Armer Kerl, vielleicht kann ich ihm wenigstens irgendwie helfen«, dachte ich.
Es war nicht weit bis zu ihm. Beim Näherkommen hörte ich seine Schreie, als er kämpfte. Ich rief: »Keine Panik! Ich helfe dir.« Gleichzeitig dachte ich: »Bloß wie? Du bist ja viel größer als ich.« Als er mich sah, fing er an zu schreien: »Hilf mir, Kumpel, was ist los mit mir?«. »Na ja«, sagte ich, »ich glaube, wir sind tot!«
»Blöder Idiot«, rief er. »Wieso soll ich denn tot sein? Ich rede doch mit dir! Wie könnte ich denn tot sein? Wenn man tot ist, ist man tot, das weiß doch jeder.«
»Na ja, Kumpel«, sagte ich, »hör einfach auf zu denken. Kannst du dich von dort wegbewegen, wo du bist?« Plötzlich malte sich Entsetzen auf seinem Gesicht. »Nein«, kam seine Antwort, »ich kann nicht. Etwas hält mich fest. Ich glaube, so eine Art Kordel.«
Ich schlang die Arme um seinen Brustkorb. »Zieh, komm schon!«, rief ich. Mit einem gewaltigen Ruck riss er sich von dem dunklen Schatten am Boden los. Er kam viel schneller von seiner dunklen Gestalt los als ich. Ich weiß nicht, wie oder warum, aber so war es. Er war frei und ich auch. Und so begann unsere Reise in das neue Leben.
»Ich heiße James, aber meine Freunde nennen mich Jim«, sagte ich. Er antwortete: »Und ich, alter Kumpel, ich bin Bill, Bill Barnes. Aber meine Freunde nennen mich ›Der Bär‹.« Ich brauchte ihn nur anzusehen und verstand, warum. Aber trotz seiner Körpergröße sah ich die Angst auf seinem Gesicht und die Verwirrung in seinen Augen.
»Lass uns reden«, sagte er. Wir gingen ein paar Schritte und ich erklärte ihm, wie ich hierher gekommen war und seine Ankunft beobachtet hatte. »Es ist doch lachhaft. Ich kann doch nicht tot sein!«, sagte Bill. »Ich habe eine Frau und drei Kinder. Was werden sie ohne mich machen?«. »Ich weiß nicht«, gab ich zurück, »ich weiß es einfach nicht. Es muss doch eine Antwort auf all diese Fragen geben.« Wir gingen weiter.
»So wie ich es sehe, können wir nicht die Einzigen sein, die gestorben sind. Es muss noch andere geben. Ist dir eigentlich aufgefallen, dass es hier weder hell noch dunkel ist, sondern nur neblig? Ich weiß nicht, ob es Tag oder Nacht ist, auch nicht, wie spät es ist. Und schon gar nicht, was hier los ist.«
Der Boden unter unseren Füßen war hart. Der Kriegslärm hinter uns nahm immer mehr ab. Wir kämpften uns durch den Nebel. Ich blieb stehen und sah Bill an. »Ich glaube, wir haben uns verlaufen, und ich weiß nicht, wohin wir gehen sollen.« Aber Bill hörte gar nicht zu, sondern sah woanders hin. »Was ist los?«, fragte ich.
»Da kommt ein Licht auf uns zu«, gab er zur Antwort. »Vielleicht kommt Hilfe.« Das Licht wurde langsam größer und ich hörte Stimmen darin. »Bill, kannst du das hören?«, flüsterte ich. »Ja. Hinter dem Licht ist jemand. Sieh mal, da sind ein paar Menschen. Vielleicht können sie uns helfen.«
»Hallo, ihr da!«, rief ich. Könnt ihr uns sehen?«.
»Ja«, kam es zurück. Ein Offizier trat vor und mit ihm ein anderer Herr, der Kleidung trug, die ich noch nie gesehen hatte.
»Hallo, Sir«, sagte ich. »Könnten Sie uns sagen, was passiert ist und wo wir sind?« »Man wird Ihnen später alles erklären. Zuerst müssen wir weg von hier«, antwortete der Hauptmann.
Wir folgten dem Hauptmann und dem merkwürdigen Mann, der ein Licht trug. Unterwegs blieben wir ab und zu stehen, um andere aufzulesen, denen es genauso ging wie uns. Allmählich lichtete sich der Nebel und der Boden unter unseren Füßen wurde weicher. Jetzt sah alles anders aus; Bäume tauchten auf. Es schien zwar keine Sonne, aber es war warm. Beim Weitergehen fielen mir zerfurchte, bräunlich-grüne Grasflecken und ein paar zum Teil zerstörte Gebäude auf–vermutlich Überbleibsel aus dem Krieg.
Wir gingen auf eine große Wellblechbaracke zu, an deren Eingang eine Gruppe junger Soldaten unruhig wartete. Ich wollte Bill gerade fragen, was er davon hielt. Aber als ich sein Grinsen sah, fragte ich stattdessen: »Was ist denn daran so lustig?« »Ich überlege gerade«, antwortete er. »Ob hier wohl die Flügel und die Harfe ausgeteilt werden? Ich brauche dann aber ziemlich große!«
»Machen Sie sich nichts vor, Soldat«, ertönte eine Stimme. Wir drehten uns um und sahen den Hauptmann dort stehen. »Mag sein, dass Sie ganz gut begriffen haben, was mit Ihnen passiert ist, aber ich will es einmal ganz deutlich sagen«, fuhr er fort. »Wir sind alle tot, na ja, auf jeden Fall körperlich hinüber. Ich bin schon eine ganze Weile hier und helfe Leuten wie Ihnen, sich an ein neues Zuhause zu gewöhnen. Ich weiß, Sie haben eine Menge Fragen, die auch garantiert beantwortet werden. Gehen Sie jetzt alle in dieses Gebäude, dort finden Sie Sitzgelegenheiten. Setzen Sie sich einfach hin und entspannen Sie sich.« Daraufhin entfernte sich der Hauptmann mit dem Herrn, der das Licht trug.
Wir betraten einen riesigen, lauten Saal mit hunderten Stühlen, auf denen meistens Männer, aber auch ein paar Frauen saßen. Manche unterhielten sich, andere lachten oder weinten. Einige starrten einfach stumm geradeaus. Vorn stand ein Rednerpult. »Hoffentlich bekommen wir hier Antworten auf unsere Fragen«, sagte ich zu Bill.
Plötzlich ertönten sphärische Klänge und es wurde still im Saal. Ich kann den Klang nicht beschreiben, aber er hatte etwas Friedliches, Beruhigendes an sich. Ich sah zu Bill hinüber und bemerkte, wie die Angst aus seinem Gesicht wich. Über jeden im Saal senkte sich Frieden. Nach zehn oder zwanzig Minuten verstummte die Musik.
Vom Rednerpult drang die Stimme eines hoch gewachsenen Offiziers. »Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Marsh und ich möchte Ihnen erklären, wo Sie sind. Sie haben inzwischen sicher gemerkt, dass Ihnen etwas zugestoßen ist. Sie befinden sich mittlerweile an einem anderen Ort und merken nun auch, dass dieser Ort sehr real ist.
Sie befinden sich auf der Ebene zwischen Himmel und Erde, genannt Astralebene, aber machen Sie sich im Augenblick keine großen Gedanken darüber, denn dies ist ein Ort, an dem Sie sich ausruhen und eingewöhnen können. Es wird so sein, als gingen Sie wieder in die Schule. Es gibt hier für Sie viel zu lernen. Wahrscheinlich war diese Ebene für viele von Ihnen ein Schock, weil Sie gesehen haben, dass das Leben weitergeht. Was Sie Tod nennen, ist lediglich ein Ortswechsel.
Dieser Saal hier ist einer von vielen, die in der niederen Astralebene errichtet wurden, als Hilfe für diejenigen, die im Krieg sterben. Hier unterstützt man Sie dabei, diese Übergangsphase Ihres neuen Lebens zu akzeptieren. Vermutlich fragen Sie sich, was dem Feind zugestoßen ist. Wenn dies mir widerfährt, was ist dann mit ihm? Nun, Gott macht keinen Unterschied. Sie werden später verstehen, dass alle seine Kinder sind.
Am Ausgang werden Sie in Gruppen aufgeteilt und einquartiert werden. Ihrer Gruppe wird jemand zugeteilt werden, der mit Ihnen über Sie sprechen wird. Anschließend werden Sie lernen, Ihre Willenskraft einzusetzen, denn in diesem Leben wird es auf den Willen des Einzelnen ankommen. Schauen Sie doch einmal nach, ob hinten auf Ihren Stühlen eine Zahl steht. Bitte merken Sie sich diese Zahl, wenn Sie den Saal verlassen. Ich werde zu einem späteren Zeitpunkt wieder eine Ansprache halten, aber jetzt verabschiede ich mich erst einmal.«
Wir gingen zu einem der Ausgänge. Ich drehte mich nach Bill um und sah ihn direkt hinter mir. »Alles in Ordnung, Bill?«, fragte ich.
»Klar, Jim. Welche Nummer hast du?«, fragte er.
»Nicht zu fassen–1901!«, erwiderte ich. »19 und 1 ergibt mein Alter. Zuerst bekommen wir eine Nummer, wenn wir eingezogen werden. Und jetzt, wo wir tot sind, bekommen wir noch eine.«
Eine laute Stimme unterbrach mich. »Alle mit den Nummern 1900 bis 1950, bitte mitkommen.« Ich sah hoch und stellte fest, dass die Stimme einem Feldwebel gehörte. Ich bemerkte zu Bill: »Nicht einmal hier wird man sie los.« »Du hast Recht«, sagte er, »aber ich glaube, wir sollten ihm besser folgen.« Wir überquerten ein paar Felder und näherten uns einer großen Baracke.
»Also, Jungs«, sagte der Feldwebel, »Ihr werdet fürs Erste hier einquartiert. Drinnen findet ihr Betten, macht es euch also bequem. Ich bin gleich zurück.« Als ich eintrat, sah ich Betten auf beiden Seiten des Raumes und steuerte auf eines zu, während Bill das neben mir nahm. Ich drehte mich zu ihm um und sagte: »Ich glaube, ich lege mich hin.«
Ich legte mich aufs Bett und begann mich zu entspannen, während mir die letzten Stunden durch den Kopf gingen, die mich weiter zurückdenken ließen. Ich frage mich, ob meine Mutter weiß, dass ich tot bin. Es wird ihr das Herz brechen, wenn sie es erfährt. Sie wollte nicht, dass ich zur Armee gehe, aber ich wollte nicht auf sie hören. O, Mama, es tut mir so Leid. Hätte ich doch nur auf dich gehört, dann wäre ich jetzt nicht hier und könnte dir sagen, dass ich am Leben und nicht tot bin. Ich merkte, wie ich in eine Art Depression versank, als ich die Stimme des Feldwebels hörte. Es war, als hätte er meine Gedanken gelesen.
»Also, Jungs«, sagte er, »hört ihr mir mal zu? Ihr müsst eine Menge lernen, und je schneller wir damit anfangen, desto besser. Das Erste, was ihr vermissen werdet, sind die Menschen, die ihr liebt. Es wird eine Zeit lang dauern, bis ihr darüber hinweg seid, aber mit unserer Hilfe und eurer Selbstbeherrschung werdet ihr diese Emotionen in den Griff bekommen. Ich lasse euch jetzt allein, damit ihr euch ausruhen könnt, aber ich bin in ein paar Stunden wieder zurück.« Dann ging er.
Da ich sehr müde war, legte ich mich wieder hin und schlief ein. Die Stimme des Feldwebels weckte mich. »Los, raus aus den Federn. Hopp, hopp, alle aufstehen!« Nach dem Schlaf fühlte ich mich erfrischt und ausgeruht. Beim Aufstehen merkte ich, dass ich immer noch dasselbe trug wie bei meiner Ankunft, aber seltsamerweise rochen weder ich noch meine Kleidung.
»Alles in Ordnung, Jim?«, rief Bill mir zu. Ich sah ihn an.
»Ja, Kumpel, alles in Ordnung, aber ich frage mich, was sie jetzt für uns auf Lager haben. Wie kommst du zurecht?«
»Ganz gut«, gab er zurück. »Ich habe eine Weile gebraucht, um einzuschlafen, aber dafür, dass ich tot bin, fühle ich mich sehr gut.«
Ich erinnere mich, dass ich laut sagte, er sei ein rechter Witzbold. Ausgerechnet da rief uns der Feldwebel zur Ordnung. »Stellt euch jetzt draußen in Zweierreihen auf. Man lässt den Lehrer nicht warten.« »Also auf ein Neues«, dachte ich, als wir uns in Bewegung setzten.
Es entging mir nicht, dass alle besorgt dreinschauten, als wir uns einem kirchenähnlichen Gebäude näherten. Wir gingen hinein und setzten uns hin. Vor uns befanden sich ein Altar, ein Tisch und zwei Stühle. Es dauerte nicht lange, bis sich der Hauptmann vernehmen ließ. »Guten Tag, meine Herren. Sollten Sie meinen Namen vergessen haben, ich heiße Marsh, Hauptmann Marsh. Ich werde nicht persönlich zu Ihnen sprechen, sondern das Wort an jemanden übergeben, der schon viel länger in dieser Welt ist als ich und der sich zu den höheren Ebenen der Astralwelt hinentwikkelt hat. Was Sie gleich erleben werden, wird ein Schock für Sie sein, aber hier ist das etwas ganz Normales.«
Alle Augen waren auf den Hauptmann gerichtet und jeder fragte sich, was wohl als Nächstes passieren würde. Plötzlich tauchte aus dem Nichts ein wirbelnder Nebel auf. Er nahm allmählich die Gestalt eines Mannes an und schimmerte vom Scheitel bis zur Sohle, als er sich verdichtete. Wo vor uns eben noch ein leerer Raum gewesen war, stand jetzt ein Mann. Ich drehte mich um, um zu sehen, wie die anderen reagierten. Ich glaube, sie waren genauso verblüfft wie ich. »Du liebes bisschen. Und was kommt jetzt?«, dachte ich.
»Meine Herren«, sagte der Hauptmann, »ich vertraue Sie jetzt Ihrem Lehrer an.«
»Offenbar hören Sie mir alle zu«, sagte der Lehrer. »Ich kann mir keine bessere Art vorstellen, um diese Aufmerksamkeit zu bekommen, als mit einem beeindruckenden Auftritt. Zuerst möchte ich Ihnen etwas über Ihre neue Umgebung erzählen. Sie befinden sich auf der vierten von sieben Astralebenen. Jede Ebene unterscheidet sich von den anderen durch die Manifestation, Dichte und Geschwindigkeit ihrer Grundessenz. Ihr physischer Körper verändert sich in einer Weise, die Ihr spirituelles Wachstum bestimmt–etwas, wonach Ihre Seele immer sucht. Viele von Ihnen lassen ihre Seelen buchstäblich verhungern und lassen beispielsweise zu, dass der Verstand vom Materialismus völlig vereinnahmt und beherrscht wird.
An die Seele wendet man sich immer, um nach oben zu schauen, nicht um zurückzuschauen. Sie muss Ihr Leben mit Hoffnung und Liebe erfüllen… Selbst wenn Sie sich bemühen, werden Sie diesen Idealen nicht immer gerecht, doch es ist immer ein Schritt in die richtige Richtung, sich zu bemühen.
Meine lieben Freunde, Sie sind im Krieg gefallen und Ihr bewusster Verstand hat Hass auf den Feind entwickelt, so wie er auf Sie. Aber Sie sind Ihre Gedanken und diese hasserfüllten Gedanken verzögern Ihre Entwicklung. Ihr schlimmster Feind sind Sie selbst, nicht die Soldaten, denen Sie auf dem Schlachtfeld gegenüberstanden. Auf dem Schlachtfeld des Lebens müssen Sie Ihren Charakter bilden, um sich auf Ihre nächste Phase vorzubereiten.
Sie wurden nun einmal zu früh in diese Welt hineingeworfen–wie ein Apfel, der gepflückt wird, bevor er reif ist. Genauso erleben viele von Ihnen einen verfrühten Tod–als bitter. Deshalb ist es unser Wunsch, Ihnen zu helfen, Ihrer Individualität zur Reife zu verhelfen, damit sich Ihre Seele weiterentwickeln kann. Suchen Sie nur bei sich selbst, denn viele Antworten liegen in Ihnen.
Bitte konzentrieren Sie sich jetzt auf meine Worte. Sie haben gehört, dass es sieben Ebenen gibt. Ebenso haben Sie sieben Körper. Einer davon war der physische Körper, den Sie beim Verlassen der irdischen Ebene abgestreift haben. Hier auf der vierten Astralebene lernt Ihr Astralleib, im Einklang mit den Schwingungen hier zu schwingen. Sie sind feiner und schneller als die auf der irdischen Ebene. Das erklärt, weshalb hier alles genauso greifbar und real ist wie auf der Erde. Unser Ziel ist es, Ihnen zu helfen, sich auf die Schwingungen Ihrer neuen Umgebung einzustellen und sie mit ihnen in Einklang zu bringen.
Sie befinden sich auf der zweiten Ebene Ihres bewussten Lebens, und da die dritte und vierte Ebene nur geringfügig feiner als die irdische sind, sind wir bestrebt, Sie auf die fünfte Ebene zu bringen. Das wird dann stattfinden, wenn Sie Ihre mentalen und emotionalen Schwingungen verfeinern. Ich komme von der siebten Ebene, wo die Materie schneller schwingt und verfeinerter, vergeistigter ist als hier. Sie fragen sich vielleicht, wieso ich auf Ihre Ebene kommen kann.
Die Antwort darauf ist einfach. Ich habe gelernt, meine Schwingungen herunterzutransformieren, damit ich mich auch auf niedrigeren Ebenen aufhalten kann. Durch Gedankenkraft kann ich sie so weit herunterschrauben, dass ich mich hier materialisieren und mit Ihnen sprechen kann. Nun, das ist wirklich genug für den ersten Vortrag. Sie werden sich an diese Worte erinnern, wenn Sie über Ihre erste Lektion nachdenken. Sie brauchen sich keine Notizen zu machen. Möge der Große Geist Sie bis zu unserem nächsten Treffen segnen.«
Mit diesen Worten begann der Lehrer, sich vor uns zu entmaterialisieren. Als wir gegangen waren, dachte ich über seine seltsamen Erklärungen nach. Viele schienen aus einem Märchenbuch zu stammen. Ich hatte so viel zu lernen und hatte das Gefühl, so wenig zu verstehen. Der Hauptmann erhob sich und fragte, ob es noch weitere Fragen gebe, und ein paar Hände gingen nach oben.
Der Hauptmann deutete auf einen jungen Mann, der aufstand und sagte: »Mein Name ist George Taylor. Gibt es einen Gott, Sir?« Der Hauptmann erwiderte: »Ja, George. Es gibt einen Gott und wir werden später etwas über die Gotteskraft sagen, die allen Dingen innewohnt.«
Dann deutete er hinten im Saal auf jemanden, der aufstand und sagte: »Ich heiße Tom Richardson. Werde ich meine Frau wiedersehen und mit ihr sprechen können, Sir?« Ich spürte sofort, dass diese Seele in Sorge war. »Tom«, sagte der Hauptmann, »Sie haben gehört, dass Sie einen besonderen Führer zugewiesen bekommen werden, der Ihnen beibringen wird, wie Sie mit all Ihren Lieben kommunizieren können.«
Tom blieb stehen und weinte. »Aber das genügt mir nicht. Ich will sie jetzt sehen.« Langsam ließ er den Kopf in die Hände sinken und weinte wie ein Kind.
»Es reicht, Soldat«, sagte der Hauptmann. »Beherrschen Sie sich.« Seine Stimme verriet einen starken Willen, doch es schwangen auch Verständnis und Mitleid darin. Tom hob den Kopf: »Es tut mir Leid, Sir. Ich weiß nicht, was in mich gefahren ist.«
Der Hauptmann sagte: »Ich verstehe, wie Ihnen zumute ist. Wir alle machen das hin und wieder durch. Aber ich kann Ihnen versichern, dass es Ihnen gut gehen wird. Ich habe zwei Kinder zurückgelassen, das älteste war erst fünf. Aber ich kann mit ihnen und meiner Frau mithilfe einer spirituell bewussten Person, einem so genannten Medium, kommunizieren.
Ihre Führer werden diese Information in Ihre praktischen Lektionen einbauen, um Ihnen gelegentlich über Gewissensbisse hinwegzuhelfen, die Sie bekommen werden. Ich finde, wir sollten hier besser aufhören, meine Herren. Würden Sie bitte aufstehen und hinausgehen, dort wartet Ihr Feldwebel auf Sie.«
Nachdem wir entlassen worden waren, gingen wir zu unseren Unterkünften zurück. Ich legte mich aufs Bett und versuchte, alles in mich aufzunehmen, was ich gehört hatte. Mir ging so viel im Kopf herum, dass ich schnell müde wurde. Ich schloss die Augen und schlief sofort fest ein. Als ich aufwachte, hatte ich das Gefühl, so viel Stärke wie nie zu besitzen. »Mein Gott, es ist wunderbar, am Leben zu sein«, dachte ich.
Ich lachte laut vor mich hin. »Was rede ich denn da? Ich bin doch tot!« Und doch fühlte ich mich lebendiger als je zuvor. Ich ging hinüber ans Fenster, sah hinaus und dachte, hier wird es sicher niemals dunkel, denn es war immer noch taghell. Ich setzte mich wieder auf mein Bett und erinnerte mich sofort an das, was der Lehrer vorhin gesagt hatte. Das war seltsam, denn ich hatte niemals ein gutes Gedächtnis. Ich betrachtete Bill, der immer noch schlief. Sollte er sich nur ausruhen.
Nachdem ich eine Weile untätig dagesessen war und mich ziemlich langweilte, merkte ich plötzlich, dass ich nicht gesehen hatte, was jenseits des Saals lag. Da musste es ganz sicher noch etwas anderes geben. Ich ging zur Tür und öffnete sie leise, um niemanden zu stören. Ich ging auf die Kirche zu und behielt sie als Orientierungspunkt im Auge, um mich nicht zu verlaufen. Als ich weiterging, fühlte ich eine Wärme, die von allen Seiten ausstrahlte. Ich sah hoch, weil ich dachte, das müsse die Sonne sein, aber die Sonne war nirgends zu sehen und am Himmel gab es keine einzige Wolke. Ich hatte vorher nicht darauf geachtet und das schien mir jetzt seltsam. Aber andererseits–was war an diesem Ort nicht seltsam? Ich ging weiter und sah andere Menschen. Es waren junge Paare darunter, die Hand in Hand gingen; offenbar hatten sie seit ihrer Ankunft zusammengefunden. Wie glücklich sie aussahen!
Recht besehen hatte ich niemals eine feste Freundin gehabt; doch was ich nie gehabt hatte, würde ich auch nicht vermissen. Es war ein so wunderbarer Tag, dass ich zu einem Dickicht in der Nähe ging. Beim Näherkommen sah ich, dass die Bäume schlank und aufrecht waren. Ringsherum standen Lilien und Glockenblumen nebeneinander im Gras und zeigten ihre farbenprächtig leuchtenden Blüten. In der Luft hing der schwere süße Duft von Geißblatt und Lavendel.
Der Blumenteppich vor mir sah so einladend aus, dass ich mich hinsetzte und an einen der Bäume lehnte und begann, mich zu entspannen. Mir fiel auf, dass die Bäume in voller Blüte standen und damit meine Stimmung widerspiegelten. Ich gab mich Tagträumereien hin und nickte ein, wurde aber von einer Stimme aufgeschreckt.
Als ich mich umsah, erblickte ich zu meinem Erstaunen einen Orientalen, der direkt hinter mir stand. »Keine Angst«, sagte er, »ich bin hier, um dir zu helfen. Ich möchte mich vorstellen. Mein Name ist Chan und ich bin dazu ernannt worden, als dein Führer zu arbeiten. Auch wenn wir unterschiedlichen Rassen angehören, wird es zwischen uns keine Sprachbarrieren geben.«
Ich sah ihn von oben bis unten an und bewunderte seine prächtige Kleidung. Die Farben leuchteten, als wären sie lebendig. Ich fragte mich, woher er war. »Natürlich von der sechsten Ebene, wo ich lebe«, sagte er.
»He, ich habe gar nichts gesagt. Woher wusstest du, woran ich gerade dachte?«
»Ich kann deine Gedanken lesen«, antwortete er. »Hier braucht man nicht zu sprechen. Auch du wirst lernen, deine höheren Sinne zum Sprechen zu benutzen.«
»Aber redest du denn gerade mit mir?«, wollte ich wissen.