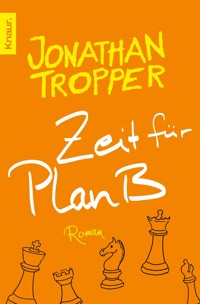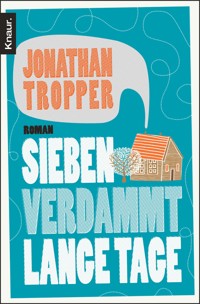
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Ich bin deine Mutter und ich liebe dich." Das sagt Mom immer. Das nächste Wort lautet stets: "Aber ..." Die Familientreffen der Foxmans enden stets mit Türenschlagen und quietschenden Reifen, wenn Judd und seine Geschwister so schnell wie möglich einen Sicherheitsabstand zwischen sich und das Elternhaus bringen. Doch nun ist ihr Vater gestorben. Sein letzter Wunsch treibt allen den Angstschweiß auf die Stirn: Die Foxmans sollen Schiwa sitzen, sieben Tage die traditionelle Totenwache halten. Das bedeutet, dass sie auf unbequemen Stühlen in einem kleinen Raum gefangen sind und nicht davonlaufen können. Nicht vor dem, was zwischen ihnen passiert ist – und nicht vor dem, was die Zukunft für sie bereithält … Sieben verdammt lange Tage von Jonathan Tropper: amüsanter Familienalltag im eBook!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 515
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Jonathan Tropper
Sieben verdammt lange Tage
Roman
Aus dem Englischen von Birgit Moosmüller
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Die Familientreffen der Foxmans enden stets mit zuschlagenden Türen und quietschenden Reifen. So schnell wie möglich versuchen die vier erwachsenen Kinder, einen Sicherheitsabstand zwischen sich und ihr Elternhaus zu bringen. Doch nun ist ihr Vater gestorben – und dessen letzter Wunsch treibt seinen Lieben den Angstschweiß auf die Stirn: Sie sollen für ihn Schiwa sitzen, sieben Tage die traditionelle jüdische Totenwache halten. Das bedeutet, dass sie auf ausgesprochen unbequemen Stühlen in einem kleinen Raum gefangen sind und nicht davonlaufen können. Nicht vor dem, was zwischen ihnen passiert ist, und nicht vor dem, was die Zukunft für sie bereithält …
Inhaltsübersicht
1. Kapitel
Mittwoch
2. Kapitel
Ich mache meinen Wagen [...]
3. Kapitel
Meine Ehe endete, wie [...]
4. Kapitel
12:15 Uhr
5. Kapitel
13:55 Uhr
14:07 Uhr
14:30 Uhr
6. Kapitel
Falls Sie eine gescheiterte [...]
7. Kapitel
15:43 Uhr
16:02 Uhr
8. Kapitel
19:45 Uhr
20:30 Uhr
9. Kapitel
21:05 Uhr
22:30 Uhr
23:06 Uhr
Donnerstag
10. Kapitel
Ich habe einen wiederkehrenden [...]
7:43 Uhr
11. Kapitel
8:25 Uhr
10:00 Uhr
12. Kapitel
11:30 Uhr
13. Kapitel
14:30 Uhr
14. Kapitel
Wade stellte unmissverständlich klar, [...]
15. Kapitel
19:00 Uhr
20:15 Uhr
16. Kapitel
20:42 Uhr
20:50 Uhr
Freitag
17. Kapitel
2:00 Uhr
18. Kapitel
8:25 Uhr
9:37 Uhr
19. Kapitel
10:00 Uhr
20. Kapitel
10:12 Uhr
21. Kapitel
Ich dachte immer, ich [...]
22. Kapitel
11:25 Uhr
23. Kapitel
11:45 Uhr
12:20 Uhr
12:55 Uhr
13:00 Uhr
13:35 Uhr
24. Kapitel
15:20 Uhr
15:50 Uhr
25. Kapitel
16:20 Uhr
26. Kapitel
20:45 Uhr
20:54 Uhr
27. Kapitel
21:30 Uhr
21:50 Uhr
22:25 Uhr
23:55 Uhr
28. Kapitel
Alice Taylor lehnte an [...]
Samstag
29. Kapitel
5:06 Uhr
6:30 Uhr
6:32 Uhr
30. Kapitel
8:06 Uhr
8:15 Uhr
9:40 Uhr
10:12 Uhr
10:25 Uhr
31. Kapitel
13:05 Uhr
14:00 Uhr
14:17 Uhr
16:40 Uhr
19:45 Uhr
20:30 Uhr
22:45 Uhr
23:30 Uhr
23:40 Uhr
Sonntag
32. Kapitel
5:20 Uhr
33. Kapitel
5:38 Uhr
34. Kapitel
10:13 Uhr
10:32 Uhr
35. Kapitel
11:22 Uhr
11:35 Uhr
11:45 Uhr
12:10 Uhr
36. Kapitel
12:45 Uhr
13:30 Uhr
37. Kapitel
13:45 Uhr
38. Kapitel
16:10 Uhr
16:45 Uhr
16:55 Uhr
17:20 Uhr
39. Kapitel
18:10 Uhr
19:50 Uhr
40. Kapitel
21:15 Uhr
22:30 Uhr
41. Kapitel
23:15 Uhr
23:45 Uhr
23:55 Uhr
Montag
42. Kapitel
6:10 Uhr
43. Kapitel
6:40 Uhr
6:55 Uhr
7:40 Uhr
44. Kapitel
10:15 Uhr
11:30 Uhr
45. Kapitel
Meine Eltern hatten ein [...]
11:50 Uhr
46. Kapitel
13:45 Uhr
16:40 Uhr
47. Kapitel
18:30 Uhr
19:30 Uhr
48. Kapitel
20:15 Uhr
20:45 Uhr
20:55 Uhr
49. Kapitel
21:25 Uhr
21:35 Uhr
Dienstag
50. Kapitel
8:15 Uhr
9:10 Uhr
9:25 Uhr
9:40 Uhr
9:55 Uhr
1
Dad ist tot«, bemerkt Wendy leichthin, als käme das öfter vor, oder tagtäglich. Es kann ganz schön nerven, dass sie immer so cool tut und selbst angesichts einer solchen Tragödie die Unerschütterliche spielt. »Er ist vor zwei Stunden gestorben.«
»Wie geht es Mom?«
»Du weißt doch, wie Mom ist. Ihre größte Sorge war, wie viel Trinkgeld sie dem Leichenbeschauer geben soll.«
Ich muss lächeln, auch wenn ich mich wie immer über die für meine Familie so typische Unfähigkeit aufrege, in Krisensituationen Gefühle zu zeigen. Jeden Anlass, der eigentlich nach aufrichtig zum Ausdruck gebrachten Emotionen verlangt, schmälern oder pervertieren wir Foxmans umgehend durch unsere hauseigene, genmanipulierte Mischung aus ironischen und ausweichenden Kommentaren. Wir kämpfen uns durch Geburtstage, Feiertage, Hochzeiten und Krankheiten, indem wir uns gegenseitig aufziehen, auslachen oder beleidigen. Jetzt ist Dad tot, und Wendy redet dumm daher. Geschieht ihm recht, schließlich war er, wenn es ums Unterdrücken von Gefühlen ging, immer an vorderster Front dabei, sozusagen als Vorreiter.
»Es kommt noch besser«, erklärt Wendy.
»Besser? Lieber Himmel, Wendy, weißt du eigentlich, was du da sagst?«
»Du hast recht, das ist jetzt falsch rübergekommen.«
»Ach, wirklich?«
»Er hat sich von uns gewünscht, dass wir für ihn Totenwache halten.«
»Wer?«
»Über wen sprechen wir gerade? Dad! Er wollte, dass wir für ihn Schiwa sitzen.«
»Dad ist tot.«
Wendy seufzt, als fände sie es extrem ermüdend, sich durch den dichten Dschungel meiner Dummheit kämpfen zu müssen. »Ja, und wie es aussieht, ist das der optimale Zeitpunkt für eine Totenwache.«
»Aber Dad ist doch Atheist.«
»Dad war Atheist.«
»Soll das heißen, er hat kurz vor seinem Tod noch zu Gott gefunden?«
»Nein, das soll heißen, dass er tot ist und du deine Verben im richtigen Tempus verwenden sollst.«
Wenn wir wie zwei herzlose Arschlöcher klingen, dann deswegen, weil wir so erzogen wurden. Zu unserer Ehrenrettung sei allerdings angemerkt, dass wir bereits seit geraumer Zeit um ihn trauern – mehr oder weniger, seit vor anderthalb Jahren die Krankheit bei ihm diagnostiziert wurde. Obwohl er schon länger unter Magenproblemen litt, hatte er die Bitten meiner Mutter, doch zum Arzt zu gehen, stets mit einer wegwerfenden Handbewegung abgetan und es stattdessen vorgezogen, einfach die Dosis der Antazida zu erhöhen, die er bereits seit Jahren nahm. Er warf sich die magensäurebindenden Tabletten ein wie Bonbons, wobei er auf Schritt und Tritte kleine Fetzen Alufolie fallen ließ, so dass unsere Teppiche wie feuchter Asphalt glänzten. Dann verfärbte sich sein Stuhlgang plötzlich rot.
»Dein Vater fühlt sich nicht ganz wohl«, untertrieb meine Mutter am Telefon.
»Meine Kacke blutet«, jammerte er irgendwo im Hintergrund. In den fünfzehn Jahren seit meinem Auszug ist mein Vater kein einziges Mal selbst ans Telefon gekommen. Immer hatten wir Mom an der Strippe, und Dad machte im Hintergrund schräge Bemerkungen, wenn ihm danach war. Genauso verhielten sie sich, wenn man ihnen leibhaftig gegenüberstand. Mom beanspruchte für sich stets das Rampenlicht. Ihr Ehemann musste sich mit einem Platz im Chor begnügen.
Auf der Computertomographie-Aufnahme sah man die Tumore an der Schleimhaut seines Zwölffingerdarms fast wie Blüten sprießen. Als weiteres Beispiel für Dads ohnehin schon legendären Stoizismus kam nun also hinzu, dass er Magenkrebs, der bereits Metastasen bildete, ein Jahr lang mit Antazida behandelt hatte. Es folgten die üblichen Operationen, die Bestrahlung und dann die Rosenkranz-Runden der Chemo, welche die Tumore zum Schrumpfen bringen sollten, in Wirklichkeit aber bloß ihn selbst schrumpfen ließen, bis seine einst breiten Schultern nur noch knochige Knubbel waren, die unter den Falten seiner schlaffen Haut verschwanden. Der nächste Schritt war das Verkümmern der Muskeln und Sehnen und dann der traurige, bröckelnde Abstieg in die Extremschmerztherapie, die darin gipfelte, dass er in ein Koma fiel, aus welchem er, wie wir alle wussten, nicht mehr erwachen würde. Warum sollte er auch? Warum aufwachen, wenn einen nur noch der schmerzhafte, scheußliche Schlamassel von Magenkrebs im Endstadium erwartet? Er brauchte vier Monate, um zu sterben – drei Monate länger, als die Onkologen prophezeit hatten. »Ihr Dad ist ein Kämpfer«, erklärten sie, wenn wir ihn besuchten. Was absoluter Schwachsinn war, denn die Krankheit hatte ihn bereits klar geschlagen. Falls er überhaupt noch etwas mitbekam, dann war er bestimmt ziemlich sauer darüber, wie lange er für etwas so Einfaches wie das Sterben brauchte. Dad glaubte nicht an Gott, folgte aber sein Leben lang dem Credo »Scheiß oder gib die Schüssel frei!«
Sein eigentlicher Tod war also kein großes Ereignis, sondern eher ein letztes trauriges Detail.
»Die Beerdigung ist morgen früh«, erklärt Wendy. »Ich fliege heute Abend mit den Kindern. Barry hat einen Geschäftstermin in San Francisco. Er wird den Nachtflug nehmen.«
Wendys Ehemann Barry arbeitet als Portfolio-Manager für einen großen Hedgefonds. Soweit ich es beurteilen kann, wird er dafür bezahlt, dass er mit Privatjets durch die Welt gondelt und beim Golf gegen andere, noch reichere Männer verliert, die unter Umständen das Geld seines Fonds gebrauchen könnten. Ein paar Jahre zuvor hat man ihn nach L.A. versetzt, was eine völlig widersinnige Aktion war, da er sowieso ständig auf Reisen ist und Wendy bestimmt lieber wieder an der Ostküste leben würde, wo sie mit ihren Knöchelproblemen und den Stimmungsschwankungen nach ihren Schwangerschaften besser zurechtkommt. Wenigstens wird sie für ihre Unannehmlichkeiten sehr gut entschädigt.
»Du bringst die Kids mit?«
»Anders wäre es mir lieber, das darfst du mir glauben. Aber sieben Tage sind einfach zu lang, um sie mit dem Kindermädchen allein zu lassen.«
Die Kids sind der sechsjährige Ryan und der dreijährige Cole, zwei flachsköpfige, pausbäckige Jungs, die mit ihrem Temperament bisher noch jeden Raum innerhalb von zwei Minuten verwüstet haben, sowie Serena, Wendys sieben Monate alte Tochter.
»Sieben Tage?«
»So lange dauert eine jüdische Totenwache nun mal.«
»Wir werden das doch nicht wirklich durchziehen, oder?«
»Es war sein letzter Wunsch«, antwortet Wendy. In diesem einen kurzen Moment bilde ich mir ein, den brennenden Schmerz ganz weit hinten in ihrem Hals hören zu können.
»Und Paul macht da mit?«
»Von ihm habe ich es überhaupt erst erfahren.«
»Was hat er gesagt?«
»Dad will, dass wir Schiwa für ihn sitzen.«
Paul ist mein Bruder und nur sechzehn Monate älter als ich. Mom hat immer darauf beharrt, dass ich kein Unfall war. Angeblich ist sie mit voller Absicht nur sieben Monate nach Pauls Geburt wieder schwanger geworden, aber das habe ich ihr nie so ganz abgenommen – erst recht nicht mehr, nachdem mein Vater, als er eines Freitagabends nach dem Essen besonders viel Pfirsichschnaps erwischt hatte, in feierlichem Ton einräumte, dass sie damals der Meinung waren, Mom könne während der Stillphase nicht wieder schwanger werden. Was Paul und mich betrifft, kommen wir gut miteinander aus, solange wir keine Zeit miteinander verbringen.
»Hat schon jemand mit Phillip gesprochen?«, frage ich.
»Ich habe sämtliche neueren Nummern angerufen, die wir von ihm haben, und überall eine Nachricht hinterlassen. Sollte er wider Erwarten eine davon abhören, und vorausgesetzt, er ist nicht gerade im Knast oder zugekifft oder liegt tot im Straßengraben, dann haben wir allen Grund zu der Annahme, dass er mit einer gewissen, wenn auch geringen Wahrscheinlichkeit auftauchen wird.«
Phillip, unser jüngster Bruder, ist neun Jahre nach mir zur Welt gekommen. Schwer zu sagen, welche fortpflanzungstechnische Logik meine Eltern damit verfolgten. Erst Wendy, Paul und ich, alle innerhalb von vier Jahren, und dann fast ein Jahrzehnt später Phillip, nachträglich draufgeklatscht wie ein peinlicher Anhang. Phillip ist der Paul McCartney unserer Familie: Er sieht besser aus als der Rest von uns, blickt auf Fotos immer in eine andere Richtung, und hin und wieder geht das Gerücht, er sei gestorben. Als Nesthäkchen der Familie wurde er abwechselnd verhätschelt und ignoriert – vielleicht ein entscheidender Faktor dafür, dass er sich zu einem letztendlich so verkorksten Erwachsenen entwickelt hat. Im Moment lebt er in Manhattan, wo man ziemlich früh aufstehen müsste, um eine Droge zu finden, mit der er noch nicht herumexperimentiert hat, oder auf ein Model zu treffen, das er noch nicht gevögelt hat. Er verschwindet jeweils für mehrere Monate vom Radar, um dann eines Tages unangekündigt zum Abendessen zu erscheinen und ganz nebenbei – oder auch nicht – zu erwähnen, dass er im Gefängnis war, oder in Tibet, oder soeben mit einer schauspielenden Beinahe-Berühmtheit Schluss gemacht hat. Mittlerweile ist es über ein Jahr her, dass ich ihn das letzte Mal gesehen habe.
»Hoffentlich schafft er es«, sage ich, »denn wenn nicht, wird er am Boden zerstört sein.«
»Wenn wir schon gerade von missratenen kleinen Brüdern reden, wie steht’s denn um deine eigene griechische Tragödie?«
Wendy kann in ihrer spitzzüngigen Taktlosigkeit recht witzig, ja fast charmant sein, aber dass es zwischen krass und grausam unter Umständen eine Grenze gibt, ist ihr definitiv noch nie aufgefallen. Normalerweise komme ich mit ihrer Art trotzdem gut klar, aber nach den letzten paar Monaten fühle ich mich völlig fertig, und mein Schutzpanzer liegt in Schutt und Asche.
»Ich muss jetzt aufhören«, sage ich und bemühe mich dabei nach Kräften, nicht so zu klingen, als bräche um mich herum immer noch alles zusammen.
»Lieber Himmel, Judd. Ich wollte damit doch nur andeuten, dass ich mir Sorgen um dich mache.«
»Ja, bestimmt.«
»Deswegen brauchst du nicht gleich so passiv aggressiv zu reagieren. Das reicht mir schon von Barry.«
»Wir sehen uns dann zu Hause.«
»Na schön, wenn du meinst«, antwortet sie angenervt. »Bis dann.«
Ich warte darauf, dass sie auflegt.
»Bist du noch da?«, fragt sie schließlich.
»Nein.« Ich lege auf und stelle mir vor, wie sie ihr Telefon in die Ecke wirft, während Schimpfwörter wie Maschinengewehrsalven von ihren Lippen spritzen.
Mittwoch
2
Ich mache meinen Wagen gerade für die zweistündige Fahrt nach Elmsbrook fertig, als Jen in ihrem bonbonfarbenen Geländewagen neben mir hält. Ich habe sie schon eine Weile nicht mehr gesehen und nicht auf ihre Anrufe reagiert, aber auch nicht aufgehört, an sie zu denken. Nun steht sie hier vor mir. In ihren engen Sportklamotten sieht sie wie immer sensationell aus, ihr Haar schimmert in einem Honigblond, das bestimmt nicht billig war, und ihre Mundwinkel sind zu einem zaghaften Klein-Mädchen-Lächeln hochgezogen. Ich kenne alle Sorten von Lächeln, die Jen im Repertoire hat, und weiß genau, was sie bedeuten und wohin sie führen.
Das Dumme daran ist, dass mich jedes Wiedersehen mit ihr an das erste Mal erinnert, als ich sie auf ihrem scheußlichen roten Rad über den Platz fahren sah. Ich habe dann sofort wieder ihre langen, strampelnden Beine vor Augen, ihr wehendes Haar und ihr vor Aufregung gerötetes Gesicht, und genau daran will man eigentlich nicht denken, wenn man seiner zukünftigen Ex-Frau gegenübersteht. Baldigen Ex-Frau. Ex-Frau in spe. Die Selbsthilfebücher und Websites liefern noch keinen richtig guten Titel für Ehepartner, die sich gerade in jenem Fegefeuer befinden, durch das man muss, bevor die Gerichte die jeweilige persönliche Tragödie offiziell ratifiziert haben. Wie üblich bin ich bei Jens Anblick sofort von Kummer erfüllt – nicht, weil sie offensichtlich herausgefunden hat, dass ich mich mittlerweile in einer miesen Kellerwohnung eingemietet habe, sondern weil ich mir seit meinem Auszug vorkomme, als erwischte sie mich bei unseren Treffen jedes Mal in einem intimen, peinlichen Moment – als würde ich mir gerade mit einer Hand in der Hose einen Pornofilm ansehen oder laut zu Air Supply singen, während ich an einer roten Ampel stehe und mir in der Nase bohre.
»Hey«, sagt sie.
Ich werfe meinen Koffer in den Kofferraum. »Hey.«
Wir waren neun Jahre miteinander verheiratet. Jetzt sagen wir »Hey« zueinander und versuchen, uns dabei nicht in die Augen zu sehen.
»Ich habe dir schon ein paar Mal eine Nachricht hinterlassen.«
»Ich hatte viel zu tun.«
»Ja, klar.« Ihr ironischer Unterton weckt in mir den vertrauten Wunsch, sie innig zu küssen und gleichzeitig zu würgen, bis sie blau wird. Da in unserer momentanen Situation keins von beidem zur Debatte steht, muss ich mich damit begnügen, den Kofferraumdeckel lauter als nötig zuzuknallen.
»Wir müssen reden, Judd.«
»Das ist jetzt kein so guter Zeitpunkt.«
Sie erreicht die Fahrerseite meines Wagens schneller als ich und lehnt sich gegen die Tür, wobei sie mir ihr schönstes Lächeln schenkt – jenes, von dem ich ihr so oft gesagt habe, dass es mich dazu bringt, mich immer wieder neu in sie zu verlieben. Doch ihre Rechnung geht nicht auf, denn diesmal erinnert es mich nur an alles, was ich verloren habe.
»Es gibt keinen Grund, warum das zwischen uns nicht freundschaftlich ablaufen kann«, sagt sie.
»Du vögelst mit meinem Chef. Das ist ein ziemlich handfester Grund.«
Sie schließt die Augen, um die riesigen Reserven an Geduld zu aktivieren, die sie für den Umgang mit mir braucht. Früher habe ich diese Augenlider immer vor dem Einschlafen geküsst, das rauhe Flattern ihrer Wimpern wie Schmetterlingsflügel zwischen meinen Lippen gespürt, das leichte Kitzeln ihres Atems an meinem Kinn und Hals. »Du hast recht«, antwortet sie, wobei sie sich bemüht, so auszusehen, als müsse sie sich bemühen, nicht gelangweilt zu wirken. »Ich bin ein schlechter Mensch. Ich war unglücklich und habe etwas Unverzeihliches getan. Aber wie sehr du mich auch hassen magst, weil ich dein Leben ruiniert habe, die Opferrolle steht dir nicht.«
»Es geht mir gut.«
»Ja. Es geht dir großartig.«
Jen wirft einen vielsagenden Blick auf die schäbige Bruchbude, deren Souterrain ich bewohne. Das Haus sieht aus wie von einem Kind gezeichnet: ein Dreieck auf einem Rechteck, mit schlampig übereinandergestaffelten Linien als Ziegelsteinen, einem einzigen Flügelfenster und einer Haustür. Links und rechts stehen ähnlich heruntergekommene Hütten, die nichts gemeinsam haben mit dem kleinen, schmucken Häuschen im Kolonialstil, das wir von meinem Ersparten gekauft haben. Jen wohnt dort immer noch mietfrei und schläft in dem Bett, das einmal meines war, mit einem anderen Mann.
Meine Vermieter, die Lees, sind ein verschlossenes chinesisches Ehepaar mittleren Alters, das in einem Zustand fortwährenden Schweigens lebt. Ich habe die beiden noch nie miteinander sprechen hören. Er praktiziert im Wohnzimmer Akupunktur, und sie fegt dreimal täglich mit einem handgefertigten Besen, der aussieht wie eine Theaterrequisite, den Gehsteig. Egal, ob ich gerade aufwache oder einschlafe, jedes Mal höre ich das Flüstern ihrer hektischen Besenborsten auf dem Asphalt. Darüber hinaus aber scheinen diese beiden Menschen gar nicht zu existieren. Ich frage mich oft, warum sie sich überhaupt die Mühe gemacht haben, einzuwandern. Bestimmt gibt es auch in China jede Menge eingeklemmte Nerven und staubige Gehsteige.
»Du bist nicht bei dem Mediator erschienen«, sagt Jen.
»Ich mag den Kerl nicht. Er ist nicht unparteiisch.«
»Natürlich ist er unparteiisch.«
»Er steht auf deine Titten und ist somit auf deiner Seite.«
»Oh mein Gott, das ist doch wirklich lächerlich.«
»Tja, über Geschmack kann man streiten.«
Und so weiter. Ich könnte auch noch den Rest des Gesprächs zitieren, allerdings läuft es immer wieder auf dasselbe hinaus: zwei Menschen, die nicht damit klarkommen, dass ihre Liebe sich in Gift verwandelt hat, und sich deswegen gegenseitig mit Granaten des Bedauerns bewerfen.
»Ich kann einfach nicht mit dir reden, wenn du so bist.« Mit genervter Miene gibt sie die Fahrertür frei.
»Ich bin immer so. So bin ich nun mal.«
Mein Vater ist gestorben!, würde ich ihr am liebsten ins Gesicht schreien, tue es aber nicht, weil sie sonst bestimmt in Tränen ausbricht, und ich wahrscheinlich auch. Damit hätte sie eine Lücke in meiner Abwehr gefunden, doch ich werde nicht zulassen, dass sie in einem Trojanischen Pferd aus Mitgefühl meine Schutzwälle durchbohrt. Ich bin auf dem Weg nach Hause, um meinen Vater zu Grabe zu tragen und meiner Familie gegenüberzutreten, und eigentlich sollte Jen in dieser Situation an meiner Seite sein. Aber sie gehört nicht mehr zu mir. Man heiratet, um einen Verbündeten gegen seine Familie zu haben, und trotzdem muss ich mich jetzt allein in die Schützengräben stürzen.
Jen schüttelt traurig den Kopf. Ihre Unterlippe beginnt zu zittern, und in ihrem Augenwinkel bildet sich eine Träne. Ich kann diese Frau nicht mehr berühren, küssen oder lieben. Wie sich gerade herausstellt, kann ich nicht einmal mehr ein Gespräch mit ihr führen, das nicht schon innerhalb der ersten drei Minuten in wütende Beschuldigungen ausartet. Aber ich kann sie immer noch traurig machen, und damit muss ich mich vorerst zufriedengeben. Es wäre leichter, so viel leichter, wenn sie nicht darauf bestehen würde, weiterhin so verdammt gut auszusehen, so durchtrainiert, honigblond, rehäugig und verletzlich. Denn selbst jetzt, nach allem, was sie mir angetan hat, ist da noch immer etwas in ihren Augen, das in mir den Wunsch weckt, sie um jeden Preis zu behüten und zu beschützen, auch wenn ich weiß, dass in Wirklichkeit ich derjenige bin, der beschützt werden muss. Es wäre so viel leichter, wenn sie nicht Jen wäre. Aber sie ist es, und an der Stelle, wo es früher nur reinste Liebe gab, befindet sich nun eine Schlangengrube aus Wut und Verbitterung und einer anderen, dunklen, verdrehten Liebe, die schlimmer schmerzt als der ganze Rest zusammengenommen.
»Judd.«
»Ich muss los«, sage ich, während ich die Wagentür aufmache.
»Ich bin schwanger.«
Auf mich ist noch nie geschossen worden, aber so ähnlich muss sich das anfühlen – jener Sekundenbruchteil des Nichts, bevor der Schmerz die Kugel einholt. Sie war schon einmal schwanger. Damals weinte sie und küsste mich, und dann tanzten wir wie zwei Verrückte im Bad herum. Aber unser Baby starb, bevor es zur Welt kommen konnte. Drei Wochen vor dem errechneten Termin wurde es von der Nabelschnur stranguliert.
»Glückwunsch. Ich bin sicher, Wade wird einen wunderbaren Vater abgeben.«
»Ich weiß, dass das hart für dich ist. Ich dachte nur, du solltest es von mir erfahren.«
»Habe ich ja nun.«
Ich steige in den Wagen. Sie stellt sich vor die Motorhaube, so dass ich nicht losfahren kann.
»Sag was. Bitte!«
»Also gut. Du kannst mich mal, Jen. Du kannst mich mal kreuzweise. Ich hoffe, Wades Kind hat da drin mehr Glück als meines. Darf ich jetzt fahren?«
»Judd.« Ihre Stimme klingt leise und brüchig. »Du kannst mich doch nicht wirklich so sehr hassen, oder?«
Ich sehe ihr direkt in die Augen und versuche, so viel Aufrichtigkeit wie möglich in meinen Blick zu legen. »Doch, das kann ich.«
Vielleicht liegt es an meiner komplizierten Trauer um meinen Vater, die endlich an meinen Nerven zu zerren beginnt, oder vielleicht auch nur an der Art, wie Jen zurückzuckt, als hätte ich ihr eine Ohrfeige verpasst, auf jeden Fall reicht der intensive Schmerz, der für einen verräterischen Moment in ihren großen Augen aufblitzt, beinahe aus, um mich dazu zu bringen, sie wieder zu lieben.
3
Meine Ehe endete, wie solche Dinge immer enden: mit Sanitätern und Käsekuchen. Ehen zerbrechen. Jeder Mensch hat seine Gründe, aber letztendlich weiß keiner so genau, warum. Wir haben sehr jung geheiratet. Vielleicht war das unser Fehler. Im Staat New York State darf man vom Gesetz her eher heiraten als Tequila trinken. Wir wussten, dass eine Ehe Probleme mit sich bringen kann, genau, wie wir wussten, dass es in Afrika hungernde Kinder gibt. Das war tragisch, aber Welten von unserer Realität entfernt. Bei uns würde es anders laufen. Wir würden das Feuer am Brennen halten, beste Freunde sein und gleichzeitig jede Nacht bis zur Besinnungslosigkeit vögeln. Wir würden den Fallen der Selbstgefälligkeit aus dem Weg gehen, indem wir uns ein junges Herz und einen fitten Körper bewahrten und dafür sorgten, dass unsere Küsse lang und tief blieben und unsere Bäuche flach. Wir wollten immer Händchen halten, wenn wir nebeneinander hergingen, uns bis tief in die Nacht hinein unsere Gedanken ins Ohr flüstern, im Kino jedes Mal wild knutschen und im Bett mit unbebremster Begeisterung dem Oralsex frönen, bis die arthritischen Einschränkungen des Alters das eines Tages vielleicht nicht mehr ratsam erscheinen ließen.
»Wirst du mich noch lieben, wenn ich alt bin?«, wollte Jen oft wissen. Für gewöhnlich waren wir da gerade in ihrem Zimmer und lümmelten schläfrig auf ihrer durchhängenden Matratze, eingehüllt in den schweren, nach Sex riechenden Moschusduft unserer sich langsam abkühlenden Körper. Sie lag hinterher meist auf dem Bauch und ich auf der Seite, so dass ich den Mittelfinger durch den flachen Canyon ihrer Wirbelsäule gleiten lassen konnte, bis ich auf die ansteigende Rundung ihres sensationellen Hinterns stieß. In unserer Anfangszeit war ich von einem albernen Stolz auf ihren Hintern erfüllt. Ich hielt ihr allein deswegen alle Türen auf, weil ich ihn dann in ihrer Jeans wippen sehen konnte – rund, fest und von perfekter Proportion. Bei seinem Anblick dachte ich jedes Mal: Das ist ein Hintern, mit dem man alt werden kann. Irgendwie betrachtete ich Jens Hintern als meinen persönlichen Verdienst. Am liebsten hätte ich ihn separat mit nach Hause genommen, um ihn meinen Eltern vorzustellen.
»Auch wenn ich einen Hängebusen habe, mir die Zähne ausfallen und ich so vertrocknet und runzelig bin wie eine Backpflaume?«, fuhr Jen fort.
»Klar.«
»Du wirst mich dann nicht gegen eine Jüngere eintauschen?«
»Doch, natürlich. Aber ich werde deswegen ein richtig schlechtes Gewissen haben.«
Dann prusteten wir beide los, weil das alles so undenkbar klang.
Die Liebe ließ uns gemeinsam dem Narzissmus erliegen. Ständig sprachen wir davon, wie nahe wir uns waren und was für ein perfektes Band zwischen uns bestand, als wären wir das erste Paar in der Geschichte der Menschheit, das es genau richtig machte.
Für eine Weile waren wir zwei ekelerregend egozentrische Arschlöcher, die einander ständig in die Augen starrten, während alle anderen rundherum versuchten, ein bisschen Spaß zu haben. Wenn ich daran denke, wie dumm wir damals waren und wie absolut blind für die Realität, die uns erwartete, dann würde ich am liebsten die Zeit zurückdrehen und diesem mageren, eingebildeten Jungen mit dem stolzgeschwellten Herzen und der Dauererektion die Zähne einschlagen.
Genüsslich würde ich ihm schildern, wie er und die Liebe seines Lebens langsam, aber sicher in einen Alltagstrott verfallen werden. Zwar wird der Sex zwischen ihnen immer noch wunderbar sein, trotzdem aber so alltäglich, dass sie es keineswegs mehr als Ding der Unmöglichkeit betrachten, ihn zugunsten einer Fernsehsendung oder eines Mitternachtssnacks zu verschieben. Irgendwann werden sie sogar aufhören, lautes Furzen sorgsam zu vermeiden und die Tür zu schließen, wenn sie aufs Klo gehen. Ihm wird es plötzlich peinlich sein, vor gemeinsamen Freunden lustige Geschichten zum Besten zu geben, wenn sie dabei ist, weil sie seine lustigen Geschichten alle schon kennt. Sie wird nicht mehr wie andere Leute über seine Witze lachen. Stattdessen wird sie abends immer länger mit ihren Freundinnen telefonieren. Banale Kleinigkeiten werden zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen ihnen führen: eine nicht ersetzte Klopapierrolle oder durchgebrannte Glühbirne, eine Schüssel mit angetrockneten Müsliresten in der Spüle, der richtige Umgang mit dem Scheckheft. Ein unausgesprochenes Punktesystem wird ins Spiel kommen, bei dem jede Seite entsprechend ihrem eigenen komplizierten Regelwerk Buch führt. Am liebsten würde ich wie ein Schreckgespenst vor dem selbstgefälligen kleinen Scheißkerl Gestalt annehmen und ihm seinen Heiratswunsch austreiben. Vergiss das mit dem Heiraten, würde ich ihn anschreien, entscheide dich lieber für den Tequila! Dann würde ich ihn mir schnappen und in die Zukunft entführen, um ihm den Blick auf seinem Gesicht zu zeigen … als ich in mein Schlafzimmer trat und Jen dort mit einem anderen Mann im Bett vorfand.
Zu diesem Zeitpunkt hätte ich wahrscheinlich längst etwas ahnen müssen. Wie jedes andere Verbrechen bringt auch Ehebruch unweigerlich Nebenprodukte hervor, so wie Pflanzen beispielsweise Sauerstoff produzieren oder Menschen, nun ja, Scheiße. Es hätte zweifellos eine Handvoll Möglichkeiten gegeben, es herauszufinden, so dass mir das unsäglich schmerzhafte Trauma, es mit eigenen Augen ansehen zu müssen, erspart geblieben wäre. Die Hinweise müssen sich schon eine ganze Weile angehäuft haben wie ungelesene E-Mails, nur einen Mausklick davon entfernt, geöffnet zu werden.
Eine fremde Nummer auf ihrer Handyrechnung, ein Telefongespräch, das sie schnell abbrach, wenn ich den Raum betrat, eine Restaurantquittung, auf die ich mir keinen Reim machen konnte, ein kleiner Knutschfleck an ihrem Hals, von dem ich nicht wusste, wann ich ihr den verpasst haben sollte, und natürlich ihre merklich verminderte Libido. In den Tagen, die auf meine Entdeckung folgten, ließ ich das letzte Jahr unserer Ehe Revue passieren, wie man es nach einem Einbruch mit den Aufzeichnungen der Überwachungskameras macht. Dabei fragte ich mich, wie ich so verdammt blind sein konnte, dass es tatsächlich nötig war, sie in flagranti zu erwischen, um es endlich zu kapieren. Selbst dann, als ich den beiden bereits dabei zusah, wie sie auf meinem Bett stöhnend vor sich hin wippten, brauchte ich eine Weile, bis ich eins und eins zusammengezählt hatte.
Das Seltsame an der Sache ist nämlich, dass es – egal, wie viel Spaß man selbst beim Sex empfindet – dennoch etwas Erschreckendes und eigenartig Verstörendes hat, anderen dabei zuzusehen. Die Natur hat sich große Mühe gegeben, die Grundlagen des Geschlechtsverkehrs so einzurichten, dass es unmöglich ist, sich selbst dabei besonders gut im Blick zu haben. Denn wenn man das Ganze mal genau betrachtet, ist der Anblick von Sex eine chaotische, schmutzige und oft auch groteske Angelegenheit: die Haare, die gereizte, fleckige Haut, die klaffenden Körperöffnungen, die entblößten, feucht glänzenden Organe. Ganz zu schweigen von der Gewalt des Paarungsaktes an sich, dessen primitive, elementare Natur uns ins Gedächtnis ruft, dass wir alle nur dumpfe Tiere sind und uns verzweifelt an unseren Platz in der Nahrungskette klammern, indem wir so viel wie möglich essen, schlafen und vögeln, bevor etwas Größeres des Weges kommt und uns verschlingt.
Als ich an Jens dreiunddreißigstem Geburtstag früher als sonst nach Hause kam und sie mit weitgespreizten Beinen auf dem Bett vorfand, über ihr den breiten, schwammigen Hintern irgendeines Typen, der im universalen Rhythmus der Fortpflanzung die Backen zusammenkniff und wieder löste und der beide Hände unter ihrem Hintern hatte, damit er sie bei jedem Stoß anheben konnte, während ihre Finger dort, wo sie sich in seinen Rücken gruben, weiße Abdrücke hinterließen … nun ja, da dauerte es eine Weile, bis das alles richtig bei mir ankam.
Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch gar nicht begriffen, dass die Frau im Bett wirklich Jen war. Ich wusste nur, dass es sich um mein Bett handelte und der einzige Mann, der darin Sex haben sollte, eigentlich ich selbst war. Für einen Moment zog ich die Möglichkeit in Betracht, dass ich mich im falschen Haus aufhielt, aber das erschien mir eher unwahrscheinlich. Außerdem bestätigte mir ein rascher Blick auf das Foto von Jen auf meinem Nachttisch, das sie blutjung und zerbrechlich wie Porzellan in ihrem Brautkleid zeigte, dass ich durchaus am richtigen Ort war. Wobei ich tatsächlich eine Spur von Erleichterung empfand, denn ein solcher Fehler – aus Versehen das Haus der Nachbarn zu betreten und dann in deren Schlafzimmer hinaufzumarschieren, ohne diesen Irrtum zu bemerken – wäre wahrscheinlich Grund genug, eine Gehirnuntersuchung vornehmen zu lassen und mit dem Schlimmsten zu rechnen. Außerdem, hätte ich meine Nachbarn tatsächlich dabei ertappt, wie sie am helllichten Nachmittag wie die Karnickel vor sich hin rammelten, dann bezweifle ich, dass sie selbst eine aus tiefstem Herzen kommende Entschuldigung akzeptiert hätten. Auf keinen Fall hätte ich ihnen je wieder in die Augen sehen können, geschweige denn die Bitte an sie richten, sich um unsere Post zu kümmern, wenn wir in Urlaub fuhren. Hinzu kam, dass unsere Nachbarn, die Bowens, schon Ende Sechzig waren und Mr.Bowen fleißig auf seinen dritten Herzinfarkt hinfutterte. Selbst wenn er noch sexuell aktiv war, was ich in Anbetracht des Umfangs seiner wabbeligen Wampe stark bezweifelte, hätte eine derart peinliche Störung bei ihm vermutlich zum sofortigen Herzstillstand geführt. Deswegen war es wohl alles in allem als positiv zu werten, dass ich mich in meinem eigenen Haus befand.
Wobei sich aus dieser Tatsache eine Reihe beunruhigender Probleme ergaben, von denen das offensichtlichste darin bestand, dass die Frau, die sich dort in einer Lache ihres eigenen Schweißes auf dem Bett wälzte und ihren kunstvoll manikürten Zeigefinger soeben wie einen Pfeil genau ins Schwarze versenkte, sprich in den Anus ihres Geliebten, meine Ehefrau Jen war.
Was ich natürlich schon in dem Moment wusste, als ich den Raum betrat. Mein Gehirn jedoch bewahrte mich davor, mir dessen so richtig bewusst zu werden, indem es mir kleine, beliebige Gedanken zu verarbeiten gab, nur um mich abzulenken, während sich mein Unterbewusstsein hinter den Kulissen verzweifelt abmühte, die Fakten zu sammeln und eine Strategie zur Schadensbegrenzung zu entwickeln. Statt also sofort zu denken: Jen vögelt mit einem anderen, meine Ehe ist am Ende, oder so was in der Art, war mein nächster Gedanke vielmehr: Jen steckt mir beim Sex nie den Finger in den Hintern. Wobei ich mir das keineswegs wünschte, erst recht nicht mehr jetzt, nachdem ich mit eigenen Augen gesehen hatte, wo dieser Finger gewesen war. Jen und ich probierten von Zeit zu Zeit durchaus schräge oder auch schmutzige Sachen aus – Stellungen, Utensilien, cremige Nachspeisen, et cetera –, aber ich falle eindeutig in jene Kategorie von Männern, die grundsätzlich nie den Wunsch verspüren, ihren Hintern ins Spiel zu bringen. Wobei ich solche Männer durchaus nicht verurteile.
Abgesehen von dem Mann, der sich gerade von zwei Gliedern des Zeigefingers meiner Frau aufspießen ließ – übrigens nur einen Finger von demjenigen entfernt, den sie letzte Woche in die Luft gereckt hatte, als uns auf der Fahrspur für Fahrzeuge mit mindestens zwei Insassen irgendein unverschämter Kerl schnitt, und nur zwei Finger von dem kleinen Diamantring entfernt, den ich ihr zu unserem fünften Hochzeitstag geschenkt hatte. Das Urteil, das ich über ihren Liebhaber fällte, fiel dementsprechend hart aus. So hart, dass ich eine weitere Sekunde brauchte, bis mir dämmerte, dass es sich doch tatsächlich um Wade Boulanger handelte, einen beliebten Radiomoderator, der – abgesehen davon, dass er gerade meine Frau vögelte und dabei offensichtlich gerne mal anal stimuliert wurde – zufällig auch noch mein Boss war.
Wade moderiert eine beliebte morgendliche KIRX-Radiosendung mit dem Titel Hoch die müden Glieder mit Wade Boulanger. Er spricht über Sex, Autos, Sport und Geld, hauptsächlich aber über Sex. In diesem Zusammenhang berät er sich live mit Pornostars, Stripperinnen und Prostituierten. Er nimmt Anrufe von Männern und Frauen entgegen, die ihm bis ins letzte Detail von ihrem Sexualleben berichten. Außerdem kündigt er jedes Mal an, wenn er furzen muss, und bewertet seine Leistung anschließend nach der Lautstärke. Einsamen, nach Sex lechzenden Anrufern erteilt er gerne den guten Ratschlag: »Hoch die müden Glieder!« Es gibt T-Shirts, Kaffeetassen und Autoaufkleber mit diesem Leitspruch. Der Typ ist von Beruf Arschloch und hat seine Sendung an insgesamt zwölf Radiostationen verkauft. Firmen, die ihn für Werbeverträge wollen, stehen bei ihm Schlange wie die Schafe. Ich übertreibe nicht. Schließlich war ich sein Produzent und buchte die Gäste. Mir waren die Leute unterstellt, die für ihn die Anrufer aussiebten, ebenso die Computerheinis, die seine Website betrieben. Ich sprach mit der Geschäftsleitung über Format und Sponsoring der Sendung. Für den Kontakt mit der Rechtsabteilung, PR und Werbung war ich ebenfalls zuständig. Außerdem bestellte ich das Mittagessen und eliminierte sämtliche Schimpfwörter mit einem Piepton.
Als Wades Karriere langsam in Schwung kam, hatte ich gerade erst das College hinter mich gebracht und arbeitete als Assistent bei WRAD, einem kleinen Lokalsender. Aus irgendeinem Grund mochte mich Wade, und nachdem sie seinen Produzenten wegen eines Zusammenstoßes mit der Medienkontrollbehörde feuerten, gab er die Stelle mir. Im Anschluss an die Sendung saßen wir oft endlos beim Mittagessen, verbrachten ganze Nachmittage auf Kosten des Senders in irgendwelchen Restaurants, tranken doppelte Martinis und hatten dabei oft recht gute Einfälle. Er nannte mich seine Stimme der Vernunft, legte großen Wert auf meine Meinung und nahm mich am Ende sogar mit, als er von dem Lokalsender zu KIRX wechselte. Als die Sendung dann an andere Radiostationen verkauft wurde und die Geschäftsleitung wegen meines Vertrages Probleme machte, drohte er mit Kündigung.
Wade ist groß und bullig, hat dunkles, borstiges Haar und eine Spalte am Kinn, die es aussehen lässt wie einen kleinen Hintern. Seine Zähne leuchten in einem Weißton, der in der Natur nicht vorkommt. Als Vierzigjähriger hält er immer noch engen Kontakt mit seinen ehemaligen Burschenschaftskameraden, als gäbe es nichts Wichtigeres. Auf der Straße bewertet er lautstark jeden entgegenkommenden Busen und spricht dabei hartnäckig von Titten. Diese Sorte Kerl ist er. Man kann sich leicht vorstellen, wie er damals in seiner Studentenverbindung zur Höchstform auflief: Bestimmt schüttete er, angefeuert von seinen Kumpanen, ein Bier nach dem anderen hinunter, machte sich über die Neuzugänge lustig, die als sogenannte »Füchse« noch nicht richtig in die Burschenschaft aufgenommen waren, und kippte auf Partys K.-o.-Tropfen in die roten Plastikbecher hübscher Studienanfängerinnen.
Nichts im Leben bereitet einen auf die Erfahrung vor, zusehen zu müssen, wenn die eigene Ehefrau Sex mit einem anderen Mann hat. Es handelt sich dabei um eines jener surrealen Ereignisse, die man sich zwar – genau wie den eigenen Tod oder einen Sechser im Lotto – irgendwann mal vorzustellen versucht, letztendlich aber keine große Klarheit darüber gewinnt. Wenn es dann so weit ist und man darauf reagieren soll, befindet man sich auf unerforschtem Terrain.
Deswegen stand ich, statt zu reagieren, wie angewurzelt da und starrte auf Jens Gesicht, während Wade wie der Kolben einer breiten, haarigen Maschine in sie hineinpumpte. Ihr Kopf war nach hinten gebogen, ihr Kinn zu Gott emporgereckt, während sie heftig vor sich hin keuchte, den Mund weit aufgerissen, die Augen in lustvoller Ekstase fest zusammengekniffen. Ich versuchte mir ins Gedächtnis zu rufen, ob sie mit mir zusammen auch jemals so extrem konzentriert und so wunderschön verrucht ausgesehen hatte, aber das war schwer zu sagen, schließlich hatte ich noch nie diesen Zuschauerplatz in der ersten Reihe innegehabt. Außerdem war es eine Weile her, seit wir das letzte Mal tagsüber Sex gehabt hatten, und nachts ist es schwieriger, die Nuancen in der Mimik des Partners zu erkennen.
In dem Moment stieß Jen ein langes, drängendes Stöhnen aus, das in einer tiefen Tonlage begann, dann jedoch schlagartig ein paar Oktaven höher sprang und plötzlich wie das Japsen eines verwundeten Welpen klang. Ich war mir ziemlich sicher, dass ich dieses Geräusch bei ihr noch nie gehört hatte. Während sie es ausstieß, glitten ihre Hände an Wades Rücken nach unten und packten seinen Hintern, um ihn noch tiefer in sie hineinzuziehen.
Ich ertappte mich dabei, dass ich mir über Wade Boulangers Schwanz Gedanken machte.
Genauer gesagt über die Frage, ob er wohl größer war als meiner. Oder vielleicht dicker? Härter? War er ein wenig gebogen, wie es manche Schwänze sind, so dass er womöglich Stellen in ihr berührte, die meiner nie erreicht hatte – bisher verwaiste Regionen weichen Gewebes, die sie derart aufschreien ließen? War Wade gar ein besserer Liebhaber als ich? Hatte er sich mit Tantra-Techniken befasst? Zumindest war er mit so vielen Nutten und Pornostars im Bett gewesen, dass er genügend Gelegenheit gehabt hatte, entsprechende praktische Tipps einzuholen. Von meinem Beobachtungsposten aus sah es jedenfalls so aus, als wüsste Wade, was er da tat, wobei ich natürlich zu meiner Ehrenrettung hinzufügen muss, dass ich mich noch nie selbst beim Sex gesehen habe. In dem Moment bedauerte ich fast, dass Jen und ich uns nie dabei gefilmt hatten, wie manche andere Paare es tun. Sich hin und wieder mal so eine Aufnahme anzusehen, wäre vielleicht hilfreich gewesen. Wahrscheinlich machte ich dabei eine genauso gute Figur wie er. Dieses Japsen jedoch … während der zehn Jahre, in denen ich mit Jen alle möglichen Sex-Spielarten ausprobiert hatte, war niemals dieses Japsen aus ihrer Kehle gedrungen. Das hätte ich mir gemerkt.
Mir wurde klar, dass ich bereits darüber nachdachte, wie ich Jen – meiner Jen – später davon erzählen würde. Wie ich ihr am Abend, wenn ich nach Hause kam, jedes Detail dieses ganzen Irrsinns schildern würde. Aber ich war ja schon zu Hause. Meine Jen existierte nicht mehr, sie hatte sich direkt vor meinen Augen in Luft aufgelöst, und dieser neuen, quiekenden, schwitzenden, anal so experimentierfreudigen Jen brauchte ich nichts zu erzählen. Von der konnte wohl eher ich ein paar Sachen lernen. Plötzlich spürte ich unzählige, mikroskopisch kleine Nadelstiche auf meinem Bauch – das erste Anzeichen für die Wut, die sich gerade in den dunkelsten Tiefen meiner brodelnden Eingeweide formierte. Obwohl diese Wut erst im Entstehen war, konnte ich ihre extreme Hitze bereits wie einen gebündelten Laserstrahl in meiner Brust hochsteigen spüren. Ich wusste, dass sie, sobald sich die Welt wieder zu drehen begann, zu einem weißglühenden Blitz erblühen und mich in Brand stecken würde.
Währenddessen vögelten die beiden weiter, rein und raus, auf und nieder, keuch und japs, als wollten sie einen Rekord aufstellen. Untermalt wurde das Ganze von den Geräuschen, über die man sonst nicht nachdenkt, dem Klatschen und Glitschen, dem furzartigen Einsaugen, der mechanischen Begleitmusik des Geschlechtsverkehrs. Die Luft war erfüllt vom stechenden Geruch ihres Aktes. Und ich stand immer noch zitternd wie Espenlaub da und ließ es geschehen.
Dann hob Wade plötzlich Jens linkes Bein über seinen Kopf und legte ihn auf ihrem rechten ab, wodurch er sie auf die Seite drehte, ohne auch nur einen Stoß auszulassen. Es war nicht einfach, dieses Manöver durchzuführen, ohne ihn rauszuziehen, ein echter kleiner Fick-Stunt, doch die Leichtigkeit, mit der er das machte, und die Bereitschaft, mit der Jen sich wie aufs Stichwort drehte und auf die Seite rollte, ließ keinen Zweifel daran, dass die beiden dieses Kunststück schon öfter vollbracht hatten. In dem Moment fragte ich mich zum ersten Mal, wie lange das wohl schon ging: einen Monat? Sechs Monate? Wie viele Positionen hatten sie wohl geübt? Wie viel von meiner Ehe war eine Lüge? Jen vögelte gerade seitwärts mit Wade Boulanger, und zwar auf meinem Bett, genauer gesagt der verknitterten Ralph-Lauren-Bettwäsche, die sie anlässlich unseres Einzuges ins Haus bei Nordstrom erstanden hatte. Mein Leben, wie ich es kannte, war vorbei.
Wahrscheinlich ist dieser Zeitpunkt genauso gut geeignet wie jeder andere, um zu erwähnen, dass ich gerade einen großen Geburtstagskuchen in Händen hielt.
Ich war früher als sonst von der Arbeit aufgebrochen, um den Schoko-Erdbeer-Käsekuchen abzuholen, den Jen so gern mochte. Jen meldete sich an ihrem Geburtstag immer krank. Wir wollten abends miteinander essen gehen, aber ich war früher nach Hause gekommen, um sie mit dem Kuchen zu überraschen. Noch im Auto hatte ich die Schachtel geöffnet und dreiunddreißig Kerzen plus eine zusätzliche fürs Glück hineingesteckt. In der Diele war ich stehen geblieben, um die Kerzen mit dem besonders langen Feuerzeug anzuzünden, das ich extra für diesen Zweck gekauft hatte. Da ich sie oben rumoren hörte, entsorgte ich rasch die Schachtel und eilte hinauf, wobei ich langsam und vorsichtig wie ein Fassadenkletterer auf Zehenspitzen dahinschlich und bei jedem Schritt darauf achtete, dass die Kerzen nicht ausgingen. Mittlerweile waren sie über die Hälfte niedergebrannt, und der vorher makellos weiße Zuckerguss war mit roten Wachssprenkeln übersät, die aussahen wie Blutstropfen auf frischem Schnee. Wäre alles nach Plan gelaufen, dann hätte Jen die Kerzen inzwischen längst ausgeblasen. Sie hätte ein wenig von dem Zuckerguss abgebrochen und vom Finger geleckt, um mich anschließend mit ihren süß und cremig schmeckenden Lippen zu küssen, und wir wären bis ans Ende unserer Tage glücklich gewesen. Diesen Störfall aber hatte ich nicht eingeplant, und nun war der Kuchen ruiniert.
Später würde ich ihr ein paar schmerzhafte Fragen stellen, von denen ich schon vorher wusste, dass sie nichts brachten. Wie konnte sie das nur tun? Wann hatte das angefangen? Und warum? Liebten die beiden sich, oder ging es ihnen nur um den Kick verbotener Schäferstündchen? Welche Antwort wollte ich hören?
Eigentlich wollte ich gar keine Antworten auf diese Fragen hören. Ein Mann, der mit eigenen Augen ansehen muss, wie seine Gattin mit einem anderen kopuliert, hat wohl größere Chancen, die Sache für sich zu einem Abschluss zu bringen, wenn er statt wissenschaftlicher Analyse eine 357er-Magnum einsetzt, und zwar am besten aus nächster Nähe. Mir war klar, dass ich trotzdem fragen würde, weil man das eben so macht. Ich war plötzlich gezwungen, wider Willen in einem Film mitzuspielen, und hatte keine andere Wahl, als mich an das Drehbuch zu halten. In dem Moment aber kam mir wie eine Erleuchtung die einzig relevante, wichtigste Frage in den Sinn, und ich wusste verdammt genau, dass ich bereit war, die Antwort herauszufinden. In ihre einfachste Form gebracht, lautete diese Frage: Wie weit konnte ich einen Schoko-Erdbeer-Käsekuchen mit dreiunddreißig Kerzen für jedes Lebensjahr und einer zusätzlichen fürs Glück in Wade Boulangers Hintern hineinschieben? Wie sich herausstellte, ziemlich weit.
Danach passierten sehr schnell sehr viele Dinge gleichzeitig.
Als Erstes begann Wade zu schreien. Nicht, weil er plötzlich den Hintern voller Schoko-Erdbeer-Käsekuchen hatte, auch wenn das mit Sicherheit schon Grund genug gewesen wäre. Nein, wie ich später von einem indiskreten Sanitäter erfuhr, schrie Wade vor allem deswegen, weil er, ehe er in Jen eingedrungen war, eine Creme auf seinen Schwanz aufgetragen hatte, für die er in seiner Radiosendung immer Werbung machte. Diese Creme sollte die männliche Leistung beim Sex steigern und war, was Wade nicht wusste, sehr leicht entzündlich, weshalb dank der dreiunddreißig Geburtstagskerzen und der einen zusätzlichen fürs Glück nun seine Eier in Flammen standen. Dass die Packung nicht mit einem diesbezüglichen Warnhinweis versehen war, lag wahrscheinlich daran, dass die meisten Männer für gewöhnlich darauf achteten, ihre besten Stücke von offenen Flammen fernzuhalten. So kam es, dass Wade unter lautem Gebrüll von Jen herunter – und damit aus ihr heraus – flüchtete und sich quer über das Bett auf den Rücken rollte, während er gleichzeitig mit beiden Händen versuchte, seinen brennenden Hodensack zu löschen. Zu allem Überfluss war er auch noch kurz davor gewesen, zu ejakulieren, als er Feuer fing, so dass er nun, obwohl er sich gleichzeitig vor Schmerzen wand, kleine Streifen gebackenen Ejakulats in die Luft spritzte.
Während Wade brüllend vor sich hin brutzelte und dabei heiß in seine Hände kam, brach Jen ebenfalls in lautes Geschrei aus und rollte sich so schnell, wie sie nur konnte, in die andere Richtung. Anfangs plärrte sie nur deswegen, weil Wade sich so ruckartig aus ihr zurückgezogen hatte und dabei derart heftig mit der Stirn gegen ihren Nasenrücken geknallt war, dass ihr der Schmerz die Tränen in die Augen trieb. Dann sah sie durch das kaleidoskopartige Prisma ihrer Tränen plötzlich mich am Fußende des Bettes stehen, die Hände mit rotbrauner Käsekuchenmasse bedeckt. Deswegen schrie sie einen Moment lang hauptsächlich aus Überraschung und Scham, doch als sie dann vom Bett rollte und als armseliges Häufchen auf dem Boden landete, wo sich der Absatz von Wades umgekipptem Vierhundert-Dollar-Halbschuh in ihren Oberschenkel bohrte, gewann wieder der Schmerz die Oberhand.
Ich für meinen Teil schrie, weil das, was ich in diesem Augenblick empfand, um einiges schlimmer war als verbrannte Eier oder – wie sich später bei Jen herausstellte – eine gebrochene Nase. Dieser verwüstete Raum war einmal mein Schlafzimmer gewesen, dieses mit Käsekuchen und Körperflüssigkeiten beschmierte Bett mein Bett – und diese nackte, völlig geknickt auf dem Boden kauernde Frau meine Ehefrau. Innerhalb von wenigen Sekunden hatte ich alle drei verloren.
Dann verstummten plötzlich sämtliche Schreie, und es folgte einer jener Momente der Stille, in denen man einfach nur dasteht und spürt, wie sich der Planet unter einem dreht, bis einem davon ganz schwindelig wird. Der Geruch nach Sex und verbranntem Skrotum erfüllte die Luft wie ausgeströmtes Gas, und ich schwöre, dass der Raum explodiert wäre, wenn jemand in dem Moment ein Streichholz angezündet hätte.
»Judd!«, rief Jen vom Boden aus.
Wade, der immer noch vor Schmerz stöhnte und vor Schreck über den zu erwartenden Schaden an seinen Hoden die Augen angstvoll aufriss, rollte sich unbeholfen vom Bett, stürmte ins Bad hinüber und schlug die Tür hinter sich zu. Nackte Männer sollten grundsätzlich nicht rennen. Durch die Tür war Wasserrauschen zu hören, untermalt von Wades kehligen Flüchen.
Ich blickte zu Jen hinüber, die nackt auf dem Boden saß, den Rücken gegen ihren Nachttisch gestützt. Sie hatte die Knie so eng an den Körper gezogen, dass sie ihr die Brüste platt drückten, und schluchzte in ihre Hände hinein. Bei diesem Anblick verspürte ich den Wunsch, auf die Knie zu sinken und sie in die Arme zu schließen, wie ich es in jeder anderen Situation außer der gegenwärtigen wohl auch getan hätte. Ich begann mich sogar schon auf sie zuzubewegen, hielt dann jedoch abrupt inne. Es war kaum länger als eine Minute her, dass ich durch die Schlafzimmertür getreten war, und mein Gehirn hatte sich noch nicht an diese schlagartig verwandelte Welt gewöhnt, in der ich Jen hasste und daher nicht mehr trösten konnte. Mein Körper war eine brodelnde Masse aus überholten Reflexen und heftigen Impulsen, und ich hatte keinen blassen Schimmer, was zum Teufel ich tun sollte. Der Drang, zu flüchten, wurde auf einmal übermächtig, aber die beiden einfach in meinem Haus zurückzulassen schien mir eine allzu bedingungslose Kapitulation darzustellen. Ich musste so schnell wie möglich losschlagen, mich verstecken, das Weite suchen, in Tränen ausbrechen, meine Daumen in Wades Augenhöhlen rammen und ihm die Augäpfel zerquetschen, Jen im Arm halten, Jen erwürgen, mich selbst umbringen, in einen tiefen Schlaf versinken und beim Aufwachen wieder zwanzig sein, und das alles möglichst in ein und demselben Moment. Ein totaler Nervenzusammenbruch war ebenfalls eine Option.
Jen blickte mit rotgeweinten Augen zu mir hoch. Blut und Rotz liefen ihr aus der Nase bis zum Kinn hinunter und von dort weiter auf die Brust. Ich empfand sogar Mitleid mit ihr, wofür ich mich wiederum selbst hasste.
»Ich kann nicht glauben, dass du das getan hast«, hörte ich mich sagen.
»Es tut mir so leid.« Mittlerweile hatte sie beide Arme um ihren nackten Körper geschlungen und zitterte heftig.
»Zieh dir was an und sieh zu, dass du ihn aus dem Haus schaffst.«
Damit endete unser Gespräch. Neun Jahre Ehe mit einem Herzschlag verpufft. Recht viel mehr gab es dazu nicht zu sagen. Als ich das Schlafzimmer verließ, knallte ich die Tür so fest hinter mir zu, dass im Inneren der Trockensteinmauer irgendetwas klappernd nach unten fiel. Durcheinander und völlig desolat blieb ich auf dem Gang einen Moment stehen und atmete aus. Mir war gar nicht bewusst gewesen, dass ich die Luft angehalten hatte. Dann eilte ich hinunter, um das Porzellan von Jens Großmutter in tausend Scherben zu schlagen – womit ich immer noch beschäftigt war, als schließlich die Polizei und die Sanitäter eintrafen.
»Und, wie geht es jetzt weiter?«, fragte Jen. Wir standen in der Küche und versuchten, umgeben von Unmengen zerschmetterten Porzellans ein Gespräch zu führen.
»Halt den Mund.«
»Ich weiß, dass du im Moment keinen Wert darauf legst, aber es tut mir wirklich furchtbar leid – ich kann dir gar nicht sagen, wie leid.«
»Halt einfach den Mund.«
Das lief nicht gut.
»Für das, was ich getan habe, gibt es keine Entschuldigung. Weißt du, ich fühle mich schon seit längerem so unglücklich, irgendwie verloren, und …«
»Würdest du jetzt verdammt noch mal bitte den Mund halten!«, schrie ich sie an.
Sie zuckte zusammen, als befürchtete sie, ich könnte handgreiflich werden. Ihre Nase war mittlerweile ziemlich angeschwollen und verfärbte sich dort, wo sie vorhin mit Wades Stirn kollidiert war, hässlich violett. Sobald sich unsere Probleme in der Nachbarschaft herumgesprochen hatten, würde Jens blaugeschlagenes Gesicht jedes Mal, wenn sich die Hausfrauen bei einem Magermilch-Latte den neuesten Klatsch zuflüsterten, Anlass zu endlosen Spekulationen geben.
Ich schloss die Augen und rieb mir die Schläfen. »Ich werde dir jetzt ein paar Fragen stellen, und ich möchte, dass du sie so knapp wie möglich beantwortest. Hast du mich verstanden?«
Sie nickte.
»Wie lange vögelst du schon mit Wade?«
»Judd …«
»Beantworte meine Frage!«
»Gut ein Jahr.«
Nach den Ereignissen der vorangegangenen halben Stunde hätte man meinen sollen, mich könnte mittlerweile nichts mehr erschüttern. Eine Affäre, die schon gut ein Jahr dauerte, war kein Strohfeuer, keine vorübergehende sexuelle Verirrung, sondern eine Beziehung. Das bedeutete, dass Jen und Wade bereits einen Jahrtag hinter sich hatten. Sie und ich waren anlässlich unseres ersten Hochzeitstags in einer Pension in Newport abgestiegen. Jen trug an dem Abend ein lavendelfarbenes Negligé, und ich las ihr ein kitschiges Gedicht vor, das sie so sehr zum Weinen brachte, dass ich hinterher noch eine ganze Weile das Salz auf ihren Wangen schmecken konnte. Wie hatten Jen und Wade wohl ihren ersten Jahrtag gefeiert? Und wenn wir schon dabei sind … ab wann zählten die beiden eigentlich? Ab dem ersten Flirt? Dem ersten Kuss? Dem ersten Fick? Dem ersten Mal, als einer von beiden »Ich liebe dich« sagte? Jen war sowohl sentimental als auch gewissenhaft, was ihren Kalender betraf, so dass sie zweifellos die genauen Daten all dieser Meilensteine im Kopf hatte.
Seit gut einem Jahr rannte Jen also bei jeder sich bietenden Gelegenheit los, um Sex mit Wade Boulanger zu haben, meinem mehr als athletisch gebauten Alpha-Männchen-Boss. Ich konnte es einfach nicht fassen. Das Ganze war für mich genauso unvorstellbar, als hätte ich gerade herausgefunden, dass sie eine Serienkillerin war, was mir ehrlich gesagt lieber gewesen wäre. Ich hätte dem Prozess beigewohnt, beim Schuldspruch düster genickt, meine Geschichte dem People-Magazin erzählt und danach mein Leben weitergelebt. Zumindest hätte ich dann gewusst, wo ich an diesem Abend schlafen würde.
»Gut ein Jahr«, wiederholte ich. »Du verstehst dich recht gut aufs Lügen, was?«
»Inzwischen schon, ja.« Fast trotzig erwiderte sie meinen Blick.
»Liebst du ihn?«
Sie wandte den Blick ab.
Das tat weh, denn damit hatte ich nicht gerechnet.
Während ich über die Konsequenzen nachdachte, die es mit sich bringen würde, wenn ich ihr mit einer Porzellanscherbe die Kehle durchschnitt, stieß Jen einen langen, dramatischen, von Selbstmitleid erfüllten Seufzer aus.
»Als das mit Wade anfing, hatten wir beide schon eine ganze Weile unsere Probleme.«
»Kein Vergleich zu denen, die wir jetzt haben.«
Vermutlich antwortete sie mir darauf etwas, doch ich hatte ihre Stimme bereits ausgeblendet. Ich hörte nur noch das Knirschen des Porzellans unter meinen Füßen, während ich die Küche durchquerte, das klagende Ächzen des Scharniers, als ich die Haustür aufschwang, und schließlich den plötzlichen Ausstoß von Luft, als meinem Körper einfiel, dass er wieder atmen musste.
Wie zum Teufel sollte es jetzt weitergehen?
Ich saß in meinem Wagen, der immer noch in der Auffahrt stand, und hielt das Lenkrad so fest umklammert, dass sich meine Knöchel weiß färbten. Ich fühlte mich wie gelähmt, weil ich einfach nicht wusste, was ich als Nächstes tun sollte. Es gibt nichts Traurigeres, als in einem Wagen zu sitzen und absolut keinen Ort zu haben, wo man hinkann. Oder doch, vielleicht gibt es etwas noch Traurigeres: in einem Wagen zu sitzen, der vor einem Haus steht, in dem man plötzlich nicht mehr zu Hause ist. Denn im Allgemeinen kann man, wenn man nirgendwo anders mehr hinkann, wenigstens noch nach Hause. Jen hatte mich nicht nur betrogen, sondern darüber hinaus auch noch obdachlos gemacht.
Schlagartig färbte eine wahnsinnige Wut meine Angst blutrot, und ich begann zu zittern. Am liebsten hätte ich Jen auf der Stelle erwürgt. Ich wollte spüren, wie ihre Luftröhre unter meinen Daumen nachgab. Oder aber Wade mit einem von diesen gebogenen Messern erstechen, die wilde Eingeborenenstämme zum Ausschlachten von Menschen entwickelt haben. Ich stellte mir vor, wie ich ihm so ein Ding durchs Brustbein in mehrere lebenswichtige Organe rammte und dann zusah, wie ihm dunkles Blut aus dem Mund quoll, angereichert mit herausgerissenen Gewebefetzen. Nein, noch besser wäre ein dramatischer Selbstmord. Ich könnte durch eine Leitplanke in den Hudson River fahren und Jen mit einem lähmenden Schuldgefühl zurücklassen, das sie ihr ganzes restliches Leben lang verfolgen würde, genau wie mich der Anblick von Wades heftig rammelndem Hintern.
Aber wahrscheinlich würde sie bloß wieder eine Therapie machen, womöglich sogar bei demselben Psychofuzzi, bei dem sie damals aufgehört hatte, weil er irgendwann dazu übergegangen war, sie nach jeder Sitzung fest zu umarmen. Dieser grabschfreudige Freudianer würde sie irgendwie davon überzeugen, dass ihr bei der ganzen Sache die Opferrolle zukam und sie es sich selbst schuldig war, wieder glücklich zu sein, womit mein Tod völlig umsonst gewesen wäre. Dann konnte ich bestenfalls noch darauf hoffen, dass sie am Ende Wade mit ihrem notgeilen Therapeuten betrügen würde. Gilt das überhaupt als Betrügen, wenn eine Frau den Geliebten betrügt, mit dem sie ursprünglich ihren Ehemann betrogen hat? Da das alles Neuland für mich war, kannte ich mich mit den geltenden Gesetzen nicht aus.
Im Rückspiegel konnte ich die Vorderseite des Hauses sehen, die unteren Ecken des Panoramafensters unseres Wohnzimmers und die Linie, wo gestaffelte rote Ziegel das Steinfundament ablösten. Mein ganzes Leben, die Summe meiner Existenz, befand sich hinter dieser Wand. Eigentlich sollte ich in der Lage sein, aus dem Wagen zu steigen, durch die Haustür hineinzumarschieren und das alles einfach zurückzufordern. Die Tür würde sich widersetzen, wie sie es in den wärmeren Monaten immer tat. Man musste sie nach unten drücken, während man den Türknauf drehte, und sich gleichzeitig mit der Schulter fest gegen das schwere Erlenholz lehnen. Ich hatte die Schlüssel direkt vor mir, sie klimperten gegen die Lenksäule, von der ich nicht wusste, in welche Richtung ich sie drehen sollte.
Wie, verdammt noch mal, ging es jetzt weiter? Was für eine gottverdammte Scheiße.
Ich warf einen Blick auf meine Armbanduhr, die Rolex Cosmograph Daytona aus Weißgold, die Jen mir zu meinem dreißigsten Geburtstag geschenkt hatte. Ich war mit der Citizen, die ich bis dahin getragen hatte, recht zufrieden und empfand sogar ein gewisses Bedauern, als ich plötzlich dieses wuchtige Stück protzigen Metalls überreicht bekam, aber solche Dinge waren für Jen nun mal wichtig. Sie hatte sich auf das Leben in der Vorstadt eingestellt wie eine Schauspielerin, die sich voller Enthusiasmus in eine neue Rolle wirft, und sorgte stets mit Entschlossenheit dafür, dass wir beide entsprechend aussahen.
»Für das Geld, das diese Uhr gekostet hat, könnten wir einen tollen Urlaub machen«, gab ich zu bedenken.
»Den tollen Urlaub können wir trotzdem machen«, entgegnete sie. »Urlaube kommen und gehen, eine solche Uhr dagegen ist ein richtiges Erbstück.«
Ich war zu jung für ein Erbstück. Mit dem Wort assoziierte ich bettlägerige alte Männer mit gelben, gekrümmten Zehennägeln und knochigen Handgelenken, die in muffigen, nach Desinfektionsmitteln und Verwesung riechenden Räumen vor sich hin vegetierten. »Man könnte auch sagen, fünf Hypothekenraten«, stellte ich fest.
»Es ist ein Geschenk!«, fauchte Jen, die manchmal ganz schön schnippisch werden konnte.
»Ein Geschenk, für das ich bezahlt habe.«
Obwohl ich zu dem Zeitpunkt bereits lange genug verheiratet war, um zu wissen, dass diese Bemerkung falsch, lieblos und außerdem nicht im entferntesten konstruktiv war, konnte ich sie mir trotzdem nicht verkneifen. Manchmal war ich einfach so drauf, keine Ahnung, warum. Kaum ist man verheiratet, bilden sich auch schon bestimmte Verhaltensmuster heraus. Jen war aufgrund ihrer genetischen Veranlagung unfähig, irgendeine Art von verbaler Entschuldigung von sich zu geben. Dafür machte ich manchmal unqualifizierte Bemerkungen, die ich gar nicht so meinte. Grundsätzlich akzeptierten wir beide diese Schwächen, sowohl die eigenen als auch die des anderen – mit Ausnahme der konkreten Momente, in denen sie tatsächlich zum Tragen kamen. Dann mussten wir jedes Mal den Drang unterdrücken, einander wutentbrannt an die Gurgel zu gehen.
»Demnach ist unser Geld also dein Geld?«, fragte Jen. Aus ihren Augen blitzte der Genuss der Entrüstung. Wieder einmal war es ihr gelungen, uns mit einem nahtlosen Übergang in einen anderen Streit zu verfrachten. Sie hatte diese Fähigkeit im Lauf der Zeit immer mehr perfektioniert – wie ein Boxer, der zuschlägt und dann zur Seite springt, ehe der Gegenschlag kommt. Ich konnte einfach nicht mit ihr streiten, ohne dass mir davon schwindelig wurde.
Am Ende behielt ich die Uhr. Etwas anderes hatte auch nie ernsthaft zur Debatte gestanden. Die Citizen verbannte ich in das kleine Fach meiner Sockenschublade, wo bereits die Schlüssel zu unserer alten Wohnung lagen, außerdem zwei alte Handys, mein College-Ausweis, ein paar japanische Wurfsterne aus meiner kurzen Ninja-Phase in der siebten Klasse, der Foul-Ball von Lee Mazzilli, den ich als Junge im Shea-Stadion aufgefangen hatte, sowie eine Handvoll anderer Artefakte früherer Versionen von mir, die inzwischen längst tot und begraben waren.
Nun konnte ich von der Rolex ablesen, dass es drei Uhr Nachmittag war. Ich brauchte ein wenig Zeit, um in Ruhe nachzudenken, die Situation zu analysieren und mir meinen nächsten Schachzug zu überlegen. Ich ließ die Finger über die Tasten meines Handys gleiten und ging die Liste mit meinen Kontakten durch, obwohl mir bereits klar war, dass ich niemanden anrufen würde. Vielleicht schafften Jen und ich es ja doch, die Sache wieder zurechtzurücken, und dann wäre es bestimmt nicht angenehm, wenn mich alle komisch anstarrten. Ich wusste, der Schaden war nicht wiedergutzumachen, unsere Unschuld verloren und das Vertrauen zwischen uns zerstört, dennoch stellte sich mir die alte Scherzfrage: Wenn deine Ehefrau mit deinem Boss schläft, ohne dass jemand davon erfährt, ist es dann überhaupt passiert? Ich hatte niemanden, den ich anrufen konnte, keine Freunde, die nicht auch mit Jen in Verbindung standen. Ich dachte kurz an meine Mutter, aber mein Vater lag im Koma, so dass sie genug eigene Probleme hatte.
Mein Leben befand sich gerade im freien Fall, und ich hatte keine Ahnung, wohin ich mich wenden sollte. Ein eiskaltes Gefühl von Verzweiflung setzte sich irgendwo ganz hinten in meinem Hals fest. Plötzlich war ich nicht mehr wütend oder am Boden zerstört, sondern hatte nur noch Angst vor der ungeheuren pulsierenden Einsamkeit, die sich erst jetzt wie ein Schraubstock um meine inneren Organe legte.
Ich lenkte meinen Wagen durch den kleinen Geschäftsbezirk von Kingston, am Bahnhof vorbei und auf die Überführung I-87