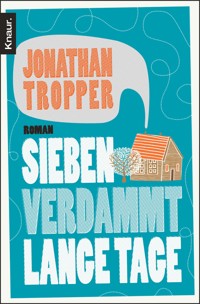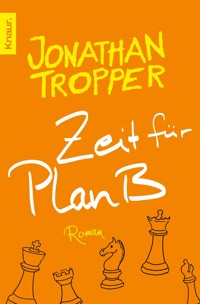
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Während ihres Studiums waren Ben und seine vier besten Freund unzertrennlich. So sollte es auch immer bleiben. Aber ein paar Jahre später hat die Realität sie eingeholt – und aus den Unschlagbaren Fünf sind gute Bekannte geworden, die einander nur noch gelegentlich über den Weg laufen. Das ändert sich, als einer von ihnen in große Schwierigkeiten gerät und die vier anderen beschließen: Wir müssen etwas tun! Es ist Zeit für Plan B! Dummerweise haben sie den aber nie gemacht – was bedeutet, dass sie nun eine erstaunliche Anzahl von Gesetzen brechen müssen … Zeit für Plan B von Jonathan Tropper im eBook!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 545
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Jonathan Tropper
Zeit für Plan B
Roman
Aus dem Amerikanischen von Veronika Dünninger
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Inhaltsübersicht
Widmung
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
Dank
Für Lizzie und Spencer, mit denen es einfach herrlich ist, dreißig zu sein.
1
Jack war ein Filmstar, was bedeutete, dass man ihm im Hinblick auf sein ungehobeltes Benehmen ein gewisses Maß an Freiheit zubilligte. Trotzdem, als er stoned und verschwitzt auf Lindseys Party anlässlich ihres dreißigsten Geburtstags aufkreuzte, dem übereifrigen Oberkellner mit der Faust auf die Nase schlug und sich in die eingetopften Gladiolen übergab, die im Torre’s die kniehohen Fensterbretter säumten, bevor er an unserem Tisch auf einem Stuhl bewusstlos in sich zusammensank, war niemand amüsiert. Lindsey nicht, die »Ach zum Teufel!« sagte und hinüber an die Bar ging, um sich noch einen Wodka geben zu lassen. Chuck nicht, der das Eis aus seinem und meinem Drink auf seine Serviette kippte und, während er leise auf Jack fluchte, in die Küche stürmte, um den Oberkellner zu verarzten. Alison nicht, die von ihrem Platz aufsprang und sich eifrig bemühte, Jack wiederzubeleben, indem sie ihm sanft das Gesicht tätschelte, einen nassen Lappen auf die Stirn legte und immer wieder eindringlich flehte: »O mein Gott, Jack, wach auf.« Und ich nicht, der ich – da ich mir nicht besser zu helfen wusste – vom Tisch aufstand und unter dem missbilligenden Schweigen gut gekleideter Dinnergäste an die Bar schritt, um Lindsey Gesellschaft zu leisten.
Na ja, um ehrlich zu sein, irgendwie war ich schon amüsiert. Es kommt schließlich nicht alle Tage vor, dass man im wirklichen Leben etwas Derartiges geboten bekommt.
»Alles okay mit dir, Lindsey?«, fragte ich in genau dem Augenblick, in dem sie den Kopf zurückwarf und den Wodka hinunterkippte. Irgendwo im Hintergrund rieselte Musik – Yanni oder sonst irgendeine Musik, die unter Schlafmitteleinfluss steht – leise aus unsichtbaren Lautsprechern.
»Im Vergleich zu anderen, würde ich sagen, es geht mir hervorragend«, sagte sie mit einem Blick in Jacks und Alisons Richtung. »So ein Arschloch.«
»Noch zwei«, rief ich dem Barmann zu, dem es tatsächlich gelang, den Blick, mit dem er Lindsey unter den Augenbrauen hervor anstarrte, lange genug abzuwenden, um meiner Bitte nachzukommen.
»Meinst du, es hat ihn jemand erkannt?«, fragte ich mit einem Blick ins Restaurant.
»Und wenn schon.«
»Auf dich, Geburtstagskind.« Wir stießen an und leerten die Gläser.
»Ich glaube, die würden weitaus mehr dabei rausschlagen, wenn sie wüssten, wer er ist«, meinte Lindsey. »Schließlich bekommt man nicht alle Tage die Gelegenheit, zuzusehen, wie ein echter Filmstar sein Leben zerstört.«
»Er kann von Glück reden, dass sie ihn nicht festgenommen haben.«
»Die Nacht ist noch jung.«
»Ich hoffe, dem Oberkellner ist nichts passiert«, sagte ich. Ich verzog das Gesicht bei dem Gedanken an den plötzlichen Faustschlag, an das knackende Geräusch, das zu hören war, als Jacks Faust und das Gesicht des Oberkellners aufeinanderprallten. Jacks Faust schläge hatten im Allgemeinen den Vorzug, von THX-Soundeffekten begleitet zu werden. Im wirklichen Leben verblüffte das Geräusch durch die fehlende Resonanz, wodurch noch weitaus mehr Gewalt in ihm zu stecken schien.
»Wäre es Ihnen vielleicht möglich«, wandte sich Lindsey an den Barmann, »eine Zeit lang nicht auf meine Brüste zu starren?«
Der Barmann, ein Typ in den Vierzigern mit einem Kropf und einem langen Schnauzer, stöhnte und entfernte sich rasch ans andere Ende der Bar. Er zog ein Geschirrtuch hervor und begann, peinlich genau auf einem unsichtbaren Schmutzfleck herumzureiben. »Bist du sicher, dass mit dir alles okay ist?«, fragte ich.
»Er hat sich nicht einmal bemüht, es unauffällig zu machen«, empörte sie sich.
»Also ist es gar nicht die Tatsache, dass er dich angestarrt hat, die dich ärgert, sondern nur, wie schlampig er es ausgeführt hat.«
»Ach, halt den Mund, Ben.«
In diesem Augenblick kam Chuck aus der Küche zurück, die Stirn unter dem sich lichtenden Haar mit Schweißtropfen besprenkelt. »Du meine Güte, hier drin ist es vielleicht heiß.« Er bestellte sich ein Club-Soda auf Eis, was er immer trank, wenn er am nächsten Morgen operieren musste. Der Barmann bediente ihn, ohne Blickkontakt aufzunehmen, und zog sich dann rasch wieder ans andere Ende der Bar zurück.
»Wie geht’s dem Oberkellner?«, fragte ich.
»Er wird’s überleben. Er hat eine Quetschung auf dem Nasenrücken, und es wird ihm noch ein paar Tage wehtun, wenn er niesen muss. Ich hab ihm gesagt, ich geb telefonisch ein Rezept für ihn durch. Wie geht’s Hollywood?«
Wir sahen alle hinüber zu dem Tisch, an dem Alison Jack inzwischen wiederbelebt hatte und ihm ein Glas Wasser einflößte, von dem das meiste in dunklen, feuchten Flecken auf seinem braunen Hemd endete. Die trübe Beleuchtung des Restaurants verlieh seiner ohnehin schon aschfahlen Gesichtsfarbe eine gelbsuchtartige Blässe, so dass er ausgezehrt und kränklich wirkte. »Er hat schon besser ausgesehen«, sagte ich wahrheitsgemäß.
»O Mann, ich hab schon obdachlose Junkies zu Gesicht bekommen, die besser ausgesehen haben«, schnaubte Chuck verächtlich.
»Erspar uns bitte grässliche Details aus deinem gesellschaftlichen Umgang.«
»Hey, bleib cool«, sagte Chuck mit einem dämlichen Grinsen. Chuck hatte irgendwie die Phase verpasst, in der wir alle Anredefloskeln wie »O Mann« und »Hey, bleib cool« abgelegt hatten, und er hielt hartnäckig an diesen Anachronismen fest, als könnten sie seinen Haarausfall irgendwie verlangsamen.
»Das ist ein hübsches Bild für die Boulevardpresse«, unterbrach uns Lindsey, die sich in diesem Augenblick wieder zur Bar umwandte. Die Lichtstrahlen der Restaurantbeleuchtung ließen ihre blonden Strähnchen hell aufschimmern, als sie den Kopf bewegte.
»Ich denke, wir sollten ihn besser von hier wegschaffen«, sagte ich. »Wenn ihn irgendjemand erkennt, dann können wir uns das hier in Entertainment Tonight ansehen.«
»Recht geschehen würde es ihm«, sagte Lindsey, während wir uns von der Bar erhoben.
»Was hat man eigentlich davon, ein berühmter Filmstar zu sein, wenn einen niemand erkennt?«, brummte Chuck.
»Sieh ihn dir bloß an«, sagte ich. »Selbst ich erkenn ihn kaum wieder.«
Das stimmte. Jacks normalerweise hellblondes Haar war ein schmieriges, verfilztes Durcheinander über seiner Gucci-Sonnenbrille, und er trug einen Vier- oder Fünftagebart. Es fiel schwer zu glauben, dass das derselbe Mann war, dessen Gesicht (und Körper, immer der Körper) im Lauf der letzten Jahre auf jeder größeren Zeitschrift abgebildet war, derselbe Kerl, den Journalisten der Boulevardpresse auf abgedroschene Phrasen wie »Cooler Typ« und »Frauenschwarm« reduzierten. Doch sein verwahrlostes Erscheinungsbild an jenem Abend hätte keineswegs dazu beigetragen, an diesem Eindruck irgendetwas zu ändern. Wenn Jack ausging, sah er oft aus, als hätte er sich seit einer Woche nicht geduscht. Das war typisch Hollywood. Alle Stars benahmen sich in letzter Zeit genauso wie er, falls die heimlich aufgenommenen Schnappschüsse in Entertainrnent Weekly und Movieline als Indiz gelten konnten. Das war ihre Art zu sagen: »Selbst wenn ich beschissen aussehe, bin ich immer noch schön.« Was in Jacks Fall unbestreitbar stimmte. Sein eigentliches Wesen schien zwischen den Schmutzschichten hindurch – die perfekten grünen Augen, die schön geschwungenen Wangenknochen, die lässige, unbewusste Anmut, mit der er seinen schlanken Körper bewegte. Wenn man seinen besten Tag hatte, konnte man von Glück reden, wenn man so aussah wie Jack mit Pocken.
Als wir uns dem Tisch näherten, wandte Alison den Blick ab, aber erst, nachdem ich schon bemerkt hatte, dass sie Tränen in den Augen hatte. Ich stieß Lindsey in die Seite. »Geh mit ihr nach draußen.«
Nachdem die Frauen gegangen waren, nahmen Chuck und ich rechts und links von Jack Platz, der inzwischen wieder aufrecht saß, mit verschleiertem Blick zwar, aber ansonsten offensichtlich nur leicht benommen. »Meinst du, wir können jetzt ohne weitere Zwischenfälle von hier verschwinden?«, fragte ich ihn.
»Tut mir leid, Leute«, sagte Jack mit einem verlegenen Eine-Million-Dollar-Lächeln. Und dann, etwas besorgt: »Habe ich irgendjemanden erwischt?«
»Du hast den Oberkellner k.o. geschlagen«, sagte ich.
»Was hat er gemacht?«
»Geblutet, hauptsächlich.«
»Scheiße.« Er warf einen verächtlichen Blick auf seine Knöchel, als hätten sie ohne sein Zutun gehandelt. »Ich wusste, dass ich eigent lich zu fertig war, um noch hierher zu kommen, aber ich wollte doch unbedingt zu Lindseys Party.«
»Auftrag ausgeführt, Mann«, sagte Chuck.
»Scheiße, mein Kopf tut weh«, sagte Jack, lehnte sich zurück und rieb sich die Schläfen.
Auf einmal beugte sich Chuck vor und drückte Jacks Nase mit Daumen und Zeigefinger zusammen. Von Schmerz durchzuckt, schnellte Jack hoch und schlug Chucks Hand beiseite. »Arschloch!«
»Ich dachte mir schon, das würde vielleicht wehtun«, sagte Chuck mit einer gewissen Genugtuung.
»Kokain?«, fragte ich.
»Eindeutig, Mann«, sagte Chuck. »Macht die Nasengänge ziemlich wund.«
»Kein Heroin?«
»Könnte sein«, antwortete Chuck. »Aber sein Verhalten lässt eher auf Kokainsucht schließen.«
»Scheiße, Jack«, sagte ich. Ich fühlte mich plötzlich wie am Boden zerstört. »Koks?«
Es blieb ihm erspart, mir eine Antwort geben zu müssen, denn in diesem Augenblick kam der Geschäftsführer, begleitet von zwei stämmigen Küchenhilfen, um uns aus dem Restaurant zu werfen.
Das war der Zeitpunkt, als wir das erste Mal dachten, dass Jack vielleicht ein echtes Problem hatte.
Natürlich, es war nicht das erste Mal, dass uns der Gedanke kam, Jack könnte womöglich nicht wirklich drogenfrei sein, aber wie kann man schon eine echte Abhängigkeit von den allgemein üblichen Starallüren unterscheiden? Welcher größere Hollywoodstar zerlegte denn nicht dann und wann seine Hotelsuite oder wurde zerzaust und benebelt dreinblickend vor dem VIP-Room von den Paparazzi abgelichtet? Wenn jedes Mal gleich die Warnlichter aufblinken würden, wenn ein Filmstar ein bisschen über die Stränge schlug, dann müssten sie an der Betty-Ford-Klinik ja Drehtüren einbauen. Trotzdem, rückblickend betrachtet, hatte Jack in den letzten Monaten doch irgendwie zurückgezogen gewirkt, war am Telefon immer in Eile und etwas zappelig, wie man selbst klingt, wenn man ein Ferngespräch führt oder gerade aus der Dusche kommt, wenn das Telefon klingelt. Er war geistesabwesend und angespannt, völlig anders als der Jack, den wir alle kannten. Aber wenn man zwölf Millionen pro Film verlangen kann, dann ist ein gewisser Druck natürlich unvermeidlich. Die Geier von der Boulevardpresse kreisten schon seit Monaten über ihm und suchten (will heißen: gierten) nach Anzeichen eines Zusammenbruchs, aber als Jacks Freunde fühlten wir uns verpflichtet, die Berichterstattung einfach zu ignorieren. Keiner will glauben, dass er die Medien braucht, um mit einem Freund in Verbindung zu bleiben.
Die Ironie an alledem war, dass Jack sich im Grunde nie für die Schauspielerei interessiert hatte. Für ihn kam die Berühmtheit mit derselben Leichtigkeit des Glücks daher wie alles andere auch. Auf dem College kam er im Allgemeinen ziellos auf eine Party geschlendert, wenn er spätabends vom Joggen auf dem Weg nach Hause war, unrasiert, das Haar schweißtriefend auf der Kopfhaut klebend, mit deutlichen Flecken in den Achseln seines zerlumpten NYU-Sweatshirts, und dann zog er meist eine Stunde später wieder ab – mit einem beliebigen der unzähligen Mädchen, die sich gegenseitig fast über den Haufen rannten, um sich ihm anzubieten. Er plante es nicht; er plante nie irgendetwas. Die Dinge passierten Jack einfach. Hätte er je darüber nachgedacht, dann hätte er vermutlich angenommen, dass es sich bei allen anderen genauso verhielt. Aber Jack dachte nie darüber nach. Man wollte es ihm übel nehmen oder ihn vielleicht sogar ein bisschen hassen, aber wie konnte man andererseits jemandem seine angeborenen Talente missgönnen, wenn er sich dieser nicht einmal bewusst war? Er hatte nicht die geringste Ahnung, was für ein charmantes Wesen er besaß, was ihn natürlich nur noch charmanter machte.
In unserem letzten Collegejahr nahm Jack einen Teilzeitjob als Kellner im Violet Café an. Sein Finanzhilfeabkommen sah vor, dass er zwanzig Stunden die Woche arbeitete. Eines Tages servierte er irgendeinem Typen, der ein Senkrechtstarter in einem der großen Filmstudios war, einen Frappacchino. Dieser Typ kannte irgendjemanden, der irgendjemanden kannte, und binnen weniger Wochen hatte er einen Termin für Probeaufnahmen vereinbart. Es war fast unvermeidlich. Kurz nach dem Thanksgiving Day erhielt Jack einen Mitgliedsausweis des Verbands der Filmschauspieler und eine Komparsenrolle in einem Thriller mit Harrison Ford. Irgendwelche Drehbuchbearbeiter vor Ort gaben ihm noch drei Zeilen und eine Zwölf-Sekunden-Schießerei, in der er einen chinesischen Bodybuilder wegpustete, bevor er selbst erschossen wurde. Jack war für drei Wochen in L. A., um diese Szenen zu drehen, und als er zurückkam, war er enttäuscht, dass er Harrison Ford nicht kennengelernt hatte. »Der war gar nicht da«, sagte Jack verbittert. »Der arbeitet schon wieder an einem neuen Film.«
Ein Casting-Agent, der für Miramax an einem finanziell bescheiden ausgestatteten Actionfilm mit dem Titel Blue Angel arbeitete, sah den Ford-Film, als er ein paar Monate später in die Kinos kam, und mochte die Art, wie Jack eine nachgemachte Pistole in der Hand hielt. Jack wurde für die Hauptrolle in Blue Angel ausgewählt, wofür er nach Tarif bezahlt wurde, und er flog nach Hollywood, um mit der Vorproduktion zu beginnen. Blue Angel wurde der Überraschungserfolg des Jahres, und die Zunft salbte Jack zu Hollywoods kommendem großen Actionstar. Keiner von uns war wirklich überrascht, als er nicht mehr zurückkam, um seinen Abschluss zu machen.
Einmal habe ich Jack gefragt, was er eigentlich für Pläne hatte, bevor er entdeckt wurde. »Was meinst du damit?«, fragte er mich.
»Du hattest Soziologie als Hauptfach, was in etwa dasselbe ist wie Arbeitslosigkeit als Hauptfach«, sagte ich. »Was wolltest du denn nach dem College machen?«
Er sah mich stirnrunzelnd an, offensichtlich völlig verblüfft von meiner Frage. »Ich weiß nicht«, sagte er und fuhr sich mit den Fingern durch sein perfektes Haar. »Irgendwas wär’ mir schon eingefallen.«
»Machst du dir denn nie Sorgen um deine Zukunft?«, fragte ich.
Jack zuckte die Schultern. »Das hier ist die Zukunft«, sagte er.
Als wir das Restaurant verließen, kotzte Jack, dem Magazin People zufolge, einer der »Fünfzig schönsten Menschen des Jahres 1999«, sich völlig voll, so dass Alison ihn in seine Limousine verfrachtete, um ihn zurück zu seinem Hotel zu bringen, wobei sie uns – während er auf allen vieren hineinkletterte – beharrlich versicherte, dass wir nicht alle mitkommen mussten. Lindsey, Chuck und ich gingen zu Moe’s, einer Bar auf der Upper East Side, die Chuck kannte – eines jener Lokale, in denen der Fußboden jeden Abend sorgfältig mit Sägemehl bestreut wird, damit es nach einer echten Spelunke aussieht. Für einen Chirurgen kam Chuck mit Sicherheit viel herum. Er schien die meisten Frauen im Lokal zu kennen, und die Bardame, die aussah wie ein Supermodel, das seine besten Zeiten hinter sich gelassen hat, begrüßte ihn mit einem Küsschen. Jack war vielleicht der Filmstar, aber Chucks Leben war ein Film. Oder zumindest ein Werbespot für Bier.
Während Chuck an der Bar ein paar Mädchen anquatschte, die kaum volljährig zu sein schienen, nahmen Lindsey und ich weiter hinten an einem Tisch Platz und bestellten uns ein paar Kamikazes und einen Krug Sam Adams. »Wie geht’s Alison?«, fragte ich. Ich musste brüllen, um mich über den Lärm der Jukebox hinweg verständlich zu machen, aus der einer dieser neuartigen Songs dröhnte, einer dieser nervenaufreibenden Ohrwürmer, die allmählich echte Musik im Radio ersetzen. Die Tatsache, dass ich mich selbst gelegentlich beim Mitsummen ertappte, verstärkte nur noch meine Abneigung gegen diese Musik.
»Liebt ihn nach wie vor, wie gut auch immer das den beiden tun mag«, sagte sie, während sie Bier in die Plastikbecher goss. »Sie glaubt, er hat den kritischen Punkt erreicht.«
»Und was meinst du?«
»Ich weiß nicht. Er hat da vorhin schon ’ne ziemlich üble Show abgezogen, selbst für einen Filmstar.«
Ich nickte zustimmend. »Er steckt auf jeden Fall tief in der Tinte.«
Einen Augenblick lang tranken wir schweigend. »Wie geht’s Sarah?«, fragte sie.
»Erkundigst du dich nach ihrer Gesundheit?«
»Vergiss es. Entschuldige.«
Ich sah hinüber an die Bar, wo sich Chuck mit einer Brünetten in einer ärmellosen Bluse köstlich amüsierte. Die Bluse war so eng, dass ich von meinem Platz aus die Konturen ihres Bauchnabels erkennen konnte. Das Licht warf einen schimmernden Glanz auf Chucks Kopf, genau über der Stelle, an der sein Haaransatz den täglichen Haarwuchsmittel-Angriffen nach wie vor standhielt. Er befand sich in einem verzweifelten Wettlauf mit seinem Haar, entschlossen, so viele Frauen wie möglich ins Bett zu bekommen, bevor es völlig verschwand.
Ein paar Wochen zuvor war ich mit Chuck übers Wochenende nach Atlantic City gefahren, und einmal, als ich in unser Zimmer im Trump Casino Hotel kam, sah ich ihn, wie er, in ein Handtuch gewickelt, im Badezimmer vorm Spiegel stand und mithilfe einer Pipette eines dieser Wundermittel auf seine Kopfhaut auftrug. Es war, als sei ich unbeabsichtigt in ein äußerst privates Ritual gestolpert, wie in dieser einen Szene in Das Imperium schlägt zurück, in der der Officer in genau dem Augenblick auf Darth Vader trifft, in dem er seine Maske nicht aufhat. Chucks Haar, noch nass von der Dusche, stand in zackigen Stacheln senkrecht ab, und zwischen den vereinzelten kräftigen Strähnen schimmerte seine rosa Kopfhaut wie bloßgelegtes Gewebe hindurch. Er wandte sich mit einem verlegenen Grinsen zu mir um, die Pipette noch immer hoch über dem Kopf haltend, wie den Taktstock eines Dirigenten, und sagte: »Was hab ich denn schon zu verlieren?«
»Es muss schön für ihn sein«, sagte Lindsey mit einem Kopfnicken in Chucks Richtung. »Wo er auch hingeht, er trifft immer irgendjemanden, den er anquatschen kann.«
»Für einen Mann mit einem Hammer sieht eben alles wie ein Nagel aus«, sagte ich. Ihre Augen lächelten mich über den Rand ihres Pappbechers hinweg an.
»Was glaubst du, wonach er eigentlich auf der Jagd ist?«, fragte sie mich und stellte ihr Bier ab. Ich warf ihr einen Blick zu. »Abgesehen von dem Offensichtlichen«, verbesserte sie sich. »Ich meine, was glaubst du, weshalb er so entschlossen ist, mit möglichst vielen Frauen zu schlafen? Auf dem College, okay. Es ist ein akzeptabler Übergangsritus, aber mit dreißig ist das doch ein bisschen …«
»Unreif?«
»Eher bemitleidenswert«, sagte sie.
»Ich weiß nicht«, sagte ich matt. Ich trank einen Schluck Bier und behielt ihn im Mund, ließ die mikroskopisch kleinen Luftbläschen meine Zunge kitzeln, bis sie platzten. »Vielleicht hat Chuck einfach noch nicht die Richtige gefunden.«
»Wie würde er das denn überhaupt merken? Er ist ja immer schon verschwunden, noch bevor das Laken trocken ist. Er hat einen noch größeren Peter-Pan-Komplex als du. Bei seinem gehört noch dazu, dass er vor Tagesanbruch aus dem Fenster davonfliegt.«
Ich lachte. »Erstens hältst du jetzt mal den Mund«, sagte ich. »Und zweitens glaube ich, es ist eher eine Art James-Bond-Komplex. Er macht es nicht, um sich länger jung zu fühlen. Ich glaube, er macht es, um sich wie ein echter Mann zu fühlen.«
Im Gegensatz zu Lindsey und Alison, die ihn erst auf dem College kennengelernt hatten, wusste ich, dass es bei Chuck nicht immer so gelaufen war, was vermutlich der Grund war, weshalb ich ihm weitaus mehr durchgehen ließ als die beiden. Wir waren zusammen aufgewachsen, hatten zusammen die Grundschule und die Highschool besucht, wo er es alles andere als leicht gehabt hatte. Von früher Kindheit an bis in unser drittes Highschool-Jahr hinein war Chuck mit Abstand das übergewichtigste Kind in der Klasse gewesen. Nicht auf eine groteske Weise fett, aber auf eine komische Weise plump, so dass er immer ein wenig ungepflegt wirkte. Er wurde nicht ständig gehänselt, wie es in diesen John-Hughes-Filmen der Fall ist, aber er litt trotzdem darunter, vor allem, wenn es um Mädchen ging. Durch seine witzige Art war er bei ihnen in gewisser Weise beliebt, aber sobald er an etwas Ernstem interessiert war, bekam er jedes Mal das übliche »Lass-uns-gute-Freunde-sein«-Gerede zu hören. Dann schoss er schließlich in die Länge, was, zusammen mit einer eisern durchgehaltenen Diät, sein Gewicht auf ein normales Maß reduzierte. Doch zu dem Zeitpunkt war es schon zu spät. Er hatte die ersten beiden Jahre auf der Highschool als Dickerchen gegolten, und bei dieser Einschätzung blieb es in weiten Kreisen auch für die nächsten beiden. Und wenn man sechzehn ist, dann ist die Einschätzung der anderen eben neun Zehntel der Wahrheit.
Das College hingegen war ein perfekter Neuanfang für ihn, und Chuck schoss los wie ein Pferd aus dem Gatter. Vielleicht war es Kompensation, vielleicht Rache an all den Frauen für die früheren Zurückweisungen oder vielleicht auch nur all der aufgestaute, unterdrückte Sexualtrieb, den er nun, nachdem er jahrelang solo gelebt hatte, endlich mit jemand anders und in dem ausleben konnte, was er ungeniert »eine Nummer schieben« nannte. Wie auch immer man es erklären wollte, Chuck konnte gar nicht glauben, wie leicht es auf einmal war, sich flachlegen zu lassen, und er ging dabei mit einer unbändigen Ausgelassenheit zu Werke, als hätte er im Supermarkt einen Einkaufsgutschein gewonnen.
Irgendwann gegen Ende des Colleges setzte bei Chuck der Haarausfall ein, und er bekam auf einmal das Gefühl, als hätte eine gigantische Uhr zu ticken begonnen. Es muss ihm entsetzlich ungerecht vorgekommen sein, dass er, der so hart darum gekämpft hatte, ein körperliches Handikap loszuwerden, aus seiner Sicht nun ein neues aufgebürdet bekam, über das er keinerlei Kontrolle besaß.
Lindsey und ich beobachteten, wie Chuck das Mädchen näher an sich zog und ihr irgendetwas zuflüsterte. Sie lachte mit dem ganzen Körper und gab ihm einen flüchtigen Kuss auf die Wange. »Na ja, er beherrscht schon ein paar Kunststücke«, sagte Lindsey. »Ich denke, das muss man ihm lassen.«
»Wenn wir ihn doch nur dazu bringen könnten, seine Kräfte positiv zu nutzen«, sagte ich geistesabwesend und trank noch einen Schluck von meinem Sam Adams.
»Du siehst traurig aus«, sagte sie.
»Ich bin nur nachdenklich.«
»Worüber denkst du nach?«
»Ob ich traurig sein soll oder nicht.«
»Immer noch der alte Ben.«
Eine Zeit lang tranken wir schweigend.
»Wir lassen uns scheiden«, sagte ich schließlich.
»Oh!« Sie schien aufrichtig überrascht. »Ich wusste ja, dass ihr getrennt lebt, aber ich dachte, das sei nur ein zeitweiliger Knatsch. Dass ihr es wieder ausgebügelt hättet.«
»Ich weiß nicht«, sagte ich, obwohl ich es wusste. »Ich denke, das Ausbügeln war vielleicht der zeitweilige Knatsch.«
»Es tut mir leid«, sagte sie, und sie meinte es ehrlich.
»Themawechsel, bitte«, sagte ich.
»Wie läuft’s mit dem Schreiben?«, fragte sie. Falsches Thema.
»Bei Esquire?«, fragte ich. »Gut.«
»Schreibst du schon irgendwelche Features?«
»Nein. Ich bin immer noch der Listenverfasser.« Listen, das war bei Esquire ein großes Thema. 7 lebensnotwendige Magenübungen, 10 kleine Pflegetipps für eine große Nacht. 30 Dinge, die Sie über Ihr Geld wissen sollten. Bevor man zu den richtigen Artikeln aufsteigen durfte, musste man erst seine Zeit bei den Listen absitzen.
»Und dein Roman?«
»Hab ihn seit Monaten nicht angerührt.«
»Wo liegt das Problem?«
»Ich neige dazu, die Dinge auf die lange Bank zu schieben, aber lass uns davon irgendwann anders reden.«
»Aha.«
»Ich weiß nicht«, sagte ich, während ich einen Eiswürfel zwischen meinen Zähnen zermalmte. »Ich glaube, es ist der Protagonist. Er ist zu autobiographisch.«
»Und das heißt?«
»Ohne Motivation.«
»Armer Ben«, sagte sie mitfühlend.
»Arme Alison«, entgegnete ich.
»Arme Lindsey«, sagte Lindsey. »Dreißig Jahre alt. Kannst du dir das vorstellen?«
»Allerdings«, sagte ich. »Ich bin selbst letzten Monat dreißig geworden.«
Ihr Kiefer sackte überrascht ein wenig nach unten, und dann wandte sie sich mit einem traurigen Lächeln zu mir um und nahm meinen Kopf zwischen beide Hände. »O scheiße, Benny. Das hab ich total vergessen.« Sie beugte sich vor und gab mir einen sanften Kuss auf die Lippen. »Alles Gute zum Geburtstag, Benny.«
Der Kuss und der Spitzname ließen mich sechs Jahre zurückdenken, als Lindsey und ich noch zusammen waren. Es ist das grundlegende Prinzip der Gruppendynamik, dass kein Freundeskreis eine wirklich zusammenhängende Einheit bleiben kann, es sei denn, einige von ihnen sind auf irgendeine vertrackte Weise ineinander verliebt. Vertrackt, da sie, wenn die Sache einfach läge, als Paar verschwinden würden, was das Ende der Gruppe bedeuten würde. Da gab es Alisons unermüdliche und unerwiderte Liebe zu Jack, die vernünftigerweise als mütterliche Fürsorge kaschiert wurde, damit die Situation nicht ungemütlich wurde. Chuck war glücklich in sich selbst verliebt. Und dann war da meine Liebe zu Lindsey, die als simple Lust begonnen hatte, als wir auf dem College zunächst Freundschaft schlossen, die dann aber zu einer vollreifen, schmerzlich schönen Liebe aufblühte, die unausgesprochen blieb, bis wir das College abgeschlossen hatten. Wir wussten beide, dass sie da war, und wir wussten beide, dass wir beide es wussten. Es war so offensichtlich an der Art, wie sie mich zur Begrüßung oder zum Abschied küsste, wie sie es immer schaffte, genau meinen Mundwinkel zu treffen. Oder an der Tatsache, dass Lindsey und ich offenbar jedes Mal, wenn wir fünf gemeinsam ausgingen, nebeneinander saßen. Und ich war stets derjenige, der sie abends nach Hause brachte, obwohl Chucks Studentenbude näher lag. Und doch, trotz all dieser versteckten Hinweise, wollte keiner von uns beiden diese Liebe zu Collegezeiten wachsen lassen. Ich glaube, wir hatten Angst davor, dass wir uns gegenseitig nicht mehr haben würden, falls es mit uns nicht klappen sollte. Oder zumindest steckte diese Überlegung wohl bei ihr dahinter. Ich selbst wäre bereit gewesen, das Risiko einzugehen, wenn ich mir nicht so sicher gewesen wäre, dass sie mich sanft, aber entschieden zurückweisen würde. Ich habe es auf dem College mit den Mädchen nicht so wild getrieben wie Chuck und mit Sicherheit nicht so wild wie Jack, der bei den Mädchen gut und gern als Vorbedingung für eine Kursteilnahme hätte gelten können, ohne Witz. Aber ich arrangierte mich mit einem etwas allzu belesenen Mädchen vom Typ Clark-Kent-ohne-das-Alter-Ego, und der Grund dafür war, denke ich, dass all die Gefühle, die ich für Lindsey empfand und die in meinem Inneren leise vor sich hin köchelten, in der Zwischenzeit irgendwo anders ausgelebt werden mussten.
Am Tag nach dem College-Abschluss tanzten Lindsey und ich auf einer Party zusammen, wie üblich ein wenig enger, als es die offizielle Grenze für »nur gute Freunde« vorsieht, als sie mich fragte: »Also, Benny, was wirst du jetzt machen?«
»Ich hab dir doch erzählt, was ich vorhabe«, sagte ich. »Ich nehme mir ein paar Monate frei, um zu schreiben, und dann werde ich anfangen, mich bei ein paar Verlagen vorzustellen.«
»Nein«, sagte sie, und ihr geschmeidiger Körper hielt auf einmal völlig still, und sie wich ein Stück zurück, um mir in die Augen zu blicken. »Ich meine, was wirst du mit mir machen?«
Wir blieben zwei perfekte Jahre zusammen, Jahre, aus denen man eine Sechzig-Sekunden-Montage aus Filmausschnitten hätte machen können, mit einem Harry-Connick-Jr.-Song im Hintergrund, wie in Harry und Sally. Spaziergänge im Park, Küsse im Regen, Späße auf einem Straßenmarkt et cetera. Zwei Jahre, das war für mich lange genug, um zu glauben, dass es niemals enden würde. Aber das tat es natürlich doch, als Lindsey irgendwann Panik bekam und entschied, dass sie mit vierundzwanzig noch viel zu jung für ein sesshaftes Leben war und dass es an der Zeit war, sich auf den Weg zu machen und die Welt zu entdecken. Sie schmiss ihren Job als Grundschullehrerin und ging auf Weltreise, wobei ihr ein zwischenzeitlicher Job als Flugbegleiterin zugute kam, und ich traf schließlich Sarah wieder, die inzwischen eine Karriere, Ziele und einen etwas höher entwickelten Nestinstinkt hatte.
Lindsey zog etwa zur selben Zeit zurück nach Manhattan, zu der ich heiratete. In den nächsten paar Jahren fing sie beruflich ständig etwas Neues an, arbeitete in der Werbebranche, dann im Diamantenhandel an der Siebenundvierzigsten Straße und schließlich als Aerobiclehrerin bei Equinox. Die meiste Zeit arbeitete sie zwischen zwei Jobs für eine Zeitarbeitsfirma als Empfangsdame. Was immer sie gesucht hatte, als sie sich auf unbekannte Wege aufmachte, sie hatte es nicht gefunden, und ich hätte mich dadurch eigentlich bestätigt fühlen sollen, aber stattdessen war ich nur traurig. Ich sah sie hin und wieder, wenn wir alle gemeinsam ausgingen, aber wir kamen nie unter vier Augen zusammen. Lindsey hätte es niemals vorgeschlagen, da ich schließlich verheiratet war, und ich hatte Angst davor, mit ihr allein zu sein, denn dann hätte es sich noch schwerer leugnen lassen, dass ich die Falsche geheiratet hatte. Also trafen wir uns im Schutz unserer kleinen Gruppe, blieben sporadisch in Kontakt und versuchten, die Tragik nicht zu erkennen, die darin lag, dass wir zu flüchtigen Bekannten geworden waren.
»Ben?«, holte mich Lindsey in die Gegenwart zurück.
»Ja?«
»Du weinst ja.«
»Ich bin bloß betrunken«, sagte ich.
Sie legte den Kopf an meine Schulter und schlang die Hände um meinen Arm. »Armer Ben.«
2
Am nächsten Tag rief mich Alison im Büro an.
»Hi, Ben, ist die Zeit okay für einen Anruf?« Alison war Anwältin, und vermutlich eine verdammt gute, auch wenn sie sich wohlweislich dagegen entschieden hatte, Prozessanwältin zu werden. Dazu hat sie eine zu friedliche Natur. Trotzdem, in etwa fünf Jahren würde sie sich bei Davis Polk um eine Aufnahme als Partner bewerben können, daher war es schon ziemlich nett von ihr, mich – einen Artikelredakteur und leitenden Listenverfasser bei Esquire – zu fragen, ob die Zeit okay für einen Anruf sei. Wann immer ich mich in erstklassigem Selbstmitleid ergehen wollte, erinnerte ich mich schmerzlich daran, wie aufgeregt ich war, als ich bei Esquire eingestellt wurde. Wie ich an meinem ersten Arbeitstag in meiner erbärmlichen kleinen Kabine Platz nahm, mit dem uneingeschränkten Blick auf die Wand, die Beine auf das Resopalbrett legte, das zwischen den beiden Seitenwänden aufgehängt war und mir als Schreibtisch diente, und mich lächelnd darüber freute, dass ich das große Los gezogen hatte. Ich war so sicher, dass es nur eine Frage von Monaten sein würde, bis ich die Leute mit meinen Schreibkünsten vom Hocker reißen und von meinem Korrekturlesen und Themensammeln zu erhabeneren Schreibaufträgen aufsteigen würde. Vielleicht würde ich sie sogar bewegen können, eine meiner Kurzgeschichten zu veröffentlichen. Und wenn ich mit meinem Roman fertig war, würde es ein Kinderspiel für mich sein, aufgrund meines gediegenen Prestiges als Esquire-Journalist das Interesse eines Agenten und größerer Verlage zu wecken. Selbst nachdem ich erfahren hatte, dass die meisten ernst zu nehmenden Artikel gar nicht von Angestellten, sondern von freien Mitarbeitern verfasst wurden, blieb ich zuversichtlich, dass meine Talente irgendwann doch Anerkennung finden würden.
Es dauerte ein paar Jahre, bis ich begriff, dass mit mir gar nichts passierte. Ein solches Nichts passiert niemals auf einen Schlag. Es fängt langsam an, so langsam, dass man es gar nicht bemerkt. Und dann, wenn man es irgendwann doch bemerkt, verdrängt man es in die hintersten Gehirnwindungen, in einer Wolke voller nüchterner Erklärungen und Entschlüsse. Man hat viel zu tun, man stürzt sich in bedeutungslose Arbeit, und eine Zeit lang hält man das Bewusstsein des Nichts in Schach. Aber dann passiert irgendetwas, und man ist gezwungen, der Tatsache ins Auge zu blicken, dass einem in genau diesem Augenblick das Nichts passiert, und das schon seit geraumer Zeit.
Bei mir passierte es mit einer Shortstory. Ich sollte die Geschichte über einen Mann Korrektur lesen, der mit seinem jüngeren Bruder durch Florida fuhr, unterwegs zur Beerdigung ihres Vaters, den sie kaum noch kannten. In der Nähe einer Alligatorfarm haben sie eine Autopanne, und während sie dasitzen und zusehen, wie die Einheimischen mit den Alligatoren kämpfen und sie zusammentreiben, sprechen sie über die Zerrüttung der Familie und die Dämonen, die den Vater dazu getrieben hatten, sie zu verlassen. Der belletristische Redakteur bei Esquire, Bob Stanwyck, im Büro durchweg als »Wyck« bekannt, hatte eine Schwäche für Erzählungen, die zarte Nuancen eines Reiseberichts besaßen, aber kaum, falls überhaupt, eine Auflösung am Ende, und diese Kurzgeschichte war absolut typisch für ihn. Sie machte auch begreiflich, weshalb er meine eigenen Shortstorys durchweg über den bürointernen Postdienst an mich zurücksandte, mit höflichen abschlägigen Bemerkungen, die er auf gelbe Post-its kritzelte.
Nachdem ich mit der Erzählung fertig war, warf ich einen beiläufigen Blick auf die Biographie des Autors und stellte verblüfft fest, dass er sechsundzwanzig Jahre alt und diese Geschichte bereits die dritte war, die er veröffentlichte. Ich war damals achtundzwanzig, und das Einzige, was ich als Erfolg meiner Bemühungen vorweisen konnte, war … Nichts. Auf einmal kamen mir die grauen, abgewetzten, stoffüberzogenen Wände meiner Kabine lächerlich klein vor, und die Styropordecke mit den winzigen braunen Kratern erschien mir noch niedriger als zuvor. Das war der Tag, an dem ich begriff, dass ich meinen Job hasste. Und es sollte noch ein paar Monate dauern, bis mir noch etwas klar wurde: Etwas zu begreifen und etwas daran zu ändern, das sind zwei völlig verschiedene Dinge.
Als Alison anrief, saß ich in meiner Kabine und dachte über die metaphorische Bedeutung von Star-Wars-Filmpuppen nach – für einen Artikel, der niemals erscheinen würde. Ich dachte über die Anordnung der Filmpuppen nach, die dekorativ oben auf meinen Aktenschränken saßen, und spielte mit dem Gedanken, ihnen einen neuen Luke Skywalker mit Yoda auf dem Rücken hinzuzufügen (Gott sei Dank gibt es Büros, den letzten Spielplatz des Erwachsenen, der nicht erwachsen werden will). Ich war neun Jahre alt, als Star Wars in die Kinos kam, und wie so viele meiner Altersgenossen habe ich diese Phase nie wirklich hinter mir gelassen. Und als nun, zweiundzwanzig Jahre später, Die dunkle Bedrohung in die Kinos kam und man aus diesem Anlass eine Reihe neu entworfener Filmpuppen aus der ursprünglichen Trilogie auf den Markt brachte, hatte ich einen starken posthypnotischen Drang verspürt, sie zu kaufen.
Ich habe den Eindruck, dass sich die Filmpuppen in diesen zwanzig Jahren stark verändert haben. Die Farben sind kräftiger, die Puppen sind detailgenauer gearbeitet, und in mancherlei Hinsicht ähneln sie tatsächlich den Schauspielern, die sie verkörpern. Sie haben bessere Accessoires, sie sind etwas größer, und sie sind anatomisch genauer. Echte Menschen hingegen scheinen, wenn sie älter werden, an Farbe und Detail zu verlieren, und wenn sie die Lebensmitte überschritten haben, fangen sie manchmal sogar an, zu schrumpfen. Luke, Han, Leia und sogar Obi-Wan scheinen etwas anmutiger zu altern als der Rest von uns. Dreißig … scheiße.
Ich sagte Alison, dass die Zeit okay für einen Anruf sei.
»Es ist wegen Jack«, sagte sie. Sie klang nervös. »Ich glaube, er steckt wirklich in der Klemme.«
»Darüber habe ich auch schon nachgedacht«, sagte ich.
»Er ist süchtig, Ben. Er braucht Hilfe.«
»Hast du mit ihm darüber gesprochen?«
»Du hast doch gesehen, in welchem Zustand er war«, sagte Alison. »Kaum waren wir wieder im Hotel, hat er sich aufs Bett fallen lassen und ist sofort eingeschlafen. Ich hab sein Rasierzeug durchsucht, hab zwei Beutel Koks gefunden und sie in die Toilette gespült. Er war so wütend, als er aufwachte, Ben. Er war ein völlig anderer Mensch. Er hat das Zimmer auseinandergenommen, um irgendwo noch Drogen zu finden, und hat mich wüst beschimpft. Er sagte, ich …«
An dieser Stelle versagte ihre Stimme. Die süße Alison, die nie ein böses Wort zu jemandem sprach, die Jack fast ein Jahrzehnt lang selbstlos geliebt hatte, hatte sich von ihm wüst beschimpfen lassen müssen, während er aus seinem Rausch zu sich kam.
»Du weißt doch, dass er nichts von alledem wirklich gemeint hat«, sagte ich zu ihr. »Das sind die Drogen, die dann das Reden übernehmen.«
»Und dann kam Seward rein«, fuhr sie fort, verzweifelt bemüht, ihrer Stimme nichts anmerken zu lassen. Paul Seward war Jacks Agent und ein absoluter Kontrollfreak. Wenn man seinen Worten Glauben schenkte, dann hatte er Jack gezeugt, entbunden und einhändig zum Star aufgepäppelt. »Er hat mich praktisch vor die Tür gesetzt, hat gesagt, ich soll unten in der Lobby warten, und er würde Jack schon den Kopf zurechtrücken.«
»Und was ist dann passiert?«
»Ich hab eine Stunde unten gewartet und bin dann noch einmal auf sein Zimmer gegangen. Es war niemand da. Paul muss ihn durch einen anderen Ausgang weggebracht haben.«
»Dieser Dreckskerl.«
»Ja. Das ist er allerdings.«
»Sind sie zurück nach L. A. gefahren?«
»Ich nehm’s an.«
Sie schien auf irgendeinen Vorschlag von mir zu warten, aber mein Kopf war völlig leer. Ich nahm R2-D2 in die Hand und begann geistesabwesend, seinen kuppelförmigen Kopf hin- und her zudrehen, eine alte Angewohnheit von mir. Das klickende Geräusch, das die Sperrklinken verursachten, während der Kopf des Droiden hin- und herschwenkte, beruhigte mich. »Ich bin mir nicht sicher, was wir deiner Ansicht nach jetzt unternehmen sollten«, sagte ich.
»Ich weiß es auch nicht«, sagte Alison, und ich hörte die Erschöpfung in ihrer Stimme. »Aber ich weiß, dass dieser Agent gar nichts für ihn tun wird. Jack ist schließlich sein Goldesel.«
»Vielleicht könnten wir mit Paul reden und versuchen, ihm das ganze Problem klarzumachen«, sagte ich. »Jack bringt ihm im Augenblick vielleicht noch eine hübsche Stange Geld ein, aber wenn er in dem Tempo weitermacht, könnte er im Grunde jederzeit abstürzen. Wenn er ihn vorübergehend aus dem Verkehr zieht, damit er wieder clean wird, investiert er in eine längere Zukunft.« Noch während ich sprach, merkte ich schon, dass dieser Ansatz ein Trugschluss war. Hollywood war kein Ort, an dem man in die Zukunft eines Menschen investierte. Jack war hier und jetzt ein Star, und als sein Agent musste man das Eisen schmieden, solange es heiß war. Bis nächstes Jahr, wenn Jacks Karriere womöglich den Bach runterging, würde Seward ein hübsches Sümmchen beiseitegeschafft haben, von dem er leben konnte, während er sich seinen nächsten Goldesel suchte.
»Wir sind seine Freunde, Ben.«
»Ich weiß.«
»All seine Freunde dort draußen benutzen ihn für irgendwas, verstehst du? Wir sind seine einzigen wirklichen Freunde.«
»Was sollen wir jetzt also tun?«, fragte ich.
»Ich denke, wir sollten es vielleicht mit einer Intervention versuchen«, sagte Alison.
Eine Intervention. Die Überraschungsparty des Millenniums. Lege Ort und Zeit fest, lade den Ehrengast ein, und lass all seine Freunde mit leichten Erfrischungen und beharrlicher Liebe auf ihn warten. Überraschung! Du hast Mist gebaut, und wir alle wissen es.
»Glaubst du, Jack würde sich auf eine solche Geschichte wirklich einlassen?«, fragte ich, während ich R2 zurück an seinen Platz neben C-3PO stellte, seinen goldenen Gefährten.
»Ich weiß nicht«, räumte sie ein. »Aber irgendetwas müssen wir versuchen. Ich würde es mir selbst nie verzeihen, wenn wir jetzt tatenlos zusehen und dann irgendetwas Schlimmes passiert.«
»Eine Intervention, hm? Sollten wir nicht lieber einen professionellen Drogenberater zu Rate ziehen?«
»Vermutlich schon«, sagte Alison. »Aber jede noch so geringe Chance, dass Jack auf uns anspricht, wird sofort verpuffen, wenn er sieht, dass wir einen Außenstehenden einbezogen haben.«
»Da hast du vermutlich recht.«
»Was? Was meinst du?«
»Es klingt einfach so … dramatisch. Wie ein fürs Fernsehen gemachter Kinofilm mit einem ehemaligen Sitcom-Schauspieler als Hauptdarsteller oder einem dieser Beverly Hills-90210-Mädchen.«
»Wenn man für einen Filmstar nicht dramatisch werden kann«, sagte Alison, »für wen denn dann?«
Ich musste zugeben, dass sie da in gewisser Weise recht hatte.
»Dieser Bursche geht also mit drei Frauen gleichzeitig, okay?«, sagte Chuck. »Und er weiß, dass er sich für eine von ihnen entscheiden muss, aber er ist sich nicht sicher, für welche.«
»Warum klingen deine Witze eigentlich immer autobiographisch?«, fragte ich.
»Weil sein Leben eine einzige Pointe ist«, sagte Lindsey.
Wir hielten eine Telefonkonferenz ab, von Alison arrangiert, um zu besprechen, wie genau sich eine freundliche Intervention im Fall Jack durchführen ließ. Chuck, Alison und ich waren noch bei der Arbeit und Lindsey in ihrer Wohnung. Alison musste uns für eine Minute in die Warteschleife schalten, um einen anderen Anruf entgegenzunehmen, was Chuck die Gelegenheit gab, uns mit seinem nächsten Witz zu beglücken.
»Ihr seid ja beide bloß eifersüchtig«, sagte Chuck. »Jedenfalls, er beschließt, jeder von ihnen zehntausend Dollar zu geben, und sich je nachdem, wie sie das Geld ausgeben, zu entscheiden.«
»Perfekt«, sagte Lindsey.
»Die erste Frau kommt also zurück und hat das Geld ausgegeben, um ihm ein neues Motorrad zu kaufen. Die zweite Frau sagt: ›Ich kann so viel Geld von dir nicht annehmen, ich nehm bloß fünf Riesen, denn mehr muss ich für die Kreuzfahrt, die wir zusammen machen wollten, nicht bezahlen.‹ So weit alles klar?«
»Und wie«, sagte ich.
»Die dritte Frau nimmt die zehn Riesen und investiert sie in eine Neuemission irgendwelcher hochdynamischer Internet-Aktien. Ein paar Wochen später hat sie achtzig Riesen, die sie mit ihm teilt, vierzig für jeden. Also.« Chuck hielt einen Augenblick inne. »Und wen wird er jetzt heiraten?«
»Ich geb’s auf«, sagte Lindsey sofort.
»Ich auch«, sagte ich.
»Die mit den größten Titten«, verkündete Chuck triumphierend.
»O mein Gott«, stöhnte Lindsey.
»Ich wusste, es stinkt nach Autobiographie«, sagte ich.
Dann klickte es in der Leitung, und wir alle hörten Alisons Stimme. »Ich bin wieder da.«
»Und besser als vorher, hey la hey la«, sang Chuck.
»Okay«, sagte Alison. »Ich hab mit euch allen mehr oder weniger das gleiche Gespräch geführt hinsichtlich einer Intervention für Jack. Wir sind uns alle einig, dass das im Augenblick die beste Verfahrensweise zu sein scheint.«
»Die beste Verfahrensweise?«, sagte Chuck. »Es ist die einzige.«
»Und damit ist sie die beste«, fauchte Alison ihn an.
»Okay«, schaltete ich mich ein. Chuck und Alison hatten die Angewohnheit, ständig über Kreuz zu kommen. Das war schon immer so gewesen, schon damals auf dem College. Chucks forsche und oft ungehobelte Art vertrug sich nicht mit Alisons stillem, feinsinnigem Wesen. Er betrachtete ihre stillschweigende Missbilligung seines oftmals unangebrachten Benehmens als Herausforderung, die ihn zu noch stärkeren Extremen anstachelte, was ihr wiederum das Gefühl gab, jede pöbelhafte Bemerkung sei ein persönlicher Angriff gegen sie. Sobald sie sich erst einmal in den Haaren lagen, konnte sie nichts mehr auseinanderbringen, daher hatten wir anderen im Lauf der Zeit gelernt, sie zu unterbrechen, sobald sich eine Meinungsverschiedenheit auch nur anbahnte. »Also, wie wollen wir diese Sache jetzt anpacken?«, fragte ich.
Alison erzählte uns, dass Jack sie ein paar Tage nach dem Zwischenfall im Torre’s angerufen hatte, um sich zu entschuldigen, und ihr gesagt hatte, er würde Dienstag in einer Woche für eine Premiere nach New York kommen und möchte sie gern zum Abendessen einladen. »Ich werde ihm sagen, er soll mich in meiner Wohnung abholen«, überlegte sie.
»Und dort werden wir alle warten«, sagte Lindsey.
»Ja«, sagte Alison.
»Er wird stocksauer sein«, sagte Lindsey.
»Lass ihn stocksauer sein«, warf ich ein.
»Er wird sich schämen«, sagte Lindsey. »Es klingt irgendwie grausam. Als ob wir uns alle gegen ihn verschwören.«
»Er muss erfahren, dass wir es aus Sorge um ihn tun. Aus Liebe«, sagte Alison.
»Lindsey hat recht«, sagte Chuck. »Vielleicht sollten wir nicht alle dort sein. Das könnte vielleicht ein bisschen zu viel für ihn sein.«
»Wenn du nicht mitkommen willst …«, begann Alison.
»Das habe ich nicht gesagt«, brauste Chuck auf. »Aber ihr habt doch keine Ahnung, womit ihr es da überhaupt zu tun habt, also lasst mich euch wenigstens eine Vorstellung davon geben. Kokain ruiniert das endokrine System. Es löst im Gehirn eine Hypersekretion an Norepinephrin aus, was beim Abhängigen oft zu Halluzinationen und Psychosen führt, von denen die häufigste extreme Paranoia ist. Das ist ein typisches Symptom. Lindsey hat recht, es besteht durchaus die Gefahr, dass er unsere Absichten völlig falsch versteht.«
»Entschuldige, Chuck«, sagte Alison. »Ich hab’s nicht so gemeint.«
»Wie auch immer.«
»Hört zu«, sagte Lindsey. »Wir haben noch ein paar Tage Zeit, um zu überlegen, ob es noch eine bessere Möglichkeit gibt. Im Augenblick, denke ich, sollten wir uns darauf einigen, dass wir alle für ihn da sein werden.« Wir stimmten unter leisem Gemurmel zu. »Aber ich glaube, wir sollten uns alle über den Ernst dieser Aktion im Klaren sein«, fuhr Lindsey fort.
»Was meinst du damit?«, fragte ich.
»Wir könnten ihn verlieren«, sagte sie leise. »Wenn er richtig wütend wird oder schon so weit hinüber ist, dass er sich mit uns nicht mehr auseinandersetzen kann, wird er einfach aus dem Zimmer davonstürmen, und das könnte dann das Letzte sein, was wir von ihm sehen.« Sie sagte »wir«, aber wir alle wussten, dass sie im Grunde zu Alison sprach. »Was ich sagen will, ist: Ich glaube nicht, dass das eine von diesen Geschichten ist, die entweder klappen oder nicht, und dass wir alle, ganz gleich, wie die Sache ausgeht, einen Monat später wieder seine Freunde sind. Die Geschichte wird Konsequenzen haben.«
»Da stimme ich Lindsey zu«, sagte Chuck.
Alison atmete einmal tief aus. »Hört zu. Was mich betrifft, so denke ich, er ist auf bestem Wege, sich selbst zugrunde zu richten. Wir können nicht tatenlos hier herumsitzen, nur weil wir Angst haben, seine Freundschaft zu verlieren. Was haben wir denn davon, seine Freunde zu bleiben, wenn er in einem halben Jahr tot ist?«
»Könnte es wirklich so ernst sein, Chuck?«, fragte ich.
»Es ist eine sehr eigenwillige Droge«, sagte Chuck. »Sie wirkt bei jedem anders, und ich weiß ja nicht einmal, wie lange er sie schon nimmt. Er könnte noch ein Jahr durchhalten, es könnte aber auch sein, dass er schon ein Ödem im Gehirn hat, das blutet. Dann könnte er schon morgen an einer Gehirnblutung sterben.«
Das ließ uns alle für einen Moment verstummen, und das Einzige, was man hörte, war das statische Knistern von Bell Atlantic. Irgendjemand begann, nervös mit einem Bleistift auf den Schreibtisch zu klopfen. An der Universität von New York hatten wir alle hin und wieder Gras geraucht, das wir in Zwanzig- und Fünfzig-Dollar-Päckchen von den Rasta-Typen erstanden, die durch den Washington Square Park stromerten, aber mit jeglichen härteren Sachen fehlte uns jegliche Erfahrung. Nancy Reagan hatte uns eingebläut: »Sagt einfach nein«, und wir hatten gelernt, Drogen instinktiv zu verabscheuen, aber das hieß nicht, dass wir die Gefahren wirklich kannten. Als Chuck uns die Auswirkungen der Droge in konkreten medizinischen Fachbegriffen schilderte und auch eine mögliche Todesfolge erwähnte, wurde sie auf einmal zu einer weitaus realeren und bedrohlicheren Gefahr. Ich musste an diesen einen Werbespot denken, den es vor ein paar Jahren gab – den mit dem Ei und der Bratpfanne. Das hier ist dein Gehirn, und das hier ist dein Gehirn unter Drogeneinfluss. Noch irgendwelche Fragen?
»Wir sind seine Freunde«, sagte Alison schließlich. »Wir müssen tun, was wir für das Beste halten, ganz gleich, wie unangenehm es sein könnte.« Sie klang, als versuchte sie, nicht nur uns, sondern auch sich selbst zu überzeugen.
»Dann werden wir’s eben tun«, sagte ich. »Sind wir uns alle einig?«
Wir waren es.
An jenem Tag gab ich auf dem Nachhauseweg von der Arbeit allen Ernstes fünfundsechzig Dollar für eine lebensgroße Darth-Vader-Maske aus, eine von diesen Masken, die man sich ganz über den Kopf ziehen kann. Es gab keinen vernünftigen Grund, sie zu kaufen. Ich sah sie im Schaufenster des Star Magic Shop, und ich ging einfach hinein und kaufte sie. Sie hatte diesen herrlichen Geruch von neuem Plastik, den Geruch von Kindheit. Als Luke Skywalker in Die Rückkehr der Jedi-Ritter Darth Vader die Maske herunterriss, hatte ich das Gefühl, als hätte man mir irgendetwas unwiederbringlich weggenommen. Zuzulassen, dass Vader der dunklen Seite der Macht abschwor, das würde seine böse Gegenwart in den ersten beiden Filmen für immer beeinträchtigen. Star Wars und Das Imperium schlägt zurück würden für mich niemals wieder das sein, was sie einmal waren – wie auch zwischen mir und dem Jungen, der ich einmal gewesen war, eine weitere Verbindung gekappt worden war.
Im Laufe der Jahre hatte Vader jedoch den Sturm überstanden und es geschafft, sich als prominenteste Ikone aus der Trilogie einen Namen zu machen, und auch wenn ich aus dieser Tatsache einen gewissen Trost schöpfte, nahm sie mir doch nichts von meiner Verlegenheit, die ich wegen meines Kaufs empfand, als ich dem jungen Mädchen an der Kasse meine American-Express-Karte reichte. Ich ging nach Hause, die Maske in einer Tüte, fühlte mich beschämt, schwermütig und auf eine seltsame Weise aufsässig. Als ich in meine Wohnung kam, nahm ich die Maske aus der Tüte und legte sie auf den Küchentisch, und eine Zeit lang starrten wir uns einfach an, als könnte sich keiner von uns beiden so recht vorstellen, was der andere hier eigentlich machte.
3
Dreißig … scheiße!
Das war mein stilles Mantra in den Wochen vor und nach meinem dreißigsten Geburtstag. Soweit ich wusste, hatte man dem Tag keine Stunden und dem Jahr keine Tage genommen, und doch hatte sich dieser Meilenstein an mich herangeschlichen wie eine gewaltige, stille Welle, die sich hinter einem aufbaut, während man der Küste zugewandt ist. Er war bei weitem zu schnell gekommen. An manchen Tagen hatte ich das Gefühl, als würde ich noch immer denken wie ein Neunzehnjähriger, und nun war ich auf einmal doch schon ein Jahrzehnt älter.
Star Wars war über zwanzig Jahre her. Ich kann mich noch erinnern, wie ich den Film sah, als er in die Kinos kam. Ich bin viermal in die Vorstellung gegangen. 1977 gehörten Videorekorder noch nicht zum allgemein üblichen Standard, und man wusste nie, wann man wieder die Gelegenheit haben würde, einen bestimmten Film zu sehen. Man musste den Film verinnerlichen, so dass man ihn einfach mitnehmen konnte.
Dreißig … scheiße! Es war wie eine dieser sinnlosen Listen, die ich für den Esquire verfasste. Mick Jagger, Roger Daltry und die Beatles sind alle schon über fünfzig. Billy Joel und Elton John sind auch nicht mehr weit davon entfernt, ebenso Harrison Ford und Sylvester Stallone. Gary Coleman und die ganzen Bradys sind erwachsene Männer. Magic und Bird haben sich zurückgezogen, Jordan hat sich schon zweimal zurückgezogen, und Shaquille O’Neal ist sechs Jahre jünger als ich. Ich habe vor acht Jahren das College abgeschlossen. Meine Eltern sind in den Sechzigern, dem Alter, das ich immer mit Großeltern in Verbindung brachte, nicht mit Eltern. Inzwischen kann es mir jeden Tag passieren, dass ich zu einem Arzt gehe und feststellen muss, dass er jünger ist als ich.
Wäre ich ein Athlet, dann hätte ich meine beste Zeit jetzt hinter mir. Wäre ich ein Hund, dann wäre ich jetzt schon tot.
Dreißig … scheiße!
Es ist eine hübsche runde Zahl, wenn man alles unter Dach und Fach hat. Erfolg, Liebe, eine Familie, das grundsätzliche Gefühl, dass man tatsächlich auf diesen Planeten gehört. Wenn man das alles hat, dann stehen einem die Dreißig gut. Aber wenn man es nicht hat, dann fühlt man sich, als hätte man eine Frist versäumt, und auf einmal nehmen die Chancen, es je richtig zu deichseln, je wirklich Glück und Erfüllung zu finden, rapide ab. Man begreift, dass all die Hoffnungen und Träume bis zu diesem Zeitpunkt in Wirklichkeit Erwartungen waren, die nun, noch immer unerfüllt, verzweifelte Stoßgebete an einen Gott geworden sind, an den man, da war man sich doch sicher, gar nicht mehr glaubte. Bitte, gib mir ein unbeschwertes Herz und ein hübsches Mädchen an die Hand, oder wie auch immer dieses Lied geht. Ist das zu viel verlangt?
Dreißig … scheiße!
Alt genug, um auf einmal schon die Vierzig zu erkennen, den Prozac-Geburtstag, der im Rückspiegel am Horizont schimmert, ein metallischer, glitzernder Fleck, der beständig größer wird. Alt genug, um allmählich die kleinen, fast unmerklichen Spuren des Alterns bei seinen Freunden und im eigenen Spiegel zu erkennen. Alt genug, zweifellos, um einen kokainsüchtigen Freund zu haben und zu begreifen, dass vielleicht doch nicht alles ein gutes Ende nehmen wird.
Dreißig ……………………………………………………………….. …………………………………………………………….. scheiße!
Alison lebte an der Central Park West, fünf Blocks Richtung Innenstadt und drei Blocks östlich von meiner Wohnung, aber es hätte auch eine andere Welt sein können. Ich lebte in einem Mietshaus an der Zweiundneunzigsten Straße, zwischen West End und Riverside, tagsüber eine recht nette Gegend, aber nachts wurde sie ein verruchter Drogen-Umschlagplatz mit Dealern und pockennarbigen, ausgemergelten Junkies, die auf den Bürgersteigen und in Hauseingängen heimlich ihre Geschäfte abwickelten. Wenn ich nachts mit einem beklommenen Gefühl diesen Spießrutenlauf von oder zu meiner Wohnung antrat, kam ich mir vor wie ein auffälliger Eindringling und betete nicht um Glück und Erfüllung, sondern lediglich darum, in Ruhe gelassen zu werden.
Drüben an der Central Park West gab es nichts dergleichen. Die Vorstände der genossenschaftlichen Wohnungsbaugesellschaften würden es nicht zulassen. Bei jedem Gebäude gab es in der Lobby mindestens zwei Portiers, die dafür sorgten, dass die Nachbarschaft friedlich und die Bürgersteige frei von den Großstadtstrolchen blieben, die sich von meiner Nachbarschaft angezogen fühlten. Zu Alisons Nachbarn zählten Mia Farrow, Diane Keaton, Tony Randall, Carly Simon, Madonna und unzählige andere Prominente, die man oft zwischen den überdachten Hauseingängen und den Taxis entdecken konnte, die ihnen uniformierte Portiers mit silbernen kleinen Pfeifen herbeiriefen. In Alisons Aufzug gab es sogar einen Knopf mit einem kleinen eingravierten Auto, mit dem man den Portier wissen lassen konnte, dass man ein Taxi haben wollte, so dass er einem – je nachdem, wie weit oben man wohnte – bereits eines herbeigewinkt hatte, wenn man unten ankam. Wenn man im Penthouse wohnte, wartete vielleicht schon ein Taxi, bis man unten war, wogegen sich nichts sagen ließ. Um von meiner Wohnung aus ein Taxi zu bekommen, musste man hinüber bis zur West End laufen und sich selbst eines herbeiwinken, aber viel häufiger kam es vor, dass man einfach bis zum Broadway ging und die U-Bahn nahm.
Alisons Zuhause war eine geräumige Dreizimmerwohnung mit abgetrenntem Esszimmer und einer Wohnküche, zwei großen Bädern und Blick auf den Central Park. Es war ein Geschenk ihrer Eltern gewesen, also musste sie sich nicht einmal um die Miete Sorgen machen. Nicht dass sie Sorgen gehabt hätte, bei ihrem sechsstelligen Gehalt und ihrem Trustfonds-Portfolio. Die Reichen werden wirklich nur noch reicher. Ihre Wohnungseinrichtung war spärlich, aber geschmackvoll, auch wenn ich mir sicher bin, dass das jadegrüne, L-förmige Ledersofa im Wohnzimmer vermutlich mehr gekostet hat als sämtliche Einrichtungsgegenstände in meiner Wohnung zusammen, Stereoanlage und Videorekorder eingeschlossen.
Als ich in der Wohnung ankam, saßen Lindsey und Alison bereits auf besagtem Sofa unter einem gerahmten Magritte und tranken Apricot Sour. Lindsey war zwanglos gekleidet – in einer schwarzen Banana-Republic-Jeans und einer ärmellosen Körperweste stellte sie noch immer eine allmählich schwindende sommerliche Bräune zur Schau –, während Alison einen kurzen Karorock und ein weißes T-Shirt trug. Das Haar hatte sie zu einem lockeren Pferdeschwanz zusammengebunden. Beide Frauen waren schön, dachte ich, aber wie Tag und Nacht. Lindsey war sexy, aber einschüchternd, während Alison einladend, aber verletzlich war.
»Wir haben eben festgestellt«, sagte Lindsey, »dass unsere Generation die erste ist, für die die Popkultur das einzige Bezugssystem ist. Jede Erfahrung nehmen wir durch die Linsen der Popkultur auf. Wir sind zu einem solchen Ausmaß damit aufgewachsen, dass es das Einzige ist, auf das wir uns stützen können.«
»Nenn mir ein Beispiel«, sagte ich, während ich mich zu ihr auf die Couch setzte und dem Impuls widerstand, sie zu küssen. Ich gab mich damit zufrieden, ihr Parfum einzuatmen, während ich mir bei Alison Rum und Soda bestellte. Ich hatte Lindsey in den letzten beiden Jahren nur ein paar Mal gesehen, so dass ich noch immer bei jedem Wiedersehen ein bittersüßes Flattern in der Brust verspürte. Das Verhältnis von Bitterkeit und Süße schwankte je nachdem, in welcher Stimmung ich mich in dem betreffenden Augenblick befand, aber es war nicht verwunderlich, dass die Bitterkeit in letzter Zeit etwas stärker geworden war.
»Ich weiß, was sie meint«, sagte Alison, während sie sich erhob, um mir an ihrer Bar einen Drink zu mixen. »Zum Beispiel, dass wir Leute beschreiben, indem wir sie mit Filmstars vergleichen. Unsere Eltern hätten niemals irgendjemanden mit einem Filmstar verglichen, es sei denn, es hätte eine wirklich verblüffende Ähnlichkeit bestanden. Filmstars gehörten nicht zum Alltag, und es gab noch nicht annähernd so viele.«
»Außerdem wussten damals noch nicht unbedingt alle, wie jeder Star aussah«, fügte Lindsey hinzu. »Aber heutzutage, dank der von den Medien geschürten Gier nach Prominententratsch, sind wir uns sicher, dass jeder, dem wir jemanden auf diese Art beschreiben, es begreifen wird. Wir könnten sagen, jemand ist extrem groß und muskulös, aber wir können genauso gut sagen, er sieht aus wie ein Schwarzenegger. Die Eigennamen bestimmter Leute werden zu normalen, beschreibenden Substantiven, die allgemein anerkannt werden. Unsere Sprache entwickelt sich parallel zu unserem Bezugssystem. Sie wird weniger deskriptiv und stärker visuell. Wir beschreiben nicht mehr mit Worten. Wir beschreiben, indem wir ein vergleichbares Bild heranziehen.«
»Das ist interessant«, sagte ich. »Aber das beschränkt sich nicht ausschließlich auf Bilder. Wir können andere Leute auch anhand der Musik oder der Filme, die sie mögen, beschreiben, oder anhand der Bücher und Zeitschriften, die sie lesen.«
»Stimmt«, sagte Alison und reichte mir meinen Drink, bevor sie sich am anderen Ende der Couch zusammenrollte. »Wenn du mir von einem Typen erzählst, der die Zeitschrift Soldies of Fortune liest und die Musik von Van Halen oder Anthrax hört, dann fange ich an, mir im Geist eine Vorstellung von ihm zu machen und mir eine Meinung über ihn zu bilden, und dann weiß ich schon genug, um zu wissen, dass ich ihn nicht mögen würde.«
»Chuck liebt Van Halen«, bemerkte Lindsey.
»Ich weiß«, sagte Alison in genau dem richtigen Tonfall, dass wir anderen losprusteten.
Chuck kam ein paar Minuten später, noch immer in seinem OP-Anzug, obwohl ich mir sicher war, dass er genug Zeit hatte, um sich umzuziehen. Es war bloße Eitelkeit, aber nachdem er sieben Jahre Medizin studiert hatte, war es, denke ich, sein gutes Recht. Er warf einen Blick auf unsere leeren Gläser auf dem Couchtisch und sagte: »Gehört es zum guten Ton, sich vor einer Intervention volllaufen zu lassen?«
»Auf jeden Fall«, sagte Alison.
»Vor allem, wenn es eine Intervention für dich selbst ist«, sagte Lindsey.
»Möchtest du was trinken, Chuck?«, fragte ich.
»Na ja«, sagte Chuck, »ich denke, nur für den Fall, dass Jack total high hier aufkreuzt, sollten wir dafür sorgen, dass auf dem Spielfeld in etwa Gleichstand herrscht.«
Nachdem ich Chuck einen Screwdriver gemixt hatte, verkündete Alison, dass es an der Zeit sei, die Strategie zu besprechen. Sie wollte, dass wir alle an der Tür warteten, wenn sie Jack hereinließ, aber ich fand, dass wir Jack auf diese Weise vielleicht gar nicht erst in die Wohnung bekommen würden. Lindsey schlug vor, Alison sollte Jack in die Wohnung lassen und ihm dann sagen, dass wir alle im Wohnzimmer warteten und mit ihm reden wollten, aber Chuck war der Ansicht, das würde ihm einen zu großen Vorteil verschaffen. »Ich weiß, es klingt seltsam«, sagte er, »aber wir müssen ihn wirklich überrumpeln.« Letztendlich entschieden wir uns dafür, dass Alison die Tür allein aufmachen und Jack ins Wohnzimmer bringen sollte, wo wir dann alle warten würden.
Alison stand auf, um sich noch einen Drink zu mixen. Chuck zündete sich eine Zigarette an, und als Alison ihn nicht anschnauzte, er solle sie gefälligst ausmachen, wusste ich, dass sie äußerst erregt war.
»Wir sind alle nervös«, sagte ich leise, während ich von hinten zu ihr an die Bar trat. »Es wird schon klappen.«
»Nervös war ich vor etwa einer Stunde«, sagte sie. »Inzwischen schwanke ich zwischen blankem Entsetzen und dem Gedanken, ob wir die ganze Sache nicht abblasen sollten.«
In genau diesem Augenblick ertönte zweimal der Türsummer. Das Signal von Oscar, dem Portier. Wir sahen uns alle an und kamen uns auf einmal ein bisschen lächerlich und völlig verunsichert vor. Selbst Lindsey, die sich im Allgemeinen durch nichts aus der Ruhe bringen lässt, blickte etwas unbehaglich drein. Eine Minute später klingelte es an der Wohnungstür.
»Showtime«, flüsterte Chuck und ließ sich auf die Couch plumpsen.
Wir hörten, wie Alison die Tür aufmachte und Jacks Stimme ins Wohnzimmer drang. Wir drei auf der Couch sahen uns an. Schuldgefühle und Beklommenheit standen uns ins Gesicht geschrieben, eine offenkundige Manifestation, die die Luft in Alisons Wohnzimmer verdichtete. Jack war unser Freund, und wir hatten uns gegen ihn verschworen und versteckten uns nun vor ihm. Als sich Alisons und Jacks Schritte dem Wohnzimmer näherten, spürte ich sogar ein Zittern in der Magengegend, als hätte ich auf Samt gegen den Strich gerieben.
Und dann war er plötzlich da. Mit seinen Jeans und dem marineblauen Sakko über einem weißen Oxford-Hemd sah Jack von Kopf bis Fuß aus wie ein Filmstar im Freizeitlook. Er war frisch rasiert und frisch geduscht, weit entfernt von dem verschmierten, kotzenden Etwas, das er gewesen war, als wir ihn das letzte Mal sahen. Auf einmal fragte ich mich, ob wir nicht einen Riesenfehler begangen hatten. Jack sah uns an. Sein Gesicht war eine ausdruckslose Maske. Er war eindeutig überrascht, doch es gelang ihm, cool zu bleiben und nur leicht verwirrt dreinzublicken. Seine Augen konnte man hinter den grünen, schwach getönten Gläsern seiner schwarz umrandeten Gucci-Sonnenbrille noch gut erkennen, dem neuesten schicken Accessoire des postmodernen Prominenten, das die Botschaft vermittelte: »Ich muss mich nicht hinter dunklen Gläsern verstecken, um unnahbar zu bleiben.«
Mir fiel ein, dass wir gar nicht besprochen hatten, wer eigentlich das Reden übernehmen sollte.
»Hi, Leute«, sagte Jack in einem freundlichen, aber wachsamen Tonfall.