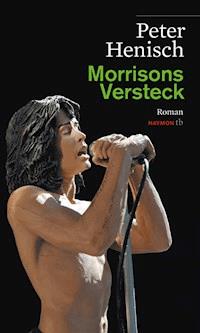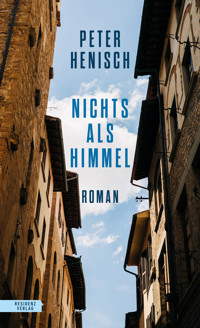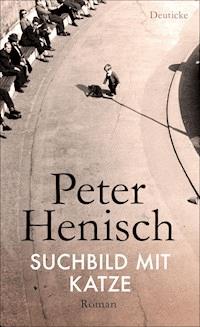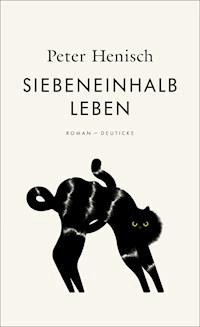
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Paul Zsolnay Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Autor Paul Spielmann, der auf einer Bank im Park sitzt und schreibt, ist irritiert. Wer ist der Mensch, der plötzlich auftaucht und ihm zu nahe rückt? Bildet sich der doch tatsächlich ein, dass es in Spielmanns Roman „Steins Paranoia“ um ihn geht. Er heißt Max Stein, wie der Protagonist, und anscheinend gibt es auch Parallelen zwischen seiner Geschichte und der im Roman. Am nächsten Tag setzt sich Spielmann auf eine andere Bank, wird den Quälgeist aber nicht los. Als er beschließt, ab sofort zu Hause zu arbeiten, beginnt Stein, Spielmanns Entführung vorzubereiten. Spielerisch wechselt Peter Henisch die Ebenen zwischen Fakten und Fiktion, zwischen Leben und Literatur, wie das nur ein ganz großer Erzähler kann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 137
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Der Autor Paul Spielmann, der auf einer Bank im Park sitzt und schreibt, ist irritiert. Ist der Mensch, der da auf einmal neben ihm sitzt und ihm zu nahe rückt, ein harmloser Spinner oder ein echter Psychopath? Bildet sich der doch tatsächlich ein, dass es in Spielmanns Roman Steins Paranoia um ihn geht. Er heißt offenbar Max Stein, genau wie der Protagonist, und anscheinend gibt es auch Parallelen zwischen seiner Geschichte und der im Roman. Am nächsten Tag setzt sich Spielmann auf eine andere Bank. Doch so leicht wird er den Quälgeist, der schon bald wieder an seiner Seite ist, nicht los. Als er beschließt, ab sofort zu Hause zu arbeiten, beginnt Stein, Spielmanns Entführung vorzubereiten.
Spielerisch wechselt Peter Henisch die Ebenen zwischen Fakten und Fiktion, zwischen Leben und Literatur, wie das nur ein ganz großer Erzähler kann.
Deuticke E-Book
Peter Henisch
SIEBENEINHALB LEBEN
Roman
Deuticke
Für Craig Decker, den lieben Freund
1
Dieser Sommer, der nicht enden wollte … Es war schon Ende September, aber die Tage waren noch immer heiß und die Nächte lau. Das war schön, aber man hatte das Gefühl, dass es nicht so bleiben konnte. Man musste es also nutzen, solang es noch ging.
Dabei der Verdacht, dass einem da etwas geschenkt wurde, das man gar nicht verdiente. Und dass es dann, wenn sich das Wetter eines Tages doch noch wendete, lang dauern mochte, bis es wieder so schön wurde. Falls es je wieder so schön wurde, worauf man sich nicht so ohne weiteres verlassen konnte. Ich war gewiss nicht der Einzige, der das empfand.
Im Türkenschanzpark lagen jüngere Menschen leicht bis fast gar nicht bekleidet auf den nach wie vor erstaunlich grünen Wiesen. Ältere saßen auf Bänken und genossen das warme Rot unter den geschlossenen Lidern. Oder sahen den Enten zu, die auf dem Teich bei der Meierei hin und her schwammen, und den Kindern, die diese Enten mit Semmelbröckchen fütterten. Joggerinnen und Jogger drehten ihre Runden, Hunde aller Formate wurden spazieren geführt, in den Bäumen, deren Blätter noch kaum gelb waren, zwitscherten die Vögel.
Beinahe idyllisch, notierte ich – na und? Nur die Rudel von Jugendlichen, die, in für die Halswirbelsäule schädlicher Haltung, mit ihren I-Phones in der Hand virtuelle Ungeheuer jagten, fand ich ein bisschen störend. Pokémon Go hieß das Spiel, das seit Anfang des Sommers angesagt war, ein Spiel, bei dem die Kids, wie wohlwollende Kommentatoren schrieben, immerhin Bewegung an der frischen Luft machten. Außerdem hörte man ab und zu das Folgetonhorn eines Einsatzfahrzeugs, aber das war draußen, in der Hasenauerstraße, der Gersthofer Straße oder gar in der Peter-Jordan-Straße, also weit genug entfernt.
Ich hatte eine Bank entdeckt, die ein wenig im Gebüsch versteckt lag. Wenn die Blätter der Sträucher fielen, in denen sogar noch späte Blüten standen, würde es mit dieser Verborgenheit vorbei sein. Vorläufig fand allerdings nur selten jemand anderer hierher, und wenn doch, so handelte es sich meist um dezente Personen. Wortkarge oder schüchterne Menschen, die allenfalls leise grüßten, bevor sie sich ans andere Ende der Bank setzten und sich dann in ihre Zeitungen oder sogar Bücher vertieften (tatsächlich, diese Minderheit gab es noch) oder einfach aufs Wasser hinausschauten.
Doch dann, eines Nachmittags, saß ein Mann am anderen Ende der Bank, der sich anders verhielt. Er nahm nicht viel Platz ein, er hatte schmale Schultern. Vielleicht lag dieser Eindruck allerdings auch an der Haltung, in der er vorerst verharrte – die Arme vor der Brust gekreuzt, die linke Hand am rechten und die rechte Hand am linken Oberarm. Als ob ihm kalt wäre. Trotz der nach wie vor fast sommerlichen Temperatur.
Das war es, was mir zuallererst an ihm auffiel. Aber ich wollte ihn gar nicht weiter beachten. Ich schrieb in mein Notizheft. Ich würde mich nicht ablenken lassen. Gerade jetzt, da ich das Gefühl hatte, dass ich mit dem Text, mit dem ich letzthin nur mühsam vorangekommen war, endlich in Fahrt kam.
Im wahrsten Sinne des Wortes. In diesem Text saß ich auf meinem Rad. Das heißt, zuerst, auf den letzten Metern vor der Passhöhe, stand ich noch in den Pedalen. Doch schon im nächsten Satz hatte ich die Steigung überwunden – jetzt! –, die Anspannung in den Waden, aber auch in den Armen und im Rücken löste sich. Und schon sauste ich bergab, bergab, und in diesem Satz versuchte ich den Fahrtwind einzufangen, den ich damals, mit sechzehn oder siebzehn, gespürt hatte, diesen Wind, der mir den Schweiß von der Stirn wegblies und mir durchs Haar fuhr.
Weiter so, weiter so! Von dem schmalen Mann, der sich neben mich gesetzt hatte, durfte ich mich nicht irritieren lassen. Allerdings war das leichter gedacht als getan. Ich versuchte ihn zu ignorieren, aber ich fühlte mich von ihm beobachtet. Oder genauer: Ich hatte den Eindruck, dass dieser Mensch, der vom Rand der Bank näher an mich heranrückte, nicht so sehr mich beobachtete als vielmehr den Bleistift, mit dem ich schrieb.
Den Bleistift, den ich gerade vorher gespitzt hatte. Es war mir wichtig, mit gut gespitzten Bleistiften zu schreiben. Trotzdem war es unwahrscheinlich, dass der distanzlose Mensch neben mir meine Handschrift wirklich lesen konnte. Aber das Gefühl, dass sein Blick jeder der kleinen Bewegungen folgte, die meine durch Impulse aus dem Gehirn gesteuerte Hand auf den Bleistift übertrug – dieses Gefühl war dennoch störend.
So gut mir die letzten paar Sätze von der Hand gegangen waren – jetzt kamen sie ins Stocken. Schon wollte ich aufstehen und gehen. Da sprach mich der Mann an. Sie sind doch, sagte er, der Herr – Spielmann, nicht wahr? Ich war nicht geistesgegenwärtig genug, um mich zu verleugnen.
Der Autor …, sagte der Mann
Ja, gab ich zu. Ich bin Schriftsteller.
Der Autor des Buchs mit dem Titel Steins Paranoia?
Ich habe mehrere Bücher geschrieben, sagte ich. Und war schon im Begriff, aufzustehen. An dieses Buch wurde ich ungern erinnert.
Warten Sie, sagte er, hören Sie zu, dieses Buch … Das ist ein Buch, das mich ganz besonders … Persönlich … Wie soll ich sagen? … Spezifisch? … Genau: spezifisch … Berührt hat … Höchst ambivalent berührt allerdings, muss ich sagen.
Abrupt erhob sich auch er und schnitt mir dadurch den schmalen Weg ab.
Mein Name, sagte er, ist nämlich Stein.
Er war zwar ein schmaler Mann, aber ich konnte trotzdem nicht an ihm vorbei.
Max Stein, sagte er. Sein Gesicht kam dem meinen dabei zu nah.
Max Stein. Das war der Name des Protagonisten jenes Buchs. Steins Paranoia. Erschienen vor dreißig Jahren – oder waren es schon mehr?
Dieses Buch, das Sie da über mich geschrieben haben …, sagte der Mann. Sie können sich wahrscheinlich denken, dass ich damit nicht voll und ganz einverstanden war.
Ich machte eine Ausweichbewegung, die er spiegelverkehrt erwiderte. Dabei wären wir beinahe beide gestrauchelt. Ein paar Enten flatterten aus dem Schilf auf. Sie werden mir doch nicht einfach davonrennen, sagte er, setzen wir uns wieder.
Also gut, seufzte ich. Was wollen Sie von mir?
Dass Sie mir zuhören, sagte er. Das ist doch nicht zu viel verlangt – oder? Ich habe ja schon damals, im Jahr 1988, Kontakt zu Ihnen aufnehmen wollen. Aber nach meiner Entlassung aus der Klinik war ich noch längere Zeit in einem Zustand, in dem es mir schwergefallen ist, Dinge, die ich mir vorgenommen hatte, auch wirklich zu tun.
Mit den Pillen, die ich weiterhin nehmen sollte, bin ich immer erst gegen Mittag halbwegs hell gewesen. Und bevor ich auch nur das Telefonbuch aufgeschlagen oder die Auskunft angerufen hatte, war es schon wieder dunkel. Dort auf der Psychiatrie haben die Ärzte bei mir übrigens eine bipolare Störung konstatiert, keine Paranoia. Bereits der Titel Ihres Buchs ist also eine Ungenauigkeit – Sie hätten sorgfältiger recherchieren sollen.
Hören Sie …, sagte ich – aber er schnitt mir das Wort ab, wie er mir zuvor den Weg abgeschnitten hatte.
Natürlich ist nicht alles falsch, was Sie über mich geschrieben haben, sagte er. Nein, keineswegs. Für manche Passagen gilt geradezu das Gegenteil. Sie haben ja, wenn ich das sagen darf, eine erstaunliche Einfühlungsgabe.
Er griff in die Brusttasche seiner Jacke und nahm ein Zigarettenetui heraus. Rauchen Sie?, fragte er. Nein, sagte ich, das soll ich nicht mehr.
Eine erstaunliche Einfühlungsgabe, wiederholte er und zündete sich eine Zigarette an. Ist es die Möglichkeit?, habe ich gedacht. In manchen Passagen Ihres Buchs hab ich mich erblickt wie in einem Spiegel.
Bereits in den Abschnitten, in denen Sie die Geschichte meiner Krise in der dritten Person erzählen. Aber erst recht in denen, in denen Sie aus der Ich-Perspektive schreiben. Wie macht er das, dieser Autor, habe ich mich gefragt, gleich damals, als ich Ihr Buch zum ersten Mal gelesen habe. Aber darf er denn das überhaupt? Ist dieses Sich-Versetzen in das Innenleben eines Menschen, eines Menschen in der Krise wohlgemerkt, eines Menschen, der nicht gefragt wurde, ob ihm das recht ist, nicht eigentlich eine Distanzlosigkeit, eine Missachtung der Intimsphäre, etwas wie Hausfriedensbruch im Seelenbereich?
Hören Sie, sagte ich, das ist ein Missverständnis … Ich habe damals nicht Ihre Geschichte geschrieben – ich kenne Ihre Geschichte gar nicht …
Sie lügen, sagte er und blies mir Rauch ins Gesicht. Vielleicht tat er es auch nicht absichtlich, vielleicht lag es am Abendwind, der jetzt aufkam.
Denn eben versank die Sonne hinter den Bäumen am anderen Teichufer. Und wie jeden Abend erhoben sich die Krähen mit rauem Geschrei aus den Wipfeln. Gleich würden sie anfangen, ihre Runden über dem Park zu drehen. Jeden Abend drehten sie diese paar Runden, bevor sie abflogen.
Ich muss jetzt gehen, sagte ich.
Nein, bleiben Sie, sagte er. Überraschend sanft berührte seine Hand meinen Unterarm. Sie müssen nicht gleich beleidigt sein – wenn Sie nicht bewusst lügen, so lügen Sie halt unbewusst. Alle Dichter lügen, das ist eine alte Wahrheit, und wir wollen jetzt keinen Unterschied zwischen Dichtern und Schriftstellern machen.
Außerdem haben Sie doch auch Gedichte geschrieben, nicht wahr? Da war doch so ein Band mit einem roten Umschlag, stimmt’s? Poesie der Peripherie oder so ähnlich. Ja, sehen Sie: Ich war schon früh ein Fan von Ihnen.
Und damals, als ich Ihr Buch über mich gelesen und wieder gelesen habe … Das ging ja recht schnell, es ist ja nicht allzu dick … Also da war ich nicht nur empört, nein, da war ich doch auch irgendwie stolz … Einmal so, einmal so – wie es sich für einen bipolar Gestörten, für einen Manisch-Depressiven, wie man früher, meines Erachtens treffender, gesagt hat, gehört.
Aber auf jeden Fall habe ich das Bedürfnis gehabt, mit Ihnen zu reden. Mit Ihnen zu reden und Sie auf Verschiedenes hinzuweisen, was in diesem Buch, bei all Ihrem Einfühlungsvermögen, doch etwas unscharf oder schlicht falsch war. Und Sie zu ersuchen, gewisse Fehler, die Sie ja kaum mit Absicht gemacht haben werden, zu korrigieren. Ein paar definitiv falsche Behauptungen richtigzustellen, einmal abgesehen vom fragwürdigen Titel.
Zum Beispiel die, dass mein Vater in Kanada in der Emigration war. Er hat damals, gerade noch vor den Nazis davongekommen, nicht in Kanada Zuflucht gefunden, sondern in Mexiko. Oder die, dass ich meine kleine Tochter an dem Tag, an dem Sie die Geschichte meiner sogenannten Paranoia beginnen lassen, von einem Tanzkurs abgeholt habe. Das war bitteschön kein Tanzkurs, sondern ein Kurs für Kindertheater.
Na eben, sagte ich. Damit klären Sie die Sachlage doch selbst. Es geht in meinem Buch gar nicht um Ihre Tochter oder Ihren Vater, und es geht – tut mir leid, wenn ich Sie mit dieser Feststellung enttäusche – vor allem nicht um Sie. Allfällige Ähnlichkeiten oder Namensgleichheiten sind reiner Zufall.
Jetzt sagen Sie bloß, sagte er, Sie haben auch Waldheim frei erfunden!
Mein Gott, Waldheim! Den hatte ich nicht zu erfinden brauchen. Zwar war der in meinem Buch nur am Rand vorgekommen oder, genauer, im Hintergrund: der Schattenwerfer in der Hofburg. Aber daran, dass es ihn wirklich gegeben hatte, war nicht zu zweifeln. Max Stein hingegen, den ich ins Zentrum des Buchs gestellt hatte – der war eine Kopfgeburt, der war doch, bitteschön, meine Kopfgeburt, auch wenn dieser merkwürdige Mensch, von dem ich mich gar nicht so lang hätte aufhalten lassen sollen, sich offenbar einbildete, etwas mit ihm zu tun zu haben.
So viel war mir schon klar, sagte er, dass sich an der ersten Auflage, die ja bereits im Buchhandel war, nichts mehr ändern ließ. Und einen Anwalt damit zu beauftragen, eine einstweilige Verfügung zu erwirken, dazu habe ich mich weder psychisch noch finanziell in der Lage gefühlt. Außerdem ging es mir ja nicht darum, Ihr Buch, unser Buch, aus dem Verkehr zu ziehen – ich fand es doch richtig und wichtig, dass es dieses Buch gab. Es wäre nur um ein paar Korrekturen gegangen, für den Fall weiterer Auflagen.
Jetzt flog auch der Reiher auf, der über uns in der Trauerweide gesessen war. Solang er sich nicht rührte, was er perfekt beherrschte, sah er aus wie ein abgestorbener Zweig, doch mit entfalteten Flügeln erwies er sich als großer Vogel.
Es hat keine weiteren Auflagen gegeben, sagte ich.
Auch das war ein Grund, warum ich ungern an dieses Buch erinnert wurde.
Doch der Mann neben mir tat gerade das. Mich ungebeten an dieses Buch zu erinnern. Dieses Buch, sagte er, ist vielleicht nicht Ihr bestes, aber möglicherweise Ihr wichtigstes. Und da ich nun einmal darin vorkomme, und zwar nicht nur irgendwie am Rande, sondern als Hauptfigur, habe ich mich berechtigt, nein, geradezu verpflichtet gefühlt …
Sie sind doch ein Autor, habe ich gedacht, der mit sich reden lässt. Ich war einmal bei einer Lesung von Ihnen, damals – erinnern Sie sich noch an das Studentencafé in der Berggasse? Dort haben Sie gelesen. Und danach wurde diskutiert. Es hat mir gefallen, wie Sie aufmerksam und geduldig auf die Fragen aus dem Publikum eingegangen sind, durchaus auch bereit, andere Meinungen als Ihre eigene gelten zu lassen.
Wir hätten uns doch auf gewisse Korrekturen für die zweite und alle weiteren Auflagen einigen können. Oder zumindest auf ein Vor- oder Nachwort, in dem Sie ein paar Richtigstellungen untergebracht hätten. Ja, das habe ich gedacht und gehofft. Aber als ich mich endlich, ein paar Monate, nachdem das Buch erschienen war, dazu aufgerafft habe, bei Ihrem Verlag anzurufen, hat es geheißen, unser Autor ist in Amerika.
Ich muss jetzt wirklich gehen, sagte ich und ging schon.
So, sagte er, neben mir hergehend, haben Sie etwas Wichtigeres zu tun?
Ja, sagte ich. Aber das geht Sie nichts an.
Sie sollten nicht so abweisend sein, sagte er. Ich bin einer Ihrer treuesten Leser.
Ich fragte mich, wie ich den Kerl loswerden konnte.
Ich habe alles von Ihnen gelesen, sagte er. Von Ihrem ersten Buch, diesem Buch über Ihren Vater, angefangen.
Das war nicht mein erstes Buch, sagte ich. Und es war nicht nur ein Buch über meinen Vater.
Na ja, sagte er, jetzt seien Sie nicht so heikel. Das war doch das Buch, mit dem Sie bekannt geworden sind – oder? Und dann war noch das Buch über diesen Vorstadtpropheten … Wie hat denn das bloß geheißen? Der Moses von Simmering?
Nicht ganz, sagte ich. Aber hören Sie zu: Wir können vielleicht ein anderes Mal weiterreden. Jetzt aber bin ich leider wirklich sehr in Eile.
Und blieb an der nächsten Ecke stehen und zückte mein Handy. Ich muss mir ein Taxi rufen, sagte ich.
Bis nach Hause hätte ich keine zehn Minuten zu gehen gehabt. Aber ich wollte auf keinen Fall, dass dieser lästige Mensch mitbekam, wo ich wohnte. Ich wählte also die Taxinummer. Ich sagte, an welcher Ecke ich stand. Ihr Taxi, hieß es, kommt in drei Minuten.
Und wann können wir weiterreden, fragte der Mann, morgen? Treffen wir uns einfach wieder bei dieser Bank am Teich?
Ich weiß nicht, sagte ich.
Ich bringe unser Buch mit, sagte er. Es wäre mir daran gelegen, dass Sie es signieren.
Wohin?, fragte der Taxifahrer.
Das werde ich Ihnen gleich sagen, antwortete ich, fahren Sie nur einmal los.
Ich sah mich nach dem Mann um, der sich Stein nannte, er stand an der Ecke, an der ich ihn stehengelassen hatte, und schaute uns nach. Er kam mir jetzt nicht nur schmal vor, sondern auch klein. Die Hose, die er trug, eine hellbraune Cordhose, war zu lang für ihn, sie erinnerte ein wenig an die Hose eines Clowns, er hätte sie kürzen lassen sollen.
Also wohin jetzt?, wollte der Fahrer wissen. Bis zu dem Haus, in dem Paula und ich damals noch wohnten, hätten wir keine zwei Minuten gebraucht. Tatsächlich nur bis dorthin zu fahren, schien mir peinlich. Fahren Sie in den achten Bezirk, sagte ich. Lange Gasse 21.
Unwillkürlich nannte ich diese Adresse. Eine Adresse, an der ich früher gewohnt hatte. Doch während wir die Währinger Straße stadteinwärts fuhren, fragte ich mich, was ich dort wollte. Oder dort sollte. Das ergab doch keinen Sinn!