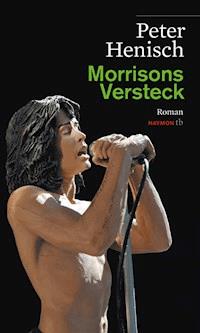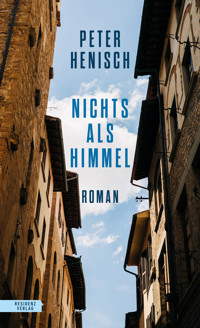Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Residenz Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ein wunderbar ironischer Roman über eine junge Frau, einen alten Mann und die Kraft der Literatur. Als Buchhändler war der alte Herr Roch stets von Büchern umgeben, nun hat er selbst einen "Jahrhundertroman" geschrieben. Es soll darin um Literatur gehen – von Musil und Roth bis zu Bachmann und Handke. In Geschichten, in denen der Möglichkeitssinn die Wirklichkeit oft ausblendet. Die Studentin Lisa, Kellnerin in Rochs Stammcafé, soll das Manuskript für ihn abtippen. Da sie Rochs Schrift nicht lesen kann, will er ihr diktieren, doch alles ist heillos durcheinandergekommen. Zwischen dem alten Mann, der voller Geschichten steckt, und der jungen Frau, die ihm nicht alles glaubt, entwickelt sich eine ambivalente Beziehung. Doch Lisa hat auch andere Sorgen: Ihre Freundin Semira soll abgeschoben werden. Kann Rochs Bücherlager ihr Zuflucht bieten?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 357
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Peter Henisch
Der Jahrhundertroman
Roman
Wir danken für die Unterstützung
© 2021 Residenz Verlag GmbHSalzburg – Wien
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikationin der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
www.residenzverlag.com
Alle Urheber- und Leistungsschutzrechte vorbehalten.
Keine unerlaubte Vervielfältigung!
Umschlaggestaltung: Boutiquebrutal.com
Typografische Gestaltung, Satz: Lanz, Wien
Lektorat: Jessica Beer
ISBN ePub:
978 3 7017 4643 9
ISBN Printausgabe:
978 3 7017 1731 6
Für EvaDankbar für Rat, Hilfe, Liebe
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
1
Zwei Euro pro Seite, hatte Herr Roch gesagt. Zwei Euro pro Seite würde er ihr bezahlen. Es ginge darum, ein Manuskript abzutippen. Ein Manuskript, an dem ihm gelegen sei.
Sie würde sich etwas dazuverdienen und ihm würde sie einen Gefallen tun. Einen großen Gefallen, denn an diesem Manuskript sei ihm viel gelegen. Es handle sich nämlich um einen Roman. Um einen Roman, an dem er seit Jahren schreibe und an dem er, wenn sie ihn recht verstanden hatte, noch weiterschreiben wolle.
Aber zuerst ginge es darum, das Vorhandene zu überblicken.
Das Wort überblicken aus dem Mund des Herrn Roch! Beinahe peinlich – der alte Mann war extrem kurzsichtig. Sein Blick durch die dicken Brillen tat ihr fast weh.
Wenn er die Zeitungen las, tief über den Tisch gebeugt, an dem er für gewöhnlich saß, dem Tisch in der Ecke neben dem Notausgang, verwendete er zusätzlich eine kleine Lupe. So eine, wie sie die Markensammler gebrauchten, die sich jeden Dienstag hier trafen. Das war einer der Tage, an denen Lisa relativ viel zu tun hatte. Auch am Freitag tat sich einiges, da kamen die Damen, die Canasta oder Tarock spielten. Sonst war der Job im Café Klee eher beschaulich.
Aber ist dir da nicht stinklangweilig? hatte Ronnie gefragt.
Als er sie noch manchmal abgeholt hatte, also am Anfang des Semesters.
Da ist ja nichts los, hatte er gesagt, ich würde das keine zwei Wochen aushalten.
Lisa hielt es schon mehr als zwei Monate hier aus.
Das hier war einmal eine gute Gegend, sagte die Chefin, das Geschäft hat floriert. Das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Damals haben wir hier noch zwei Billardtische gehabt und eine eigene Backstube haben wir betrieben. Da sind noch Cremeschnitten und Torten in der Vitrine gelegen, nicht nur die paar Schokobrezel und Manner-Schnitten.
Trotzdem sollte Lisa manchmal die Scheiben der Vitrine polieren. Es durfte ja nicht so aussehen, als hätte sie nichts zu tun. Und die Tischplatten aus echtem Marmor, von denen einige zwar schon Sprünge, aber immer noch eine gewisse Würde hatten, sollte sie bitte abwischen. Auch wenn noch gar niemand darauf gefrühstückt hatte.
Wenn sich Lisa dann in eine der mit ehemals grünem Samt tapezierten Nischen setzte und ihren Laptop aufklappte, hatte Frau Resch allerdings nichts dagegen. Sie ging davon aus, dass ihre Aushilfe etwas für die Uni tippte. Was studieren Sie, hatte sie gefragt, als sie Lisa eingestellt hatte, aha, schön. Lisa hatte den Verdacht, dass sie vielleicht selbst einmal studiert hatte.
Doch dann war ihr Studium wahrscheinlich im Sand verlaufen oder es war etwas dazwischengekommen. (Ein Mann, ein Kind, eine Ehe, eine Scheidung, eine Depression.) Darüber wollte Frau Resch aber nicht gern reden. Die zwei oder drei Mal, als Lisa sie doch darauf ansprechen wollte, wandte sie sich rasch ab und ging in die Küche.
Wie flink Sie tippen! sagte Herr Roch. Das könnte ich nie.
Er habe immer nur mit zwei Fingern getippt. Wenn es nötig war. In seinem früheren Leben. Aber das liege schon ein paar Jahre zurück.
Den Roman jedoch habe er natürlich mit der Hand geschrieben. Es war ihm wichtig, die Gedanken direkt vom Kopf in die Hand fließen zu lassen. Leider hatte er dann seinen Schlaganfall gehabt. Mein Schlaganfall, sagte er. Mit der gleichen Selbstverständlichkeit, mit der er von seinem Roman sprach.
Mit dem er nun, sagte er, wieder in Schwung kommen wolle. Wobei ihm Lisa entscheidend helfen könne. Indem sie vorerst abtippe, was schon vorliege. Zwei Euro pro Seite. Das sei doch ein faires Angebot.
Hallo, liebe Semira, tippte Lisa,
sorry, dass ich mich so lang nicht gerührt hab. Liegt daran, dass ich eine Weile gebraucht hab, um mich auf die Situation hier in Wien einzustellen. Hab an der Uni inskribiert und einen Platz in einer WG gefunden.
War und ist aber beides nicht ohne Probleme. Also die Uni: nichts als Hektik am Anfang. Z.B. hätte ich beinah den Anmeldetermin für so ein blödes Proseminar versäumt. Und dabei war es wichtig, ausgerechnet in dieses Proseminar hineinzukommen.
Sonst verlierst du gleich Zeit, bist, kaum dass du zu studieren angefangen hast, schon im Rückstand. Hat Ronnie gesagt, der mir gerade noch rechtzeitig über den Weg gelaufen ist. Oder bin ich ihm über den Weg gelaufen? Ist eine Frage der Perspektive, nicht wahr? Jedenfalls ist er bereits im dritten Semester und kennt sich aus. Nicht nur an der Uni kennt er sich aus, sondern auch in der Stadt. Ronnie kennt nicht nur nur billige Mensen und Shops. Er kennt auch jede Menge coole Lokale.
Außerdem hat er mir ja ganz gut gefallen. Mit seiner ständigen Besserwisserei ist er mir aber schon bald auf die Nerven gegangen. Und vielleicht war es doch keine so gute Idee, gleich mit ihm in diese WG zu ziehen. Wo wir zwar zwei durch einen Gemeinschaftsraum getrennte Zimmer haben, aber anfangs oft in einem Bett gelandet sind.
Der Job, den ich hier gefunden habe, ist aber okay. Kellnerin in einem Kaffeehaus im 17. Bezirk. Ein Job, bei dem ich mir die Arbeit einigermaßen einteilen kann. Halbwegs kompatibel mit den Vorlesungen, die ich besuchen muss.
Die Chefin (Fr. Resch heißt sie) hat Verständnis dafür. Aber was sie mir zahlen kann, ist nicht viel. Einen kleinen Zuschuss könnt ich schon brauchen. Hab um Studienbeihilfe angesucht, doch ob ich die bekommen werde, ist alles andere als sicher.
Mein Vater verdient zu gut, und dass ich kein Geld mehr von ihm nehmen will, ist eigentlich Privatsache. Die Kolleginnen in der Beratungsstelle der Hochschülerschaft haben gemeint, ich kann das ja als Anmerkung ins Einreichungsformular schreiben. Aber vorgesehen ist so etwas nicht. Jetzt kann ich bis auf Weiteres nur abwarten.
Da ist allerdings ein Gast im Café, der mir einen Nebenverdienst anbietet. Herr Roch. Ein alter Mann. Nach einem Schlaganfall ein bisschen beschädigt. Ich könnte, sagt er, etwas für ihn abtippen. Doch ich weiß nicht recht, ob ich darauf eingehen soll.
Aber jetzt schreib ich schon wieder viel zu lang von mir. Und von meinen vergleichsweise kleinen Problemen. Wie geht es dir? Dass du jetzt noch ein Jahr in unserer alten Schule absitzen musst, ist echt blöd. Aber im Mai machst du die Matura und vielleicht kannst du ja dann auch nach Wien kommen.
Immerhin ist ja alles noch halbwegs gut ausgegangen, oder? Hauptsache ist doch, dass die leidige Geschichte mit eurem Bleiberecht nun geklärt ist. Hoffentlich gehts deiner Mutter jetzt etwas besser! Du wirst sehen, es wird alles gut.
Was schreiben Sie, Fräulein Lisa? fragte der Herr Roch.
Nichts Interessantes, sagte sie. Etwas für die Uni, log sie.
Tatsächlich sollte sie etwas für die Uni schreiben. Aber immer, wenn sie dazu ansetzte, verlor sie schon nach wenigen Sätzen den Faden.
Dann tippte sie unversehens ganz etwas anderes. Manchmal einfach nur, was sie an so einem langen Vormittag im Café Klee hörte und sah. Wie draußen der Regen rauschte. Wie die Pendeluhr tickte. Wie der Luster mit den Krakenarmen zitterte, wenn ein schweres Auto vorbeifuhr.
Etwas für die Uni also, sagte der Herr Roch.
Mit seinen trockenen Lippen lächelte er.
Er lächelte, als ob er ihr nicht glaubte – oder lächelte er, als ob er wüsste?
Dieser Herr Roch ging ihr manchmal ganz schön auf die Nerven.
Schon weil er sie permanent mit Fräulein anredete. Das ist doch, sagte sie, eine Anrede von vorgestern. Schon möglich, sagte er, vielleicht bin ich auch von vorgestern. Aber sehen Sie, es gibt mich noch immer.
Fräulein Lisa, sagte er. Liebes Fräulein Lisa! Haben Sie sich mein Angebot durch den Kopf gehen lassen? Was zögern Sie noch? Was ist das Problem? Zwei Euro pro Seite. Können Sie die nicht brauchen?
Ja, warum zögerte sie noch? – Also zuerst, sagte sie später, war da so ein Bauchgefühl. Einmal abgesehen davon, dass der Typ sie nervte. Eine Ahnung, dass sie sich damit etwas einbrocken würde. Eine Suppe, die sie vielleicht nicht so gern auslöffeln wollte.
Und dann war da sein Gerede von diesem Roman. Manchmal nannte er diesen Roman sogar seinen Jahrhundertroman. War das sein Ernst? Erwartete er, dass sie das ernst nahm? War das nicht geradezu ein Indiz dafür, dass sowohl mit dem Mann als auch mit dem Manuskript, von dem er sprach, etwas nicht stimmte?
Okay, wenn er sie dafür bezahlte, hätte sie, ohne lang zu fragen, auch das Telefonbuch abtippen können. Seine schriftstellerische Kompetenz konnte ihr doch egal sein. Aber schließlich hatte sie Germanistik inskribiert, weil sie ein gewisses Interesse an Literatur hatte. Und das war ihr nach den ersten sechs, sieben Wochen Uni noch nicht ganz vergangen.
Ist der Herr Roch ein Autor? fragte sie die Chefin.
Der? Ein Autor? – Hören Sie zu, Lisa: Dieser Herr ist vor allem ein Dampfplauderer!
Nun schloss ja das eine das andere vielleicht gar nicht aus. Und Dampfplauderer – das klang ja beinahe harmlos.
Doch die Frau Resch fügte diesem Urteil noch etwas hinzu:
Passen Sie auf, Lisa, lassen Sie sich von dem nicht einwickeln!
Und dann erhob sie ganz ungewohnt laut ihre Stimme:
Das wollte ich Ihnen ohnehin schon längst sagen, Lisa, der Herr Roch ist ein Stammgast und es ist gut, wenn Sie angemessen freundlich zu ihm sind, aber es ist besser, wenn Sie dabei eine gewisse Distanz wahren!
Eben. Obwohl Lisa der Ton, in dem die Chefin das gesagt hatte, etwas übertrieben vorkam, fand sie ihr Bauchgefühl dadurch bestätigt. Doch genau das, die Distanz zu wahren, war ein Problem. Es war ein geringeres Problem, wenn die Frau Resch da war – dann trat sie an den Tisch des Herrn Roch, stellte ihm hin, was er bestellt hatte, lächelte, aber ließ sich auf kein längeres Gespräch ein. Bloß war die Frau Resch bald immer weniger da.
In den ersten Wochen, die sie im Café Klee aushalf, hatte Lisa sich manchmal gefragt, warum diese Frau sie überhaupt eingestellt hatte. Für das wenige, das im Café Klee zu tun war, wäre keine Aushilfe nötig gewesen. Worum ging es ihr also, der Frau Resch? Ging es ihr darum, nicht ganz den Kontakt zur jüngeren Generation zu verlieren? Schon möglich. Aber nun stellte sich heraus, worum es ihr noch ging.
Nach zwei, drei Tests, durch die sich erwies, dass sie dem Mädel das spärlich besuchte Lokal für eine gewisse Zeit allein überlassen konnte, blieb sie länger und länger weg. Unternahm nicht nur immer ausgedehntere Shoppingtouren, sondern hatte schon bald Termine bei der Friseurin, bei der Kosmetikerin, im Fitnesscenter, im Bräunungsstudio. Und der Herr Roch bekam das natürlich bald mit. Immer öfter tauchte er gerade dann auf, wenn Frau Resch soeben gegangen war.
Na, so etwas! sagte er dann etwa, nachdem er an seinem Tisch in der Ecke Platz genommen hatte. Ist Ihre Chefin schon wieder ausgeflogen! Na ja, sie will sich halt auch noch ein bisschen des Lebens freuen. Solang noch das Lämpchen glüht. Was meinen Sie, Fräulein Lisa – hat sie einen Freund?
Weiß ich doch nicht, sagte sie. Interessiert mich auch nicht.
Wirklich nicht? sagte er. Aber das wäre doch hübsch! Na, jedenfalls kann sie sich jetzt etwas mehr entfalten. Seit Sie, Fräulein Lisa, da sind. Das ist ja ein Glück!
Nicht nur ein Glück für die Frau Resch – auch und besonders für die Gäste. Speziell vom ästhetischen Standpunkt aus betrachtet. Bedauerlicherweise sehe ich ein bisschen schlecht. Aber dafür hab ich trotzdem einen Blick.
Er nahm die Brille ab und putzte sie. Zwinkerte mit seinen Maulwurfsaugen. Fräulein Lisa. Sie sind ein Sonnenstrahl! Vor Ihnen haben nur alte Weiber hier ausgeholfen.
Jetzt hören Sie aber auf! sagte sie. Ihre zweifelhaften Komplimente können Sie sich sparen. Überhaupt Komplimente! Die kommen in meiner Generation nicht mehr an.
Tatsächlich? sagte er. Das ist aber auch ein bisschen schade, oder?
Was weiß ich?! sagte sie. Sie fand diese Bemerkung ärgerlich.
Ja, er nutzte diese Stunden, der Herr Roch. Nicht nur, um sie anzubraten, sondern auch für etwas anderes. Wenn sie an ihrem Tisch vor dem Laptop saß und tippte, hörte sie ihn in den Zeitungen blättern. Manchmal blätterte er sanft, manchmal blätterte er heftig, aber ab und zu hörte sie auch das leise Geräusch, das er verursachte, wenn er eine Seite herausriss.
Manchmal tat er das auch, wenn Frau Resch da war. Aber dann ging er dabei behutsamer vor. Langsam, langsam, gewissermaßen in Zeitlupe. Wenn nur Lisa da war, glaubte er offenbar, er müsse sich nicht so sehr zurückhalten.
Oder er hatte es darauf angelegt, dass sie davon Notiz nahm und irgendwann einmal darauf zu sprechen kam. Eine Weile versuchte sie es noch zu ignorieren. Aber dann, eines Donnerstagnachmittags, als Frau Resch wie üblich in der Bräunungsröhre lag und daher kaum vor fünf zu erwarten war, ging sie ihm doch auf den Leim.
Sie brauchen nicht zu glauben, dass ich das nicht merke! sagte sie.
Glaub ich auch nicht, sagte er. Aber Sie werden mich nicht verraten.
Nein, sagte sie. Das ist nicht meine Art. Aber warum tun Sie das?
Wenn Sie sich zu mir setzen, sagte er, werde ich es Ihnen erklären.
Also, die Sache ist die, sagte er und dämpfte die Stimme, obwohl niemand sonst im Raum war. Mein Jahrhundertroman ist ja ein Roman, der in der Vergangenheit, nämlich vor hundert Jahren, beginnt, aber in der Gegenwart endet. Und nun ist es so: Was die Vergangenheit angeht, so hat man ja alle möglichen Quellen. Aber was die Gegenwart betrifft, die ich ja auch irgendwie einfangen will, ja, muss, denn ich will ja diese beiden Zeitebenen zueinander in Beziehung setzen, brauche ich dazu natürlich auch gewisse Materialien.
Verstehe, sagte sie, zum Beispiel Zeitungsartikel.
Das habe ich mir gedacht, sagte er, dass Sie mich verstehen – Sie schreiben ja auch.
Wie kommen Sie darauf? sagte sie.
Aber das merke ich doch! sagte er. Ich bin zwar etwas kurzsichtig, aber nicht blind.
Wenn Sie da drüben sitzen, nur ein paar Meter von mir entfernt, und tippen … Wie Sie dabei dreinsehen, wie Sie atmen, wie Sie manchmal die Zungenspitze zwischen die Lippen schieben … Das macht auf mich nicht den Eindruck, als ob Sie wirklich was für die Uni schreiben würden, sondern …
Das geht Sie nichts an, sagte sie, stand auf und zog sich hinter die Theke zurück.
Sie schreiben doch manchmal Gedichte, habe ich recht?
Rasch klickte sie den Text, an dem sie gerade geschrieben hatte, weg.
Gedichte? Wie kommen Sie denn auf diese Idee?
Gehör, sagte er. Ich höre die Länge und Kürze der Zeilen.
Nun war Lisas Laptop zwar wirklich nicht mehr der jüngste. (In ihrer gegenwärtigen Situation konnte sie sich keinen neuen leisten.) Und die Tastatur war schon ein bisschen klapprig. Aber Herr Roch hatte erstaunlich feine Ohren.
Sein Gehör hatte durch den Schlaganfall offenbar nicht gelitten.
Gedichte also, sagte er, geben Sie’s zu.
Wenn er lächelte, hing sein rechter Mundwinkel ein bisschen schief.
Ach was! sagte sie. Ich mache halt viele Absätze.
Ist mir doch ganz egal, ob das, was ich da ab und zu tippe, Prosa ist oder Lyrik. Prosaische Lyrik oder lyrische Prosa, was weiß ich. Stimmt, ich habe etwas davon bei diesem Poetry-Slam vorgelesen. Aber das war Ronnies Idee! Ich hätte mir das nicht einreden lassen sollen.
Hi, Mira! Du fragst, wie das gelaufen ist. Was soll ich dir sagen / schreiben? Blöd ist es gelaufen! Kaum waren wir dort, im Hinterzimmer eines mir gleich unsympathischen Lokals, hab ich mich schon fehl am Platz gefühlt. Mein erster Impuls war, wieder umzudrehen, aber Ronnie hat mich zurückgehalten.
Dabei kann ich gar nicht sagen, warum ich mich unter den anderen, die dort hinkamen, so wenig wohlfühlte. Bis auf wenige Ausnahmen, lauter Leute in unserem Alter. Ein paar davon hatte ich, glaube ich, schon an der Uni gesehen. Vielleicht lag es ja auch an mir, an meiner eigenen Unsicherheit, aber so war das eben.
Dort aufzutreten war schlicht und einfach nicht meins. Einmoderiert von diesem Blödmann, der sich aufführte wie ein DJ. Den meisten Applaus hatten die, die rappten oder sonst irgendeine Show abzogen. Ich las meinen Text vom Blatt. Nur Ronnie applaudierte.
Deine Performance, sagte er, war halt nicht gerade mitreißend. Wie er das Wort Performance sagte, dafür könnt ich ihn schon ohrfeigen. Übrigens ist er jetzt mit Tina zusammen. Die studiert nicht nur Germanistik, sondern auch Anglistik und Komparatistik, ist aber trotzdem eine blöde Kuh.
Erzählen Sie etwas von sich, sagte der Herr Roch – aber was sollte sie ihm denn groß erzählen? Dass sie Ende Mai die Matura gemacht hatte, trotz allem, was sie von der Vorbereitung auf diese sogenannte Reifeprüfung (Reife / Wofür denn?) abgehalten, was ihre Konzentration darauf erschwert hatte? Und dass sie gleich anschließend ihren Koffer gepackt hatte, nicht um mit ihrer Klasse auf Maturareise zu fahren, sondern um von zu Hause auszuziehen (zu Hause / Wo war das)? Aus dem Haus, in dem sie eine überbehütete und viel zu lange Kindheit verbracht hatte, und dann zwei oder drei Jahre des Zweifels?
Aus der Kindheit war sie herausgefallen wie aus einem allzu schönen Traum. Einem Traum, aus dem ihre Eltern ihren um zwei Jahre jüngeren Bruder Jakob und sie nicht aufwachen lassen wollten. Dieser Traum spielte in einem großen, alten, aber selbstverständlich den Bedürfnissen einer wohlhabenden Familie von heute angepassten Haus mit adrett eingerichteten Zimmern, einem weitläufigen Garten mit prächtigen, alten Bäumen, Biotop und Pool und einer hohen Mauer rundherum. Und manche Sequenzen dieses Traums spielten in noch absurder von der Außenwelt abgeschirmten Ferienressorts.
Sollte sie das erzählen? Nein, das war peinlich. Für sich hatte sie es notiert, in ihr Tagebuch (Nachtbuch). Sobald sie erwachsen genug dazu gewesen war. Um sich klarzumachen, was sie gehasst hatte (vorerst noch uneingestanden, aber nachhaltig):
Diese sowohl in den Ferien als auch daheim, wo es ja doch am schönsten sein sollte, aufgenommenen Videos, die wir immer wieder ansehen mussten.
Diese demonstrative Innigkeit zwischen Papa und Mama.
Dieses Glück, das vor allem uns Kids zum Strahlen brachte.
Mimik, Gestik, alles war auf die Darstellung unseres komfortablen Glücks programmiert.
Auch wenn es uns manchmal schon ein bisschen langweilte.
Strahlend gückliche Kinder glücklicher Eltern.
In Papas Videoclips spielten wir unsere Rollen perfekt.
Den Verdacht, dass das alles nicht stimmte, hatte ich allerdings schon länger gehabt. Den Verdacht, dass die Wirklichkeit nicht so kitschig schön wäre. Ich erinnere mich an den Tag, an dem ich vor dem Spiegel stand und zum ersten Mal die Pickel auf meiner Stirn wahrnahm. Ich drückte sie aus und es blutete und das war hässlich. Aber das war die Wahrheit und sie zu sehen hatte etwas Befreiendes. Und ich verspürte Lust, das zu demonstrieren. So schlug ich die Tür meines Teenagerzimmers, das im ersten Stock lag, hinter mir zu, schritt die Treppe hinunter in unseren sogenannten Salon, wo schon alle bei Tisch saßen und auf mich warteten (Vater, Mutter, Bruder, Hund und Katz, die natürlich auch glücklich zusammenlebten), und zeigte mich. Aber Mama sprang sofort auf und kam mit Wattepads aus dem Bad zurück, Papa schüttelte nur den Kopf und Jakob (Bruder Jakob / Bruder Jakob / schläfst du noch?) zuckte die Achseln, und dann aßen wir Lachs und den Kaviar, den ein dankbarer Patient meines Vaters aus St. Petersburg geschickt hatte.
Sollte sie das erzählen? Nein, dazu hatte sie keine Lust. Und schon gar nicht wollte sie erzählen, wie dieser Film dann gerissen war. Kurz bevor sie nach La Réunion fliegen sollten – einmal was anderes, auf den Kanaren hatten sie ja schon alle Inseln durch. Aber das Flugzeug flog dann eben ohne sie, denn in der Nacht davor war Papas Verhältnis mit seiner Ordinationshilfe aufgeflogen und von diesem Morgen an war alles ganz anders.
Zuerst der monatelange Streit meiner Eltern und dann die Stille, als sie endlich ausgestritten hatten. Unterbrochen von den Telefonaten, die meine Mutter mit ihrer Anwältin führte. Zwischendurch heulte sie auch, die liebe Mama. Aber wenn sie mit der Anwältin die Konditionen der Scheidung besprach, streute sie zwischendurch immer wieder Gehässigkeiten gegen Papa ein, und da verging mir das Mitleid gründlich. So viel war schon wahr, dass sich mein Vater, der seine um zwanzig Jahre jüngere Ordinationshilfe nicht nur vögelte, sondern auch die Absicht hatte, ein neues Leben mit ihr zu beginnen, damit als echtes Arschloch erwies. Jedenfalls ihr, unserer armen Mama, gegenüber. Aber dass sie ihn, wie sie der Anwältin wiederholt und mit am Telefon fast überschnappender Stimme sagte, nun zugrunde richten wollte – sie werde es ihm heimzahlen, er sollte zahlen, zahlen und noch einmal zahlen … das konnte ich nicht mehr hören. Mein Bruder zog sich in sein Zimmer zurück, verschanzte sich hinter dem Bildschirm und schoss auf alles, was sich bewegte. Mich aber trieb es aus dem Haus.
Dann ließ ich mich treiben. Weg aus dem blöden Villenviertel und der Schrebergartenöde. Durch den kleinen Wald und über die große Wiese. Und weiter und weiter, vorbei am Soldatenfriedhof und am Kreuzweg. Und dann, das ergab sich, hatte ich es nicht mehr weit zum Haus des Großvaters.
Um Missverständisse zu vermeiden: Es war nicht so, dass ich eine besondere Beziehung zu ihm hatte. Solange er gesund gewesen war, waren Besuche bei ihm eher eine Pflichtübung. Das galt auch für meine Eltern und meinen Bruder. Längere Besuche beim Opa gab es nur zu Weihnachten und zu seinem Geburtstag.
Sonst kamen wir eher nur auf einen Sprung. Er war ein alter Mann, der sich bemühte, zu uns Kindern freundlich zu sein, aber man merkte ihm die Mühe an. Er fragte, wie es uns in der Schule gehe, er schenkte uns große Tafeln Schokolade, von denen er immer einen Vorrat im Haus hatte, weil er selbst gern naschte. Er streichelte uns, solange wir klein waren, über den Kopf, was wir nicht wirklich gernhatten, aber wir ließen ihm die Freude, für den Fall, dass es ihm wirklich eine Freude war.
Nun aber war der Opa ein Pflegefall. Eines Morgens war er aus dem Bett aufgestanden und unversehens gestürzt. Er hatte sich nichts gebrochen, aber er kam nicht mehr auf die Beine. Im Spital hatte man ihn durchgecheckt, Indizien für einen Gehirnschlag hatte man angeblich nicht entdeckt, aber als man ihn wieder nach Hause gebracht hatte, brauchte er buchstäblich für alles Hilfe.
Er hatte zwei Pflegerinnen, die ihn abwechselnd betreuten. Rund um die Uhr, wohlgemerkt, zwei Wochen im Monat die eine und zwei Wochen im Monat die andere. Zwei Slowakinnen, die Papa, wie er oft nebenbei erwähnte, weit über den Tarif bezahlte. Mein Vater, der anfangs noch öfter vorbeischaute, um zu sehen, ob alles klappte und mit Zdenka und Rosa, so hießen die beiden, die pünktliche Verabreichung der Sedativa zu besprechen, die dem Großvater seiner Ansicht nach guttaten, aber dann, als der Krieg zwischen Mama und ihm ausgebrochen war, immer weniger.
Mama hatte Besuche bei ihrem kranken Schwiegervater schon vorher kaum ertragen. Der arme alte Mann tat ihr so leid, dass sie seinen Anblick einfach nicht aushielt. Und seinen Geruch. Der Großvater wollte ziemlich häufig aufs Klo. Ihn dorthin und wieder zurückzubringen war zwar eine Aufgabe, die von den Slowakinnen erledigt wurde, sowohl von Zdenka als auch von der etwas weniger robust gebauten Rosa, aber selbst wenn man da diskret wegsehen konnte, wegriechen konnte man nicht.
Jetzt, da ich öfter vorbeikam, versuchte ich ihn von der Konzentration auf seinen Stuhlgang abzulenken. Manchmal gelang das sogar. Er hatte eine Reihe von DVDs mit Aufnahmen der Sendung Universum. Einmal, als wir eine Folge ansahen, in der die Kameraleute Löwen an der Tränke beobachtet hatten, die in der grellen Sonne blinzelten, fragte er mich, ob ich glaubte, dass man Raubtieren Brillen verschreiben könnte. Er war ja früher Augenarzt gewesen.
Aber warum sollte Lisa das dem Herrn Roch erzählen?
Sie schrieb es. Für sich. Sie konnte ja schreiben, was sie wollte.
Später würde sie vielleicht mehr darüber schreiben.
Doch den Herrn Roch ging das überhaupt nichts an.
Sie fing an, die Graffiti zu notieren, die sie auf dem Weg von der Straßenbahn zum Café oder vom Café zur Straßenbahn las:
No borders. Freiheit für alle. Kein Mensch ist illegal
Manche waren nach einer Weile übertüncht, aber wenn man wusste, was da gestanden hatte, konnte man es noch eine Zeitlang erahnen.
Leben statt funktionieren. Let’s dance, baby.
Entschuldigung, sagte der Herr Roch, ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten … Ob Sie schreiben oder nicht schreiben, das ist natürlich Ihre Angelegenheit … Und erst recht, was Sie schreiben. Gar keine Frage! … Ich hab nur gedacht, wenn Sie womöglich selbst schreiben, nur einmal angenommen …
Als ob er sie mit diesen Floskeln einkreisen wollte.
Also nur einmal angenommen, sagte er, gesetzt den Fall … Dann wären Sie für den Job, den ich Ihnen anbiete, ganz besonders qualifiziert. Um nicht zu sagen – und vor diesem Wort ließ er eine effektvolle Pause – prädestiniert.
Jetzt hören Sie aber auf! sagte sie.
Aber das meine ich ernst! sagte er. Sie sind die Person, die mir helfen kann, den Jahrhundertroman endlich in den Griff zu bekommen. Eine Person, die nicht nur flott auf dem Laptop tippt, sondern …
Sondern was?
Sie sind auch eine Person, die dieses Projekt interessiert.
So, sagte sie.
Ja, sagte er. Oder interessiert es Sie etwa nicht?
Was sollte sie sagen? Sie wollte nicht unhöflich sein.
Ja klar, sagte er, bevor ihr eine ausweichende Antwort einfiel. Sie können sich halt noch zu wenig darunter vorstellen.
Von da an versuchte er ihr zu erklären, was es mit dem Jahrhundertroman auf sich habe. Das war allerdings nicht so einfach, denn er holte recht weit aus. Und das führte dazu, dass er manchmal unterbrochen wurde. Das Café Klee hatte nach wie vor nicht viele Gäste, aber einige, um die sie sich zu kümmern hatte, kamen doch.
Dass Herr Roch dann nicht weiterredete, lag aber nicht nur daran, dass sie sich vorübergehend von seinem Tisch entfernen musste. Er verstummte, so kam es ihr vor, durch jede dieser Unterbrechungen verstimmt. Als ob es eigentlich eine Zumutung wäre, dass Personen, die das, was da zwischen ihm und ihr zu besprechen war, nichts anging, einfach in ihr Gespräch hereinplatzten. Vielleicht war es aber auch so, dass er, wenn er in seinen Ausführungen gestört wurde, irritiert war und vergaß, was er gerade zuvor hatte sagen wollen.
So viel bekam sie trotzdem mit, dass er die Idee des Jahrhundertromans schon lang mit sich herumtrug. Eigentlich, sagte er, seit dem Jahr 1999. Am 1. Jänner 2000 habe er sich hinsetzen und mit dem Jahrhundertroman anfangen wollen. Und das habe er auch tatsächlich getan, aber dann sei ihm Verschiedenes dazwischengekommen.
Zwar habe er sich, sagte Roch, nicht entmutigen lassen. In immer neuen Anläufen habe er versucht, den Jahrhundertroman in Schwung zu bringen. Aber da habe es nicht nur Probleme gegeben, die mit seinem persönlichen, in den ersten Jahren des neuen Jahrhunderts ein wenig entgleisten Leben zusammenhingen (einmal ganz abgesehen von den Problemen, die sich durch seine, wie er es nannte, kleine Behinderung ergaben). Es gab auch Probleme, die, wie er betonte, im Wesen des Projekts lagen.
Das Wesen seines Projekts! Wenn er so redete, ging er ihr wieder recht auf den Geist. Vor allem weil er nie klarmachen konnte, worin dieses Wesen eigentlich bestand. Ach was, dachte sie dann, warum hör ich mir das überhaupt an? Und trotzdem schaffte er es, sie immer wieder an seinen Tisch zu locken.
Und dann, eines Nachmittags, kam es zum Eklat. Das war an einem Mittwoch, als die Chefin früher als erwartet aus dem Sonnenstudio zurückkam. Für gewöhnlich briet sie dort bis 17 Uhr. Aber da hatte es einen Stromausfall gegeben, der zum Frust der Kunden an diesem Abend nicht mehr behoben werden konnte, und so war die Frau Resch, als sie die Tür öffnete und auf einmal im Raum stand, in dem Roch und Lisa bis dahin zu zweit gewesen waren, ohnehin schon ziemlich geladen. Diesen Zusammenhang begriff Lisa allerdings erst später. Im Moment überraschte sie die Heftigkeit der Reaktion. Habe ich Ihnen nicht gesagt, Sie haben sich nicht zu den Gästen zu gesellen, rief ihre Arbeitgeberin erstaunlich schrill, augenblicklich kommen Sie mit mir in die Küche! Und wenn Sie, Herr Roch, mir die Lisa nicht in Ruhe lassen, kriegen Sie Lokalverbot!
Ich weiß schon, sagte Roch, als Frau Resch das nächste Mal weg war, Ihre Chefin will nicht, dass Sie sich mit mir abgeben. (Das war an einem Monatsersten. Vormittags. Da musste sie auf die Bank.) Sie ist mir nicht wirklich gewogen, die Madam. Sie hält mich für einen Scharlatan oder weiß der Teufel, wofür sie mich hält.
Er schnaubte empört, suchte in seinen Sakkotaschen nach einem Taschentuch und schnäuzte sich.
Oder sie bildet sich ein, ich mach Sie ihr abspenstig. Aber das fällt mir doch überhaupt nicht ein! Ich will mich doch nicht um das Vergnügen bringen, von Ihnen meine Melange und mein Frühstücksei serviert zu bekommen.
Er trank einen Schluck Kaffee und begann sein Ei aufzuklopfen.
Aber damit, sagte er, muss es doch nicht sein Bewenden haben. Lisa! Sie sind doch eine sensible Person. Sie sind die, die mir helfen kann, das habe ich Ihnen gleich angesehen.
Angesehen? sagte sie. Und wie sehen Sie so was?
Er nahm die Brille ab und putzte sie. Sie meinen: Mit diesen schlechten Augen?
Nein, entschuldigung, sagte sie. So habe ich es nicht gemeint.
Schon recht, sagte er, Sie müssen das nicht zurücknehmen. Ich bin nicht ganz so heikel, wie Sie glauben.
Er setzte die Brille wieder auf. So viel ist wahr: Ich würde Sie gerne besser sehen. Aber vielleicht ist es so: Manche Defekte, mit denen man leben muss, kann man mit der Zeit ein bisschen ausgleichen. Wenn man weniger sieht, spürt man vielleicht mehr. Also vielleicht hab ich es eher gespürt als gesehen, dass Sie, liebes Fräulein Lisa, etwas anders sind – ja, besser kann ich es nicht sagen – etwas anders.
Anders als wer? fragte sie.
Nun, sagte er, anders als die meisten Leute, die hier hereinkommen.
Und wahrscheinlich auch anders als die meisten, die draußen vorbeigehen.
Draußen war Nebel, die Leute, die vorbeigingen, waren auch für jemanden, der überhaupt keine Brille brauchte, nur schemenhaft zu sehen. Lisa fühlte sich verpflichtet, zumindest diese Unbekannten in Schutz zu nehmen.
Aber woher wollen Sie denn das wissen, sagte sie, wie all diese Menschen gestrickt sind? – Doch insgeheim, das heißt auf eine Art, die sie sich vorerst nur halb und halb eingestand, fühlte sie sich durch seine Worte bestätigt. Oder durchschaut? Sowohl das eine wie auch das andere. Durchschaut und bestätigt in ihrem Selbstgefühl.
Durchschaut und erkannt in ihrem Anderssein. Denn das war es doch, was sie seit Langem empfand. Nicht erst seit sie, mit elf oder zwölf, Harry Potter gelesen hatte. Eingebildetes Anderssein. Oder war es Anderssein als Einbildung?
Dieses Outsiderfeeling, etwas zwischen Unsicherheit und – ja, doch: Stolz.
Schon im Kindergarten hatte sie das empfunden, schon in der Volksschule. Dieses Gefühl, nicht ganz dazuzugehören. Manchmal war sie sich vorgekommen wie von einem anderen Stern.
Und so ging es ihr ja auch jetzt wieder. In der WG war sie immer noch eine Fremde. Am liebsten zog sie sich in ihr Zimmer zurück. Aber das grenzt an Kommunikationsverweigerung, sagte Ronnie, dafür, dass man kaum zwei Worte mit den anderen redet und dann die Tür hinter sich zumacht, zieht man nicht in eine WG.
Was ist denn das für ein schräger Typ? fragte Ronnie.
Weiß ich nicht, sagte sie. Ich werde nicht recht schlau aus ihm. Wenn ich es richtig mitgekriegt hab, war er früher Buchhändler. Oder er hat in einer Bücherei gearbeitet.
Und jetzt?
Jetzt ist er anscheinend schon längere Zeit in Pension. Und schreibt etwas. Oder hat etwas geschrieben. Oder will etwas schreiben.
Was denn?
Irgend so einen Roman, sagte sie.
Es war wahrscheinlich besser, Ronnie nicht ganz einzuweihen.
Das Wort Jahrhundertroman kam ihr jedenfalls nicht über die Lippen.
Sie wollte sich nicht lächerlich machen. Oder sie wollte Roch nicht lächerlich machen.
Und du willst etwas von diesem Roman abtippen?
Vielleicht, sagte sie.
Na, gratuliere! sagte Ronnie. Lass dich bloß nicht auf was Verrücktes ein!
Wahrscheinlich hatte auch das eine Rolle gespielt. Was sie tat oder ließ, war doch ihre Sache! Ronnie hatte ihr gar nichts mehr dreinzureden! Womöglich ließ Tina sich das gefallen. Sie nicht.
Und Roch ließ nicht locker. Er arbeitete weiter daran, Lisa die von ihm behauptete geistige Verwandtschaft zwischen ihm und ihr zu suggerieren. Sehen Sie, sagte er, als ich so jung war wie Sie, da habe ich auch Gedichte geschrieben.
Aber ich habe Ihnen doch gesagt …, sagte sie.
Ja, ja, sagte er. Ich weiß schon. Aber vor mir brauchen Sie das doch nicht zu verleugnen.
Ein paar von meinen Gedichten, sagte er, sind sogar veröffentlicht worden. In Literaturzeitschriften. Von denen es damals noch viele gegeben hat. Viel mehr als jetzt, kommt mir vor, damals war vieles im Aufbruch. Aber das war im inzwischen vergangenen Jahrhundert.
In meinem Jahrhundert, sagte er. Er lachte und musste husten. Dass so ein Jahrhundert, aus dem man kommt, auf einmal vergangen ist! Und jetzt bald seit zwei Jahrzehnten! Das ist schon komisch, wissen Sie. Manchmal erschrickt man darüber, aber das ist erst recht komisch.
Dass man auf einmal so etwas wie ein Fossil ist …
Er hustete noch immer, offenbar war ihm etwas in die falsche Kehle gekommen.
Diese aufgebackenen Semmeln, nichts als Bröseln … In meinem Jahrhundert hat es noch anständige Semmeln gegeben.
Sie klopfte ihm auf den Rücken.
Danke, sagte er, lieb von Ihnen. Dafür, Fräulein Lisa, haben Sie sich ein Gedicht verdient:
Ich bin / es hat nichts zu sagen / wer
Ich komme / ich soll mich nicht fragen / woher
Ich gehe / man wird mir schon schaffen / wohin
Man legt darauf Wert / dass ich pausenlos fröhlich bin.
Kennen Sie das?
Kommt mir irgendwie bekannt vor, sagte sie.
Ja, sagte er. Eine kleine Variation.
Von Ihnen? fragte sie.
Nein, sagte er. Nicht von mir. Aber es gefällt mir. Darum habe ich es mir gemerkt und kann es auswendig.
Schön, sagte sie.
Ja, sagte er. Und wahr … Denn genau das, liebes Fräulein Lisa, genau das ist es ja.
Was? fragte sie.
Was wir uns nicht gefallen lassen dürfen! Diese Erinnerungslosigkeit. Diese Geschichtslosigkeit. Diese erbärmliche Gesichtslosigkeit.
Fällt Ihnen das nicht auf, wenn Sie zum Beispiel in der Straßenbahn fahren, Fräulein Lisa? Diese Leere in den Blicken der meisten Leute? Aus der Leere in ihren Köpfen schauen sie hinaus ins Leere … Oder sie starren auf die Bildschirme ihrer Handys, dieser verführerischen Spielzeuge, die von der Welt drinnen und draußen ablenken.
Ganz selten liest jemand noch ein Buch, hab ich recht? Wenn Sie von hier stadteinwärts fahren, zum Schottentor, wo Sie, nehme ich an, aussteigen, um an die Uni zu gehen, wie viele Leute sehen Sie da, die ein Buch lesen? Vielleicht irgendwelche frommen Muslime, die den Koran lesen, oder irgendwelche bildungsbeflissenen Chinesen! Aber die Hiesigen, unsere Landsleute, unsere Zeitgenossen, die noch ein Buch lesen – und nicht, wenn sie sich schon der anachronistischen Anstrengung unterziehen, mit den Augen gedruckten Zeilen zu folgen, eine dieser elenden Gratiszeitungen, in denen bis auf ein paar idiotische Schlagzeilen nichts drinsteht, nichts und wieder nichts, sodass man es, wenn man aussteigt, auch gleich wieder vergessen kann und das bunte Blatt, in dem man, ohne irgendwas wahrzunehmen, geblättert hat, in den Papierkorb wirft, wo es hingehört – die Menschen dieser angeblichen Kulturnation, die heutzutage in den öffentlichen Verkehrsmitteln noch ein richtiges Buch lesen, sind eine aussterbende Spezies.
Sie haben recht, sagte Roch, manchmal spreche ich ziemlich lange Sätze. Auch das sei ein Anachronismus in Zeiten wie diesen. Aber dazu bekenne er sich, darauf sei er stolz. Denn was sind denn das für Zeiten, bitteschön, in denen ein Satz über mehr als zwei Zeilen, ein Satz mit mehr als bloß Satzgegenstand und Satzaussage, also mit Ergänzungen, Beifügungen, fallweise sogar mit Umständen der Art und Weise, des Ortes und vor allem der Zeit, die Geduld und das Fassungsvermögen dieser an geistiges Fastfood gewöhnten Menschen schon überfordert?
Ja, sagte Roch, das ist doch die traurige Wahrheit. Wir leben in Fastfoodzeiten, Fräulein Lisa. Und die meisten Leute finden das ganz normal, wenn nicht sogar gut. Kurz angebunden an den Pflock des Augenblicks.
Und deswegen schreibe er den Jahrhundertroman. Deswegen und dagegen. Das heißt, er habe begonnen, ihn zu schreiben. Dann habe sich zwar einiges ergeben, das die Verwirklichung dieses Projekts erschwerte, manchmal sei er schon drauf und dran gewesen, zu verzagen. Doch jetzt, seit Lisa erschienen sei, habe er neuen Mut gefasst.
Er sagte tatsächlich: Seit Sie erschienen sind. Sie sind die Person, die mir wirklich helfen könnte. Ja, Fräulein Lisa, geben Sie Ihrem Herzen einen Stoß! Darf ich Sie auf etwas einladen? Es wäre mir eine Freude.
Sie ging dazu über, die Graffiti zu fotografieren.
Mehr Wildnis. Riot-Girl statt Barbie Girl.
Lebe grenzenlos. Diese Parole war eines Tages durch ein zwischen die ersten zwei Buchstaben eingefügtes i ergänzt worden. Lisa fotografierte sie noch einmal. Und dann noch einmal. Bei besseren Lichtverhältnissen.
Liebe grenzenlos. Genau. Das gefiel ihr.
Sie war versucht, das Foto Ronnie zu zeigen.
Schau! sagte sie. Aber Ronnie war gerade in ein Videospiel vertieft.
Wahrscheinlich war er auch nicht der richtige Adressat für diese Botschaft.
Stimmt schon, vielleicht erinnerte Herr Roch Lisa ein wenig an ihren Großvater … Durch die Art, wie er gewisse Wörter aussprach … Das Wort Melange zum Beispiel … Oder das Wort Bagage … Aber darüber hinaus hielt sich die Ähnlichkeit in Grenzen.
Nach seinem Schlaganfall war seine rechte Seite, wie er es nannte, ein bisschen lädiert. Aber er war auf den Beinen, das war doch das Wichtigste. Und er war lang nicht so alt wie ihr Opa damals. Der hatte zuletzt behauptet, er sei bereits hundert.
Aber nein, Opa, sagte sie, du bist noch nicht hundert, du warst gerade erst neunzig.
Wie willst du das wissen? antwortete er. Man ist so alt, wie man sich fühlt. Wer bist du überhaupt? Warte! Du kommst mir bekannt vor … Du kommst mir bekannt vor, aber ich erinnere mich nicht an deinen Namen.
Ich bin Lisa, sagte sie. Lisa, deine Enkelin. Lisa, dein Enkelkind.
Du lügst, sagte er. Du bist kein Kind, du bist eine Frau … Sie sind eine fremde Frau (da war er auf einmal per Sie mit ihr) … Ich kenne Sie nicht. Wer hat Sie überhaupt hereingelassen?
Er verkniff die Augen. Sind Sie die neue Pflegerin?
Nein, Opa, sagte sie, es gibt keine neue Pflegerin.
Und wo ist Zdenka? fragte er.
Zdenka hat sich ein bisschen hingelegt. Oben, im kleinen Zimmer, hat sie sich hingelegt, in dem Papa für sein Examen gelernt hat.
Welcher Papa? fragte er.
Na, mein Vater, Dein Sohn!
Ich habe einen Sohn? fragte er.
Klar, Opa, du hast einen Sohn.
Das ist mir entgangen, sagte er, das muss ich meiner Frau sagen. Seien Sie so freundlich und rufen Sie meine Gattin!
ach Großvater lieber Großvater letzten Endes warst du schon nicht mehr ganz auf dem Laufenden
Zdenka lag oben im Zimmer in dem mein Vater für sein Examen gebüffelt hatte
ich saß neben dir und hielt deine überraschend leichte Hand
aber deine Frau meine Oma lag seit sieben Jahren draußen auf dem Friedhof
doch die Vögel zwitscherten trotzdem auf der Terrasse
fraßen das Körnerfutter pickten das Fett aus den Meisenringen
schau Opa sagte ich die vielen Vögel ach ja sagte er Amsel Drossel Fink & Star
ob ich den Frühling noch ertrage ob ich mir noch ein Jahr antun soll ich weiß nicht
Aber das hatte nichts damit zu tun. Das hatte nichts damit zu tun, dass sie sich schließlich doch auf den Job mit Rochs Roman einließ. Das hatte vor allem mit ihrer finanziellen Lage zu tun. Und die wurde damals, im Laufe des November, prekär.
So eine Scheiße, mailte sie Semira. Die Hoffnung auf die Studienbeihilfe kann ich begraben. Zuerst hat es wochenlang gedauert, bis die Kommission auf mein Ansuchen reagiert hat. Und jetzt wollen sie eine notariell beglaubigte Bestätigung, aus der hervorgeht, dass mich mein Vater nicht finanziell unterstützt.
Und mein Vater müsste das unterschreiben. Was für eine Idee! Natürlich wird er das nie machen. Er hat mir ja erst unlängst ein Kuvert mit zwei Fünfhundertern geschickt. Ich habe mir vorgenommen, sie nicht anzurühren, aber ich weiß nicht, wie lang ich das durchhalte.
Herr Roch jedoch bot ihr zwei Euro pro Seite. Okay, sagte sie. Ich könnte dieses Manuskript jetzt abtippen.
Das freut mich, sagte er. Das freut mich ganz außerordentlich. Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen gleich morgen die erste Lieferung bringen.
Diese erste Lieferung sollte sie allerdings nicht im Café Klee entgegennehmen. Die Chefin musste nichts davon mitbekommen. Erneut hatte diese Roch mit Lokalverbot gedroht, wenn er ihre Kellnerin nicht in Ruhe lasse. Er war zwar nicht ganz sicher, wie ernst sie das meinte, aber vielleicht war es besser, sie nicht zu provozieren.
Lisa traf Roch also in einem etwa eine Viertelstunde vom Café entfernten Park. Als sie ein paar Minuten zu spät, kurz nach halb drei, dort hinkam, saß der Alte schon auf einer Bank. Das Wetter war in dieser Woche wieder besser geworden, die Sonne brachte die letzten Blätter, die noch an den Bäumen hingen, zum Leuchten. Für Mitte November war es ein erstaunlich milder Tag.
Neben Roch auf der Bank stand eine etwas abgeschabte Aktentasche. Darin war wahrscheinlich das angekündigte Manuskript. Als sich Lisa, ohne lang zu überlegen, so zu ihm setzte, dass die Tasche vorerst zwischen ihnen stand, stellte er sie von links nach rechts.
Dabei wirkte die Tasche bedenklich gewichtig.
Schön, dass Sie gekommen sind, sagte er, ich habe schon befürchtet, Sie haben es sich anders überlegt.
Er nahm ihre Hand und hielt sie für ein paar Augenblicke fest.
Entschuldigung, sagte er, als er merkte, dass ihr das nicht recht war. Ich bin nur so froh, dass Sie sich wirklich entschlossen haben …
Er beendete den Satz nicht. Ließ ihn gewissermaßen in der Luft hängen.
Vielleicht spürte er den leisen Zweifel, der sich inzwischen wieder in ihr rührte. Hatte sie sich wirklich entschlossen? Erwartete er, dass sie es noch einmal bestätigte, oder fürchtete er, dass sie wieder dementierte? Der halbe Satz hing in der Luft, zwischen ihm und ihr war für ein paar Sekunden eine etwas ratlose Stille.