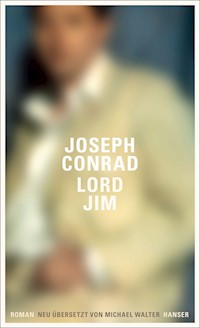9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Joseph Conrad, Gesammelte Werke in Einzelbänden
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Inmitten der endlosen Weite der Südsee vollzieht sich auf einer Insel das Schicksal des Sonderlings Axel Heyst, der mit einer jungen Frau vor der Welt geflüchtet ist und dennoch von dieser Welt eingeholt und auf Leben und Tod gefordert wird. »Das letzte Wort dieses Romans wurde am 29. Mai 1914 niedergeschrieben. Und jenes letzte Wort war der Titel. Damals war Friedenszeit. Da nun der Augenblick der Veröffentlichung herannaht, habe ich erwogen, ob es nicht angebracht sei, das Titelblatt zu ändern. Das Wort ›Sieg‹, jenes strahlende und tragische Ziel hohen Bemühens, schien zu groß, zu erhaben, um einem einfachen Roman voranstehen zu können. Was meine Entscheidung für diesen Titel vor allem beeinflußte, waren die dunklen Eingebungen jenes heidnischen Überbleibsels von Furcht und Wunderglauben, das immer noch in der Tiefe unserer alten Humanität lauert. ›Sieg‹ war das letzte Wort, das ich in Friedenszeiten geschrieben hatte. Es war mein letzter literarischer Einfall, bevor die Pforten des Janustempels tosend aufsprangen und überall auf der Welt Herz, Geist und Gewissen der Menschen erbeben ließen. Mit einer solchen Fügung durfte nicht leichtfertig umgegangen werden. Und so entschloß ich mich, das Wort stehenzulassen, in der gleichen Zuversicht, in der schlichte Bürger des alten Rom ›das Omen anzunehmen‹ pflegten.« Joseph Conrad schrieb diese Sätze in seinen Bemerkungen zur ersten Ausgabe des Romans.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 577
Ähnliche
Joseph Conrad
Sieg
Eine Inselgeschichte
Aus dem Englischen von Walter Schürenberg
FISCHER E-Books
Inhalt
Die englische Originalausgabe erschien 1915 unter dem Titel ›Victory‹
Für Perceval und Maisie Gibbon
Gestalten rief ich und sah düstere Schatten winken,
Überird’sche Wesen, die Menschennamen
Auf Sand und Strand und Wüstenerde schrieben.
Milton, Comus
Erster Teil
I
In unserem wissenschaftlichen Zeitalter besteht, wie jeder Schuljunge weiß, eine sehr enge chemische Verwandtschaft zwischen Kohle und Diamanten. Das ist, glaube ich, auch der Grund dafür, daß manche Leute von der Kohle als von ›schwarzen Diamanten‹ sprechen. Beide Gebrauchsgüter stellen Reichtum dar; aber Kohle ist eine sehr viel unhandlichere Form von Besitz. Unter diesem Gesichtspunkt weist sie einen bedauerlichen Mangel an Dichte auf. Wenn man noch ein Kohlenflöz in die Westentasche stecken könnte – aber das kann man nicht! Gleichzeitig geht von der Kohle, dieser höchsten Errungenschaft des Zeitalters, in dem man uns abgesetzt hat wie verdutzte Reisende in einem unruhigen Grand-Hotel, etwas Faszinierendes aus. Und ich vermute, daß diese beiden Bedeutungen der Kohle, die praktische und die mystische, Heyst – Axel Heyst – davon abhielten, einfach wegzugehen.
Die Tropical Belt Coal Company ging in Liquidation. Die Welt der Finanzen ist eine rätselhafte Welt, in der, so unglaublich es scheinen mag, die Verdampfung der Verflüssigung vorangeht. Zuerst verdampft das Kapital, und dann verflüssigt sich die Firma. Das ist eine einigermaßen unnatürliche Physik, aber ihr war der anhaltende Müßiggang Heysts zuzuschreiben, über den wir ›dort draußen‹ unsere Witze zu machen pflegten – wenn auch keine bösartigen. Ein untätiger Körper kann niemandem etwas zuleide tun, ruft keine feindlichen Gefühle hervor und lohnt kaum den Spott. Er mag immerhin manchmal im Wege sein, aber das konnte man von Axel Heyst nicht sagen. Er kam keinem Menschen ins Gehege, als säße er auf dem höchsten Gipfel des Himalaja, und genau so auffällig war er auch in mancher Beziehung. Jeder in dieser Weltecke wußte von ihm, der auf seiner kleinen Insel wohnte. Und eine Insel ist ja nichts weiter als der Gipfel eines Berges. Axel Heyst, der dort festsaß, war nicht von dem unabsehbaren, mit der Unendlichkeit verschmelzenden, stürmischen und glasklaren Luftmeer umgeben, sondern von einer lauen, flachen See; einem kümmerlichen Ableger der großen Wasser, die die Kontinente unserer Erdkugel umspülen. Seine häufigsten Besucher waren Schatten, Wolkenschatten, welche die Monotonie der dumpf brütenden Tropensonne ablösten. Sein nächster Nachbar – und damit komme ich auf vergleichsweise belebtere Dinge – war ein träger Vulkan, der den ganzen Tag über schwach rauchte und mit seiner Kuppe eben über den nördlichen Horizont ragte, aber bei Nacht aus den klaren Sternen ein seltsames rotes Glühen zu ihm herüberschickte, das sich sprunghaft ausbreitete und wieder zusammenfiel wie das Ende einer riesigen Zigarre, an der im Dunkel hin und wieder jemand pafft. Auch Axel Heyst war Raucher, und wenn er – als letztes vor dem Zubettgehen – mit seiner Zigarre müßig auf der Veranda saß, erzeugte er in der Nacht ein Glühen von gleicher Art und gleichem Umfang wie jener andere, der so viele Meilen entfernt war.
In gewissem Sinne leistete ihm der Vulkan Gesellschaft in der nächtlichen Dunkelheit, die oft – so meinte man – zu dicht war, um einen Lufthauch durchzulassen. Selten reichte der Wind aus, eine Feder fortzublasen. An den meisten Abenden des Jahres hätte Heyst mit einer bloßen Kerze draußen sitzen können, um in einem der Bücher zu lesen, die ihm sein Vater hinterlassen hatte. Der Vorrat war nicht gering. Aber das tat er nie. Aus Furcht vor Moskitos wahrscheinlich. Auch fühlte er sich durch die Stille nie versucht, irgendeine beiläufige Bemerkung an den gesellig aufglühenden Vulkan zu richten. Er war schließlich nicht geisteskrank. Ein komischer Kauz, ja – das hätte man von ihm sagen können, und das wurde auch gesagt; doch zwischen beidem ist ein gewaltiger Unterschied, das wird man mir zugeben.
In den Vollmondnächten war die Stille rings um Samburan – auf den Karten als ›Runde Insel‹ verzeichnet – überwältigend, und in der Flut kalten Lichts konnte Heyst seine unmittelbare Umgebung wahrnehmen; sie bot den Anblick einer verlassenen Siedlung, in die der Dschungel eingebrochen ist: formlose Dächer über niederer Vegetation, gebrochene Schatten von Bambushecken gegen den leuchtenden Schein hoher Gräser, etwas wie ein überwachsenes Stückchen Weg, das sich zwischen zottigem Gesträuch zu der nur etwa hundert Meter entfernten Küste senkte, mit einem schwarzen Pier und einer Art Mole, die auf ihrer unbeleuchteten Seite ganz tintig war. Aber der auffälligste Gegenstand war eine riesige schwarze Tafel, auf zwei Pfosten erhöht, die Heyst, wenn das Mondlicht auf jene Seite fiel, die weißen Lettern ›T. B. C. Co.‹ in einer mindestens halbmeterhohen Zeile entgegenhielt. Das waren die Initialen der Tropical Belt Coal Company, seiner Arbeitgeberin – seiner verflossenen Arbeitgeberin, um genau zu sein.
Entsprechend der widernatürlichen Geheimlehre der Finanzen ging die T. B. C. Company, nachdem ihr Kapital im Laufe von zwei Jahren verdampft war, in Liquidation – gezwungenermaßen, wie ich glaube, nicht freiwillig. Die Sache selbst indessen verlief ganz zwanglos. Sie schleppte sich hin; und während die Liquidation – in London und Amsterdam – ihren trägen Lauf nahm, blieb Axel Heyst, der im Prospekt als ›Betriebsleiter in den Tropen‹ figurierte, auf seinem Posten in Samburan, der Kohlenstation Nr. 1 der Gesellschaft.
Und es war nicht nur eine Kohlenstation. Es gab dort auch eine Kohlenmine, die am Berghang, knapp fünfhundert Meter von der verfallenen Hafenanlage und der imposanten Tafel, zutage trat. Es war das Ziel der Gesellschaft gewesen, alle Kohlenvorkommen auf den tropischen Inseln in Besitz zu nehmen und sie an Ort und Stelle abzubauen. Und es gab, weiß Gott, jede Menge von Kohlenvorkommen. Heyst war es, der auf seinen ziemlich planlosen Wanderungen die meisten Kohlenvorkommen in diesem Teil des tropischen Landgürtels ausfindig gemacht hatte, und da er ein fixer Briefschreiber war, hatte er seitenlang darüber an seine Freunde in Europa geschrieben. So erzählte man wenigstens.
Wir glaubten nicht, daß sich irgendwelche Vorstellungen von Reichtum damit verbanden – jedenfalls nicht für ihn selbst. Anscheinend war seine Hauptsorge dabei der »Fortschritt«, wie er es nannte, offenbar in Richtung auf die allgemeine Ordnung des Universums. Einige hundert Leute auf den Inseln hatten ihn von einem »gewaltigen Fortschritt in diesen Regionen« sprechen hören. Die überzeugte Handbewegung, mit der er die Phrase begleitete, suggerierte von diesem Fortschritt zu erfassende tropische Weiten. Das hatte zusammen mit seinen vollendeten Manieren etwas Bezwingendes, ließ jedenfalls die Zuhörer, wenigstens eine Zeitlang, verstummen. Niemand machte sich die Mühe, mit ihm zu streiten, wenn er sich in dieser Tonart erging. Sein Eifer konnte keinem Menschen schaden. Es bestand auch keine Gefahr, daß irgend jemand seinen Traum von der tropischen Kohle ernst nahm, wozu sollte man also seine Gefühle verletzen?
So urteilten Männer in angesehenen Handelskontoren, bei denen er als einer, der mit Empfehlungsbriefen – und auch mit bescheidenen Kreditbriefen – in den Osten gekommen war, Besuch machte, einige Jahre bevor diese Kohlenminen in seinen höflich gedrechselten Reden aufzutauchen begannen. Von Anfang an bestand einige Schwierigkeit, seinen Aufenthaltsort auszumachen. Dabei war er kein Reisender. Ein Reisender kommt an und reist wieder ab, fährt irgendwohin weiter. Heyst fuhr nicht ab. Ich traf einmal einen Mann, den Filialleiter der Oriental Banking Corporation in Malakka, zu dem Heyst ohne irgendeinen besonderen Anlaß (es war im Billardzimmer des Klubs) in den Ruf ausgebrochen war:
»Ich bin von diesen Inseln verzaubert!«
Das stieß er plötzlich hervor, à propos des bottes, wie die Franzosen sagen, während er sein Queue kreidete. Und vielleicht war es wirklich eine Art von Verzauberung. Es gibt eben mehr Zauberkräfte, als unsere Allerweltsmagier sich je träumen lassen.
Der magische Zirkel in Heysts Fall war ungefähr ein Kreis mit einem Radius von achthundert Meilen, gezogen um einen bestimmten Punkt in Nord-Borneo. Er berührte eben noch Manila, dort war Heyst gesichtet worden. Er berührte noch Saigon, und auch dort hatte man ihn einmal gesehen. Das waren vielleicht seine Versuche auszubrechen. Wenn ja, so waren sie gescheitert. Es muß ein Zauber gewesen sein, der sich nicht brechen ließ. Der Filialleiter – der Mann, der den Ausruf gehört hatte – war von dem Ton, dem Nachdruck, der Verzückung, was auch immer es war, oder von der Ungereimtheit desselben so beeindruckt gewesen, daß er ihn mehr als einer Person berichtet hatte.
»Komischer Kauz, dieser Schwede«, bemerkte er nur dazu; aber daraus entstand der Name ›der verzauberte Heyst‹, den manche unserem Manne anhängten.
Er hatte noch andere Namen. In seinen früheren Jahren, lange bevor er so vorteilhaft kahl auf dem Kopfe wurde, führte er sich einmal mit einem Empfehlungsschreiben bei Mr. Tesman von Tesman Brothers, einer erstklassigen Firma in Surabaja, ein. Nun war Mr. Tesman ein netter, wohlwollender alter Herr. Er wußte nicht, was er mit dem Besucher anfangen sollte. Nachdem er ihm gesagt hatte, sie wünschten, ihm den Aufenthalt auf den Inseln so angenehm wie möglich zu machen, und seien bereit, ihn bei seinen Plänen zu unterstützen undsoweiter, und nachdem er Heysts Danksagung entgegengenommen hatte – man kennt ja diese Art von Konversation –, fragte er in gemütlichem väterlichem Ton:
»Und Sie interessieren sich für –?«
»Fakten«, fiel Heyst auf seine zuvorkommende Art ein. »Nichts ist so lohnend wie Fakten. Harte Fakten! Nichts als Fakten, Mr. Tesman.«
Ich weiß nicht, ob der alte Tesman ihm beipflichtete oder nicht, aber er muß darüber gesprochen haben, denn eine Zeitlang bekam unser Mann den Spitznamen ›Harte Fakten‹. Er hatte das seltene Glück, daß seine Aussprüche an ihm hängenblieben und Teil seines Namens wurden. Danach trieb er sich auf einigen von Tesmans Handelsschonern in der Javanischen See herum und verschwand dann an Bord eines arabischen Schiffes in Richtung Neu-Guinea. In jenem entlegenen Teil seines Zauberkreises blieb er so lange, daß er fast schon vergessen war, als er auf einer Eingeborenen-Prau voller Vagabunden aus Goram wieder in Sicht kam, von der Sonne schwarz gebrannt, sehr mager, mit stark gelichtetem Haar und unter dem Arm eine Mappe mit Skizzen. Diese zeigte er bereitwillig vor, war aber in jeder anderen Beziehung sehr zurückhaltend. Er habe eine »vergnügte Zeit« gehabt, sagte er. Ein Mann, der zum Vergnügen nach Neu-Guinea geht – na schön!
Später, Jahre danach, als die letzten Spuren der Jugend von seinem Gesicht und alle Haare von seinem Kopf geschwunden waren und sein rötlich goldener Schnurrbart zu wahrhaft stattlicher Länge gewachsen war, hängte ihm ein gewisser übel beleumdeter Weißer ein neues Epitheton an. Während er mit zittriger Hand ein hohes Glas, das er ausgeleert und das Heyst bezahlt hatte, niedersetzte, sagte er mit jenem bedächtigen Scharfsinn, dessen kein bloßer Wassertrinker fähig ist:
»Heyst is’n pöfekter Gen’lman. Pöfekt! Aber er is’n Ut-uto-utopist.«
Heyst hatte prompt diesen Ort öffentlicher Erquickung, wo der Ausspruch gefallen war, verlassen. Utopist, wie? Fürwahr, das einzige, was ich von ihm hörte und was man vielleicht in diesem Sinne auslegen konnte, war seine Einladung an den alten McNab persönlich. Sich mit jener vollendeten, für ihn so bezeichnenden Höflichkeit in Benehmen, Geste und Stimme umwendend, hatte er mit feinem Humor gesagt:
»Kommen Sie und löschen Sie Ihren Durst mit uns, Mister McNab!«
Vielleicht war es das. Ein Mann, der auch nur im Scherz den Vorschlag machen konnte, des alten McNab Durst löschen zu wollen, mußte ein Utopist und Schimärenjäger sein; denn ausgesprochene Ironie war nicht Heysts starke Seite. Aus diesem Grund eben war er vielleicht so allgemein beliebt. In jener Epoche seines Lebens, auf der Höhe seiner physischen Entwicklung, von breiter, kraftstrotzender Erscheinung, glich er mit seinem kahlen Kopf und langen Schnurrbart Bildern Karls XII. abenteuerlichen Angedenkens. Zu der Annahme indessen, Heyst sei auch nur im geringsten eine Kämpfernatur, bestand kein Grund.
II
Etwa zu dieser Zeit ging Heyst eine geschäftliche Partnerschaft mit Morrison ein, über deren Bedingungen die Leute im Zweifel waren. Einige sagten, er sei Teilhaber, andere sagten, er sei eine Art von ›paying guest‹, aber in Wahrheit war die Angelegenheit viel komplexer. Eines Tages tauchte Heyst in Timor auf. Warum von allen Orten der Welt gerade in Timor, weiß niemand. Kurz, er lag bei Delly, jenem stark verseuchten Ort, vor Anker, vielleicht auf der Suche nach irgendwelchen noch unbekannten Fakten, als er auf der Straße auf Morrison stieß, der – auf seine Art – ebenfalls ein ›Verzauberter‹ war. Wenn man zu Morrison – er stammte aus Dorsetshire – von heimfahren sprach, schüttelte er sich. Er sagte, es sei dort dunkel und feucht; man lebe dort wie mit Kopf und Schultern in einem nassen Jutesack. Aber das war nur seine übertreibende Art zu reden. Morrison war ›einer von uns‹. Er war Eigentümer und Kapitän der Capricorn, einer Handelsbrigg, und es hieß, daß er sich gut dabei stehe, abgesehen von dem Nachteil eines allzu großen Altruismus. Er war der lieb und wert gehaltene Freund einer Reihe gottverlassener Dörfer an finsteren Flußläufen und obskuren Buchten, bei denen er ›Produkte‹ einhandelte. Oft fuhr er durch äußerst gefährliche Kanäle zu irgendeiner elenden Siedlung, nur um dort eine halb verhungerte Bevölkerung vorzufinden, die ihn um Reis bestürmte und nicht einmal über so viel ›Produkte‹ verfügte, um auch nur Morrisons Handkoffer zu füllen. Unter allgemeinen Freudenbezeugungen brachte er gleichwohl den Reis an Land, erklärte den Leuten, daß das ein Vorschuß sei und sie nun in seiner Schuld stünden, predigte ihnen Fleiß und Energie und schrieb einen umständlichen Vermerk in einen Taschenkalender, den er stets bei sich trug; damit war die Transaktion für gewöhnlich beendet. Ich weiß nicht, ob Morrison auch so dachte, aber für die Dorfbewohner bestand daran nicht der geringste Zweifel. Wann immer so ein Küstendorf die Brigg sichtete, begann man dort alle Gongs zu schlagen und alle Wimpel zu hissen; alle Mädchen steckten sich Blumen ins Haar, die Menge reihte sich am Ufer auf, und Morrison blickte strahlend und glänzenden Auges durch sein Monokel mit tiefer Befriedigung auf den ganzen Tumult. Er war groß, hohlwangig und sauber rasiert und sah aus wie ein höherer Anwalt, der seine Perücke den Hunden vorgeworfen hat.
Wir pflegten ihm Vorhaltungen zu machen:
»Sie werden von Ihren Vorschußlieferungen nie etwas wiedersehen, wenn Sie so weitermachen, Morrison.«
Dann setzte er eine wissende Miene auf.
»Ich werde sie schon eines Tages ausquetschen – keine Sorge. Und dabei fällt mir ein« – er zog sein unvermeidliches Notizbuch hervor – »dieses Dorf Soundso. Denen geht es wieder recht gut; die kann ich mal fürs erste ausquetschen.«
Er machte eine rigorose Eintragung in sein Notizbuch.
Memo: – Ausquetschen Dorf Soundso, bei erstbester Gelegenheit.
Dann steckte er den Bleistift zurück und ließ das Gummiband mit unerbittlicher Endgültigkeit zuschnappen; aber nie begann er mit dem Ausquetschen. Manche murrten über ihn, er verderbe das Geschäft. Nun, bis zu einem gewissen Grade vielleicht; aber nicht sehr. Die meisten Orte, mit denen er Handel trieb, waren nicht nur in der Geographie unbekannt, sondern auch dem Spezialwissen der Händler verborgen, das ganz unauffällig von Mund zu Mund weitergegeben wird und einen Grundstock mysteriöser Ortskenntnis bildet. Man ließ auch durchblicken, Morrison habe in jedem einzelnen dieser Dörfer eine Frau, aber die meisten von uns wiesen solche Andeutungen entrüstet zurück. Er war ein wahrer Menschenfreund und eher ein Asket als das Gegenteil.
Als Heyst ihn in Delly traf, ging Morrison mit hängendem Kopf, das Einglas über die Schulter geworfen, die Straße entlang und bot den hoffnungslosen Anblick jener hartgesottenen Tramps, die man auf unseren Straßen von Arbeitshaus zu Arbeitshaus trotten sieht. Als er über die Straße hinweg angerufen wurde, blickte er verstört und kummervoll auf. Er war wirklich in Schwierigkeiten. Vor einer Woche hatte er Delly angelaufen, und die portugiesischen Behörden hatten unter dem Vorwand, daß seine Papiere nicht in Ordnung seien, ihm eine Geldstrafe auferlegt und seine Brigg beschlagnahmt.
Morrison hatte nie überflüssiges Bargeld in der Hand. Bei seinen Handelsmethoden wäre das auch seltsam gewesen, und all die in dem Notizbuch vermerkten Außenstände waren keinen Milreis Kredit wert – ganz zu schweigen von einem Schilling. Die portugiesischen Beamten baten ihn, sich nicht zu beunruhigen. Sie gaben ihm eine Woche Aufschub und schlugen vor, danach die Brigg zu versteigern. Das bedeutete für Morrison den Ruin, und als Heyst ihn über die Straße in seinem gewohnten höflichen Ton begrüßte, war die Woche nahezu abgelaufen.
Heyst ging zu ihm hinüber und sagte mit einer leichten Verbeugung, etwa so wie ein Fürst einen anderen bei privater Gelegenheit anredet:
»Was für ein unerwartetes Vergnügen. Hätten Sie etwas dagegen, in jener verrufenen Weinschenke dort drüben etwas mit mir zu trinken? Für eine Unterhaltung auf der Straße ist die Sonne wirklich zu heiß.«
Der verstörte Morrison folgte ihm gehorsam in die düstere, kühle Spelunke, die zu betreten er zu jeder anderen Zeit für unter seiner Würde gehalten hätte. Er war ganz benommen. Er wußte nicht, was er tat. Man hätte ihn ebensogut über den Rand eines Abhanges hinunterschubsen können wie in diese Weinkneipe. Er setzte sich nieder wie ein Automat. Er war sprachlos, sah aber ein Glas mit herbem Rotwein vor sich und trank es aus. Mittlerweile hatte Heyst, höflich und aufmerksam, sich ihm gegenübergesetzt.
»Ich fürchte, Sie sind im Begriff, einen Fieberanfall zu bekommen«, sagte er mitfühlend.
Das löste dem armen Morrison endlich die Zunge.
»Fieber!« rief er aus. »Geben Sie mir Fieber. Meinetwegen die Pest. Das sind Krankheiten. Damit wird man fertig. Aber ich werde glatt umgebracht. Von den Portugiesen umgebracht. Die Bande hier hat mich endlich untergekriegt. Übermorgen soll’s mir an die Kehle gehen.«
Auf diesen leidenschaftlichen Ausbruch reagierte Heyst mit einem ganz leichten, überraschten Hochziehen der Augenbrauen, das ebensogut in einen Salon gepaßt hätte. Morrisons verzweifelte Beherrschung war zusammengebrochen. Mit ausgedörrter Kehle war er kreuz und quer durch das elende Kaff aus Lehmhütten gewandert, stumm, ohne eine Seele, an die er sich in seiner Not hätte wenden können, und vollkommen wahnsinnig gemacht von seinen Gedanken; und da war er nun plötzlich auf einen Weißen gestoßen – weiß im übertragenen und im buchstäblichen Sinne, denn die portugiesischen Beamten vermochte Morrison nicht als weißrassig anzuerkennen. Die Ellbogen auf den Tisch gestemmt, das bleiche, unrasierte Gesicht von dem Rand seines runden Korkhelms beschattet, gab er sich dem bloßen Trost eines heftigen Redeschwalls hin, wobei ihm die Stimme fast versagte. Sein weißer Anzug, den er seit drei Tagen auf dem Leib hatte, war verschmutzt. Er sah schon ganz verkommen und rettungslos verloren aus. Heyst war über den Anblick entsetzt; aber er ließ sich nichts anmerken und verhehlte seinen Eindruck unter den vollendet guten Manieren, die ihm eigen waren. Er trug die höfliche Aufmerksamkeit zur Schau, die ein Gentleman einem anderen beim Zuhören schuldet, und das wirkte, wie immer, ansteckend, so daß Morrison sich zusammenriß und seinen Bericht im Plauderton und in weltmännischer Haltung beendete.
»Es ist ein schändliches Komplott. Und leider ist man demgegenüber hilflos. Dieser Schurke Cousinho – Andreas, Sie wissen – trachtet seit Jahren nach meiner Brigg. Natürlich würde ich sie nie verkaufen. Sie ist nicht nur mein Lebensunterhalt, sie ist mein Leben. Und darum hat er diese nette kleine Verschwörung mit dem Leiter des Zollamts ausgeheckt. Die Versteigerung ist natürlich nur eine Farce. Hier gibt’s keinen, der darauf bieten könnte. Er wird die Brigg für ein Butterbrot bekommen – nein, nicht einmal das – für einen Brotkrümel. Sie waren jetzt einige Jahre auf den Inseln, Heyst. Sie kennen uns alle; Sie haben gesehen, wie wir leben. Jetzt werden Sie Gelegenheit haben zu sehen, wie einer von uns endet; denn es ist das Ende – für mich. Ich kann mir da nichts mehr vormachen. Sie sehen das ein – nicht wahr?«
Morrison hatte sich zusammengenommen, aber man spürte das Krampfhafte seiner wiedererlangten Selbstbeherrschung. Heyst wollte gerade sagen, daß er ›die ganze Tragweite dieser unglücklichen Sache durchaus – ‹, als Morrison ihn plötzlich unterbrach.
»Mein Ehrenwort, ich weiß nicht, weshalb ich Ihnen das alles erzählt habe. Ich vermute, der Anblick eines durch und durch weißen Mannes wie Sie machte es mir unmöglich, meinen Kummer für mich zu behalten. Es läßt sich mit Worten nicht sagen; aber da ich Ihnen soviel erzählt habe, kann ich Ihnen ebensogut auch das noch sagen. Hören Sie. Heute morgen an Bord, in meiner Kajüte, bin ich auf die Knie gefallen und habe um Hilfe gefleht. Auf den Knien!«
»Sie sind gläubig, Morrison?« fragte Heyst mit einem deutlichen Anflug von Respekt.
»Ein Heide bin ich bestimmt nicht.«
Morrison hatte in seiner Antwort einen leisen Vorwurf mitschwingen lassen, und es entstand eine Pause, während der Morrison vielleicht sein Gewissen prüfte und Heyst seine ungerührte, höflich interessierte Miene bewahrte.
»Natürlich betete ich wie ein Kind. Ich glaube an betende Kinder – nun ja, an betende Frauen auch, aber von Männern, meine ich, erwartet Gott etwas mehr Selbstvertrauen. Ich halte nichts von einem Manne, der den Allmächtigen endlos mit seinen Sorgen belästigt. Eine ziemliche Unverfrorenheit, finde ich. Gleichviel, heute morgen – und ich habe nie wissentlich irgendeinem Geschöpf Gottes etwas zuleide getan – betete ich. Es überkam mich plötzlich – plumps, lag ich auf den Knien; daraus mögen Sie ersehen – «
Beide blickten einander ernsthaft in die Augen. Der arme Morrison fügte noch etwas kleinlaut hinzu:
»Nur ist das hier ein so gottverlassenes Nest.«
Heyst erkundigte sich auf taktvolle Art, ob er den Betrag erfahren dürfe, auf Grund dessen die Brigg beschlagnahmt sei.
Morrison unterdrückte einen Fluch und nannte barsch eine Summe, die an sich so geringfügig war, daß jeder andere als Heyst sich laut ereifert hätte. Und selbst Heyst konnte kaum ein ungläubiges Staunen in seinem höflich gemessenen Ton unterdrücken, als er fragte, ob Morrison tatsächlich dieser. Betrag nicht zur Hand habe.
Morrison hatte ihn nicht. Er hatte nur ein bißchen englisches Gold an Bord, ein paar Sovereigns. Sein ganzes verfügbares Geld hatte er bei den Tesmans in Samarang gelassen, zur Bezahlung gewisser Rechnungen, die während seiner Abwesenheit fällig würden. Jedenfalls war dieses Geld für ihn ebenso wertlos, als wäre es in die untersten Regionen des Inferno gesunken. All das gab er offen zu. Er blickte mit plötzlicher Mißbilligung auf die edle Stirn, den martialischen Schnurrbart und die müden Augen des Mannes, der ihm gegenübersaß. Wer, zum Teufel, war das? Wer war er, Morrison, daß er sich so benahm, so redete? Morrison wußte von Heyst nicht mehr als wir alle, die wir im Archipel Handel trieben. Wenn der Schwede sich plötzlich erhoben und ihm eins auf die Nase gegeben hätte, wäre er nicht entgeisterter gewesen als nun, da dieser Fremde, dieser zwielichtige Reisende, mit einer leichten Verbeugung über den Tisch hinweg sagte:
»Oh! Wenn’s so ist, würde ich mich glücklich schätzen, wenn Sie mir erlauben würden, Ihnen dienlich zu sein!«
Morrison begriff nicht. Das war etwas, das einfach nicht vorkam – eine unerhörte Sache. Er hatte keine Ahnung, was das heißen sollte, bis Heyst mit Bestimmtheit sagte:
»Ich kann Ihnen den Betrag vorschießen.«
»Sie haben das Geld?« flüsterte Morrison. »Sie meinen, hier in der Tasche?«
»Ja, bei mir. Gern zu Diensten.«
Morrison starrte offenen Mundes, langte über die Schulter nach seinem Monokel, das ihm auf dem Rücken hing. Als er es hatte, klemmte er es hastig ins Auge. Ungefähr als erwarte er, daß sich Heysts üblicher weißer Tropenanzug in ein schimmerndes, bis auf die Füße fließendes Gewand verwandeln würde mit einem Paar glänzender Flügel, die dem Schweden an den Schultern sprießen würden – und als wolle er sich kein Detail dieser Verwandlung entgehen lassen. Wenn aber Heyst ein Engel von der Höhe war, auf ein Gebet hin entsandt, so ließ er sich doch diese himmlische Abkunft äußerlich nicht anmerken. Statt also niederzuknien, wozu er durchaus bereit war, streckte Morrison nur die Hand aus, die Heyst mit gebührender Bereitwilligkeit und einem höflichen Murmeln ergriff, wovon gerade noch die Worte »Lappalie – hocherfreut – zu Diensten« verständlich waren.
›Es gibt noch Wunder‹, dachte der von ehrfürchtiger Scheu ergriffene Morrison. Für ihn wie für uns alle auf den Inseln schien dieser wandernde Heyst, der sich offenbar weder tummelte noch schuftete, der allerletzte, um als Sendbote der Vorsehung in einer Angelegenheit zu fungieren, die mit Geld zu tun hatte. Die Tatsache seines Auftauchens in Timor oder irgendwo sonst war nicht wunderbarer als das Herbeiflattern eines Sperlings, der sich irgendwann auf unserm Fensterbrett niederläßt. Daß er aber eine Geldsumme bei sich in der Tasche hatte, war irgendwie unbegreiflich.
So unbegreiflich, daß Morrison, während sie zusammen durch den Sand der Fahrstraße zu dem Zollhaus – wieder einer Lehmhütte – trotteten, um die Strafe zu bezahlen, der kalte Schweiß ausbrach, er kurz anhielt und hervorstotterte:
»Hören Sie! Sie scherzen doch nicht, Heyst?«
»Scherzen!« Heysts blaue Augen verhärteten sich, indem er den aus der Fassung geratenen Morrison anblickte. »In welcher Beziehung, wenn ich fragen darf?« setzte er mit frostiger Höflichkeit hinzu.
Morrison war beschämt.
»Verzeihen Sie mir, Heyst. Sie müssen von Gott gesandt sein, als Antwort auf mein Gebet. Aber ich bin seit drei Tagen völlig kopflos vor lauter Sorgen; und plötzlich fuhr’s mir durch den Sinn: ›Was ist, wenn der Teufel ihn geschickt hat?‹«
»Ich unterhalte keine Beziehungen mit dem Übernatürlichen«, sagte Heyst herablassend und schritt weiter. »Mich hat niemand geschickt. Ich kam nur zufällig vorbei.«
»Ich weiß es besser«, widersprach Morrison. »Ich verdiene es gewiß nicht, aber ich bin erhört worden. Ich weiß es. Ich fühle es. Weshalb sonst sollten Sie – «
Heyst neigte den Kopf, als respektiere er eine Überzeugung, die er nicht zu teilen vermochte. Aber er blieb bei seiner Meinung, und murmelte, angesichts einer Widerwärtigkeit wie dieser sei es nur selbstverständlich –
Später, an Bord der Brigg – die Zahlung war geleistet, die Wache zurückgezogen –, begann Morrison, der nicht nur ein Gentleman, sondern auch eine ehrliche Haut war, von Zurückzahlung zu reden. Er kannte die eigene Unfähigkeit, sein Geld beisammen zu halten, sehr gut. Zum Teil lag das an den Umständen, zum Teil an seinem Temperament; und es wäre einigermaßen schwierig gewesen, hier die Schuld richtig zu verteilen. Selbst Morrison konnte es nicht sagen, obwohl er die Tatsache zugab. Mit kummervoller Miene machte er das Schicksal dafür verantwortlich.
»Ich weiß nicht, wie es kommt, daß ich es nie fertiggebracht habe, etwas zu sparen. Es ist eine Art von Fluch. Immer gibt’s ein oder zwei Rechnungen, die zu bezahlen sind.«
Er tauchte mit der Hand in die Tasche nach dem berühmten Notizbuch, das auf den Inseln so wohlbekannt war, dem Fetisch seiner Hoffnungen, und blätterte fieberhaft darin.
»Und doch – sehen Sie nur«, fuhr er fort. »Da steht’s – über fünftausend Dollar Außenstände. Wenn das nichts ist.«
Plötzlich verstummte er. Heyst, der sich die ganze Zeit bemüht hatte, so unbeteiligt wie möglich auszusehen, brummte begütigend. Aber Morrison war nicht nur ehrlich. Er war auch ein Mann von Ehre; und an diesem aufreibenden Tage, im Angesicht dieses erstaunlichen Boten der Vorsehung und im Aufruhr seiner Gefühle sprach er seinen großen Verzicht aus. Er verwarf die hartnäckig festgehaltene Illusion seiner Existenz.
»Nein. Nein. Die sind nichts wert. Ich werde es nie über mich bringen, sie einzutreiben. Niemals. Jahrelang habe ich das gesagt, aber ich geb’s auf. Ich habe nie wirklich daran geglaubt. Rechnen Sie nicht damit, Heyst. Ich habe Sie ausgebeutet.«
Der arme Morrison ließ tatsächlich seinen Kopf auf den Kajütentisch sinken und blieb in dieser zerknirschten Haltung, während Heyst ihm mit äußerstem Zartgefühl tröstend zuredete. Der Schwede war ebenso niedergeschlagen wie Morrison, denn er hatte für die Gefühle des anderen volles Verständnis. Anständige Gesinnung hatte Heyst noch keinem verübelt. Aber er brachte die äußere Herzlichkeit nicht auf, und dieser Mangel war ihm schmerzlich bewußt. Vollendete Manieren sind nicht das richtige Tonikum bei einem seelischen Zusammenbruch. Sie müssen alle beide dort in der Kajüte der Brigg ihre liebe Not gehabt haben. Schließlich verfiel Morrison, der in seiner düsteren Niedergeschlagenheit verzweifelt nach einem Ausweg suchte, auf die Idee, Heyst zum Mitfahren auf seiner Brigg einzuladen und ihm eine Beteiligung an seinen Handelsunternehmungen bis zur Höhe des Darlehens anzubieten.
Es war bezeichnend für Heysts ungebundene, schweifende Existenz, daß er ohne weiteres in der Lage war, diesen Vorschlag anzunehmen. Indessen spricht nichts dafür, daß er nun gerade von der Brigg aus in allen Winkeln und Ecken des Archipels, wo Morrison hauptsächlich Handel trieb, herumstöbern wollte. Weit gefehlt, aber er hätte sich mit fast jeder Abmachung einverstanden erklärt, nur um dieser qualvollen Szene in der Kajüte ein Ende zu machen. Sogleich ging mit Morrison eine große Veränderung vor, er richtete sein erniedrigtes Selbst wieder auf, klemmte das Monokel ins Auge, um Heyst liebevoll anzublicken, eine Flasche wurde entkorkt – undsoweiter. Man kam überein, keinem Menschen etwas von dieser Transaktion zu sagen. Morrison, versteht sich, war nicht sehr stolz auf die Sache und fürchtete, erbarmungslos ausgelacht zu werden.
»Ein alter Hase wie ich! Diesen verdammten portugiesischen Halunken in die Falle zu gehen! Das würde ich ewig zu hören bekommen. Wir müssen es geheimhalten.«
Aus ganz anderen Gründen, vor allem aus angeborener Diskretion, lag Heyst noch mehr daran, sich zum Stillschweigen zu verpflichten. Als Gentleman schrak er natürlich vor der Rolle eines himmlischen Sendboten zurück, die Morrison ihm mit aller Gewalt aufdrängen wollte. Schon dabei war Heyst gar nicht wohl. Auch war es ihm vielleicht nicht lieb, wenn sich herumspräche, daß er über einige Mittel verfügte, wieviel auch immer – jedenfalls genug, um Leuten Geld borgen zu können. So führten die beiden da unten ein Duett auf, wie Verschwörer in einer komischen Oper, mit ›Pst – pst, psssst! Schweig stille! Schweig stille!‹ Es muß komisch gewesen sein, weil sie es beide so ernst meinten.
Eine Zeitlang war denn auch die Verschwörung insoweit erfolgreich, als wir alle dachten, Heyst habe sich bei dem gutmütigen Morrison auf seiner Brigg einlogiert – um bei dem Dummkopf zu schmarotzen, sagten einige. Aber ihr wißt, wie das mit all solchen Geheimnissen geht. Immer ist irgendwo ein Leck. Morrison selbst, alles andere als ein gut abgedichteter Kahn, platzte vor Dankbarkeit und ließ wohl unter diesem Druck etwas Unbestimmtes durchsickern – genug, um dem Klatsch auf den Inseln Nahrung zu geben. Und ihr wißt auch, wie freundlich die Welt Dinge kommentiert, die sie nicht versteht. Ein Gerücht kam auf, Heyst habe einen geheimnisvollen Einfluß auf Morrison erlangt, sich an ihn gehängt und sauge ihn aus. Wer freilich dieses Gerede bis zu seinem Ursprung zurückverfolgt hatte, hütete sich, ihm Glauben zu schenken. Der Erfinder, so scheint es, war ein gewisser Schomberg, ein dicker bärtiger Mann von der teutonischen Rasse, mit einem losen Mundwerk, das zweifellos ständig in Bewegung war. Ob er ein Reserveleutnant war, wie er behauptete, weiß ich nicht. Hier draußen war er dem Beruf nach Hotelier, zuerst in Bangkok, dann irgendwo anders und zuletzt in Surabaja. Er schleppte straßauf straßab in diesem Teil des Tropengürtels eine kleine, stille und verängstigte Frau mit langen Locken hinter sich her, die einen töricht anlächelte und dabei einen blauen Zahn sehen ließ. Ich weiß nicht, weshalb so viele von uns seine diversen Etablissements frequentierten. Er war ein nichtsnutziger Esel und befriedigte seine Lust an übler Nachrede auf Kosten seiner Stammgäste. Er war es denn auch, der eines Abends, als Morrison und Heyst am Hotel vorbeigingen – sie gehörten nicht zu seinen regelmäßigen Gästen –, der gemischten Gesellschaft auf seiner Veranda geheimnisvoll zuflüsterte:
»Die Spinne und die Fliege, da gehen sie, meine Herren.« Dann legte er sehr gewichtig und vertraulich seine dicke Pranke an den Mund: »Wir sind unter uns; nun, meine Herren, ich kann nur sagen, lassen Sie sich nie mit diesem Schweden ein. Gehen Sie ihm nie ins Netz.«
III
Wie die menschliche Natur nun einmal ist und sowohl eine leichtfertige als auch eine niederträchtige Seite hat, so gab es nicht wenige, die entrüstet taten lediglich auf Grund der allgemeinen Neigung, alles Schlechte, das erzählt wird, zu glauben; und einer ganzen Reihe anderer machte es einfach Spaß, Heyst ›Die Spinne‹ zu nennen – hinter seinem Rücken, versteht sich. Er blieb davon ebenso unberührt und ahnungslos wie von seinen verschiedenen anderen Spitznamen. Aber manche Leute fanden wieder anderes über Heyst zu reden; nicht lange danach rückte er in größerem Zusammenhang stark in den Vordergrund des Interesses. Er nahm sozusagen feste Umrisse an. In den Augen der Öffentlichkeit war er der örtliche Manager der Tropical Belt Coal Company, mit Büros in London und Amsterdam und noch anderen Dingen, die sich großartig ausnahmen. Die Büros in den beiden Hauptstädten mochten – und so verhielt es sich wahrscheinlich – nur aus je einem Zimmer bestehen; aber durch die Entfernung hatte das alles, dort draußen im Osten, eine gewisse Aura. Wir waren mehr verblüfft als geblendet, das ist wahr; aber selbst die Nüchternsten unter uns glaubten allmählich, daß etwas daran sein müsse. Die Tesmans ernannten Agenten, der Postdienst durch Regierungsschiffe wurde kontraktlich gesichert, die Ära der Dampfkraft begann für die Inseln – ein großer Schritt vorwärts – Heysts ›Fortschritt‹!
Und all das fing mit der Begegnung zwischen dem in die Klemme geratenen Morrison und dem umherschweifenden Heyst an, mochte sie nun die unmittelbare Folge eines Gebets sein oder nicht. Morrison war kein Dummkopf, aber sein Verstand schien, was sein genaues Verhältnis zu Heyst betraf, von einer bemerkenswerten Umneblung befallen. Wenn nämlich Heyst, mit Geld wohlversehen, auf direkte Weisung des Allmächtigen und auf Morrisons Gebet hin geschickt worden war, bestand kein Grund zu besonderer Dankbarkeit, da er offenbar nicht anders gekonnt hatte. Aber Morrison glaubte an beides: an die Wirksamkeit des Gebets und an die unendliche Güte von Heyst. Er dankte Gott mit echter Demut für Seine Gnade und konnte sich Heyst gegenüber nicht genug für seine Hilfeleistung von Mann zu Mann erkenntlich zeigen. In dieser (ihm hoch anzurechnenden) heftigen Gefühlsverwirrung versteifte sich der dankbare Morrison auf Heysts Partnerschaft an seiner großen Entdeckung. Schließlich hörten wir, daß Morrison durch den Suezkanal heimgefahren war, um die grandiose Idee mit der Kohle in London persönlich zu vertreten. Er trennte sich von seiner Brigg und entschwand unserem Gesichtskreis; aber wir hörten von einem Brief oder Briefen an Heyst, worin er schrieb, daß London kalt und düster sei, daß ihm weder die Menschen noch die Dinge behagten und daß er sich »so einsam wie eine Krähe in einem fremden Land« fühle. In Wahrheit verzehrte er sich nach der Capricorn – ich meine das Schiff, nicht nur die Tropen. Schließlich fuhr er nach Dorsetshire zu seinen Verwandten, holte sich eine böse Erkältung und starb mit ungewöhnlicher Eile im Schoße seiner entsetzten Familie. Ob die Anstrengungen in der Londoner City seine Lebenskraft geschwächt hatten, weiß ich nicht; aber ich glaube, daß gerade dieser Besuch dem Kohle-Projekt zum Leben verhalf. Wie dem auch sei, die Tropical Belt Coal Company wurde geboren, kurz nachdem Morrison, das Opfer der Dankbarkeit und seines heimatlichen Klimas, gegangen war, um sich auf einem Kirchhof in Dorsetshire zu seinen Vorvätern zu versammeln.
Heyst war aufs tiefste betroffen. Er bekam die Nachricht auf den Molukken durch die Tesmans und verschwand dann eine Weile. Anscheinend hielt er sich bei einem holländischen Amtsarzt in Amboyna auf, einem Freund von ihm, der in seinem Bungalow ein wenig für ihn sorgte. Einigermaßen plötzlich tauchte er dann wieder auf, mit eingesunkenen Augen und gleichsam immer auf der Hut, als fürchte er, jemand werde ihm den Tod Morrisons zur Last legen.
Der naive Heyst! Als wäre das irgend jemand eingefallen … Keiner von uns interessierte sich im geringsten für Leute, die heimfuhren. Die waren erledigt; die zählten nicht mehr. Nach Europa fuhr man fast so endgültig wie gen Himmel. Damit schied ein Mann aus der Welt von Zufall und Abenteuer aus. Überhaupt erfuhren viele von uns erst Monate danach von diesem Todesfall – durch Schomberg, der eine völlig grundlose Abneigung gegen Heyst hatte und die Sache zu einem finsteren Gerücht aufbauschte, das er flüsternd weitergab:
»Das kommt davon, wenn man etwas mit diesem Burschen zu tun hat. Er preßt euch aus wie eine Zitrone und schickt euch dann weg – nach Hause zum Sterben. Nehmt Morrison als warnendes Beispiel.«
Natürlich lachten wir über die schwarzseherischen Andeutungen des Gastwirts. Einige von uns hörten, Heyst sei bereit, selbst nach Europa zu fahren, um sein Kohleprojekt persönlich voranzutreiben; aber er fuhr nicht. Es erübrigte sich. Die Gesellschaft wurde ohne ihn gegründet, und seine Ernennung zum Manager in den Tropen gelangte per Post an ihn.
Von Anfang an hatte er Samburan oder die Runde Insel als zentralen Sitz erwählt. Einige Exemplare des in Europa ausgegebenen Prospekts, die ihren Weg in den Osten gefunden hatten, gingen von Hand zu Hand. Wir staunten gewaltig über die Kartenskizze, die zur Erbauung der Aktionäre beigefügt war. Darauf war Samburan als der Mittelpunkt der östlichen Hemisphäre dargestellt und sein Name in riesigen Lettern eingezeichnet. Starke Linien strahlten von dort in allen Richtungen durch die Tropen und bildeten einen geheimnisvollen, mächtigen Stern – Einflußlinien, Entfernungslinien oder dergleichen. Es gibt kein romantischeres Temperament auf Erden als das des Propagandisten einer Aktiengesellschaft. Ingenieure kamen nach draußen, Kulis wurden importiert, Bungalows auf Samburan errichtet, ein Stollen in den Hang getrieben und tatsächlich etwas Kohle gefördert.
Diese Vorgänge machten die größten Skeptiker wankend. Eine Zeitlang redete alle Welt auf den Inseln von der Tropical Belt-Kohle, und sogar die, die insgeheim darüber lächelten, suchten nur ihr Unbehagen zu verbergen. O ja, es war soweit, und die Folgen lagen für jeden klar zutage – das Ende des individuellen Händlers, besiegelt durch eine große Invasion von Dampfschiffen. Wir konnten uns keine Dampfschiffe leisten. Wir nicht. Und Heyst war der Manager.
»Sie wissen doch, Heyst, der verzauberte Heyst.«
»Ach, gehen Sie! Der war doch weiter nichts als ein Herumtreiber, wenn wir uns recht erinnern.«
»Ja, er sagte immer, er sei auf Fakten aus. Nun hat er etwas, das uns alle zugrunde richtet«, bemerkte jemand bitter.
»Und das nennen sie dann Entwicklung – man sollte sie dran aufhängen!« murmelte ein anderer.
Nie zuvor war auf den tropischen Inseln so viel über Heyst geredet worden.
»Ist er nicht ein schwedischer Baron oder so etwas?«
»Der ein Baron? Kommen Sie doch nicht damit!«
Was mich betrifft, so zweifle ich nicht im geringsten daran. Als er noch zwischen den Inseln umherreiste, mysteriös und unbeachtet wie ein beliebiges Gespenst, hat er es mir selbst bei Gelegenheit gesagt. Das war lange bevor er auf diese beunruhigende Art als der Zerstörer unseres kleinen Gewerbes in Erscheinung trat – Heyst, der Feind.
Von Heyst als dem Feind zu sprechen, wurde bei vielen zu einer Mode. Er war jetzt eine konkrete Größe, deutlich sichtbar. Er sauste im ganzen Archipel umher, sprang von lokalen Postdampfern ab und wieder auf, als wären es Trambahnen, mal hier, mal da, und überall – ein großer Organisator. Das war kein Herumbummeln mehr. Das war Business. Und diese plötzliche Schaustellung zielbewußter Energie erschütterte die Ungläubigkeit der größten Skeptiker mehr, als es jeder wissenschaftliche Beweis des Werts dieser Kohlenvorkommen vermocht hätte. Es war höchst eindrucksvoll. Schomberg war der einzige, der dieser infektiösen Wirkung widerstand. Groß, männlich auf eine behäbige Art und mit reichlichem Bartwuchs, ein Glas Bier in der plumpen Tatze, so trat er wohl an einen Tisch, an dem das Thema der Stunde gerade erörtert wurde, hörte einen Augenblick zu und rückte dann mit seiner stereotypen Erklärung heraus:
»Das mag alles sein, meine Herren; aber mir kann er nichts von seinem Kohlenstaub in die Augen pusten. Da ist nicht viel dran. Woher auch, da kann einfach nichts dran sein. Ein Bursche wie der und Manager? Pah!«
War es die Klarsicht verbohrten Hasses oder nur die stupide Hartnäckigkeit einer Meinung, die manchmal am Ende auf erstaunliche Weise gegen die Welt recht behält? Die meisten von uns erinnern sich an Beispiele solch närrischen Triumphs; und dieser Esel Schomberg triumphierte. Die T. B. C. Co. ging in Liquidation, wie ich euch zu Anfang erzählte. Die Tesmans wuschen ihre Hände in Unschuld. Die Regierung annullierte die berühmten Verträge. Das Gerede erstarb, und jetzt stellte man hier und da fest, daß Heyst ganz und gar entschwunden war. Er war unsichtbar geworden, wie in jenen frühen Tagen, da er bei seinen Versuchen, den Zauber ›dieser Inseln‹ zu brechen, oft pfeilschnell außer Sicht entschwand, sei es in Richtung Neu-Guinea, sei es in Richtung Saigon – zu Kannibalen oder zu Cafés. Der verzauberte Heyst! Hatte er endlich den Zauber gebrochen? War er gestorben? Es war uns zu unwichtig, als daß wir uns allzu sehr darüber aufgehalten hätten. Wißt ihr, wir hatten ihn alles in allem ganz gern gemocht. Und Gernmögen genügt nicht, um das Interesse, das man an einem Menschen nimmt, wachzuhalten. Mit dem Haß verhält es sich da offenbar anders. Schomberg konnte Heyst nicht vergessen. Dieser schlaue, männliche Teutone war ein guter Hasser. Das kommt bei Toren öfter vor.
»Guten Abend, meine Herren. Haben Sie alles bekommen, was Sie wünschen? So! Gut! Sehen Sie? Was habe ich Ihnen immer gesagt? Aha! Da war nichts dran. Ich wußte es. Aber was ich gerne wissen möchte: was ist wohl aus diesem – Schweden geworden?«
Er betonte das Wort Schwede so, als hieße es soviel wie Halunke. Er verabscheute Skandinavier überhaupt. Warum? Das weiß nur Gott. Toren wie er sind unergründlich. Er fuhr fort: »Es ist fünf Monate oder länger her, seit ich mit jemand gesprochen habe, der ihn gesehen hat.«
Wie ich schon sagte, wir waren nicht besonders interessiert; aber Schomberg begriff das natürlich nicht. Seine Borniertheit war grotesk. Wann immer drei Leute in seinem Hotel zusammenkamen, sorgte er dafür, daß Heyst sozusagen mit anwesend war.
»Hoffe nur, der Bursche ist nicht hingegangen und hat sich ersäuft«, pflegte er mit komischem Ernst hinzuzufügen, was uns eigentlich einen Schauder hätte einjagen müssen; aber wir waren ein oberflächliches Grüppchen und durchschauten die Psychologie dieser frommen Hoffnung nicht.
»Wieso eigentlich? Heyst schuldet Ihnen doch keine Drinks, oder?« fragte ihn einmal jemand mit leichtem Unmut.
»Drinks! Ach herrje, nein!«
Der Gastwirt war kein Pfennigfuchser. Das liegt nicht im teutonischen Temperament. Dennoch setzte er eine düstere Miene auf, um uns mitzuteilen, Heyst habe alles in allem bei etwa drei Besuchen in seinem ›Etablissement‹ nicht bezahlt. Das war also Heysts Verbrechen, wofür Schomberg ihm nichts Geringeres als eine lange Folterqual wünschte. Man beachte den teutonischen Sinn für Proportion und freundliches Verzeihen. Eines Nachmittags schließlich sah man Schomberg auf eine Gruppe von seinen Stammgästen zugehen. Er war offensichtlich in Hochstimmung. Er reckte seine Männerbrust mit großer Gewichtigkeit.
»Gentlemen, ich habe Nachricht von ihm. Wem? Nun, diesem Schweden. Er ist immer noch auf Samburan. Er ist nie von da fortgewesen. Die Company ist fort, die Ingenieure sind fort, die Angestellten sind fort, die Kulis sind fort, alles ist fort; aber er klebt da fest. Captain Davidson, der von Westen her dort vorbeikam, hat ihn mit eigenen Augen gesehen. Etwas Weißes war auf der Mole; also dampfte er in die Bucht und ging in einem kleinen Boot an Land. Heyst, bei bester Gesundheit. Steckte sein Buch in die Tasche, höflich wie immer. Schlenderte gerade über die Mole und las dabei. ›Ich bleibe hier auf meinem Besitz‹, sagte er zu Captain Davidson. Ich möchte nur wissen, was er da zu essen bekommt. Hin und wieder ein Stück Dörrfisch – oder was? Ein ziemlicher Abstieg für einen Mann, der über meine Table d’hote die Nase rümpfte!«
Er zwinkerte ungeheuer maliziös. Eine Glocke ertönte, und er schritt voran in den Speisesaal wie in einen Tempel, sehr feierlich mit der Miene eines Wohltäters der Menschheit. Sie zu einem profitlichen Preis zu nähren, war sein Ehrgeiz; hinter ihrem Rücken über sie zu reden, sein Vergnügen. Es war bezeichnend für ihn, sich an der Vorstellung eines Heyst zu weiden, der nichts Ordentliches zu essen hatte.
IV
Ein paar von uns, die das nötige Interesse aufbrachten, gingen zu Davidson, um Näheres zu erfahren. Viel war es nicht. Er erzählte uns, wie er nördlich an Samburan vorbeifuhr, um zu sehen, was dort vorginge. Zuerst sah es aus, als wäre diese Seite der Insel ganz und gar verlassen. Das hatte er auch erwartet. Nun aber sah er über dem Dickicht von Vegetation, das Samburan dem Blick darbietet, die Spitze eines Fahnenmasts ohne Flagge. Als er dann den sanften Einschnitt, der eine Zeitlang offiziell als Schwarze-Diamanten-Bucht bekannt war, überquerte, konnte er mit seinem Glas die weiße Gestalt auf dem Bunker-Kai ausmachen. Das konnte nur Heyst sein.
»Ich nahm als sicher an, daß er mitgenommen werden wollte, und so dampfte ich in die Bucht. Er gab keinerlei Zeichen. Dennoch ließ ich ein Boot hinab. Ich konnte weit und breit kein anderes Lebewesen erblicken. Ja. Er hatte ein Buch in der Hand. Er sah ganz so aus, wie wir ihn immer gesehen haben – sehr elegant, weiße Schuhe, Korkhelm. Er erklärte mir, er habe schon immer einen Hang zur Einsamkeit gehabt. Das sei das erste, was ich hörte, sagte ich ihm. Er lächelte nur. Was konnte ich schon sagen? Er gehört nicht zu der Sorte, mit der man ungezwungen reden kann. Er hat so etwas. Man bemüht sich erst gar nicht.
›Aber zu welchem Zweck? Wollen Sie die Mine in Besitz behalten?‹ fragte ich ihn.
›So ungefähr‹, sagte er. ›Ich halte die Hand darauf.‹
›Aber das ist doch hier alles so tot wie Julius Cäsar‹, rief ich. ›Wirklich nichts, das festzuhalten sich lohnt, Heyst.‹
›Oh, mit den Fakten bin ich längst fertig‹, sagte er und legte stramm die Hand an seinen Helm, wobei er eine seiner knappen Verbeugungen machte.«
Auf solche Weise entlassen, ging Davidson wieder an Bord, legte das Schiff herum und beobachtete, während er abdampfte, von der Brücke aus Heyst, der auf der Mole landeinwärts ging. Er schritt in das hohe Gras und verschwand ganz – bis auf seinen weißen Korkhelm, der auf einem grünen Meer zu schwimmen schien. Dann verschwand auch dieser, gleichsam eingetaucht in die lebendigen Tiefen der tropischen Vegetation, die noch eifersüchtiger über die Eroberungen des Menschen wacht als der Ozean und die nun im Begriff war, sich über den letzten Spuren der Tropical Belt Coal Company mit A. Heyst als Manager im Osten zu schließen.
Davidson, auf seine Art ein guter, biederer Kerl, war seltsam berührt. Es muß bemerkt werden, daß er von Heyst nur sehr wenig wußte. Er gehörte zu denen, die Heysts vollendete Höflichkeit in Ton und Haltung ganz aus der Fassung brachte. An sich war er, glaube ich, ein feinfühliger Mensch, wenn auch natürlich ebenso ungehobelt wie wir alle. Wir waren von Natur eine burschikose Gesellschaft, mit eigenen Grundsätzen – nicht schlechter, möchte ich sagen, als die anderen Leute; aber feines Benehmen gehörte nicht dazu. Immerhin war Davidsons Feinfühligkeit so wirklichkeitsnah, daß er den Kurs des Dampfers, den er befehligte, änderte. Anstatt südlich an Samburan vorbeizufahren, machte er es sich zur Gewohnheit, die Durchfahrt längs der Nordküste zu nehmen, mit etwa einer Meile Abstand vom Landeplatz.
»Er kann uns sehen, wenn er uns sehen will«, bemerkte Davidson. Dann kam ihm noch ein Hintergedanke: »Ich meine, hoffentlich denkt er nicht, ich will mich aufdrängen, wie?«
Wir beruhigten ihn über diesen Punkt korrekten Verhaltens. Das Meer steht jedem offen.
Diese kleine Abweichung verlängerte Davidsons Route um einige zehn Meilen, aber da es sechshundert Meilen waren, fiel das nicht ins Gewicht.
»Ich habe meinem Reeder davon erzählt«, sagte der gewissenhafte Kapitän der Sissie.
Sein Reeder hatte ein Gesicht wie eine vertrocknete Zitrone. Er war klein und verhutzelt – was befremdete, denn im allgemeinen legt ein Chinese mit zunehmender Prosperität einige Zentimeter an Umfang und Statur zu. Einer chinesischen Firma zu dienen, ist nicht so schlecht. Wenn die einmal überzeugt sind, daß man ihre Interessen wahrt, kennt ihr Vertrauen keine Grenzen mehr. Man kann nichts falsch machen. Und so piepste Davidsons alter Chinese eilfertig:
»Allright, allright, allright. Ganz wie Sie wollen, Captain.«
Und damit war die Sache abgetan; indessen nicht ganz. Von Zeit zu Zeit pflegte der Chinese sich bei Davidson nach dem weißen Mann zu erkundigen. Er war immer noch da, wie?
»Ich sehe ihn nie«, mußte Davidson seinem Reeder gestehen, der ihn daraufhin schweigend durch seine runde Hornbrille anblickte, die für sein kleines altes Gesicht einige Nummern zu groß war. »Ich sehe ihn nie.«
Zu mir pflegte er gelegentlich zu sagen:
»Ich zweifle nicht, daß er da ist. Er hält sich verborgen. Das ist sehr unangenehm.« Er war ein bißchen verärgert über Heyst. »Komisch«, meinte er. »Von allen Leuten, mit denen ich rede, erkundigt sich keiner nach ihm, ausgenommen mein Chinese – und Schomberg«, fügte er nach einer Pause hinzu.
Ja, natürlich Schomberg. Er fragte jeden nach allem möglichen und entstellte das Gehörte so skandalös, wie es ihm sein Geist nur eingab. Von Zeit zu Zeit trumpfte er dann auf, mit sanftem Augenaufschlag, seinen dicken Lippen, seinem kastanienbraunen Bart, und sah wirklich hinterhältig aus.
»’n Abend, meine Herren. Sind Sie mit allem versorgt? So! Gut! Übrigens, wie ich höre, hat der Dschungel sogar die Baracken in der Black-Diamond-Bucht erdrückt. Tatsache. Jetzt ist er ein Einsiedler in der Wildnis. Aber was kann dieser Manager dort zu essen finden? Das ist mir ein Rätsel.«
Manchmal fragte dann ein Fremder mit echter Neugier:
»Wer? Was für ein Manager?«
»Oh, ein gewisser Schwede« – mit einem finsteren Beiklang, als wolle er sagen: »ein gewisser Straßenräuber – man kennt ihn hier gut. Aus purer Scham ist er zum Einsiedler geworden. So geht’s dem Teufel, wenn es ihn erwischt hat.«
Einsiedler. Das war der neueste der mehr oder weniger witzigen Spitznamen, die Heyst während seiner ziellosen Wanderschaft durch diesen Teil des tropischen Inselreichs angehängt wurden, wo das lose Mundwerk von Schomberg unsere Ohren peinigte.
Aber offenbar war Heyst von Natur gar kein Einsiedler. Der Anblick von seinesgleichen flößte ihm keinen unüberwindlichen Widerwillen ein. Wir müssen das annehmen, weil er aus diesem oder jenem Grund zeitweilig aus seinem Schlupfwinkel zum Vorschein kam. Vielleicht wollte er nur sehen, ob bei den Tesmans irgendwelche Briefe für ihn angekommen waren. Ich weiß es nicht. Niemand weiß es. Aber dieses Wiederauftauchen beweist, daß seine Absonderung von der Welt nicht vollkommen war. Und Unvollkommenheit jeder Art führt zu Komplikationen. Axel Heyst hätte sich nicht um seine Briefe kümmern sollen – oder was sonst es war, das ihn nach etwas mehr als anderthalb Jahren aus Samburan hervorlockte. Aber es half nichts. Er hatte nicht das Zeug zum Einsiedler! Das war das Unglück, so schien es.
Wie auch immer, plötzlich erschien er wieder in der Welt, breitbrüstig, kahlköpfig, langer Schnurrbart undsoweiter – der ganze Heyst, bis zu den freundlichen, tiefliegenden Augen, in denen noch der Schatten von Morrisons Tod weilte. Natürlich war es Davidson, der ihn von seiner entlegenen Insel mitgenommen hatte. Andere Möglichkeiten gab es nicht, es sei denn ein Eingeborenenschiff wäre vorbeigekommen – eine sehr unwahrscheinliche und geringe Chance, darauf zu warten. Ja, er kam mit Davidson, dem er unaufgefordert mitteilte, es sei nur für kurze Zeit – ein paar Tage, nicht mehr. Er wollte nach Samburan zurück.
Als Davidson sich über solche Narrheit entsetzt und ungläubig zeigte, erklärte ihm Heyst, er habe sich, als die Gesellschaft gegründet wurde, seine persönliche Habe aus Europa schicken lassen.
Für Davidson, wie für jeden von uns, war die Vorstellung, daß Heyst, der wandernde, schweifende, ungebundene Heyst, irgendwelches Eigentum besaß, um ein Haus einzurichten, eine verblüffende Neuigkeit. Eine groteske Idee. Es war, als hätte ein Vogel Grundbesitz gehabt.
»Eigentum? Sie meinen Tische und Stühle?« fragte Davidson mit unverhohlenem Staunen.
Eben das meinte Heyst. »Mein armer Vater starb in London. Seitdem hat das alles dort gelagert«, erklärte er.
»Die ganzen Jahre?« rief Davidson aus und dachte dabei, wie lange wir alle schon Heyst kannten als jemand, der in einer Wildnis von Baum zu Baum flattert.
»Sogar noch länger«, sagte Heyst, der sehr wohl verstanden hatte.
Das schien zu bedeuten, daß er schon ein Wanderleben geführt hatte, ehe er in unseren Gesichtskreis geraten war. Aber in welchen Gegenden? In welchem Alter? Geheimnis. Vielleicht war er ein Vogel, der nie ein eigenes Nest besessen hatte.
»Ich bin früh von der Schule abgegangen«, sagte er einmal bei der Überfahrt zu Davidson. »Das war in England. Eine sehr gute Schule Ich war nicht gerade eine Leuchte dort.«
Heysts Bekenntnisse. Keiner von uns – ausgenommen allenfalls Morrison, der tot war – hatte je so viel von seiner Lebensgeschichte gehört. Es scheint, daß die Erfahrungen des Einsiedlerlebens die Kraft haben, einem Menschen die Zunge zu lösen, nicht wahr?
Während dieser denkwürdigen Überfahrt auf der Sissie, die etwa zwei Tage dauerte, machte er aus freien Stücken noch einige Andeutungen – Mitteilungen konnte man es nicht nennen – über sein Leben. Und Davidson hörte interessiert zu. Es interessierte ihn nicht, weil die Andeutungen besonders aufregend gewesen wären, sondern weil eine angeborene Neugierde auf unsere Mitmenschen nun einmal zur menschlichen Natur gehört. Auch Davidsons Leben, im Hin- und Herfahren mit der Sissie auf dem Javanischen Meer, war entschieden langweilig und in gewissem Sinne einsam. Er hatte nie irgend jemand zur Gesellschaft an Bord. Eingeborene Deckpassagiere massenhaft, natürlich, aber niemals einen Weißen, so daß die Anwesenheit Heysts für zwei Tage ein Gottesgeschenk gewesen sein muß. Davidson erzählte uns später alles darüber. Heyst hatte gesagt, sein Vater habe viele Bücher geschrieben. Er sei ein Philosoph gewesen.
»Mir scheint, daß er auch ein bißchen verrückt gewesen ist«, bemerkte Davidson dazu. »Offenbar hatte er sich mit seiner Familie in Schweden schlecht vertragen. Genau die Art von Vater, die man bei Heyst vermuten sollte. Ist er selbst nicht ein bißchen komisch? Er erzählte mir, daß er sich unmittelbar nach dem Tode seines Vaters auf eigene Faust in die weite Welt aufgemacht hat, und er war immer auf Tour, bis er auf dieses berühmte Kohlenprojekt stieß. Das paßt irgendwie zu dem Sohn dieses Vaters, finden Sie nicht?«
Im übrigen war Heyst so höflich wie immer. Er erbot sich, für die Überfahrt zu bezahlen; aber als Davidson davon nichts wissen wollte, drückte er ihm herzhaft die Hand, machte eine gesittete Verbeugung und erklärte, er sei tief gerührt über dieses freundliche Entgegenkommen.
»Ich meine damit nicht den lächerlichen Betrag, den Sie nicht annehmen wollen«, fuhr Heyst fort, Davidsons Hand schüttelnd. »Aber mich rührt Ihre menschliche Art.« Neues Händeschütteln. »Glauben Sie mir, daß ich das tief zu würdigen weiß.« Letztes Händeschütteln. Aus alledem ergab sich, daß Heyst dem regelmäßigen Erscheinen der kleinen Sissie vor seiner Einsiedelei eine eigentümliche Bedeutung beimaß.
»Er ist ein Gentleman durch und durch«, sagte Davidson zu uns. »Es tat mir wirklich leid, als er an Land ging.«
Wir fragten ihn, wo er Heyst abgesetzt hätte.
»Wieso, in Surabaja – wo sonst?«
Die Tesmans hatten ihr Hauptbüro in Surabaja. Eine Beziehung zwischen Heyst und den Tesmans bestand seit langem. Die Ungereimtheit eines Einsiedlers mit eigenen Handelsbevollmächtigten befremdete uns ebensowenig wie die absurde Tatsache, daß ein vergessener, ausgedienter und abservierter Manager eines verrotteten und verblichenen Bankrottunternehmens noch Geschäfte wahrzunehmen hatte. Wir sagten Surabaja, natürlich, und nahmen als selbstverständlich an, daß er sich bei einem der Tesmans aufhielte. Einer von uns bezweifelte sogar, daß Heyst dort besonders willkommen sei; denn es war allgemein bekannt, daß Julius Tesman über das Fiasko der Tropical Belt Coal Company gewaltig verbittert war. Aber Davidson klärte uns auf. Die Sache war ganz anders. Heyst wollte in Schombergs Hotel absteigen und fuhr mit der Hotelbarkasse an Land. Nicht, daß es Schomberg eingefallen wäre, seine Barkasse zu einem bloßen Handelsdampfer wie der Sissie zu schicken. Aber sie war zu einem Küstendampfer hinausgefahren, und man hatte ihr signalisiert. Schomberg steuerte selbst.
»Ihr hättet sehen müssen, wie Schombergs Augen vorquollen, als Heyst mit einem alten braunen Lederkoffer in die Barkasse sprang!« sagte Davidson. »Er tat, als kenne er ihn nicht – zuerst jedenfalls. Ich ging nicht mit an Land. Wir blieben alles in allem nur ein paar Stunden. Luden zweitausend Kokosnüsse aus und fuhren wieder ab. Ich habe mich bereit erklärt, ihn auf meiner nächsten Fahrt in zwanzig Tagen wieder mitzunehmen.«
V
Auf seiner Rückfahrt verspätete sich Davidson zufällig um zwei Tage; das war nicht viel, gewiß nicht, aber er setzte seine Ehre darein, sogleich, noch während der heißesten Nachmittagsstunde, an Land zu gehen und Heyst zu suchen. Schombergs Hotel lag abseits in einer weiten Umzäunung, die einen Garten, ein paar hohe Bäume und unter deren weit ausgreifenden Ästen einen abgetrennten Saalbau umschloß, ›für Konzerte und andere Veranstaltungen‹, wie Schomberg es in seinen Prospekten bezeichnete. Fetzen von Plakaten mit großem rotem Aufdruck ›Jeden Abend Konzert‹ flatterten von den roh gemauerten Pfosten zu beiden Seiten des Eingangs.
Der Weg war weit und verdammt sonnig gewesen. Davidson stand auf der ›piazza‹, wie Schomberg es nannte, und wischte sich seinen nassen Hals und sein Gesicht. Mehrere Türen führten auf den Hof, aber alle Jalousien waren herabgelassen. Keine Seele ließ sich blicken, nicht einmal ein China-Boy – nichts als ein paar farbig gestrichene Stühle und Tische. Einsamkeit, Schatten und düsteres Schweigen – und eine schwache hinterhältige Brise, die von den Bäumen her wehte und dem schwitzenden Davidson einen leichten Schauer verursachte – jener kleine Schauer der Tropen, der speziell in Surabaja oft Fieber bedeutet und den unvorsichtigen weißen Mann ins Hospital bringt.
Der kluge Davidson suchte im nächstbesten verdunkelten Innenraum Schutz. In dem künstlichen Dunkel, jenseits der Flächen zugedeckter Billardtische, erhob sich eine bleiche Gestalt von zwei Stühlen, auf denen sie ausgestreckt gelegen hatte. Auf der Höhe des Mittags, wenn das zweite Frühstück mit Table d’hote vorbei war, machte Schomberg es sich bequem. Er streckte die Glieder, gewichtig, mit Bedacht, in Verteidigungsstellung, und sein großer üppiger Bart lag wie ein Küraß auf seiner Männerbrust. Er mochte Davidson nicht, der nie zu seinen treuen Kunden gehört hatte. Er schlug im Vorbeigehen auf eine Glocke auf einem der Tische und fragte in einem frostigen Reserveoffizierston:
»Sie wünschen?«
Der gute Davidson, immer noch seinen feuchten Nacken wischend, erklärte schlicht, daß er wie verabredet gekommen sei, um Heyst abzuholen.
»Nicht hier!«
Auf den Glockenton hin erschien ein Chinese. Schomberg wandte sich streng an ihn:
»Nimm die Bestellung des Herrn entgegen!«
Davidson mußte weiter. Er könne nicht warten – bäte nur, man möge Heyst mitteilen, daß die Sissie um Mitternacht ausliefe.
»Nicht hier, ich sage es Ihnen doch!«
Davidson schlug sich bekümmert aufs Knie.
»Mein Gott! Krankenhaus, vermutlich.« Eine hinreichend plausible Annahme in einer so fieberreichen Gegend.
Der Leutnant der Reserve warf nur die Lippen auf und zog die Brauen hoch, ohne Davidson anzusehen. Es konnte alles mögliche bedeuten, aber Davidson verwarf zuversichtlich die Idee mit dem Krankenhaus. Dennoch mußte er Heyst in der Zeit von jetzt bis Mitternacht auftreiben.
»Er hat hier gewohnt?« fragte er.
»Ja, er wohnte hier.«
»Können Sie mir sagen, wo er sich jetzt aufhält?« fuhr Davidson höflich fort. In seinem Innern wurde er allmählich besorgt, denn er war Heyst mit der Liebe eines freiwilligen Beschützers zugetan. Die Antwort, die er erhielt, lautete:
»Kann ich nicht sagen. Ist nicht meine Angelegenheit«, was, von einem feierlichen Kopfschütteln des Hoteliers begleitet, irgendein fürchterliches Geheimnis anzudeuten schien.
Davidson war die Höflichkeit in Person. Das war so seine Natur. Er ließ sich seine nicht gerade freundlichen Gefühle Schomberg gegenüber nicht anmerken.
›Sicher werde ich es im Büro der Tesmans erfahren‹, dachte er. Aber es war die heißeste Tageszeit, und wenn Heyst unten am Hafen gewesen war, würde er schon gehört haben, daß die Sissie eingelaufen war. Möglicherweise war Heyst sogar schon an Bord gegangen, wo er eine kühle Brise genießen konnte, die der Stadt versagt war. Davidson, der beleibt war, dachte vor allem an Kühle und hatte keine Neigung, sich zu bewegen. Gleichsam unentschlossen, zögerte er eine Weile. Schomberg, aus der Tür blickend, tat vollkommen gleichgültig. Aber er konnte das nicht durchhalten. Plötzlich wandte er sich und fragte in brüskem Ton:
»Sie wollten ihn sehen?«
»Ja, allerdings«, sagte Davidson. »Wir wollten uns treffen.« »Kümmern Sie sich nicht darum. Ihm wird jetzt nichts daran liegen.«
»Nein?«
»Nun, das können Sie sich selbst sagen. Er ist nicht hier, oder? Nehmen Sie mein Wort drauf. Kümmern Sie sich nicht um ihn. Ich rate Ihnen als Freund.«
»Danke«, sagte Davidson, innerlich erschrocken über den bissigen Ton. »Immerhin, ich denke, ich werde mich ein bißchen hinsetzen und einen Drink nehmen.«
Das hatte Schomberg ganz und gar nicht erwartet. Er rief brutal:
»Boy!«
Der Chinese kam herbei, und nachdem der Hotelier ihn durch ein Kopfnicken an den weißen Mann verwiesen hatte, ging er, etwas vor sich hinmurmelnd, hinaus. Davidson hörte ihn mit den Zähnen knirschen.
Davidson saß allein zwischen den Billardtischen, als sei das Hotel von keiner Menschenseele bewohnt. Seine Gelassenheit war so echt, daß er sich über die Abwesenheit Heysts oder das rätselhafte Benehmen Schombergs ihm gegenüber nicht besonders aufregte. Er betrachtete die Dinge auf seine eigene recht scharfsinnige Art. Irgend etwas hatte sich ereignet, und er mochte nicht weggehen, um nachzuforschen, weil ihn eine Ahnung zurückhielt, daß er auf irgendeine Weise hier Aufklärung erhalten würde. An der Wand gegenüber hing ein Anschlag ›Jeden Abend Konzert‹, gleich den Plakaten am Tor, aber in besserem Zustand. Er blickte müßig darauf und stutzte bei der – damals noch ungewöhnlichen – Tatsache, daß es sich um eine Damenkapelle handelte, ›Zangiacomo’s Fernost-Tournee – achtzehn Künstlerinnen‹. Sie hätten die Ehre gehabt, hieß es auf dem Plakat, ihr erlesenes Repertoire vor verschiedenen Exzellenzen zu spielen, auch vor Paschas, Scheichs, Häuptlingen, Seiner Hoheit dem Sultan von Mascate und so weiter.