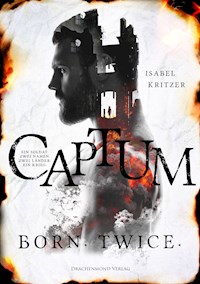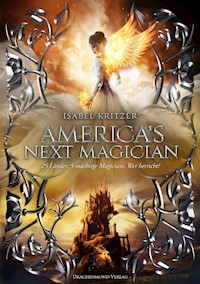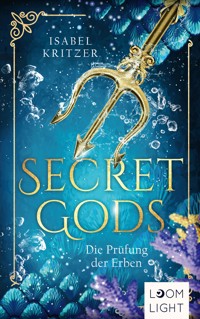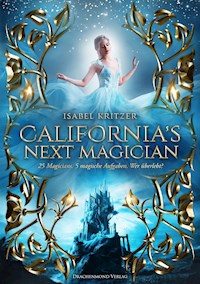Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Drachenmond Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Drei Galaxien. Fünf Welten. Sechs Völker. Ein letzter Kampf! Wenn ich dir erzähle, dass astrale Wesen über die Erde wachen, dass da draußen, im All, der Teufel lauert, dass Gott eine Tochter hat und es das Schicksal wirklich gibt. Würdest du mir glauben? Ich bin Iva und das ist meine Geschichte. Alles begann vor 494 Tagen in New York, als mein Alltag plötzlich zu einer Suche wurde. Während ich den Spuren zweier Vermisster folgte, begann nicht nur mein Herz verrückt zu spielen. Mein Weg erwies sich als Vorsehung eines uralten Volkes, deren Erfüllung über Leben und Tod entscheiden sollte …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 601
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sisu
Älter als die Erde
Isabel Kritzer
Copyright © 2018 by
Lektorat: Alexandra Fuchs
Korrektorat: Michaela Retetzki
Layout: Michelle N. Weber
Illustrationen: Isabel Kritzer
Umschlagdesign: Marie Graßhoff
Bildmaterial: Shutterstock
ISBN 978-3-95991-912-8
Alle Rechte vorbehalten
Für Alexandra Fuchs,
ohne die ich dieses Buch nie geschrieben hätte.
Und für Alexander Neurauter,
der mich mit seinen traumhaften Galaxie-Fotografien dazu inspiriert hat.
Sowie für all die besonderen Menschen,
die mir Mut gemacht haben, meine Träume zu leben!
Ihr seid die wahren Helden!
»Wir waren Sisu! Sie waren Kifu!
Wir waren das Licht, sie die Dunkelheit.
Wir brachten Hoffnung, sie den Tod.
Wir waren in der Unterzahl. Sie waren schwach.«
Inhalt
Playlist
Vorwort
Prolog
Teil I
1. Vor 613 Tagen
2. Vor 495 Tagen
3. Vor 279 Tagen
4. Vor 494 Tagen
5. Vor 311 Tagen
6. Vor 250 Tagen
7. Vor 129 Tagen
8. Vor 63 Tagen
Teil II
9. Vor 63 Tagen
10. Vor 62 Tagen
11. Vor 61 Tagen
12. Vor 60 Tagen
13. Vor 59 Tagen
14. Vor 57 Tagen
15. Vor 56 Tagen
Teil III
16. Vor 50 Tagen
17. Vor 49 Tagen
18. Vor 46 Tagen
19. Vor 45 Tagen
20. Vor 43 Tagen
21. Vor 42 Tagen
22. Vor 40 Tagen
Teil IV
23. Vor 36 Tagen
24. Vor 25 Tagen
25. Vor 22 Tagen
26. Vor 21 Tagen
27. Vor 20 Tagen
28. Vor 16 Tagen
29. Vor 14 Tagen
30. Vor 12 Tagen
31. Vor 10 Tagen
Epilog
Spezies-/Personenverzeichnis
Danksagung
Über die Autorin
Playlist
»Ich gehör nur mir« – Elisabeth das Musical
»Never give up, it’s such a wonderful life« – Hurts
»Dieser Weg wird kein leichter sein« – Xavier Naidoo
»Unforgettable« – Robin Schulz & Marc Scibilia
»Scars to your beautiful« – Alessia Cara
»Flaws« – Bastille
»Skyfall« – Adele
»Superheroes« – The Skript
»Stargazing« – Kygo ft. Justin Jesso
»Einfach sein« – Die Fantastischen Vier
»Soulmate« – Natasha Bedingfield
»People help the people« – Birdy
»Wrecking Ball« – Miley Cirus
»Hallelujah« – Pentatonix
Vorwort
Ich weiß, eigenständig und stark zu sein, erfordert Mut!
Hab den Mut!
Denn:
»Die Angst sollte dich niemals davon abhalten,
dein Leben zu leben.«
Straßensymphonie – Alexandra Fuchs
Prolog
VOR 186 TAGEN
Iva
Kaputt
Jeden Abend eine Tablette.
Jeden Morgen die bleibende Müdigkeit.
Jeden Tag die immer gleiche Frage: »Wie geht es dir?«
Jedes Mal die automatisiert gelogene Antwort: »Gut.«
Wenn ein Ding in unzählige Einzelteile zerbrochen ist,
wenn es nie wieder ganz sein wird, dann ist es: kaputt.
Bis jemand sich daran wagt, es Stück für Stück zusammenzusetzen.
Es wird wieder ganz, aber es wird nie wieder so sein, wie es einst war.
Nun bin ich aber kein Ding.
Ich bin Fleisch und Blut, Haut und Knochen, Gefühl und Sensibilität!
Kann ich überhaupt wieder zusammengesetzt werden?
Kann ich darauf hoffen, dass mich jemals wieder jemand zusammensetzt?
Was wäre, wenn ich gar nicht zusammengesetzt werden müsste?
Wenn ich gut wäre, so wie ich bin?
Wenn ich nicht kaputt, sondern nur anders wäre?
Was wäre, wenn ich sogar besonders bin?!
Ihr glaubt mir nicht?
Dann findet die Wahrheit heraus.
Teil I
Wie alles begann …
»Hoffnung war ein trügerisches Ding,
das sich einschlich, ob man wollte oder nicht.
Auch das Alter ließ sie nicht schwinden,
schloss sie vielmehr weg,
um dem Verstand zu gewähren,
über den Körper zu regieren.«
1
Vor 613 Tagen
Chelemna
Die Letzten zweier Dynastien
»Schließlich kommt irgendwann
das Ende eines jeden.«
»Sie stellen ihn als Held dar. Wieder und wieder«, knurrte der Teufelsanbeter, während sein riesiger geschuppter Schwanz neben mir über den Boden zuckte. »Weil er einen Drachen getötet hat!« Krachend fegte die dornenbesetzte Spitze einen ganzen Haufen Säulentrümmer beiseite, der lose auf der verdorrten Wiese gelegen hatte.
Unheilverkündend bebte der Boden, indes sich sein mächtiger echsenähnlicher Körper voller Wut zu seiner ganzen Größe aufplusterte. In einer erregten Geste öffneten sich die mit mehreren Krallen und Federn besetzten schwarzen Flügel und roter Dampf waberte aus geweiteten Nüstern unterhalb der blutunterlaufenen kleinen Augen.
»Er war ein Mörder. Nichts als ein grausamer Mörder!«, heulte er nun und machte seinem Volk, den Flammenwesen, alle Ehre, indem er eine rot-orangene Stichflamme in Richtung des Sees vor uns spie. Einige verdorrte Grashalme fingen dabei Feuer und wurden zu trügerischen Minifackeln, die durch eine Handbewegung von mir erloschen, bevor sie einen Flächenbrand verursachen konnten.
Auch wenn die Show gut war, verzog ich genervt das Gesicht. Bei Himemi konnte man sich nie sicher sein, wann er seine Interessen durchsetzen wollte und wann er sich wahrhaftig im Rausch der Trauer und des Zorns befand. ›Schauspieler‹ beschrieb seinen Chrakter treffend, ›labil‹ seinen Geisteszustand.
Trotzdem war er äußerst gefährlich und tödlich, darin ähnelten wir uns.
»Er hat Seti umgebracht. Seti war unschuldig und kein Drache«, brüllte Himemi so laut, dass ich den Impuls unterdrücken musste, mir die Ohren zuzuhalten. Erneut fegte er mit seinem geschuppten Schwanz zornig Trümmer beiseite. »Sie war wie ich. Sie war mein.«
Es war stets die gleiche Leier! Die mir inzwischen zu den Ohren herauskam. Wer hätte gedacht, dass solch ein plumpes Wesen derart fanatisch lieben konnte?
»Ich weiß«, entgegnete ich äußerlich ruhig, um dem Ganzen für heute ein Ende zu bereiten, und stieß innerlich einen Seufzer aus. Warum verdammt noch mal musste eigentlich immer ich mich mit Himemis Manie herumschlagen? Richtig, weil ich ungern wichtige Angelegenheiten delegierte. Und wenn seine Manie mir nicht so nützlich gewesen wäre, hätte ich dem längst ein Ende gesetzt. Kurz und schmerzlos.
Oder auch nicht.
Je länger ich darüber nachdachte, desto sicherer war ich mir, dass ich es genießen würde, ihn zu töten. Wahrscheinlich würden wir kämpfen. Das wäre eine Herausforderung, da er die Größe einer kleineren Bergkette hatte und seine Oberfläche einer dampfenden dunkellilanen Rüstung glich. Aber ich sah das sportlich. Vielleicht würden sich dabei ganz neue Gefühlsregungen ergeben, wenn Himemi physische, nicht psychische Schmerzen erlitt. Wenn er sie seinetwegen und nicht um Setis willen verspürte.
Ein interessanter Gedankengang, den ich mir bewahren würde. Schließlich kommt irgendwann das Ende eines jeden. Selbst wenn ich es mir momentan nicht leisten konnte, Himemi zum Spaß umzubringen.
Während der Teufelsanbeter weiterhin die Landschaftsgestaltung meiner ohnehin ziemlich trostlos anmutenden Ländereien übernahm, schweifte mein Blick über den großen dunkelblauen See zu meiner Residenz.
Dunkelgraue, solide gemauerte Türme stachen mit ihren Spitzen in die tief hängende Wolkendecke des eisblauen Himmels. Kleine Schießscharten, schmale vergitterte Fenster und ein großes nietenbesetztes Tor mit dicken Ketten vervollständigten das Bild der Unüberwindbarkeit dieser Mauern. Noch nie war einer der einstmals vielen Gefangenen aus meiner Festung entkommen.
Wenige Flugstunden auf Himemis Rücken entfernt lag die Hauptstadt dieses Planeten. Sie hatte, genau wie mein Anwesen, schon deutlich bessere Tage gesehen. Das wusste ich wie jeder andere auf Kekifa nur zu gut. Trotzdem strahlte unser alter Familiensitz, im Gegensatz zu der traurigen Ansammlung von metallenem Hüttenwerk und betonierter Tristess der Stadt, Macht aus. Eine kalte, von Grausamkeiten und Blutvergießen herrührende Macht. Eine, die unwiderruflich mit mir verbunden war und die einen der Gründe darstellte, warum ich stets hierher zurückkehrte.
Ich hielt die Kifu zusammen. Ich war ihr König und ich würde sie wieder erstarken lassen. Würde uns zu neuem Ruhm führen. Uns zusammen mit meinem Bruder Firihati als letzte Nachfahren unserer königlichen Dynastie zum Sieg verhelfen! Dem endgültigen Sieg – über die Sisu.
Ein weiterer Feuerschwall Himemis, gefolgt von Gebrabbel, brachte ihm meine Aufmerksamkeit zurück. »Sie erzählen sich, er hätte gewaltige Kräfte besessen, wäre mutig und tapfer gewesen, redegewandt und furchtlos«, knurrte der Teufelsanbeter voller Abscheu, mit zuckenden Nüstern.
»Furchtlos?« Das entlockte mir ein ironisches Lachen. »Leider hat er Firihati nie gegenübergestanden.« Denn wenn mein Bruder eines konnte, dann war es, jemandem Furcht einzujagen. Ihn zu erschrecken. Zu Tode zu erschrecken, um genau zu sein. Wenn er wollte, selbstredend. Nur, wenn er wollte. Ansonsten war er ein gut aussehender, charmanter Bastard. Die schwarzen Haare und die ebenmäßige Nase hatten wir von unserer Mutter geerbt. Genau wie die schlanke, hochgewachsene Gestalt. Was genau wir von unserem Vater hatten, war mir unklar. Vielleicht die Streitbarkeit. Nicht jedoch den Willen aufzugeben.
Ich würde niemals aufgeben. Nicht, solange ich lebte.
Deshalb musste ich mich mit Himemi arrangieren. Die Hitze seines Feuers war es, die mich und die Meinen bei Kräften hielt. Die enorme physikalische Schwingung der Teilchen, die entstand, sobald er die erste Flamme spie, versorgte uns mit ausreichender Energie, um zu überleben, wenn wir sie von der züngelnden Hitze absaugten. Ausgehungert wie wir waren, wurde unser Körper von selbst zum Energiemagneten und Himemis extrem heißes Feuer erlosch binnen Sekunden.
Für Firihati, Pami, meinem Ersten Berater, Xanei, meinem besten Krieger, und mich ein wöchentliches Vergnügen. Für die Bewohner der Hauptstadt ein seltenes. Denn Himemis Kräfte und sein Wille, sich uns zur Verfügung zu stellen, waren begrenzt.
Er war das letzte Flammenwesen. Ein starkes, aber eben doch nur eines. Während wir schwach waren – viel zu schwach, um auf ihn zu verzichten. Kam der von mir ersehnte Tag des Endkampfes zwischen Kifu und Sisu, würde ich Himemi unter allen Umständen schützen. Denn sollten wir wider Erwarten den Rückzug antreten müssen und all meine anderen Pläne ihr Ziel verfehlen, blieb sein Feuer die einzige Chance für den kümmerlichen Rest meines einst so stolzen Volkes, zu überleben.
Allerdings konnte ich ihn nicht kontrollieren. Er hatte seinen eigenen Kopf. Einen schrecklich eigensinnigen Dickschädel! Wenn Himemi kämpfen wollte, würde ich ihn nicht aufhalten können – mir blieb nur zu hoffen, dass all meine mit Engelszungen vorgebrachten falschen Versprechungen ihn, wie die letzten Jahrhunderte über, besänftigen würden. Ab und an versuchte ich es gar mit Humor, doch stieß ich meist auf taube Ohren.
Das Flammenwesen hatte ebenso heute meinen lauen Scherz entweder nicht registriert oder nicht witzig gefunden, denn inzwischen waren wir einen Schritt weiter im üblichen Ablauf seiner Klagen.
»Seit dem elften Jahrhundert ehren ihn die Erdlinge mit Wandmalereien in Schlössern, Burgen und heutzutage sogar mit Bildern in ihrem seltsamen In-ter-net!« Die Nüstern des Flammenwesens zuckten unkontrolliert. Es sah angewidert aus. »Seit dem dreizehnten Jahrhundert muss ich mir schlechte Gedichte anhören und sie besingen ihn seit jeher mit ihren furchtbaren Liedern!«
Nichts Neues. Und zunehmend überwog meine Ungeduld.
»Dieses Jahr überbieten die Veranstaltungen alles! Festspiele in Worms, Aufführungen an der Semperoper, im Royal Opera House, in der Dutch National Opera, an der Göteborg Opera, der Melbourne Opera und der Met Opera in New York. Außerdem Theateraufführungen in Baden-Baden, Chemnitz, Oxford, Brüssel, Marseille, Budapest und San Francisco. Dazu kommen Veranstaltungen in Venedig, Toulouse und …«
Ja. Ja. Immer dasselbe. »Es reicht!«, herrschte ich Himemi an. Jetzt hatte ich wirklich genug. Konnte er nicht ein einziges Mal seine vermaledeite Klappe halten? Oder zumindest irgendwann die geistige Stopp-Taste finden? Sein Klagelied war wie ein Tonband, das einmal eingelegt bis zum Schluss abgespielt werden musste. Komme, was wolle. Nur war ich nicht sein Seelenklemptner! Ich war der verdammte König der Kifu. Ich erwartete Respekt!
Statt ihm das entgegenzuschreien, statt es ihn direkt mit Taten zu lehren, ermahnte ich mich zur Ruhe. »Du hast deinen Standpunkt ausreichend erläutert. Und ich verfluche Sigfried, den angeblichen Drachentöter, und die Nibelungen seit ihrer Uraufführung. Genau wie du! Aber es ist keinem geholfen, wenn wir uns stets aufs Neue daran aufhängen. Diese Geschichte ist wie jede andere, die die Sewi erzählen – ein äußerst schwacher Versuch, Unwissenheit in Wissen zu wandeln. Menschen«, ich spuckte es angewidert aus. »Selbst das Wort – ihre selbst gewählte Bezeichnung – ist nichts als eine Hülse, genau wie sie. Sisu, Kifu, das bedeutet wenigstens etwas.«
»Und was haben sie daraus gemacht?«, unterbrach Himemi mich. »Lichtalb und Schwarzalb? Was soll das sein?«, höhnte der Teufelsanbeter.
Ahh! Ich hasste diese Verunglimpflichungen. Er wusste genau, wie er mich erzürnen konnte. Ob das im Moment allerdings klug war, bezweifelte ich. Meine Geduld hing bereits am seidenen Faden.
»Klingt einfach beschissen«, grollte er ungerührt.
Ja, das tat es! Geschmeidig krümmte sich meine rechte Hand in Richtung des langen Messers, das hinten im Bund der schwarzen Anzughose mit Bügelfalte steckte. Diese trug ich zu einem meiner unzähligen dunkelgrauen Hemden. Ich brauchte es nicht, um jemandem wehzutun. Aber ich liebte es, damit zu spielen. Muster faszinierten mich. Besonders wenn sie Strich um Strich in einen lebenden Körper geritzt wurden. Langsam, säuberlich, exakt folgten sie einer Gleichmäßigkeit und ließen durch meine Hand ein ausgewogenes Bild entstehen. Eines, dessenSchöpferich war. Ich ganz allein.
Mein Stempel auf der Haut des Besiegten.
Mein Siegel als Zeichen der Macht. Bezahlt mit Blut und Tränen. Geschaffen durch Stahl und Akribie.
»Es spiegelt nur das Wesen der Sewi wider«, zischte ich.
»Vielleicht.« Der große Kopf des Wesens nickte.
»Dumm. So dumm, unwissend und schwach.«
»Daran wird sich nichts ändern.«
»Ja, genau darüber könnte ich mich aufregen«, gestand ich nun doch ein.
Der Teufelsanbeter stieß einen röhrenden, fast lachenden Laut aus. »Du tust es jedenfalls stets aufs Neue!« Seine Augen blitzten hinterlistig. »Und das darf ich mir dann anhören«, kam bereits die ihm unbewusste Retourkutsche. Eine, die mir für ihn viel zu durchdacht vorkam – dafür, dass er sich scheinbar im gefühlsmäßigen Tunnel der Rachsucht befand.
Himemi führte etwas im Schilde. Seine Provokationen schienen mir heute zielgerichteter als üblich – angereichert mit Hintergedanken. Er wollte etwas, das konnte ich spüren. Nur was? Welcher Teil unserer Vorsehung würde sich dieses Mal bewahrheiten?
Angefangen hatte alles lange vor meiner Zeit. Vor Äonen von Jahren. Damals, so war es mir erzählt worden, kämpfte Keni, der regierende König der Sisu, mit Lelit, unserem regierenden König, um die Vorherrschaft in der Galaxie. Lelit kam irgendwann in den Besitz eines Artefaktes, welches das Machtgefüge zu seinen Gunsten beeinflusste. Vielleicht kreierte er es gar, vielleicht hatten die Weltenweber, als Erschaffer der Galaxien, ihre Finger im Spiel. Keni wollte sich jedenfalls nicht geschlagen geben und suchte außerhalb des Krieges, der bisher zwei Völker umfasste, nach Verbündeten. Diese fand er in einer anderen Galaxie: die Flammenwesen. Mit Himemi, der sich durch das Versprechen Kenis, ihm für seine Dienste nach dem Krieg das Artefakt Lelits zu überlassen, einverstanden erklärte, hatten die Sisu ebenfalls eine mächtige Waffe. Ihnen gelang so der Diebstahl des Artefaktes und die Befriedung unserer Galaxie. Während Keni daraufhin Wort hielt und die Kriegsbeute Himemi übergab, wusste er nicht, dass das Artefakt nur für die Kifu von unschätzbarem Wert war.
Es wird gemunkelt, es soll eine unerschöpfliche Energiequelle für die Krieger unserer Kifu-Armee dargestellt haben. Selbstredend gab es davor und danach besondere Besitztümer, doch keines von ihnen war wie dieses.
Friedliche Jahre zogen fortan ins Land, aber unter der Oberfläche brodelte es, während die nächste Generation geboren wurde. Isirenya, einer der Söhne Kenis, und Gidiya, einer der Söhne Lelits, wuchsen von unschuldigen Kindern zu Männern heran. Rachsüchtig trafen sie schließlich, die kriegerische Tradition ihrer Vorfahren fortführend, aufeinander und Gidiya tötete Isirenya im Zweikampf. Ein Sieg für die Kifu. Doch damit war der wieder aufschwellende Konflikt nicht beendet. Isirenya hatte mit Fire, seiner Frau, vor seinem Tod ein männliches Zwillingspaar gezeugt. Einer der beiden, Degineti, machte sich Jahre später zu Himemi auf, um ihn erneut um Hilfe zu bitten – in der Absicht, den Tod seines Vaters zu sühnen.
Auf Amendon, dem Heimatplaneten der Flammenwesen, fand er allerdings nichts als Zerstörung vor. Der Besitz des Artefaktes hatte Himemis Sippe gegeneinander aufgebracht und sie hatten bei ihren Ränkespielen in blinder Gier und Tobsucht einen Großteil des Planeten eingeäschert. Degineti fühlte sich im Namen seines Großvaters dafür verantwortlich und bot Himemi an, der als Einziger mit Seti, seinem Weibchen, überlebt hatte, das Artefakt mitzunehmen und an seiner statt zu verwahren. Himemi wollte allerdings nicht davon ablassen, deshalb beschloss Degineti, es zu stehlen – zum Wohle der Flammenwesen und der Sisu, deren Position er gegenüber den Kifu in Zeiten der Unsicherheit stärken wollte. In der alles entscheidenden Nacht kam es jedoch zum Kampf. Seti wurde getötet und das Artefakt durch Himemis Feuer zerstört.
Degineti kehrte bestürzt und geläutert, aber unversehrt zurück zu seiner Frau, Nefisi, und sie gebar ihm wenig später Kinder. Himemi verblieb trauernd auf Amendon – der Letzte seines Volkes. Gidiya seinerseits witterte nun eine weitere Chance, die Kifu erstarken zu lassen, und zog in böswilliger Absicht los, um Degineti und dessen Kinder zu töten. Während er den Sisu kaltblütig ermordete und damit das Wohlwollen Himemis auf unser Volk lenkte, entkam Nefisi mit den Babys. Eine Unzahl von Finten, Schlägen und Gegenschlägen zwischen den Sisu und den Kifu folgte. Ein Manöver erfolgloser und kräftezehrender als das vorhergehende. Erst als Himemi in seiner fortwährenden Wut, nach etlichen gescheiterten Friedensverhandlungen zwischen den Völkern mit mir zusammen, Simeti, den Heimatplaneten der Sisu, einäscherte, starb das letzte Kind Deginetis, der Vater von Amilaki King, meinem Erzfeind.
»Von hinten habe ich die Krallen durch den Rücken in sein Herz gebohrt und ihn auseinandergerissen. Amilakis Vater hat gelitten. Hat die Schuld seines Vokes zu spüren bekommen!«, ließ mich Himemis blutrünstiges Knurren aus der Vergangenheit auftauchen. »Und das war nur der Anfang …«
Immerhin waren wir damit am gleichen Punkt der Geschichte angelangt.
»Glaub mir, das kann ich wieder tun. Mit jedem«, grunzte der Teufelsanbeter unheilverkündend. Dampf waberte aus seinen Nüstern. »Er hatte eine körperliche Schwachstelle, die ich gefunden habe. Jeder hat eine – auch wenn nicht immer die gleiche«, fügte er überraschend weise hinzu und nickte behände mit dem hässlichen Kopf.
Ich wartete ab, da ich aus Erfahrung wusste, dass Himemi gleich zum großen Finale ansetzen würde. In drei – zwei – eins …
»Alles wegen eines Artefaktes. Wegen Macht und Vorherrschaft musste Seti sterben. Meine Seti.« Sabber tropfte gelblich schimmernd von seinen geifernden Lefzen. »Die Erdlinge erzählen das, was damals geschah, fortwährend, ohne Unterlass. Und sie werden nie damit aufhören. Ob nun Nibelungen oder neuerdings wieder Tolkien … mit diesem Ring, diesem verfluchten Ring. Die gleiche Geschichte, die gleiche Absicht, da hast du völlig recht – immer ein und dieselbe. In hundert Varianten. Mit tausend Gesichtern und Abertausenden von Masken. Meine Geschichte. Deine Geschichte. Es wird Zeit, dass das aufhört, findest du nicht?!« Das Flammenwesen schnaufte erregt, doch wirkte sein Blick klar wie nie zuvor. »Drachentöter, dass ich nicht lache. Sie haben keine Ahnung. Weder wie es sich damals zutrug noch über das, was heute vorgeht. Sie wissen nicht das Geringste über ihren verehrten Siegfried oder uns. Das sollten wir ausnutzen. Zu unserem Vorteil, um sie alle zu töten, um sie bezahlen zu lassen – ein für alle Mal! Die Sewi und die Sisu.«
Als ein roter Schleier sich über seine zu Schlitzen verengten Pupillen legte, sah ich die Raserei in seinen Blick treten. Sah, wie sich sein Geist zurückzog und seinen Instinkten die Kontrolle überließ. Ich wusste, dass er irre war. So weit von der Rationalität entfernt wie jeder, den ich fünf Stunden auf der Streckbank gefoltert hatte. Dennoch brodelte ein wildes Lachen von meinem Brustkorb hoch, aus meinem Mund. Ich konnte nicht anders, ließ mich vom Hoch seiner und meiner überbordenden Gefühle mitreißen. Sog sie auf, machte sie mir zu eigen und zog Energie daraus. Seine Mordlust stachelte mich an, setzte Adrenalin in mir frei und machte mich im gleichen Augenblick süchtig nach mehr.
Mir war klar, dass sich meine Interessen von seinen unterschieden. Er war voller Rachedurst – wollte alle töten. Ich war voller Visionen und wollte überleben. Wollte siegen, wollte der eine, der letzte, der wahre König der Galaxien sein! Das war allerdings unmöglich, wenn alles Leben erloschen war. Mein Volk benötigte Nahrung und dafür brauchten wir entweder ein neues Artefakt oder einen neuen Planeten, denn unserer hatte seinen Zenit längst überschritten. Wie es mit vielen anderen Welten im Laufe der Zeit geschehen war, hatten wir ihn ausgenommen und nun blieb nichts außer dem ungenießbaren Gerippe übrig.
»Such sie. Finde sie. Triff sie. Jeden Einzelnen. Oder ich werde es tun!«, beschwor mich der Teufelsanbeter. »Aber du wirst sowieso Dunkelheit und Verdammnis über alle bringen. Es hat längst begonnen. Dein Name ist deine Prophezeiung – genau wie bei uns anderen. Ob du willst oder nicht, du wirst sie erfüllen, weil du sie bis jetzt immer erfüllt hast. Das wissen wir beide, Chelemna.«
Ich nickte ergeben. In dem Punkt hatte er uneingeschränkt recht. Während mein Bruder Firihati Furcht säte, brachte ich Dunkelheit. Eine alles verschlingende Dunkelheit, die nun, durch mich, nach der Erde gierte.
2
Vor 495 Tagen
Ibabi
Die Wächterin
»Sie waren Blinde in
einer Welt voller Lichter.«
Fast mein ganzes Leben hatte ich über die Erde gewacht. Hatte Kriege erlebt, Krankheiten und Herrscher kommen und gehen gesehen. Ein manches Mal hatte ich im Nachhinein nicht mit Sicherheit sagen können, welches dabei das größere Übel gewesen war – besonders im letzten Millenium.
Heute schwebte ich, wie ich es gerne tat, über den Dächern von New York. Besser gesagt stand ich fast in der Luft über dem Empire State Building, während meine kaum sichtbaren Flügel, die ihren Ursprung in Höhe meiner Schulterblätter hatten, in nicht wahrnehmbarer Geschwindigkeit die Luft um mich verdrängten. Mein leuchtend blaues Haar flog im Wind. Die rot gefärbten Spitzen glänzten. Der Saum meines weißen Kleides hob sich in der lauen Prise. Auf Hochglanz polierte Metallkuppen zierten die Zehenpartie meiner schwarzen Stiefel. Hätte ich in der Welt der Menschen einen Nachnamen wählen müssen, ich hätte mich für Style entschieden und es mir zur Aufgabe gemacht, ihn jeden Tag neu zu interpretieren.
Allerdings mangelte es mir auch so nicht an Beschäftigung. Ich hatte observiert, absorbiert und mit Staunen die Entwicklung der Menschen erlebt. Ich war älter als die Erde, älter als das, was über Gott erzählt wurde – trotz allem war ich nur ich. Atibiko, stark, nannte meine Art die Ausprägung unseres Volkes, obwohl wir das für mich nur in Bezug auf manches waren. Wir besaßen außergewöhnliche Fähigkeiten, ja. In anderer Hinsicht waren wir dafür unendlich schwach. Den Sewi, wie wir die Menschen nannten, nah, so hatte Nanna, meine Ziehmutter, es stets zu erklären versucht. Und egal, was wir nun waren, existierten wir in allen drei belebten Universen oder hatten es wenigstens einst. Unter all den menschlichen und menschenähnlichen Individuen und all den anderen: den Kifu, Flammenwesen und Hurgathen. Lust und Bösartigkeit ließ diese immer wieder wie Aasgeier auf der Erde einfallen und ganze Landstriche verwüsten. Ein mancher Wirbelsturm der letzten Jahrhunderte war durch sie wider Natur verursacht worden. Aus Unachtsamkeit oder weil ich es nicht hatte verhindern können.
Gänsehaut kroch meine Arme hinauf. Trotz malte mir Falten auf die Stirn. Schuld drückte wie bleierne Gewichte auf meine zarten Schultern.
Energisch straffte ich mich.
Diese Erinnerungen lagen in der Vergangenheit, das Hier und Jetzt zählte. Jetzt war ich weder jung noch dumm genug, mich ablenken zu lassen. Jetzt stand ich in der Blüte meiner Kraft, denn die Zeit lief für uns in anderen Bahnen. Anders als die der Menschen. Unser Körper bestand nicht aus Gewebe und Materie. Beides ließen wir am Ende der Ausbildung zurück, wenn wir Zymaha wurden. Wir waren astral – Geist, purer Wille, selbstloses Sein, wenn man so wollte. Gerade deshalb konnten wir zwischen den Welten wandeln, Dimensionen bereisen, die den Sewi und vielen anderen verschlossen blieben und den wenigen fähigen Wesen ein großes Maß an Kraft abverlangten. Vielleicht waren wir in diesem Sinn das, was der Inkarnation einer Seele am nächsten kam.
Wir starben erst, wenn wir es wollten, wenn wir uns für immer aufgaben – wie die Sisu, aus deren Blut wir in grauer Vorzeit hervorgegangen waren. Allerdings war ihre Stärke, ihre dauerhaft gleichbleibende Gestalt, die sie unter den Sewi unerkannt verweilen ließ, gleichzeitig ihre Achillesferse. Wurde ihr Körper in Gänze zerstört, waren sie unwiderruflich dem Tod geweiht. Keine erfreuliche Vorstellung.
Ich schluckte, verscheuchte die Gedanken an all das und ließ meinen Blick schweifen.
Heute erzählte die Nacht eine Geschichte samtiger Stille. Väterchen Ludopus, der Wächter der Milchstraße, hatte seine Sterne auf Hochglanz gewienert, bevor er sie, im übertragenen Sinn, stolz ans Himmelszelt gehängt hatte. Ich konnte ihm nicht absprechen, dass er das Sonnensystem zuverlässig vor Feinden bewahrte.
Als mein zweites Jahrtausend in Aysis, meiner sonnigen Heimatwelt, zu Ende gegangen war, hatte er es sich nicht nehmen lassen, pflichtschuldig zu meiner kleinen Ehrenfeier zu eilen. Er war Nannas männliches Pendant, ihr Libi, wie wir es nannten. Ein kauziger Kerl mit lichtem Haar und verknittertem Anzug. Lange war das her, über dreißig Millionen Jahre. Und mehr als einmal hatte ich meine Ziehmutter vermisst. Lebensfroh, weiß gewandet und immer mit einem Scherz auf den roten Lippen, war sie das pulsierende Herzstück von Aysis. Schon ewig hatte ich sie nicht mehr gesehen. Die Erinnerungen waren alles, was mir geblieben war.
Ich seufzte still.
Der Mond tauchte die Umgebung von New York unter mir in fahles Licht. Hier und da arbeiteten noch einige in den Büros der unzähligen Gebäude. Ich genoss die Ruhe nach der Geschäftigkeit des Tages. Das Leben hatte sich verändert, seit die Elektrizität entdeckt worden war. Der Mensch hatte einen technologischen Quantensprung getan.
Alles blitzte, blinkte, vibrierte und leuchtete. Tag und Nacht. Die Stadt pulsierte trotz der späten Stunde im Takt unzähliger schlafender Herzen. Herzen, die so voll von ihrer selbst und ihren eigenen Bedürfnissen waren, dass sie nichts außerhalb ihrer Vorstellungskraft wahrnahmen. Sie sahen nur, was sie sehen wollten. Sahen uns Zymaha nicht. Sahen weder die Sisu noch die Kifu. Sie waren Blinde in einer Welt voller Lichter.
In dem Maß, in dem Kommunikation, Industrie und wissenschaftliches Bewusstsein Gestalt annahmen, verkümmerten die Natur und die Merkmale, aufgrund derer der Planet Erde einst für uns auserwählt worden war – damals, als wir flüchten mussten.
Vielleicht hatte Inati, die Seherin, genau diese Abwendung von Werten vorhergesehen? Wer wusste schon, was das Universum ihrer gliedlosen Gestalt zugeflüstert hatte oder welch aberwitzige Verschachtelungen ihre geistige Präsenz nahm.
In Augenblicken wie diesen schwebte ich staunend über einer der großen Metropolen und bewunderte die Hartnäckigkeit, mit der die Menschheit dieser Welt ihren Stempel aufdrückte. Nicht einmal die Grenzen des Planeten geboten ihnen Einhalt. Der in einer Vielzahl im Weltraum schwebende Unrat zeigte faktisch die Rücksichtslosigkeit und fehlende Weitsicht. Mir sei dank hatte nicht jeder Meteorit durch die Atmosphäre an den Ort seines Ursprungs zurückgefunden. Das ein oder andere Mal, wenn ich all die menschlichen Bemühungen der Weltraumerkundung beobachtet hatte, hatte ich mich gefragt, wann es endlich so weit sein würde; wann einer unter allen sehen würde, was die anderen nicht wahrhaben wollten: Dass es außerhalb ihres Universums und den darin geltenden Naturgesetzen noch andere Parallelwelten gab. Parallelwelten wie Aysis, meine Heimat. Dass die Zeit nicht immer der gleichbedeutende Maßstab war und die Physik ihres Universums nichts unüberwindbar Festgeschriebenes.
Amendon, der Planet der Flammenwesen, deren letzter Vertreter treffend als Teufelsanbeter bezeichnet wurde, war die beste Analogie. Waren sie wütend und hatten sich nicht im Griff, vernichteten sie mit ihrem Feuer alles um sich herum. Ihnen konnten die Flammen nichts anhaben – ihrer Umwelt und Nahrung allerdings schon. Inzwischen war die Spezies fast gänzlich ausgestorben. Schuld daran waren allein sie selbst.
Als ich fünfhundert Jahre meiner Ausbildung dort hatte verbringen müssen, hatte ich mich bis zuletzt nicht an die ätzenden Dämpfe, die die unwirtlichen Gefilde durchzogen, gewöhnen können. Ganze hundert Jahre hatte es gedauert, bis meine Netzhaut geheilt gewesen war.
Bei einem ihrer seltenen Kontrollbesuche hatte Inati mir, als ich durch Himemis Manien bereits an der Grenze zur absehbaren Verrücktheit gestanden hatte, Dalin mitgebracht.
Meinen Zymaha-Ritter mit angeborenem Charme, mein männliches Pendant, mein Libi. Mein Eros, mit Flügeln, ohne Pfeil und Bogen. Er war nicht der einstige Prinz der Sisu, in den ich mich vor Urzeiten auf den ersten Blick verliebt hatte, aber er war da gewesen. Und das hatte in dieser Situation alles bedeutet. Er war gleichermaßen meine Ablenkung und mein Verderben gewesen – kurzfristig. Bis ich unsere Verantwortung übernommen hatte, für die Menschen da zu sein. Die Kifu, Flammenwesen und Hurgathen, die sich auf die Erde ›verirrten‹, in ihre Welt zurückzuverbannen, bevor sie größeren Schaden anrichten konnten.
Während die Jahre mich darauffolgend hatten stiller werden lassen, hatte Dalin sich kein bisschen verändert. Die Zeit schien seine Jugend sogar anzufachen. Unersättlich suchte er den Kick in allem, was die Sewi im Laufe ihrer Geschichte zur Bewusstseinserweiterung verwendet hatten. Was genau er sich davon erhoffte, war mir schleierhaft. Wahrscheinlich wusste er das selbst nicht. Eines konnte ich allerdings mit Gewissheit sagen: Gefunden hatte er es bis jetzt mitnichten.
Zu meinem Bedauern war es mir irgendwann egal geworden. War er mir fast gleichgültig geworden. In meinem Herzen brannte nur ein fortwährendes Feuer. Leider. Denn Amilaki, der letzte König der Sisu, war unerreichbar für mich – schon immer und seit über einem Jahrzehnt für immer. Doch war Hoffnung ein trügerisches Ding, das sich einschlich, ob man wollte oder nicht. Auch das Alter ließ sie nicht schwinden, schloss sie vielmehr weg, um dem Verstand zu gewähren, über den Körper zu regieren.
Einst hatte es Inatis Schelte gebraucht, um mich aus meiner Liebestrunkenheit aufwachen zu lassen. Um zu realisieren, wie viel Unglück die Kifu währenddessen über die Erde gebracht hatten, weil ich weggesehen hatte, vor Eifersucht zerfressen, von Neid geblendet, mit Missgunst erfüllt – wegen eines Menschen. Wegen Anisiti Amilaki King, der Frau, die Amilaki King, wie er seit der Neuzeit in dieser Welt genannt wurde, sich geschaffen hatte. Vom folgenden Aufwachen zehrte ich für die Ewigkeit. Es hatte mich zu der werden lassen, die ich war.
Geschichte, Religion, Naturwissenschaften und alles dazwischen – ich hatte mehr Wissen, als es ein Mensch im kurzen Zyklus seines meist unbedeutenden Lebens erlernen konnte. Mich konnte kein Roboter ängstigen, womit auch? Ich konnte alles, was eine Maschine je zu bewerkstelligen vermochte – und noch viel mehr.
Ich war das, was die Sewi für übersinnlich hielten, für göttlich. Ich war aufmerksam. Ich war menschlich. Vielleicht war ich meinem Wesen nach sogar menschlicher als die Menschheit in den letzten Jahrhunderten. So vieles hatte sich wiederholt, so viele unnötige Auslöschungen und Verwüstungen, und trotzdem lernte eine Generation nichts von der vorhergehenden.
Wie kleine Krabbeltiere zog es sie näher zueinander. Jeder wollte in einer der aus dem Boden sprießenden Städte wohnen. Alle, so schien es mir, wollten sie am liebsten in ein einziges Haus ziehen und so bauten die Handwerker immer höher hinaus. Bei jedem weiteren Wolkenkratzer kam mir unwillkürlich der Turmbau zu Babel in den Sinn. Alles war schon einmal da gewesen. Alles wiederholte sich. Und wie dieser ausgegangen war … nun … das konnte man nachlesen, nicht wahr?
Dabei gab es so viel unberührte Natur, die keiner wahrzunehmen schien. Wenigstens konnte ich dort hin und wieder einige ruhige Tage verbringen, in der trauten Gesellschaft tierischer Einsiedler der eisigen Weiten der Gletscher. War ich anschließend in die umtriebige Geschäftigkeit der Millionensiedlungen zurückgekommen, hatte ich das Ende bereits nahen gesehen. Nicht in nach menschlichen Maßstäben absehbarer Zeit, aber in für mich wahrnehmbarer Zukunft.
Niemals war eine Stille wirklich still und jegliches, das keinen Raum fand, sich zu regen, verkümmerte. Zunehmend fragte ich mich, ob die Bedrohung der Spezies Mensch inzwischen nicht mehr vorrangig von den Parallelwelten ausging, sondern vielmehr von sich selbst. Und welchen Plan, welche Aufgabe hatte mir die Inati dann zugedacht?
Sie war die oberste Wächterin, das heilige Orakel; sie hatte mich in meinen ersten Jahren Nanna anvertraut und bestimmt, dass Dalin getrennt von mir aufwuchs. Sie allein lenkte unser Schicksal. In ihrer Präsenz allgegenwärtig und doch als Gestalt nicht greifbar.
Genug davon! Die Nacht hatte mich ungewollt melancholisch gestimmt.
Geringfügig verlangsamte ich meinen Flügelschlag und ließ mich in der absoluten Dunkelheit nahe dem Windschatten des Empire State Buildings nach unten gleiten. Je näher ich der mäßig belebten Straße auf dem Boden kam, desto ruhiger wurde meine Atmung.
Die Sewi erzählten sich, Gottes Sohn sei gestorben, um ihre Sünden auf sich zu nehmen, und schließlich wieder von den Toten auferstanden. Vielleicht benötigten sie erneut eine Lichtgestalt, wider ihrer Natur, die Mensch wurde, um sie an das Menschsein zu erinnern? Oder eher an das Sisu-sein, das in ihren Genen schlummerte? Damit sie zu ihrem Ursprung zurückfinden und sich trotz allem Wandel selbst treu bleiben konnten. Um aufzuwachen und tatsächlich zu sehen. Vielleicht war es eben das, was Dalin suchte: Liebe, Nähe, Beistand, Pflege, ein offenes Ohr – Menschlichkeit.
Als meine Füße einen Augenblick später auf dem Beton des Gehweges aufsetzten, drehte ich mich leicht und schritt im nächsten Moment gewohnt schwungvoll in Richtung Central Park.
Die Präsenz der Kifu, die ich aus den feinen Schwingungen des Universums las, nahm seit Wochen mit unglaublicher Intensität zu und war mit einem speziellen Charakter behaftet. Das konnte nur eines bedeuten: Xanei Jones, oft die Speerspitze genannt, Chelemnas bester Krieger, suchte trotz aller Hindernisse seinen Weg in die Stadt. Der Eroberer-König der Kifu hatte also einen Spitzel ausgeschickt! Und wenn ich die verschlungenen Ströme richtig las, war auch er selbst nicht weit.
Die Alamglocken in meinem Kopf schrillten im Gleichklang. Das Wort Weltenkrieg rückte unangenehm bedrückend in meinen gedanklichen Fokus. War es nun so weit? Noch stand alles offen …
Was immer passieren würde, eines war klar: Das ewige Spiel hatte von Neuem begonnen. Die Arbeit rief. Es galt, den Schaden, der bald entstehen würde, einzugrenzen. Dunkle Zeiten brachen an – für alle von uns.
3
Vor 279 Tagen
Iva
Der Beginn einer Eiszeit
»Mir ging ein Licht in der Dimension eines ganzen Stromkraftwerkes auf.«
Hätte ich es mir aussuchen können, würde ich in einem Ort namens Frühling wohnen und in meinem Herzen wäre immer Sommer. So wie die Dinge lagen, traf allerdings weder das eine noch das andere auf mich zu. Stattdessen war ich tot. Nicht körperlich, versteht mich nicht falsch. Geister tippten wohl kaum mit ihren durchscheinenden Fingern auf Tastaturen herum. Und obwohl das Jenseits sicher eine Unzahl anderer nicht jugendfreier, interessanterer Vergnügen bot, die das mit dem Tippen ausglichen, versteht ihr sicher meinen Punkt. Ich war innerlich tot. Und das nicht erst seit gestern. Ihr könnt euch euer Mitleid also sparen. Bestimmt erfreut sich zur gegebenen Zeit jemand anders daran. Ich hingegen war in dieser Hinsicht gerne tot, könnte man sagen. Klingt seltsam, klärt sich aber noch. Kommen wir also erst einmal auf das wie vor dem Warum zu sprechen. Ganz einfach: Ich lebte in einer seelischen Eiszeit. Zumindest fühlte es sich für mich mit meinen fast sechzehn Jahren so an.
Und für die unter euch, die sich jetzt denken: Ah … ja klar … mit fünfzehn, da tickt die Welt in einem anderen Takt, da sitzt die rosarote Brille ohne zu wackeln auf der Nase und jeder Kratzer im Nagellack ist mindestens eine mittelgroße Katastrophe, die ein ausgiebiges Krisengespräch unter Freundinnen erfordert – ja, genau so war ich. Früher. Bestimmt war ich da auch nicht die Einzige. Vermutlich hatte jeder behütet aufgewachsene Teenager keine genaue Vorstellung davon, was das Leben wirklich für Prüfungen bereithielt. Vermutlich hingen wir alle unseren Traumvorstellungen vom perfekten Leben nach und gingen davon aus, dass sie eines Tages, wenn wir nur hart genug dafür arbeiteten, eintraten.
Vielleicht schafften manche es tatsächlich, diese Vorstellungen ohne große Enttäuschungen bis zum Ende ihres Lebens beizubehalten und zu verwirklichen. Chapeau – davor ziehe ich den Hut. Möglicherweise würde ich sogar einiges dafür geben, zu tauschen. Aber da bis jetzt kein Gott oder Dämon vor meiner Tür gestanden und mir einen unmoralischen Handel unterbreitet hatte, ging ich davon aus, dass jeder sein Leben lebte und ich eben mit meinem zurechtkommen musste.
Was hatte sich bei mir verändert, fragt ihr euch? Warum redete ich mit fast sechzehn von innerem Tod? Und zwar tot im stillen Sinne, nicht Nagel-abgebrochen-Riesendrama-schenkt-mir-Aufmerksamkeit-tot. Eine ausgezeichnete Frage. Oder eigentlich nicht – wie man es nimmt. Ihr denkt jetzt, dass mich meine erste Liebe versetzt hatte oder meine Eltern sich scheiden ließen?
Ja, ein Teil davon ist geschehen. Aber erstens war das lange her und zweitens fand ich Chris Wenworth bereits zwei Wochen später nicht mehr so toll, da er nämlich die widerwärtigste Zicke der ganzen Schule, auch bekannt als Julia McAllen – im wahrsten Sinne des Wortes und ohne überkreuzte Finger hinter dem Rücken –, vor der ganzen Schule mit Zunge (Herrgott, Maria und Josef!) knutschte. War wohl mehr verliebt sein und keine Liebe, denn wenn ich ehrlich war und da wir hier ehrlich sind, bitte schön: Mir ging ein Licht in der Dimension eines ganzen Stromkraftwerkes auf, dass Gott bei ihm vielleicht alle Energie während der Kreation des Aussehens verbraucht hatte und es dementsprechend nicht mehr zur Schaffung einiger der kleinen grauen Zellen weiter innen gereicht hatte. Ihr wisst schon, die Dinger, die gemeinhin Gehirnzellen heißen. Aber genug davon, schließlich will ich hier nicht lästern. Gut, ein bisschen schon.
Ihr fragt euch jetzt, mit was ich nicht klarkomme. Oder ihr fragt euch nichts von alldem. Auch okay. So oder so werdet ihr es erfahren. Warum?! Ganz einfach, weil das nicht nur meine Geschichte ist. Es ist ein Stück weit eure. Überrascht? Gespannt? Neugierig? Gut so!
Wo waren wir also stehen geblieben? Ahh … ja. Bei meinem rüden Erwachen, als die schillernde Seifenblase meiner Fantasievorstellung vom Leben platzte und der Winter den Sommer in meinem Herzen verdrängte.
Ich verrate euch etwas im Vertrauen: Pink ist immer noch meine Lieblingsfarbe, ich mag prickelnde Zitronenbonbons, glitzernde Fingernägel, witzige Superheldenfilme (Iron Man … hach! Captain America … schmacht!) und habe ein gewaltiges Aber vor der Farbe Schwarz. Das nennt man vermutlich in einigen Kreisen eine gespaltene Persönlichkeit. Gespalten fühlte ich mich wirklich, aber sicher nicht durch meine Persönlichkeit!
Ich war ein lustiger Mensch. Eigentlich.
Ich war fröhlich. Normalerweise.
Ich lächelte gerne und oft. Ehrlich.
Allerdings waren mir all diese Eigenschaften abhandengekommen. Und die anderen in der Schule erwarteten geradezu, dass ich mir die Augen schwarz umrandete, zum dunklen Lack statt zum bunten griff und mich kleidete, als wolle ich auf meiner eigenen Beerdigung den Ehrengast mimen. Herzlichen Dank. Wenn es etwas gab, das ich nicht wollte, dann definitiv das. Außer es gäbe Pizza, in dem Fall könnten wir noch einmal darüber verhandeln. Denn unser Hausmädchen Fegegita verstand es, den Pizzahimmel auf Erden zu erschaffen. Aber Spaß beiseite, wenn ich etwas abgrundtief hasste, waren es Schubladen. Und ich spreche nicht von jenen in meinem Kleiderschrank, bei denen ich mit meiner Mutter übereinstimmte, dass sie dringend eine ordentliche Aufräumaktion gebrauchen könnten.
Da war eine Dunkelheit in mir, die ich nicht zu benennen vermochte. Die mich in eine Art Totenstarre, in ein vor mich hin vegetieren versetzte, mich zu einem Schubladeninhalt machte. Klingt seltsam? Dann will ich jetzt wirklich nicht länger um den heißen Brei herumreden …
4
Vor 494 Tagen
Iva
Als der Wind sich drehte
»Wäre es ein Theaterstück gewesen,
wäre wohl der Vorhang gefallen.«
Der Tag, an dem sich der Wind für mich drehte, war ein Freitag. Die schrille Schulglocke läutete das Ende eines der zähesten Schultage in der Geschichte meiner gesamten Schulzeit ein.
In der letzten Stunde hatte Miss Murray, meine Geschichtslehrerin, knappe fünfzig Mal ihre überdimensionierte knallrote Brille hochgeschoben – ich hatte mitgezählt, um mir die Zeit zu vertrieben. Nicht unbedingt ein Vergnügen bei einer Dame in einem beißend orangefarbenen Cordrock, der sich furchtbar mit ihrer Brille und der rostroten Haarfarbe um meine Aufmerksamkeit gestritten hatte. Ihr Anblick war wirklich keine Augenweide gewesen! Aber da es mir an Beschäftigungsalternativen gemangelt hatte, war ich eben darauf ausgewichen.
Jetzt erfüllte mich Erleichterung darüber, die Schulwoche überstanden zu haben. Leider war das Outfit fester Bestandteil ihres Kleiderschrankes und würde mir wohl nicht für immer erspart beiben. Manchmal fragte ich mich, ob sie es darauf anlegte, jeden Tag wie eine Farbexplosion auszusehen. Bis jetzt hatte ich darauf keine Antwort gefunden.
Miss Schrecklich-pünktlich-und-überkorrekt war jedenfalls während des Unterrichts überraschend nervös gewesen. Vielleicht, so überlegte ich, während ich nun aufstand, hatte sie endlich jemanden kennengelernt, der farbenblind genug war, um sich mit ihr zu einem Date zu verabreden. Vielleicht … Wer wusste das schon. Ich wünschte es ihr – als Geschichtslehrerin war sie nämlich klasse. Außerdem, wenn ich richtiglag und an ihrer Stelle wäre, wäre ich auch mit den Gedanken woanders gewesen. Hätte auch mit der Nervosität zu kämpfen gehabt.
Und nervös war ich sowieso ebenfalls. Damit saß ich im sprichwörtlichen Glashaus und sollte mir die mentalen Steinwürfe eigentlich kommentarlos verkneifen. Aber Gedanken ließen sich nun mal nicht stoppen.
Vorausschauend hatte ich bereits fünf Minuten vor Schulschluss mein Geschichtsbuch, meinen Ordner, den Block und mein – wie sollte es anders aussehen – wunderbar rosarotes Federmäppchen in meine ebenfalls rosafarbene glitzernde Tasche gleiten lassen.
Endlich durch den Gong erlöst, verabschiedete ich mich mit einem schnellen Kuss auf beide Wangen von Liane, meiner besten Freundin, deren langes blondes Haar mich prompt an der Nase kitzelte. Sie war schon immer und ewig meine rechte Nebensitzerin und ich ihre linke – zusammen bildeten wir das Dreamteam schlechthin. Dann eilte ich im Sturmschritt über den gepflasterten, sich schlagartig füllenden Schulhof.
Meine Highschool sah aus wie jede andere. Eckiger Bau, in die Jahre gekommene ergraute Fassade mit gruselig pastelliger Farbwahl der wenigen Zierelemente und einer Ausstrahlung, die der zeitlichen Modernität der Dreißiger nachempfunden zu sein schien. Kurz: grottenhässlich.
Augenrollend warf ich mein extrem langes schwarzes Haar über die Schulter, bevor ich den engen rosa Sweater über der Bluejeans aus der gleichen Bewegung heraus zurechtzupfte und mich halbwegs gerüstet fühlte. Gerüstet für das Wochenende. Tatsächlich stand auf dem angrenzenden Parkplatz schon der dunkle Van mit dem silbernen Kühlergrill meiner Tante Mariyam Garcia.
Obwohl Mariyam nicht wirklich meine Tante war, da sie laut meinem Vater Joze nur über mehrere Ecken mit uns in verwandtschaftlicher Beziehung stand, liebte ich sie über alles. Sie war jedoch nicht der vorrangige Grund für meine Begeisterung. Der wahre Grund war, dreimal dürft ihr raten … ein Junge: Iyesu Garcia, der Sohn meiner Tante. Iyesu, der die schönsten dunklen Augen und das wuscheligste Haar besaß, das ich jemals bei einem männlichen Wesen gesehen hatte. Außerdem den coolsten Style und das lässigste Lächeln. Und ja, Liane war genau meiner Meinung. Oft sah ich ihn leider nicht, da Mariyam viel arbeitete und Iyesu, den sie allein aufzog, deshalb schon in jungen Jahren von ihr auf ein piekfeines Internat ins Ausland geschickt worden war.
Einmal hatte ich meine Mutter Desita belauscht, wie sie Mariyam gefragt hatte, warum diese sich nicht zusammenriss und sich mehr Zeit für ihr Kind nahm.
»Es ist, wie es ist. Du kannst nicht auch noch von mir erwarten, dass ich nur für ihn lebe«, hatte Mariyam geseufzt. »Ich habe viel geopfert. Überleg dir lieber, wo er heute wäre, wenn ich mich nicht seiner angenommen hätte! Ich gebe mein Bestes. Wirklich. Schau ihm ins Gesicht und sag mir, was du an meiner Stelle tun würdest. Könntest du es jeden Tag ertragen?«, hatte sie gefragt.
Mir war das damals seltsam erschienen, hatte ich doch nichts an Iyesus Gesicht auszusetzen gehabt. Eigentlich konnte ich mir das bei keiner Frau mit normalem Augenlicht vorstellen! Denn holy moly, er war ein echter Hottie! Aber vielleicht hatte es damit zu tun, dass Iyesus Vater aus Gründen, die mir unbekannt waren, da wir partout nicht darüber sprachen, weg war und er ihm möglicherweise ähnelte. Allerdings war Iyesu, meiner Meinung nach, Mariyam wie aus dem Gesicht geschnitten. Ein Rätsel ohne Lösung. Zumindest für mich – im Moment.
Als ich ihn nun, nachdem ich die Schiebetür des Vans schwungvoll aufgezogen hatte, auf der Rückbank entdeckte, strahlte ich.
»Hi Iyesu!« Meine Stimme zitterte leicht.
»Hey du«, entgegnete er breit grinsend.
Beim Hineinklettern musterte ich ihn. Wollte mir jedes Detail einprägen. Er trug wie ich Jeans, allerdings dunkle, dazu ein blau-weißes Karohemd und eine schwarze Cap mit einem großen Swoosh, dem Nike-Zeichen. Verdammt, sah er süß aus! Ich würde Liane am Montag alles haarklein beschreiben.
Lächelnd erwiderte ich Mariyams angedeutete Begrüßung vorne. Mit ihrer steifen Kleidung sah sie aus wie immer. Bestimmt hatte sie sich gerade erst von ihrem Bürostuhl losgerissen. Es war stets dasselbe mit ihr. Der schwarze Businessrock wirkte mehr als nur ein bisschen unbequem. Die Feinstrumpfhose mündete bestimmt in genauso schwarzen hochhackigen Schuhen mit Pfennigabsätzen, die ich allerdings von meiner Position aus nicht sehen konnte, da sie hinter dem Steuer saß. Selbst ihre weiße, absolut knitterfreie Bluse und der gestrenge dunkle Blazer wirkten versnobt. Nur aus dem Dutt, zu dem sie ihr caramellfarbenes Haar geschlungen hatte, hatte sich im Nacken eine einzelne Strähne gelöst. Mutig kringelte sich diese und schrie geradezu in die Welt, dass selbst die perfekte Mariyam nicht alles im Griff hatte.
Hihi. Ich lächelte unwillkürlich. Meine Mutter stand im krassen Gegensatz zu ihr. Sie war herzlich, leicht orientalisch angehaucht und für alles offen. Obwohl ich ein Einzelkind war, hatte sie ihren Job, Innenarchitektin, bei meiner Geburt an den Nagel gehängt und war, bis ich das Gröbste hinter mir gelassen hatte, zur Hausfrau verkommen, wie mein Vater immer scherzhaft sagte. Inzwischen führte sie mit ihrer Schwester, Geschäftspartnerin und guten Freundin Saki Anderson einen für New Yorker Verhältnisse kleinen Blumenhandel. Erst letztes Jahr hatten sie sich vergrößert und ich war gespannt, wie es weitergehen würde.
»Was Desita anfasst, wird zu Gold«, hatte ich Mariyam mehr als ein Mal neidvoll sagen hören. Es war die Wahrheit! Umso überraschender mutete die gleichzeitige Häuslichkeit meiner Mutter an. Eine Glucke war sie zum Glück nie gewesen, trotzdem bekamen mein Vater und ich Schelte, wenn wir sie und das frisch gekochte, immer pünktlich servierte Essen versetzten. Obwohl ich gerechterweise sagen musste, dass sie so gut kochte, dass es mir leidtat, wenn ich mittags oder abends nicht zu Hause essen konnte.
An diesem Tag traf das auch zu, doch störte es mich nicht wie sonst, denn ich würde mit meiner Tante und meinem Cousin etwas unternehmen. Den Gutschein dafür hatte ich zum letzten Geburtstag bekommen. Ein ganzes Wochenende nur wir drei, hatte Tante Mariyam gesagt und geheimnisvoll gezwinkert. Iyesu hatte gegrinst und hinter dem Rücken seiner Mutter ein Daumen-hoch-Zeichen erkennen lassen.
Nun gurtete ich mich neben ihm an, während mein Blick auf die kleine pink-rot gestreifte Reisetasche auf dem schwarzen Sitz mir gegenüber fiel, die ich gestern Abend gepackt hatte und die meine Tante wie versprochen heute Vormittag, während ich in der Schule gewesen war, bei uns abgeholt hatte. Hervorragend. Sicher hatte Fegegita sie ihr ausgehändigt. Das Hausmädchen war, seit ich denken konnte, tagsüber bei uns. Abends ging sie zu sich, um Zeit mit ihrer Schwester, die ich nicht kannte, zu verbringen.
Ich lächelte zufrieden.
Das Auto setzte sich mit einem Ruck in Bewegung, während ich mich noch umsah. Weitere zwei Taschen, die von Iyesu und Mariyam, standen auf dem anderen Sitz gegenüber. Eine weinrot, eine weiß mit braunen Ledergriffen.
Als wir uns in den Strom von Wagen einordneten, die von meiner Schule wegrollten, begann Mariyam wie üblich, die anderen Fahrer zu beschimpfen. Wobei der Verkehr in New York gerade zur Rushhour wirklich furchtbar war. Das musste man ihr zugestehen. Da waren jegliche Verunglimpflichungen nicht nur gestattet, sondern meist auch angebracht. Außerdem fand ich, dass sie außerordentlich kreativ bei der Wortwahl ihrer Ausdrücke vorging. Trotzdem bemühte ich mich immer tunlichst, keinen der aufgeschnappten in Gegenwart meiner Eltern zu gebrauchen. Das wäre äh … kontraproduktiv.
Plötzlich standen wir. Blechmassen vor uns, um uns, hinter uns. Tja, die Großstadt hatte ihre Vorteile, die Verkehrsanbindung gehörte definitiv nicht dazu – ebensowenig wie die Immobilienpreise. Ausziehen mit achtzehn war ein Wunschtraum, sollte ich nicht vorher im Lotto gewinnen.
»Na, bist du gespannt, wohin es geht?«, riss mich Iyesu aus der Betrachtung eines sich im Schneckentempo vorbeischiebenden gelben Taxis.
Vor denen ließen sich die Touristen besonders gerne fotografieren. Würde ich für jeden Schnappschuss auf einem der mir in die Hand gedrückten Fotoapparate, Handys oder Tablets einen Dollar bekommen – ich hätte die erste Million vor meinem fünfundzwanzigsten Geburtstag in der Tasche! Kein Witz! Womöglich könnte ich mir damit einen eigenen Wohnschrank leisten, im Keller eines der großen Apartmentkomplexe, unter der Treppe … wie Harry Potter.
Ich riss mich von der Scheibe los und erwiderte sein Grinsen. »Klar! Verrätst du es mir?«, flüsterte ich so leise, dass Mariyam es nicht hören konnte. Vielleicht standen dann die Chancen auf eine Antwort besser?
»Das hättest du gerne!« Er lachte laut und ungeniert. »Nein, du musst dich gedulden.«
Er hatte mich also nur in Versuchung führen wollen. Schade. »Hm«, machte ich mit heiß werdenden Wangen wenig zufrieden und wandte mich wieder dem Verkehrsgeschehen zu.
»Wir werden eine Weile fahren«, unterbrach meine Tante ihr Gefluche und drehte sich um Verständnis heischend zu uns.
Was sie nicht sagte. Brauchte man bei Stau nicht immer eine Weile?
»Mom, können wir einen Film schauen?« Iyesu drückte bereits auf ein paar Knöpfe in der Mittelkonsole zwischen uns und ein kleiner schwarzer Bildschirm senkte sich von der Decke des Vans herab.
»Sicher.« Mariyam, die wieder nach vorne blickte, nickte uns im Rückspiegel zu. »Aber Iyesu! Bitte kein Schlachtenlärm, während ich mich auf die Straße zu konzentrieren versuche«, warnte sie.
Was?! Ich kicherte verhalten.
»Auf dem Rückweg vom Flughafen hat mich einer dieser Leinwandschüsse derart erschreckt, dass ich fast in den Graben gefahren wäre«, fügte sie in meine Richtung hinzu. Es klang nicht ganz ernst gemeint.
Iyesu nickte trotzdem ergeben, grummelte vor sich hin und hielt unschlüssig inne. Ich verkniff mir zwar ein lautes Lachen, grinste aber breit. Typisch Junge. Die Auswahlkriterien für Filme waren so durchschaubar: Action, Action und noch mehr Action. Die aber leider eine gewisse Anzahl an Dezibel nach sich ziehen würde. Und Gewalt und … das schlimme T-Wort. Genau, Titten!
»Seit wann bist du in New York?«, fragte ich ihn nach kurzem Schweigen. War er heute erst angekommen? Sein Internat lag, soviel ich wusste, irgendwo in der Schweiz und er flog jede Ferien hin und her. Am Wochenende nur selten. Der Flug war lang, daher lohnte es sich nicht. Das fand ich sehr schade, denn wir hatten uns schon immer außerordentlich gut verstanden und verbrachten einen Großteil seiner Zeit im Big Apple zusammen. Es kam mir manchmal gar vor, als würden wir uns jedes Jahr näherstehen – zumindest was mich betraf.
»Seit heute Morgen. War eine ziemliche Bruchlandung. Der Pilot hat irgendwas von Luftlöchern erzählt. Ich hab ihm kein Wort geglaubt. Der hatte einen über den Durst getrunken … wie er die Maschine verrissen hat.«
Meine Pupillen weiteten sich, während vor meinem inneren Auge schreckliche Bilder vorbeizogen. Ach du je! Iva, denk an was Schönes! An was Schönes!
»Iyesu!«, rief Mariyam ermahnend vom Fahrersitz. Sie schien ihm die Horrorgeschichte nicht abzunehmen. Hatte sie mir nicht erst etwas von in-den-Graben-Fahren weismachen wollen? Da kam wohl die Verwandtschaft zum Tragen.
»Echt wahr!«, versuchte er seine Mutter halbherzig zu überzeugen. Mariyam hob nur zweifelnd eine Augenbraue, wie ich im Rückspiegel sah. »Schon gut, Mom.« Iyesu lachte. »Ist ja nichts passiert, aber es war komisch – ganz ehrlich –, solche Druckdifferenzen über New York?! Kann ich mir nicht vorstellen.«
»Das ist schon möglich«, beschied Mariyam ihn, indes ihr Blick ruhig auf die Straße vor uns gerichtet blieb. Ihre Stimme hatte jedoch einen seltsamen Unterton.
»Jedenfalls fliege ich Sonntagabend wieder«, meinte Iyesu zu mir.
Ich zog daraufhin einen Flunsch. Ich hatte ihn gerne um mich. Andererseits musste er genau wie ich nächste Woche zur Schule. Blöde Schule. Aber das zu denken, brachte mir auch nichts … außerdem war sie meist gar nicht sooo schlimm. Also: blöde Entfernung! Das traf den Kern der Dinge.
»Sehen wir uns in den nächsten Ferien?«, wollte ich sogleich wissen. Iyesu war ein Jahr älter und ich wusste, dass Jungs es irgendwann nicht mehr cool fanden, mit jüngeren Mädchen abzuhängen. Hoffentlich war der Zeitpunkt bei ihm noch nicht gekommen.
»Glasklar«, erwiderte er prompt und zerstreute meine Bedenken mit einem breiten Lächeln.
Inzwischen hatte meine Tante uns wieder aus dem schlimmsten Innenstadtchaos manövriert und wir fuhren gleichmäßig auf der Schnellstraße dahin.
»Gut« Ich lächelte ebenfalls und betrachtete erneut die vorbeiziehende Landschaft, während Iyesu auf einer kleinen Fernbedienung weiter durch die Mediathek klickte.
Häuser. Brücken. Bäume. Andere Fahrzeuge. Ich mochte es, Auto zu fahren. Mitzufahren. Ich fühlte mich sicher. Und trotzdem … schnell. Sobald wie möglich, das hieß sobald ich sechzehn werden würde, wollte ich den Führerschein machen. Ich war mir im Klaren, dass es meinem Vater vor dem bloßen Gedanken graute. Aber das würde mich nicht davon abhalten. Er konnte mir ja einen Panzer kaufen – der bot Rundumschutz.
Ich lachte tonlos über das Bild in meinem Kopf.
»Ah, ich wollte dir was geben«, überraschte Iyesu mich da.
Erstaunt schaute ich ihn an.
Er unterbrach sein Tickern und verrenkte sich fast, um trotz Sicherheitsgurt an seine Hosentasche zu kommen. Je länger er brauchte, desto mehr Chaos herrschte in meinem Gehirn. Oder war es mein Herz, das unverhältnismäßig verrücktspielte?
Endlich zog er ein sorgsam zusammengewickeltes Band heraus und hielt es mir hin.
»Von mir, für dich«, sagte er und hatte tatsächlich den Nerv, mich noch mehr in Verlegenheit zu bringen, indem er leicht errötete. Er!
Meine Hand zitterte, als ich das dünne rosa Lederband in Empfang nahm und vorsichtig, so wie er es mir bei dem braunen Band an seiner linken Hand zeigte, um mein rechtes Handgelenk wickelte.
Ich verspürte zu Iyesu eine Verbundenheit, die ich sonst zu niemandem in diesem Maß empfand. Nicht einmal zu Liane. Und dieses Band bewies, dass er sich – sogar auf für alle sichtbare Weise – mit mir verbunden zeigen wollte. Dass er es auch fühlte – diese besondere Chemie, dieses Verständnis füreinander, diese Wärme zueinander, die zwischen uns war.
Seine kleine Geste machte mich wahnsinnig glücklich. Sie ließ mein Herz hüpfen und meinen Magen vor Freude Saltos schlagen.
Für das Zusammenbinden der Enden lehnte ich mich zu Iyesu hinüber, kam ihm ganz nah, damit er mir helfen konnte. Konzentriert beugte er sich vor.
Es war das Letzte, was er tat.
Plötzlich ging alles ganz schnell. Die folgenden Bilder zogen wie mit dreifacher Geschwindigkeit abgespielt an mir vorbei. Ein Ruck ging durch die Karosserie des Autos und ließ meinen Hinterkopf hart gegen die Kopfstütze des Sitzes prallen. Ich konnte schon beim nächsten Herzschlag nicht mehr sagen, ob wir von vorne, von hinten oder der Seite gerammt wurden. Es fühlte sich vielmehr an, als käme es von allen Seiten gleichzeitig, bevor sich das Gefühl unangenehm umkehrte.
Meine Welt schrumpfte auf die bloße Verwirrung meiner Sinne. Da war der Schock. Da war die Angst. Die unglaubliche Angst. Da war der Tod, von dem ich annahm, dass er nahte. Und da waren Farben, die in meinem Blickfeld erschienen, um schnell wieder zu weichen – noch bevor ich sie richtig wahrnehmen konnte. Da waren so viel Emotionen, dass ich gar nicht wusste, was eigentlich passierte. Da war alles und nichts auf einmal.
Dann gingen die Lichter aus. Meine Lichter. Und wäre es ein Theaterstück gewesen, wäre wohl auch der Vorhang gefallen.
Zu meiner großen Verblüffung – das sage ich jetzt nicht nur so, es war tatsächlich mein erstes Gefühl, als ich die Augen aufschlug – klärte sich der Schleier, der über meinen Lebensgeistern gelegen hatte, wieder. Ich hob die Lider in einer steril wirkenden Umgebung. Alles war weiß, strahlend, leer. Irgendetwas piepte und um mich war es unangenehm hell. Es roch nach desinfizierenden Chemikalien und Krankheit. Ich stand nicht mehr unter Schock, war auch nicht mehr verwirrt, ich hatte nur noch furchtbare Angst. Angst um Iyesu und Mariyam.
Als ich unter Schmerzen den Kopf drehte, entdeckte ich kurzzeitig erleichtert meine extrem bleiche Mutter und meinen müde wirkenden Vater hinter einer Glasabtrennung schräg vor dem harten Krankenhausbett, in dem ich, wie ich nun registrierte, lag.
Meine Mutter hatte eine Hand in verzweifelter Geste an das Glas gepresst, als versuchte sie mich trotz der Barriere zu erreichen. Ihre grauen Augen waren unter dem zerzausten goldblonden Haar gerötet. Ihre Kleidung bestand wie immer aus einem weiten, farbenfrohen Sarong, der ihre hochgewachsene, schlanke Figur mit seinem fließenden orangefarbenen Stoff umschmeichelte.
Mein Vater trug einen seiner hellgrauen Anzüge und stand direkt neben ihr, mit ihr verbunden durch ihre Hand in seiner. Ich sah die schlichten Eheringe blitzen, bevor ich wieder den Blick anhob. Dad wirkte unendlich traurig. Seine Augen waren rot geädert, sein Gesichtsausdruck erschöpft. Er sah gealtert aus. Unwillkürlich wusste ich, dass die Situation schlimm war. Dass etwas Furchtbares passiert sein musste. Etwas, von dem ich mir nicht sicher war, ob ich es würde verkraften können. Ich war hier, ich war wach. Und ich konnte …? Ja, konnte ich! … alles spüren und bewegen. Uff! Wen also hatte es stattdessen getroffen?
Und wie? Das war die entscheidende Frage!
Fast meinte ich, die Last der ganzen Welt beugte Dads Oberkörper nach vorne. Sein rabenschwarzes Haar, das meinem so ähnlich sah, lag platt gedrückt an seinem Kopf an. Die markanten Züge seiner Kinnpartie erschienen mir weicher zu sein als üblich.
Keiner regte sich. Wir starrten uns einfach an. Sie da draußen, ich hier drin, in der unangenehmen weißen Krankenhauskutte. Alle mit unzähligen stummen Fragen in den Augen.
Irgendwann nahm ich ein störendes Ziepen an meiner rechten Hand wahr und senkte den Blick zu der Stelle. Dort steckte eine Nadel, die eine durchsichtige Flüssigkeit aus einem Beutel, den ich an einem Infusionsständer neben meinem Bett erspähte, an mich weitergab. Kochsalzlösung, nahm ich an. So weit, so normal. Dann bemerkte ich, dass etwas fehlte: Das Armband! Ich musste es verloren haben, weil Iyesu es nicht mehr hatte festbinden können. Oh nein! Ermattet und voll ausufernder Traurigkeit sank ich zurück.
Nichtsdestotrotz versuchte ich mich innerlich zusammenzureißen. Da war so viel, das ich wissen wollte. Ich hatte so viele Fragen.
Einige Stunden später war ich verzweifelt, ungläubig und resigniert. Denn keine davon war mir beantwortet worden.
Nicht, weil keiner mit mir gesprochen hatte, nein, sie sprachen vielmehr alle mit mir. Meine Mutter, die mir nicht mehr von der Seite wich, mein Vater, meine Ärzte, die Polizei, die Inspektoren der Versicherung, Fegegita und Liane, die mich besuchten. Sie alle wollten genau wissen, was passiert war.
Ich wollte das auch!
Nur hatten wir andere Vorstellungen davon gehabt, wie der Informationsaustausch hätte stattfinden sollen. Ich war davon ausgegangen, sie würden mir sagen, was passiert war und wie es Iyesu und Mariyam ging. Sie hingegen waren davon ausgegangen, ich würde zur Klärung der Umstände beitragen. Und ich hatte mich wirklich bemüht! Aber, wie inzwischen sicher klar wurde, waren wir zu keiner zufriedenstellenden Übereinkunft gekommen. Für niemanden. Und da begann der Anfang vom Ende.
Das Auto war in unzählige Teile auseinandergerissen worden, die in einem Umkreis von fünfzig Meter verstreut aufgefunden worden waren. Die Wucht der Explosion war so heftig gewesen, dass sie drei um uns fahrende Fahrzeuge zur Seite geschleudert hatte, die ihrerseits in andere Wagen gekracht waren. Die folgende Massenkarambolage auf der Schnellstraße inklusive zehn Toten, fünfzehn Verletzten und zwei Vermissten hatte es in die landesweiten Nachrichten geschafft.
Die Polizei und einige schmierig aussehende Detectives in tadellos geschniegelten Uniformen von irgendwelchen speziell einberufenen Kommissionen vermuteten, eine Bombe sei die Unfallursache gewesen. Doch konnte für diese Theorie kein Beleg erbracht werden und in meinem Umfeld oder dem meiner Tante und meines Cousins ließ sich zudem kein Motiv für solch einen Anschlag finden. Es war hoffnungslos. Gleichzeitig war es die einzige Hoffnung, denn einen anderen Ansatz konnte niemand bieten.
Schleierhaft war, wie ich einigermaßen heil davongekommen war. Und warum ich lebte, respektive überhaupt da war. Noch schleierhafter allerdings mutete das Verschwinden meiner Verwandten an. Man hatte weder von Mariyam noch von Iyesu genug Blut gefunden, um ihren Tod mit Sicherheit feststellen zu können. Ihre Leichen konnten nicht geborgen werden und Teile der Extremitäten – die Detectives sagten es, als handle es sich dabei nicht um Arme und Beine – waren nicht gefunden worden. Allerdings nahmen die Ärzte an, dass meine Tante, sollten sie und mein Cousin es aus dem Auto geschafft haben, kurz darauf verstorben sein musste, bei dem beträchtlichen Blutverlust.
An der Unfallstelle war jeder Stein umgedreht worden, auf der Suche nach irgendeinem Hinweis, doch es hatte nichts geholfen. Weder Mariyam, ob nun tot oder lebendig, noch Iyesu waren gefunden worden.
Die Schutzgeldforderung, die daraufhin aufgrund unseres beträchtlichen Familienvermögens, speziell des meines Vaters, erwartet worden war, traf nie ein. Kein Erpresser meldete sich. Vielleicht hatte es aber einfach keinen gegeben.
Alles wurde immer seltsamer und ich war mittendrin gefangen – ohne Ausweg. Es war ein Albtraum. Nur konnte ich nicht aufwachen, denn der Albtraum war mein Leben.
5
Vor 311 Tagen
Iva
Ein Brief an das Leben
»Zieh dich warm an.«
Liebes Leben,
wir beide werden uns eines Tages an einen Tisch setzen und reden. Glaub mir, es gibt einiges, das ich dir zu sagen habe!
Ich studiere meine Rede jeden verdammten Tag ein. Vor dem Spiegel. Mit Gestik und Mimik. Wie sich das eben gehört, schließlich geht es um den ganz großen Auftritt! Das kannst du mir glauben.